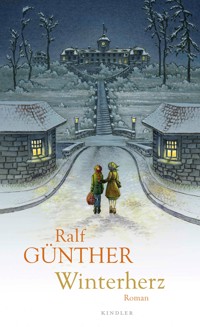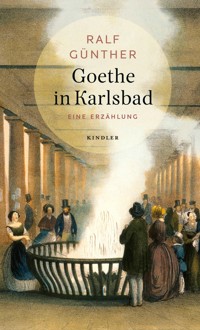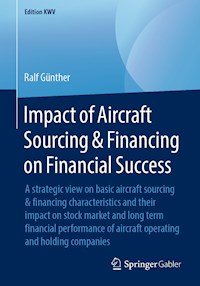9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Sommertag wie ein Gemälde 1910. Die junge Clara Schimmelpfenninck wird wegen hysterischer Atemnot ins Dresdner Lahmann-Sanatorium auf dem «Weißen Hirschen» geschickt. Nach sechs Wochen ist sie symptomfrei, aber zu Tode gelangweilt. Da wird sie zu einem Ausflug ins nahe Moritzburg eingeladen. Im Sommerkleid streift sie durch die herrliche Schilflandschaft. Prompt wird sie von einem Mann mit fein geschnittenem Gesicht und energischer Stimme angesprochen. Ob sie sich nicht zu ihm, Kirchner, und seinen Freunden gesellen möge. Die Männer und Frauen picknicken dort, trinken Wein und arbeiten an ihren Staffeleien – in einer Art und Weise, wie Clara es noch nie erlebt hat. Und so verbringt sie einen unvergesslichen Sommertag in der Künstlerkolonie «Die Brücke».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Ähnliche
Ralf Günther
Die Badende von Moritzburg
Eine Sommernovelle
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein Sommertag wie ein Gemälde
1910. Die junge Clara Schimmelpfenninck wird wegen hysterischer Atemnot ins Dresdner Lahmann-Sanatorium auf dem «Weißen Hirschen» geschickt. Nach sechs Wochen ist sie symptomfrei, aber zu Tode gelangweilt. Da wird sie zu einem Ausflug ins nahe Moritzburg eingeladen.
Über Ralf Günther
Ralf Günther, 1967 in Köln geboren, studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft. Er ist Schriftsteller und Drehbuchautor, entwickelte Serien für das ZDF und den KiKA und schrieb viele erfolgreiche historische Romane, darunter den Bestseller «Der Leibarzt» (Heyne 2001). Bei rororo sind die unterhaltenden Weihnachtstitel «Ach du fröhliche» (2011) und «Jesusmariaundjosef!» (2013) erschienen, bei Kindler «Das Weihnachtsmarktwunder» (2014). Der Autor lebt in Hamburg und Dresden.
Gewidmet all jenen, die furchtlos lieben.
In gleißenden Streifen fiel das Licht durch die Blätterkronen des Heidewalds. Die Hitze ließ den Boden knistern. Der Duft von Kiefernnadeln und frischem Buchenlaub war betörend. Auf Claras Schoß lag ein aufgeschlagenes Buch: weiße, unbeschriebene Seiten. In der Hand hielt sie eine Feder. Das Tintenfass stand in Reichweite, auf einem Tischchen neben ihrem Liegestuhl. Der Vater hatte ihr zum Abschied dieses Tagebuch geschenkt, in dem sie die Erlebnisse ihres «Erholungsaufenthalts» festhalten sollte. Doch worüber sollte sie schreiben? Über die blutverdünnenden Luftbäder? Den Geschmack der Haferplätzchen zum Frühstück? Die vegetarische Milch? Die fundamentale Bedeutung der Nährsalze, dieses täglich gepredigte Evangelium der Lahmann’schen Klinik? Die Begutachtung ihrer Ausscheidungen, die den Patienten – ein Glück! – selbst überlassen blieb?
Endlos hatte sie auf die Seiten gestarrt. Die Tinte war in der Feder geronnen. Für die Ereignislosigkeit an diesem Ort gab es keine Worte.
Clara entdeckte einen hellen Flecken auf ihrer Haut. Die Sonne hatte einen Strahl bis hierher zu ihr, hinunter auf die Lichtluftterrasse des Sanatoriums geschickt. Wie einer dieser neuen, elektrischen Theaterscheinwerfer illuminierte er einen eng umgrenzten Ausschnitt auf Claras Unterarm. Ihre Haut war blass, doch übersät von Sommersprossen. So viele wie in diesem Sommer, dem Sommer des Jahres 1910, waren es noch nie gewesen.
Eine Schwester trat an den Liegestuhl, um sie daran zu erinnern, ihren Körper zu wenden. Doch als sie Clara sachte an der Schulter berührte, sagte diese: «Lassen Sie mich. Bitte. Ich freue mich so sehr über das Licht.»
Die Schwester zog eine strenge Miene, und Clara gab der Anweisung mit einem Seufzen nach. Alle Patientinnen drehten sich auf die rechte Seite. Dies war der vorgegebene Ablauf. Das Tagebuch fiel von Claras Schoß auf die Holzplanken. Sie ließ es liegen. Die Krankenschwester ging herum und korrigierte hier und da die Haltung. Die Patientinnen sollten sich so positionieren, dass auch genügend Luft an all jene Körperteile gelangte, die der Zirkulation sonst durch allzu enge, einschnürende Kleidung entzogen waren.
Als die Schwester erneut vor Claras Liegestuhl trat, fragte sie: «Fehlt Ihnen etwas, Fräulein Schimmelpfenninck?»
«Natürlich fehlt mir etwas. Wäre ich sonst hier?»
Die Schwester hob pikiert die Nase, wandte sich ab und ging davon.
Clara kannte den Grund ihrer schlechten Laune: Es war der gleichförmige Alltag des Sanatoriums mit seinen ewigen Bädern, den Gymnastikstunden und Atemübungen an frischer Luft, der Rohkost nach den dysämischen Diätprinzipien Heinrich Lahmanns. Die sechs Wochen ihres bisherigen Aufenthalts fühlten sich an wie Jahre.
Nach erneuter Wende suchte Clara den Sonnenflecken auf ihrem Arm, doch das Vergnügen an der eigenen Haut wollte nicht zurückkehren. Das Tagebuch lag am Boden, der schwarze Einband mit em goldenen Schriftzug ihres Namens schrie Clara entgegen.
Endlich erklang das Glockensignal, das das Ende der Lichtluftbadestunde einläutete. Zudem klatschte die Schwester zweimal kurz in die Hände: Dies bedeutete den Patientinnen, sich von den Luftbadestühlen zu erheben. Den gebrechlicheren unter ihnen eilten weitere Schwestern zu Hilfe. Als Clara eine Mitpatientin stützen und ihr aufhelfen wollte, schickte diese sie fort. Kurze Zeit darauf trat die Oberschwester auf sie zu. Clara vermutete schon, dass sie für ihre schnippische Antwort zur Rechenschaft gezogen werden sollte, doch das war nicht der Fall.
«Der Herr Doktor will Sie sehen.»
Clara sah an sich hinunter: «In diesem Aufzug?»
Der Sanatoriumsvorschrift gemäß trug sie das Luftbadehemd. Darin fühlte sie sich kaum weniger als nackt. Es musste ohne Unterwäsche getragen werden, der Baumwollstoff fiel locker um den Leib, damit möglichst viel Luft auf die Haut ventiliert wurde. Weich schmiegte er sich an ihren Körper und verwies dezent auf ihre Formen. Über ihre Schultern floss das rötlich blonde Haar, offen, wie sie es auf der Straße niemals zu tragen wagen würde.
«Dies ist kein ‹Aufzug›», wies die Oberschwester sie in scharfem Ton zurecht. «Dies ist das Badehemd des großen, bedauerlicherweise viel zu früh verstorbenen Heinrich Lahmann. Hätten Sie ihn kennengelernt, Sie würden anders von ihm reden, mein Fräulein.»
Die Schwester seufzte tief, was keinen Zweifel daran ließ, dass sie den Begründer des ehrwürdigen Sanatoriums, den Geheimen Medicinal- und Hofrat, anders als Clara noch persönlich gekannt hatte.
«So werde ich meinem Arzt jedenfalls nicht unter die Augen treten», beharrte Clara.
«Nun beeilen Sie sich! Der Herr erwartet Sie.»
Die Sprechzimmer der Ärzte waren am anderen Ende der Klinik in einer Villa untergebracht, deren spitzes Dach die übrigen Gebäude in dem weitläufigen Gelände des Sanatoriums überragte. Der Heidewald war hier nur noch spärlich, dafür jedoch mit einigen besonders mächtigen Buchen vertreten. Clara suchte ihren Weg von Schatten zu Schatten. Unterdessen wuchs die Villa – einer steinernen Buche gleich – aus dem Waldboden. Der Baukörper war massiv, doch die Erker und Balkone verklärten ihn mit einer verspielten, großzügigen Wärme. Clara stellte sich den verstorbenen Gründer des Sanatoriums nicht so streng vor wie die Schwestern, die nun seinen vegetarisch-dysämischen Gral hüteten.
Nicht nur die Hitze machte ihr jeden Schritt im nunmehr eng geschnürten Kleid schwer. Auch und vor allem die Ereignislosigkeit ihres Aufenthalts – und dessen Ergebnislosigkeit. Sie konnte sich partout nicht vorstellen, wie Rohkost und Luftgymnastik ihre Erstickungsanfälle lindern sollten.
Clara seufzte. Der Stehkragen scheuerte am Hals. Die Haare hatte sie hochgesteckt, unter einen Hut mit Schleier und breiter Krempe. Allein um das Gelände zu überqueren und ihrem Arzt unter die Augen zu treten, musste sie sich ankleiden, als ginge es ins Theater.
Das Treppenhaus der Villa empfing sie mit willkommener Kühle und dem Geruch von Sandstein. Jede einzelne Stufe fiel ihr schwer. Je höher sie stieg, desto kränker fühlte sie sich. Der alte, gestrenge Sanitätsrat, der Clara behandelte, erinnerte sie an ihren Vater. Wenn er mit den Kuppen seiner knorrigen Finger über ihre Haut fuhr, um sie zu auskultieren, wie er sich ausdrückte, wurde ihr unwohl. Beinahe wie zu Beginn eines Anfalls. Auch aus diesem Grund fühlte sich Clara besser, wenn sie dem Arzt nicht im Luftbadehemd entgegentrat.
Der Hausdiener meldete ihre Ankunft. Mit niedergeschlagenem Blick trat Clara über die Schwelle. Als sie ihn wieder hob, erschrak sie. Nicht der alte Sanitätsrat erwartete sie hinter den Festungsmauern seines Schreibtischs, sondern ein junger Mann mit Nickelbrille und pomadiertem Haar, nicht viel älter als sie selbst. Der offene Kittel war zu weit, darunter trug er einen Anzug mit Weste und Fliege. Der Ansatz der nussbraunen Haare saß hoch in der Stirn. Ein wenig verwirrt starrte er durch die runden Gläser seiner Brille.
«Bitte, nehmen Sie doch Platz, Fräulein … Schimmelpfennig?»
Clara verzichtete auf die Korrektur ihres Namens, die bei beinahe jeder Nennung fällig wurde.
«Verzeihen Sie bitte, dass ich Sie im Sprechzimmer des Sanitätsrates empfange. Ich habe noch kein eigenes.»
Clara sah es ihm mit einem Kopfnicken nach. Ihr Kleid raschelte, als sie auf dem Polsterstuhl Platz nahm. Die komfortable Ausstattung der Villa stand im Gegensatz zur Kargheit der Patientenquartiere.
Der junge Doktor verharrte immer noch reglos hinter dem Schreibtisch.
«Darf ich auch Ihren Namen erfahren?», erinnerte ihn Clara.
«Verzeihung. Brandstetter, Maximilian.» Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
«Was ist denn mit dem ehrwürdigen Sanitätsrat geschehen? Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen?», erkundigte sich Clara.
«Er war selbst eines Heilaufenthalts bedürftig und weilt zur Kur in Davos. Ich habe die Ehre, ihn für die Dauer seiner Abwesenheit zu vertreten.»
Clara nickte. Dass sie diesen Wechsel als äußerst angenehm empfand, behielt sie für sich.
Endlich ließ sich auch Dr. Brandstetter nieder, auf einem Sessel, der noch bequemer aussah als der, auf dem Clara Platz genommen hatte. Er faltete die Hände, legte die Fingerspitzen an seine Lippen und musterte Clara wortlos über die Nickelbrille hinweg.
«Weshalb ließen Sie mich rufen?», fragte Clara endlich.
«Ich wollte Sie kennenlernen. Das ist meine Pflicht als vertretender Arzt.»
«Und was genau wollen Sie von mir kennenlernen? Über meine Krankenakte hinaus?» Ihr Tonfall war koketter, als Clara beabsichtigt hatte.
Aus unerfindlichem Grunde errötete Dr. Brandstetter. Statt eine Antwort zu geben, sah er sie schweigend an. Dann sprang er so unversehens auf, dass Clara erschrak.
«Haben Sie etwas dagegen», fragte er mit etwas zu lauter Stimme, «wenn ich Ihre Lungen abhorche?»
«Sie wollen mich ‹auskultieren›?», machte sich Clara – sie wusste selbst nicht, warum – den Ausdruck des alten Sanitätsrates zu eigen.
Der Arzt nickte irritiert. «Sind Sie bewandert in den Termini der Medizin?»
Clara kniff die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf.
Im Vorbeigehen nahm Dr. Brandstetter das Stethoskop vom Schreibtisch. Als er näher trat, wurden seine Schritte vorsichtig.
«Darf ich Sie bitten aufzustehen?»
Clara tat, was er verlangte.
«Und nun atmen Sie ruhig und gleichmäßig.»
Behutsam näherte er sich mit dem Stethoskop, und Clara zuckte leicht, als es den Stoff ihrer Bluse berührte. Sie atmete schnell.
Der Arzt zog die Augenbrauen zusammen. «Bitte bemühen Sie sich um ruhige Atemzüge. Ich kann sonst nichts hören.»
Clara versuchte, ihren Atem unter Kontrolle zu bringen. Es wollte ihr nicht gelingen.
«Hm», machte Brandstetter, während das Stethoskop unterhalb der Schulterblätter über ihren Rücken wanderte. Und wieder: «Hm. Hm.»
Er wandte sich ab und zog sich hinter seinen Schreibtisch zurück. Dann faltete er die Hände und spitzte die Lippen, als wolle er seine Fingerspitzen küssen. Dies war offenbar seine Art, sich zu konzentrieren.
«Ich habe Ihre Krankenakte gelesen …», sagte der Arzt endlich.
Clara rutschte auf ihrem Stuhl hin und her.
«… und bin zu der Vermutung gelangt, dass die Beschwerden, unter denen Sie – wie soll ich sagen? – leiden …»
Claras Gesicht war angespannt vor Erwartung. Sie war auf jede Enttäuschung gefasst.
«Ich denke, dass diese Beschwerden in ihrem eigentlichen Kern nicht körperlicher Natur sind. Sondern, nun ja, seelischer».
Clara errötete. «Was soll das heißen?»
Der Arzt wich ihrem Blick aus. «Sagt Ihnen der Name Sigmund Freud etwas?»
Sie schüttelte den Kopf.
«Das dachte ich mir», sagte Brandstetter mit einer verzeihenden Geste. «Nun, dieser Arzt hat junge Damen untersucht – und auch ältere, durchaus –, die unter ganz ähnlichen Symptomen litten.»
«Tatsächlich?»
«Ja. Ihre Lunge ist, soweit man hören kann, vollkommen gesund. Die Kleidung, die Sie jetzt tragen – ist das Ihre übliche Gesellschaftskleidung?»
Clara nickte.
«Und auch das Korsett tragen Sie für gewöhnlich?»
«Was tut das zur Sache?»
«Ich möchte wissen, ob Sie unter normalen Umständen frei atmen können.»
Wieder nickte Clara. Es war eine kräftige Bejahung.
«Sehen Sie, das ist alles typisch. Sie wären ein idealer Fall für Dr. Freud. Sie sind körperlich vollkommen gesund.»
«In der Tat habe ich, seitdem ich hier bin, nicht einen Anfall gehabt.»
Brandstetter nickte.
«Heißt das, ich darf als geheilt gelten und abreisen?» Der Gedanke, der sie noch eben in Euphorie versetzt hätte, bedrückte sie plötzlich.
«So weit würde ich nicht gehen», beeilte sich Dr. Brandstetter zu versichern.
«Aber wenn mir, wie Sie sagen, nichts fehlt, warum soll ich mich weiter luftbaden und sonnenwenden und haferkleien?»
Brandstetter versank in konzentriertes Brüten. Dann sagte er zögernd: «Ich würde Sie gern ein wenig ausgiebiger untersuchen, wertes Fräulein, um in der Diagnose ganz sicher zu sein. Allerdings nicht hier, sondern in einer etwas zwangloseren Atmosphäre.»
«In einer zwangloseren Atmosphäre? Was meinen Sie damit?»
«Um Gottes willen, bitte missverstehen Sie mich nicht! Ich würde Ihnen ein paar Fragen stellen. Und Sie müssten offen mit mir sprechen.»
«Sprechen?» Das Blut schoss ihr in den Kopf. «Aber worüber denn?»
«Das ergibt sich. Deshalb benötigen wir eine …», er zögerte, «eine spezielle Atmosphäre. Einen Ort der Ruhe. Weitab des Patientenalltags.»
Clara spürte ein Kribbeln. «Ich verstehe nicht. Woran genau denken Sie?»