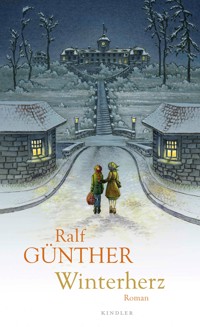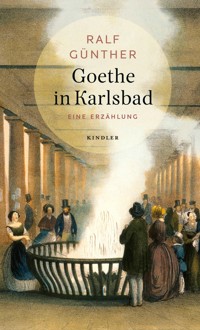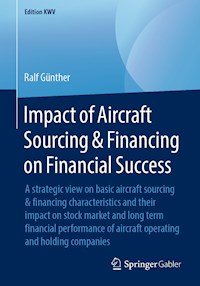9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Dresden, um 1890. Vinzent Storch stellt die berühmten "Dresdner Pappen" her – Figuren aus Papier, die als Christbaumschmuck sehr beliebt sind. Am Vormittag von Heiligabend entdeckt er zu seinem Entsetzen eine Kiste, deren Lieferung versäumt worden ist. Schnell macht er sich mit dem Pferdewagen auf in Richtung Zinnwald, um die Ware rechtzeitig zu überbringen. Unterwegs bittet ein Mädchen darum, mitgenommen zu werden, doch Storch lehnt ab. Dass Lisbeth heimlich auf seinen Wagen steigt, bekommt er nicht mit. Erst als ein heftiger Schneesturm einsetzt und er vom Weg abkommt, gibt sich das Mädchen zu erkennen. Sie behauptet, den Weg zu wissen. Wenn Storch Zinnwald rechtzeitig erreichen will, muss er Lisbeth vertrauen. Auf der Fahrt erfährt er, welch tragische Geschichte das Mädchen nach Dresden geführt hat. Da öffnet er sein Herz, und aus zwei traurigen Seelen werden Freunde. Eine herzerwärmende Geschichte, die den Erfolg von Ralf Günthers Dauerseller "Das Weihnachtsmarktwunder" fortschreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Ähnliche
Ralf Günther
Eine Kiste voller Weihnachten
Über dieses Buch
Ein Wunder an Heiligabend
Dezember 1890. Vinzent Storch stellt in seinem kleinen Betrieb «Dresdner Pappen» her, Figuren aus Papier, die als Christbaumschmuck sehr beliebt sind. Heiligabend vormittags entdeckt er mit Schrecken eine Kiste, deren Lieferung versäumt wurde. Schnell macht er sich mit dem Pferdewagen auf, um die Ware noch vor dem Fest zu überbringen.
Unterwegs bittet ein Mädchen darum, mitgenommen zu werden. Storch lehnt ab. Dass Lisbeth heimlich auf seinen Wagen steigt, bemerkt er nicht. Doch als das Schneegestöber immer dichter wird, sind die beiden bald aufeinander angewiesen. Und mitten im kalten Winter geschieht ein wahres Weihnachtswunder.
Vita
Ralf Günther wurde 1967 in Köln geboren. Er studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und spezialisierte sich auf Medienpädagogik. Als Buch- und Drehbuchautor entwickelte er Kinderserien fürs Fernsehen und schrieb historische Romane. «Der Leibarzt», sein Debüt in diesem Genre, wurde ein Bestseller. Es folgten unter anderem die Weihnachtsgeschichten «Jesusmariaundjosef!», «Ach du fröhliche» und «Das Weihnachtsmarktwunder» sowie die Künstlererzählungen «Die Badende von Moritzburg» und «Als Bach nach Dresden kam». Nach einer Zwischenstation in Hamburg lebt Ralf Günther heute wieder in der Nähe seiner Wahlheimat Dresden. Neben dem Schreiben betreut er psychisch belastete Kinder und Jugendliche in einer Reha-Klinik.
Für Felix, Benjamin, Karla, Linnea und Jonna
Wenn der letzte seiner Arbeiter gegangen und er allein in seinem Kontor war, hatte Vincent Storch die Angewohnheit, die Räume zu verdunkeln. Mit strengem Blick und einer in langen Jahren geübten Routine ging er durch die Säle und löschte alle Lampen, eine nach der anderen, Flamme für Flamme. Er begann in seinem, des Direktors, Bureau, ging dann hinüber in die Prokuratur, wo die Ärmelschoner, Tintenfässer und Schreibfedern akkurat in den Laden verstaut waren, anschließend in die Expedition, wo die Bestellungen bearbeitet und Pakete oder Kisten gepackt wurden. Falls er, was oft vorkam, den Etiketten-Leimtopf offen vorfand, bedeckte er ihn.
Dann überquerte er den Innenhof und schritt durch ein gewölbtes Tor in die Produktion. Zunächst betrat er die Werkstatt der Graveure, wo die Platten gestochen, geschliffen und poliert wurden. Dann ging er weiter in den Maschinenraum mit den großen, wie Lokomotiven stampfenden Dampfmotoren, die die Kraftübertragungsräder und Transmissionsriemen antrieben. Anschließend in die Fertigung, wo die eigentliche Handarbeit geschah: Säuberlich aufgereiht standen hier die Kisten mit Goldfolie neben der Schnittmaschine mit ihrer großen, geschwungenen und äußerst scharfen Klinge, und auf der anderen Seite die Stapel mit den fertig geschnittenen Papierbögen.
Seiner Routine folgend, ging er von hier aus weiter in die feuchtschwülen Trockenräume und schließlich, ein weiteres Mal den Hof überquerend, ins Lager. Sobald auch dort die letzte Lampe gelöscht war, seufzte er tief. Die vollkommene Stille, die ihn in diesem Moment umfing, empfand Vincent Storch als tröstlich.
Wenn er dann auf den schon nächtlichen Hof trat, wieherten die Kaltblüter, die Tag für Tag vor einen Pritschenwagen gespannt die Ware auslieferten, aus ihrem Stall heraus. Es war der letzte Gruß auf diesem Innenhof in der Dresdner Neustadt, den dann, wenn der Fabrikant Vincent Storch gegangen war, niemand mehr betrat – bis zum nächsten Morgen.
So war es jeden Tag, und so sollte es auch heute sein, am Heiligen Abend. Kein besonderer Tag für Vincent Storch, nur das Ende der Saison.
Anders war nur, dass heute, als Storch seine Abschiedsrunde machte, die Sonne von einem blauen Winterhimmel schien. Es war so hell, dass die vorderen Räumlichkeiten noch lichtdurchflutet waren. Doch je weiter der Direktor in die rückwärtigen Gefilde der Manufaktur kam, desto spärlicher drang das Tageslicht herein. In der Expedition brannten ein paar Lampen. Storch löschte sie, schloss die Augen und sog den rußigen Geruch ein. Die Arbeit des Jahres war getan. Das Sirren und Summen der Geschäftigkeit, das spätestens seit dem Sommer in seiner Weihnachtsfabrikation einsetzte, gab jetzt der Stille Raum.
«Herr Storch?», erklang eine Stimme hinter ihm.
Langsam drehte er sich um. Vor ihm stand Heinrich, der alte Vorarbeiter, sein voller Bart so grau wie Storchs eigener. Heinrich, das wusste Storch, hatte Söhne, Töchter, Nichten und Enkel. Ein halbes Stadtviertel bewohnte seine Familie! Deshalb arbeitete er immer noch, grau und gebückt, wie er war, in einem Alter, wo andere sich längst zur Ruhe setzten und ihre Kinder arbeiten ließen. Heinrichs Söhne waren in Storchs Augen Taugenichtse. Er schimpfte bei jeder Gelegenheit über sie, während Heinrich selbst voller Liebe von ihnen sprach. Die Duldsamkeit seines Vorarbeiters machte Storch zu schaffen.
«Herr Storch?», sprach Heinrich ihn erneut an.
«Was gibt’s noch, Heinrich? Geh nach Haus!»
Heinrich zögerte. «Und Sie?»
«Was ist mit mir?»
«Wo feiern Sie?»
«Was geht’s dich an?»
Unschlüssig stand Heinrich im Hof. «Es tut nicht gut, am Heiligen Abend allein zu sein, Herr.»
Storch gab sich eine gleichgültige Miene. «So halte ich es seit Jahren. Das hat mir nicht geschadet.»
Heinrich nickte langsam. Doch sein Gesicht drückte das Gegenteil von Zustimmung aus. Offenbar wusste er nicht, wie er beginnen sollte. Dann überwand er sich und formulierte eine zurückhaltende Einladung: «Wenn Sie mögen, Herr Storch, können Sie gern mit uns …»
«Auf gar keinen Fall», schnitt Storch ihm das Wort ab. «Mach, dass du heimkommst!»
Wieder nickte Heinrich – mehr ein Ausdruck der Resignation als der Zustimmung. Nach langem Innehalten wandte er sich ab und ging hinaus.
Benommen taumelte Lisbeth auf die Straße. Eben noch hatte sie in den schützenden Armen ihrer Mutter gelegen, nun war sie ganz auf sich gestellt.
«Such ein Fuhrwerk, das ins Gebirge fährt. Kümmere dich um deinen Vater und deine Geschwister. Es ist nicht gut, dass sie allein sind am Heiligen Abend …» Indem ihr die beschwörenden Worte der Mutter im Geiste nachhallten, erinnerte sich Lisbeth an den Moment des Abschieds: die großen, vor Schmerz geweiteten Pupillen der Mutter, den Schweiß auf ihrer Stirn, die Ringe unter den Augen, die sie nach bald vierundzwanzig Stunden Entbindungskampf trug. Sie war ausgemergelt und entkräftet, doch zwischen zwei Wehen konnte sie ihrer ältesten Tochter noch eine Botschaft mitgeben: «Fahr heim und kümmere dich! Ich kümmere mich um dein Geschwisterchen! Dass es – nach so langem Zögern – gesund zur Welt kommt.»
Lisbeth umarmte sie, spürte den Schweiß, der an der Mutter hinabran und sie schrumpeln ließ wie Dörrobst. Alles an ihr war klein und verzagt, bis auf den Bauch, der sich wie ein Ballon über ihren Leib wölbte. Ein Mann in Weiß hatte Lisbeth von der metallenen Pritsche fortgezogen und ihr gut zugesprochen: Dass sie die Mutter getrost im Hospital zurücklassen könne, sie solle sich keine Sorgen machen, ein paar Tage nur, und sie werde gesund und mitsamt dem Geschwisterchen nach Hause zurückkehren. Dies alles sagte der Doktor, während Lisbeths Mutter schwer atmete und ihr schließlich, als der Arzt das Mädchen schon zur Tür geführt hatte, noch einmal zurief: «Lauf, Lisbeth, lauf zum Vater!»
Der Mann im weißen Kittel hatte sich mit seinen blauen, hinter dem Brillenglas blitzenden Augen noch einmal zu Lisbeth hinuntergebeugt und es ihr versprochen: dass es schon gut ausgehen werde mit der Mutter! Und dazu hatte er so nett geschaut, dass Lisbeth ihm einfach glauben musste.
Die alten Zugpferde streckten die Köpfe aus ihrer Box und wieherten, als Storch hinüber ins Lager ging, um das letzte Licht zu löschen. Es schimmerte bis auf den Hof hinaus, das Tor stand noch offen. Storchs Blick fiel auf die Spulen mit den Bändern zum Verschnüren der fertig gepackten Pakete, die Nägel und Hämmer zum Verschließen der Kisten.
Da entdeckte er eine einzelne Holzkiste, die sich deutlich unter einer löchrigen Stoffdecke abzeichnete.
Er schoss darauf zu, zog die Decke herunter und sah seine schlimmste Erwartung bestätigt: eine mit allem Notwendigen versehene Sendung, die noch nicht abgefertigt war! Und «noch nicht» hieß: in diesem Jahr nicht mehr. Also: nicht mehr vor Weihnachten. Und das wiederum bedeutete: zu spät!
Storch eilte zum Expeditionsbuch, das zugeschlagen auf dem Schreibpult lag. Jedes weihnachtliche Paket, jede Sendung, die das Haus verließ, wurde hier verzeichnet: Auftragsdatum, Besteller, Ziel, Abgangsdatum.
Erneut entzündete er die Gaslampe. In all den Jahren hatte er das noch nie getan: ein bereits gelöschtes Licht wieder entzünden! Mit zitternden Händen schlug er die aktuelle Seite des Buches auf, fuhr über das Papier und fand die Zeile. In der Tat war der Empfänger der Sendung notiert: die Zinnwalder Kirchgemeinde. Doch in der Zeile für das Datum des Abgangs: nichts. Eine leere Spalte.
Storch stürmte hinüber ans Aktenregal und zog das Orderbuch heraus. Er befeuchtete den Zeigefinger, um besser blättern zu können. Dann fuhr er über die Tabellen. Knisternd wellte sich das Papier unter seiner Fingerkuppe. Und je länger er blätterte, desto zorniger wurde er, desto stärker sein Druck auf die Seiten. Tag um Tag, Woche um Woche musste er zurückblättern. Da, endlich, zum Ende des Monats Oktober: der Brief der Kirchgemeinde, die Bitte, das Weihnachtsfest der Gemeinde Zinnwald mit Produkten aus der Fabrikation Storch & Storch & Compagnie auszustatten. Beglaubigt war die Order durch zwei Unterschriften: die schwungvolle des Kirchgemeindevorstands sowie die krakelige des Pfarrers. Die Hitze schoss Storch ins Gesicht. Deutlich stand ihm vor Augen, was passiert war: Die Kiste war schlichtweg vergessen worden. Längst gepackt, geprüft, abgefertigt – und dann: vergessen! Aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht aufgeladen. Ein Unding in seiner, Storchs Firma, die sich durch Akkuratesse und Pünktlichkeit auszeichnete. Er, Vincent Storch, Fabrikant und Gründer, bürgte dafür mit seinem Namen.
Er stürmte nach vorn, ins helle Licht des Mittags, verglich den Zeiger seiner Taschenuhr mit dem Stand der Sonne, überlegte, wie lange man wohl mit dem Fuhrwerk bis nach Zinnwald im Erzgebirge brauchte – und musste sich eingestehen: Er wusste es nicht. Jahrelang war er nicht aus der Stadt herausgekommen – wozu auch? Alles, was er benötigte, gab es in Dresden, und was es nicht gab, ließ sich heranholen.
Doch Storch wollte diese Bestellung – die letzte der Saison – ans Ziel bringen, und zwar pünktlich zum Fest, koste es, was es wolle.
Auf der ihr gegenüberliegenden Straßenseite hatte Lisbeth etwas entdeckt, das ihre Aufmerksamkeit fesselte: einen Laden, wie es ihn daheim, in ihrer kleinen Stadt im Gebirge, nicht gab. Durch die Glasscheiben spiegelte Gold und Porzellanweiß, und aus der Tür, die sich unter dem Andrang der Kunden fortwährend öffnete und schloss und wieder öffnete, schwebte ein eigenartiger Geruch. Und noch etwas fesselte sie: Quer über die Auslagen war eine Kette goldener Engel gespannt. Sie hielten sich Flügel an Flügel und schienen alles zu beschützen, was sich unter ihre Fittiche begab.
Als das Mädchen sich anschickte, die Straße zu überqueren, tönte ein hohes, quakendes Hupen an ihr Ohr: ein Automobil! Dem Mann, der sich aus der Fensterluke lehnte, klemmte der Hut fest auf dem Kopf. Sein Gesicht war hochrot. Er schimpfte Worte, die Lisbeth nicht hören konnte, so laut ratterte das Fahrzeug vorüber. Und danach noch eines. Und noch eines, wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Daheim kam es höchstens zwei- bis dreimal in der Woche vor, dass eines den Weg kreuzte. Und dann ausgerechnet in dem Moment, als Lisbeths Mutter zwischen Leben und Tod schwebte – ein Wunder!
Länger als einen Tag und eine Nacht hatte sie bereits in den Wehen gelegen, immer schwächer war sie geworden, und der Vater hatte schon ein Segenslicht für sie angezündet, als von draußen dieses seltsame, seltene Geräusch ertönte. Aufspringen und Hinauslaufen war für den Vater eines. Die Treppen hinunter und dann – das konnte Lisbeth vom Fenster aus beobachten – dem Automobil des Bergwerksbesitzers hinterher. Bald war der Vater schneller und an dem Fahrzeug vorüber. Mit nackten Füßen lief er über die gepflasterte Hauptstraße und sprang entschlossen mitten auf den Fahrweg.
Lisbeth schrie auf. Schon wähnte sie ihn überrollt! Doch der Chauffeur stieg auf die Bremsen, und das Automobil kam schlingernd zum Stehen. Dann sprang der Mann heraus und schrie den Vater an: Was ihm denn einfalle, sich vor die Räder zu werfen!
Der Vater aber kümmerte sich nicht um Vorwürfe, sondern war gleich vor dem Chauffeur auf die Knie gefallen und hatte ihn angefleht, seine Frau einzuladen und nach Dresden zu bringen. Nur dort sei noch Rettung zu erwarten.
Lisbeth hatte vom Fenster aus jedes Wort mitgehört. Sie erstarrte. So schlimm stand es? Fassungslos sah sie zu, wie man die Mutter auf ein Brett band. Etwas Besseres hatte man in der Eile nicht finden können. Dann brachte man sie zum Auto und verlud sie auf die Rückbank. Der Bergwerksbesitzer, ein rundlicher Mann mit Schnurrbart und Zylinder, machte mit großzügiger Geste Platz und ließ sich auf der Vorderbank nieder.
Als sich die Hecktür hinter der Mutter schloss, stand Lisbeth noch immer unter Schock. Schon rüttelte der Vater an ihrer Schulter, sie solle die Mutter begleiten, denn er müsse bei den Geschwistern bleiben. «Lisbeth, deine Mutter braucht jetzt Beistand», klangen seine Worte in ihrer Erinnerung nach. Und dann seine hilflose Geste: «Ich wüsste nicht, was zu tun ist!»
Aber von ihr, einem elfjährigen Mädchen, dachte er, dass sie es wisse? Nein, vermutlich hatte der Vater in diesem Augenblick nicht so viel nachgedacht. Aber, und das hoffte Lisbeth ganz fest, er hatte sicher das Richtige getan. Zumindest hatten sie dann ja noch die Stadt und das Hospital erreicht …