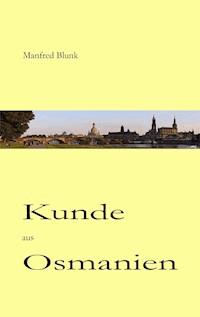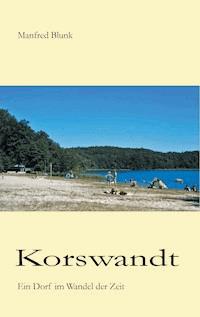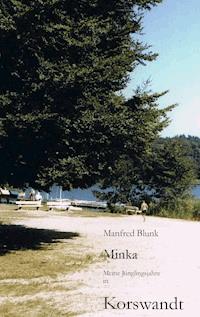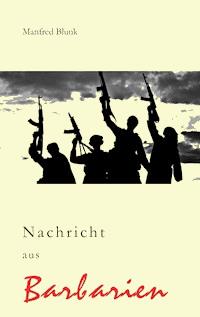Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1989. Der Ostberliner Manfred Blunk sammelt begeistert die in den Zeitungen abgedruckten Reden Gorbatschows und beginnt ein Tagebuch über die Gebrechen des Sozialismus in der DDR zu führen. Dann erlebt er in Berlin den Mauerfall. Der blanke Wahnsinn! Jetzt wird aus dem Buchhalter des Mangels ein Wende-Chronist und aus dem DDR- ein Bundesbürger. Kanzler Kohl verspricht dem Osten blühende Landschaften. Aber der Freiheitsjubel legt sich bald und der Autor erfährt in der Folgezeit, dass auch im Westen nicht alles Gold ist, was glänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommer 1989
„... Aber“, sagt HDF, „der größte Fehler, den man machen könnte, sei, sich als Parteifunktionär nicht mehr an eigene Fehler zu erinnern, in Versuchung zu kommen, an die eigene Unfehlbarkeit zu glauben und zu behaupten, dass die Meinung des I. Kreissekretärs nicht nur die Meinung des Genossen F. sei, sondern kollektive Meinung der Partei ...“
Wer ist HDF? – Landolf Scherzer, Schriftsteller im Bezirk Suhl, durfte dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Bad Salzungen vier Wochen lang bei der Arbeit über die Schulter sehen und darüber ein Buch veröffentlichen. Titel: „Der Erste – Protokoll einer Begegnung“. Seinen Helden nennt er HDF. Die drei Buchstaben stehen für Hans-Dieter Fritschler, ehemals Holzfäller, jetzt Parteiarbeiter. Der „zu lang geratene Zeitungsartikel“, wie Scherzer sein Buch nennt, ist 1988 im Greifenverlag zu Rudolstadt erschienen.
Einmal im Jahr treffen sich die Bezirksfürsten mit „ihren“ Schriftstellern. Die dürfen dann ein wenig über ihre sozialistischen Wehwehchen klagen und den einen oder anderen Wunsch nach bevorzugter Versorgung äußern. Scherzer hatte sechs Jahre darauf gewartet, über einen „Ersten“ schreiben zu dürfen. Am liebsten wäre ihm der „Erste vom Bezirk“ gewesen, aber der saß wohl zu nahe am Olymp. Seine Kollegen hatten nicht solche edlen Wünsche: Winterreifen, Telefon ... Was hat Scherzer bewogen, einen so hehren Wunsch zu äußern? Er wollte „hinter die Kulissen der Parteiarbeit schauen“.
Während des Urlaubs auf der Datsche in Berlin-Rahnsdorf hab ich Scherzers Enthüllungsprotokoll gelesen. Was ich in seinem Buch (hinter den Kulissen!) entdeckt habe, hat mir zu der Einsicht verholfen, dass der rex (real existierend) solimus (Sozialismus) in der berühmten demoli (Deutsche Demokratische Republik) wohl kaum eine Chance hat, irgendeinen Sieg zu erringen. Vielleicht hängt darum an so vielen Häuserwänden die sattsam bekannte Losung: Der Sozialismus siegt!
Dabei ist das, was bei uns offiziell Sozialismus genannt wird, mehr so eine Art katholizistischer Sozialfeudalismus, der sich durch eine vom großen Bruder überkommene Schlampigkeit auszeichnet. Doch unser Dreifaltigkeitsgott heißt nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Marx, Engels und Lenin und unser Papst sitzt, oder richtiger saß, nicht in Rom, sondern in Moskau. Den Gottesdienst haben wir durch den Jubeldienst ersetzt, eine besondere Art der Fürstenhuldigung. Und natürlich gilt auch für uns das erste Gebot: Du sollst keine andern Götter haben neben mir! – Früher konnte man nach deutschen D-Zügen die Uhr stellen. Bei uns kommen die Züge nicht nur zu spät an, sie fahren auch zu spät ab: die Krone der Schlamperei.
Ich hatte sehr gehofft, dass der XI. Parteitag im April 1986 ein paar Jüngere in die Parteispitze hieven würde, doch April, April: Unser oberster Landesfürst EHo und seine Politbüro-Rentner halten sich offenbar für unersetzbar, denn sie glauben, wer in den Olymp einzieht, erwirbt lebenslange Unfehlbarkeit – es sei denn, er fällt in Ungnade, wie Konni Naumann, der Exbezirksfürst von Berlin. Aber HDF sagte doch, es sei ein Fehler, an die eigene Unfehlbarkeit zu glauben. Oder gilt das nur für Kreissekretäre? Und es hieß ja auch seit Jahr und Tag: Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen. Immerhin druckt das „ND“ noch Gorbis Reden ab neben den täglich über uns hereinbrechenden Erfolgsmeldungen. Aber vielen reicht das nicht, sie gehen dorthin, wo Erfolge weniger in der Zeitung, dafür aber mehr auf dem Ladentisch zu finden sind.
Seit anderthalb Jahren suche ich zwei Fenster für die Datsche. Jetzt im Urlaub hab ich sie endlich in der BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) Neuenhagen bei Berlin bekommen, doch nur mit Drehbeschlag. Den Kippbeschlag darf ich armer Arbeiter-Bauern-und-Fischer-Sohn nun wieder selber ranbasteln, sofern es ihn irgendwo zu kaufen gibt.
Das Staatsvolk der Deutschen Demokratischen Republik macht sich natürlich seine eigenen Gedanken zu all dem, was da so vor sich geht in der demoli und anderswo. Dem Volk steht kein Sprachrohr zur Verfügung, es hat kein großformatiges „ND“, keine „Junge Welt“, nicht mal ein Blättchen der Wurmfortsatzparteien. Das Zentralorgan der Massen ist der Volksmund, und der ist noch allemal geistreicher und gewitzter als jedes Politbüro. Seine Sprüche werden nirgendwo gedruckt, doch sie wandern von Mund zu Mund, wie der hier: Wo wir sind, ist vorn! Wenn wir mal hinten sind, ist eben hinten vorn.
Dienstag, 15.08.89
Der Urlaub ist zu Ende. Seit gestern sitze ich wieder an meinem Schreibtisch im Köpenicker Konstruktionsbüro für Anlagen, kurz KBA genannt, und prüfe Bauprojekte.
Nach der Arbeit gehe ich in meine Kaufhalle. Wie meistens gibt es kein großes Berliner, so nennen wir das Berliner Pilsner spezial in Halbliterflaschen, 1,28 Mark die Flasche, dazu 30 Pfennig Pfand; das beste Bier in Berlin (Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik), wenn man nicht gerade im Geld schwimmt. Also kaufe ich einige Flaschen von EHos Delikatbier, das ist zwar nicht besser aber teurer.
Mittwoch, 16.08.89
Die Erfurter Elektroniker haben einen 32-bit-Mikroprozessor gebaut und das Funktionsmuster EHo übergeben. Der hat bei der Gelegenheit den Leuten etwas vorgelesen; das stand dann am nächsten Tag im „ND“.
Heute schreibt die Parteipresse: „Werktätige zur Übergabe der Muster von 32-bit-Mikroprozessoren ...“ Neunzehn Werktätige, darunter ein Professor, drücken auf die übliche Weise ihre Zustimmung aus. Bei solchen Gelegenheiten wird auch immer mal wieder die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus gepriesen. Mir scheint aber, die solimus-Überlegenheit besteht vor allem darin, dass der Mensch im Sozialismus unter ungünstigeren Bedingungen existieren kann. Großes Berliner? Wie gehabt.
Freitag, 18.08.89
Nicht nur die Züge haben oft Verspätung, auch die Zeitung lässt meistens lange auf sich warten. Das Postministerium ist nicht besser als das Verkehrsministerium. Mich sollte aber bei unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht wundern, wenn die Genossen Minister gar nicht wissen, was gespielt wird.
Im Kapitalismus ist der Werktätige als Arbeiter ein Arsch, aber als Gast und Kunde ist er König, jedenfalls solange er Geld hat. Im Sozialismus ist der Werktätige als Arbeiter König, aber als Gast und Kunde ist er ein Arsch, ob er Geld hat oder nicht.
Fahrzeughaus Rhinstraße, Berlin-Lichtenberg. In der Fahrradabteilung steht nicht ein einziges Fahrrad, doch sonst ist die Halle voll. Vor mir am Trabantstand stehen zehn Kunden. Bis ich dran bin, sagt die Verkäuferin mindestens siebenunddreißigmal: „Ham wa nich.“ Ich suche die Gummikappen für das Kupplungs- und das Bremspedal: „Ham wa nich.“ Aber die Abdeckhaube für den Batteriepluspol und Polfett kann ich erstehen.
Nebenan bedient ein junger Arbeiterkönig eine Frau, die vielleicht grade so ihren Trabant fahren kann. Er stellt ihr vier, fünf Fragen und ruft dann triumphierend: „’n Luftfiltereinsatz suchen Sie, meine Dame!“
„Ja“, seufzt die Frau erleichtert, „einen bitte.“
„Ham wa nich“, sagt der Königssohn.
Wir müssen alles tun, um die Menschen zu verändern. Befriedigen können wir sie sowieso nicht. Der Volksmund sieht durch.
Samstag, 19.08.89
Sieben Uhr. Auch Westradios halten nicht ewig. Vor zwei Jahren haben wir aus dem Trabi de Lux das DDR-Dampfradio ausgebaut und für tausend Mark (unter der Hand) einen Westrecorder reingefummelt: wunderbar. Aber jetzt hat sich der Rundfunkteil verabschiedet. Ich hab mal nachgesehn, da sind wahrscheinlich ein paar Lötstellen gerissen. Repariert mir Uwe vielleicht mal.
Zehn vor neun, Baustoffversorgung Karlshorst. Vor mir warten elf Kaufwillige. Um neun wird geöffnet. Als ich mich der bewussten Tür langsam nähere, lese ich: Bei Fliesenkauf bitte vorher Fliesen an der Zementrampe aussuchen. Ich sage meinem Hintermann Bescheid und sause los.
Auf der Rampe steht ein Königssohn und liest die FDJ (Freie Deutsche Jugend)-Zeitung „Junge Welt“. Neben ihm sind drei Wandfliesen ausgestellt:
Erste Fliese: 15x15 cm, Berlinmotiv, 3,65 Mark das Stück, zweite Fliese: 15x15 cm, anderes Berlinmotiv, gleicher Preis, dritte Fliese: 15x20 cm, schmutzig-weiß, 1,32 Mark die Platte. „Haben Sie nur die?“
„Ja.“
„Sind die hier fünfzehn mal zwanzig?“
Ohne von seiner Zeitung aufzusehen antwortet der Jungkönig wieder: „Ja.“
„Danke“, sage ich und laufe zurück.
Jetzt bin ich schon so nahe an der Tür, dass ich auf der Anleitung für den Fliesenkauf auch das kleiner Geschriebene lesen kann: Zettel mitbringen. Ich denke: „Bei drei Sorten wird es wohl auch ohne Zettel gehen.“ Endlich bin ich drin. Die Frau kenne ich von früheren Einkäufen oder Kaufversuchen. Für jemand, der Mangelware verkauft, ist sie gradezu liebenswürdig. „Na, was wolln wir denn?“
„Ich möchte die Fliesen zu 1,32 Mark.“
„Ham Se ’n Zettel?“
„Nein, der Rampenmensch liest grade Zeitung. Wie viel Fliesen sind denn in einem Karton?“
„Dreiunddreißig.“
„Dann möchte ich bitte einen Karton.“
„Aber Sie brauchen ’n Zettel, junger Mann!“
„Können Sie das nicht mit ihrem Computer machen?“
„Bei Fliesen nicht, da gibt es verschiedne Farben. Holn Se sich ’n Zettel und kommn Se gleich wieder rein.“
Als ich wieder drin bin, tippt sie auf ihrem PC die Rechnung. Der Computer rechnet auf den Pfennig genau 43,56 Mark aus. „Wie die Geldautomaten“, denke ich, „die Uhrzeit drucken sie, aber nicht den Kontostand.“
Unser Verstand ist unser Vermögen. Armut schändet nicht.
Montag, 21.08.89
Das „ND“ lässt auf Seite drei wissen: „Der Sozialismus ist so stark, wie wir ihn machen – jeder an seinem Platz.“ Hoppla! Da haben „wir“ also den allgegenwärtigen Mangel verzapft. Seltsam: Alles, was hier passiert, läuft doch unter Führung der Partei. Wer aber ist die Partei? Du, ich, Konni Naumann, die Opas vom Politbüro, EHo? Jedenfalls hat sich unter Führung der Partei die mangelhafte Planwirtschaft der Anfangsjahre zur geplanten Mangelwirtschaft von heute entwickelt.
Aber Mangel, zumal sozialistischer, hat auch sein Gutes. In fünfzig bis hundert Jahren – so lange könnte die Mauer noch stehen, meint EHo – werden die Menschen im rex solimus die gescheitesten Handwerker der Welt sein. Bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst; wer immer der Gott auch sein mag.
Dienstag, 22.08.89
Manchmal kommt auch mitten im solimus-Alltag Freude auf. Oberbastler Uwe kann ich nicht gleich erreichen, der sitzt in Hoyerswerda und ist seit kurzem selbständiger Junghandwerker. Aber nach dem Mittagessen hört sich Dietmar aus der EDV-Abteilung meine Geschichte vom Autoradio an und sagt: „Kann sein, zeig mal her.“ Er schraubt den Deckel ab, reinigt den Tonkopf und verkündet nach kurzer Untersuchung: „Na klar, det ham wa gleich.“ Dann holt er seinen Lötkolben und lötet die vier Lötstellen nach, die die beiden Leiterplatten verbinden; sie waren alle gerissen. „Die einzige Schwachstelle in dem guten Gerät“, bemerke ich.
Darauf er: „Die haben bei der Entwicklung ja nicht an unsere Straßen gedacht.“
Schon möglich. Ich renne runter ans Auto, klemme die Drähte an und die Westschnauze wummert los wie die Silbermannorgel im Freiberger Dom. Natürlich haben wir das alles in der Arbeitszeit gemacht, wir volkseigenen Könige. Privat geht vor Katastrophe! Logo.
Gestern wollte ich Fotoabzüge und Nadjas Schuhe abholen, aber die Dienstleistungsbude hatte wegen Inventur geschlossen; muss ich also heute noch mal hin. Die Fotos kann ich mitnehmen. Ein Colorabzug, 13x18 cm, kostet rund sechs Mark. Nadjas Schuhe sind noch nicht fertig. Übrigens: kein großes Berliner in der Halle.
Mittwoch, 23.08.89
Seit drei Jahren bin ich Vorsitzender des Elternaktivs in Saschas Klasse. Frau K., die Klassenleiterin, soll zum Abschied ein schön gerahmtes Klassenfoto bekommen. Die Bilder von der 4c hab ich während der letzten Klassenfahrt geknipst. Jetzt muss ich zu so einem teuren Sechs-Mark-Abzug irgendwo den passenden Bilderrahmen kaufen.
In dem Köpenicker Schreibwarengeschäft der HO (Handelsorganisation) gibt es zwei Sorten. Der eine Rahmen ist aus Metall, nicht gerade schön, aber billig; er kostet 2,65 Mark. Der andere ist ganz hübsch, Nostalgiekunststoff. Sein Preis ist allerdings beachtlich: sechsundzwanzig Mark. Da nehme ich erst mal Abstand.
Später frage ich noch in Biesdorf-Süd nach Kipp-Dreh-Beschlägen für meine späten Datschenfenster. Teufel auch! Es gibt sogar welche, aber kurz vor mir sind sie alle.
Donnerstag, 24.08.89
Einer der beiden Aufzüge im KBA unternimmt erfolgreich einen Stehversuch. Den anderen belegen die Handwerker aus Leipzig; sie bauen uns neue Fenster ein. Die alten Fahrstühle kümmerten schon etliche Jahre vor sich hin, bis sie vor kurzem endlich rekonstruiert wurden. Das währte etwa neun Monate. Dann fuhren sie wieder, aber nicht lange.
Montag, 28.08.89
In der großen Lichtenberger Kaufhalle will ich Räucherfisch kaufen, doch das Fischgeschäft hat aus „technischen Gründen“ geschlossen. Am Halleneingang warten fünfzig bis sechzig Seelen auf Einkaufswagen. Ich schau mal rüber zu Mutter Witt – Herings-Witt in Lichtenberg, bester Fischladen am Platz – aber der Räucherfisch ist alle.
In meiner Halle fehlt wieder das große Berliner; auch Buch-und Hefthüllen glänzen kurz vor Schulbeginn durch Abwesenheit. Nadjas Schuhe sind auch heute noch nicht fertig. Am 29. Juni hab ich sie abgegeben. Ich soll mich aber nicht beunruhigen, Schuhreparaturen würden zur Zeit etwa drei Monate dauern.
Dienstag, 29.08.89
Der Aufzug im Büro fährt wieder. Aber zum Frühstück muss der Fensterschlepper sich erst mal ausruhen. So bleibt alles beim alten, denn die Handwerker steigen natürlich sofort in den anderen Lift um.
Am Nachmittag entdecke ich in Köpenick endlich einen passablen Bilderrahmen: Holz, zehn Mark, mittelprächtig. Doch Schulbuchhüllen scheint es nirgendwo zu geben. In Biesdorf-Süd werden wieder Kipp-Dreh-Beschläge verkauft, allerdings nur rechte; ich brauche aber zwei linke. Mutter Witt hat noch einen Restposten Räucherfisch und meine Halle tatsächlich mal großes Berliner.
Mittwoch, 30.08.89
Nadja hat bei ihrer Dolmetscherei den litauischen Gesundheitsminister kennengelernt, der hat ihr im schönsten Kurort Litauens eine Kur besorgt; jetzt hole ich sie vom Flughafen Schönefeld ab. Das Flugzeug aus Vilnius ist zwei Minuten überpünktlich. Am Blumenstand bekomme ich keine Schnittblumen. Die Taube erzählt schlimme Dinge über den Nationalismus der Litauer. Russen haben dort jetzt keine guten Karten; sie hat sich kaum gewagt, russisch zu sprechen.
Mir ist schon früher der Gedanke gekommen, dass ein Vielvölkerstaat wie die Sowjetunion nur in einer Diktatur möglich ist. Auch andere Länder, wie Indien oder Jugoslawien, haben solche Nationalitätenprobleme. Über Stalins Zarenreich brechen sie jetzt wie eine Lawine herein. Wahrscheinlich wird Gorbi scheitern, dann könnte die SU wieder ein sehr unfreundliches Land werden.
Donnerstag, 31.08.89
UNSERE SOZIALISTISCHE PRESSE – SCHÄRFSTE WAFFE DER PARTEI. Diese Forderung der SED-Führung nimmt sich offensichtlich das „Zentralorgan“ ganz besonders zu Herzen. Da gehen mir dann immer mal ein paar Widerworte durch den Kopf, die ich ab und an aufschreibe und dem „ND“ schicke:
Sehr geehrte Redaktion!
Wenn es denn wirklich um Diskussion (laut Duden: Erörterung, Meinungsaustausch; Auseinandersetzung) geht, würde ich ganz gerne daran teilnehmen. Ich befürchte aber, es geht wie eh und je wieder nur um Agitation (laut Duden: Werbung; Methode zur Entwicklung des gesellschaftlichen Bewusstseins durch Aufklärung über aktuelle politische Tagesfragen).
Die Rede ist von Wolfgang Schneiders Vortrag „Zur Wissenschaft und Praxis des Sozialismus“ („ND“ vom 26./27.8.89, S. 3). Mir scheint, den Sozialismus – wie er vielleicht noch zu Stalins Zeiten genannt werden konnte – gibt es heute nicht mehr. Der heutige Sozialismus in Polen, Ungarn oder der SU unterscheidet sich doch wohl – mehr oder minder – von dem in Rumänien, China, der DDR und weiteren Ländern. Das führte ja auch folgerichtig zu dem „Sozialismus in den Farben der Deutschen Demokratischen Republik“.
Will man die Wissenschaft bewerten, so muss sie danach beurteilt werden, was sie im Alltag des kleinen Mannes zu leisten vermag. Da hat die Sozialismuswissenschaft wohl noch reichlich Reserven. Solange die Wissenschaft vor allem Zeitungstheorie bleibt, wird sie die Massen nicht sonderlich ergreifen.
Die Arbeiterklasse übt die Macht aus. Gut. Aber wer ist Arbeiter, wer hat Macht und was macht er damit? Hat die Arbeiterklasse den „Sputnik“ verboten? Jürgen Kuczynski bewertet das „Sputnik“-Verbot als „einen völligen Wahnsinn“ und „Ausdruck eines hierarchisch-administrativen Vorgehens“ („UZ“ vom 8.7.89, S. 3). Ist unsere gepriesene Demokratie frei von Machtmissbrauch?
Ob das Anwachsen der führenden Rolle der marxistischleninistischen Partei ein gesetzmäßiger Prozess ist, kann ich auch nach fünfzehn Jahren Parteilehrjahr nicht beurteilen. Aber bei allen Leuten, die ich kenne, stelle ich ein Anwachsen der Sorge um die Sozialismusentwicklung fest.
Theoretisch halte ich die sozialistische Planwirtschaft für die vernünftigste Sache der Welt, aber praktisch muss ich fragen: Hat sich nicht die mangelhafte Planwirtschaft der Anfangsjahre zur geplanten Mangelwirtschaft von heute entwickelt?
Gewiss ist im Sozialismus der Marxismus-Leninismus die herrschende Ideologie, aber doch immer nur in der Interpretation der jeweiligen Parteiführung. Und da gibt es ja wohl einige Lesarten. Auf Lenin hat sich bisher noch jeder berufen, ganz gleich, wie weit sein Tun und Lassen von Lenins Ansichten und Vorstellungen entfernt war. Leonid Breshnew wird als „würdiger und bewährter Fortsetzer des großen Werkes Lenins“ bezeichnet (5. Tagung des ZK der SED, Dietz Verlag Berlin 1982, S. 5). Warum muss seine Politik trotzdem in einem solchen Maße korrigiert werden, wie das seit einigen Jahren geschieht?
Die Agitatoren (siehe auch Kurt Tiedke: „Die neue Epoche auf deutschem Boden“, „ND“ vom 30.8.89, S. 3) streiten sich fortwährend mit Westideologen darüber, dass der hiesige Sozialismus nicht zum Kapitalismus reformiert wird. Aber darum geht es dem real existierenden DDR-Bürger doch gar nicht. Könnte man nicht mal mit uns darüber diskutieren (nicht agitieren), wie der Sozialismus in der DDR aussehen sollte, damit wir gerne (und möglichst alle) in ihm leben möchten?
Glasnost müsste schon dazugehören; also eine gesunde öffentliche Auseinandersetzung über alle Probleme, die uns am Herzen liegen. Martin Miersch und Udo Magister vom Oktoberklub singen in ihrem Lied „Verantwortung“: „Wir müssen wieder lernen, uns zu streiten ...“ („UZ“ vom 17.3.89). Ich meine, sie haben mit ihrer „Verantwortung“ die Sache auf den Punkt gebracht: Werden wir uns streiten, oder werdet Ihr mich wie bisher wieder nur agitieren?
Montag, 04.09.89
„Neues Deutschland“ berichtet über den Rundgang unseres Ministerpräsidenten auf der Leipziger Messe. Der Premier ist dreißigmal abgebildet, einmal mehr als EHo im Vorjahr. Wenn ich mich aber recht entsinne, hält der Generalsekretär den Rekord mit sechsunddreißig Abbildungen.
Wir haben im KBA heute die obligatorische Monatsversammlung der SED-Grundorganisation. Thema: Umtausch der Mitgliedsbücher. Ist ja möglich, dass es neue Mitgliedsbücher gibt, großes Berliner und Schulbuchhüllen gibt es nicht.
Dienstag, 05.09.89
In Biesdorf-Süd frage ich wieder nach Kipp-Dreh-Beschlägen. Die junge Verkäuferin ist eine attraktive Person. Kipp-Dreh-Beschläge hätten sie nicht, sagt sie forsch.
„Und was ist das da in dem Pappkarton?“
Sie sucht den Karton eine Weile und meint dann hochnäsig: „Ach ja, aber nur rechte, und die sind alle unsortiert. Die müssen erst sortiert werden, dazu haben wir jetzt keine Zeit.“ Dann trägt sie wieder kleine Schraubenschachteln zum Verkaufstisch.
Ich habe aber schon längst beobachtet, dass hier überhaupt nur eine Verkäuferin einen Satz Kipp-Dreh-Beschlag zusammenstellen kann, doch jene Spezialistin – wie sofort jeder Sowjetbürger sagen würde – ist heute nicht da.
Wir sind zu allem fähig – aber zu nichts zu gebrauchen.
Mittwoch, 06.09.89
Gemessen am Aufgabenbereich ist der Name „Konstruktionsbüro für Anlagen“ etwas verschwommen. Partei und Regierung haben dem KBA Berlin den Auftrag erteilt, allen Betrieben und Einrichtungen, die für die NVA (Nationale Volksarmee) produzieren oder reparieren, die erforderlichen bautechnischen und technologischen Projekte für geplante Neubauten und Rekonstruktionen zur Verfügung zu stellen. Damit das alles seinen sozialistischen Gang geht, prüfen wir – Horst, der Leiter, Werner und ich – Projekte und Bauausführung; Sachbearbeiterin Silvia sorgt dafür, dass die Prüfgruppe der Staatlichen Bauaufsicht immer arbeitsfähig ist.
Heute fahre ich nach Neubrandenburg; dort habe ich im Panzerreparaturwerk zu tun. Im Zug gibt es Frühstück; Selbstbedienung. Einmal Rührei, nicht grade viel, mit einer Konsumschrippe und ein Kännchen Kaffee kosten 4,49 Mark. Der Zug ist pünktlich.
Das Reparaturwerk mit seinen vielen Hallen und Gebäuden liegt etwas außerhalb am Tollensesee. Der Großbetrieb ist einer unserer besten Kunden. Hier wird ständig was an-, um- oder neugebaut; wir sind also öfter mal in der Viertorestadt.
Auf dem Rückweg zum Bahnhof sehe ich mich mal in einem recht ordentlichen Eisenwarengeschäft um und frage nach Ersatzteilen für meinen Flachspülkasten.
„Ja, führen wir“, sagt der Verkäufer, „aber es ist nichts da.“
„Auch nicht die Klemmspange?“
„Nein, da lassen Sie sich mal eine aus Schweißdraht biegen.“
„Danke.“
Seine Kollegin frage ich nach Kippdrehbeschlägen.
„Haben wir, aber nur linke.“
„Die such ich ja grade, in Berlin haben sie nur rechte.“
Dann lacht sie, weil ich kein Hehl daraus mache, dass ich hier besser bedient werde als in der berühmten Hauptstadt. Ein Satz Kipp-Dreh-Beschlag – in eine Semmeltüte gesteckt, die natürlich sofort zerreißt – kostet ganze 10,80 Mark – wenn man ihn bekommt.
Nach Kursbuch der Deutschen Reichsbahn – das Letzte, was uns vom Reich geblieben ist – und nach Fahrplan in der Bahnhofshalle fährt 13.17 Uhr ein Personenzug nach Oranienburg. Auf dem Bahnsteigaushang fährt er 13.19 Uhr und wirklich dann doch schon 13.40 Uhr. Aber er ist pünktlich am Ziel.
Samstag, 09.09.89
Die Taube – meine Dolmetscherin – war auf Achse und fliegt wieder ein. Ich will sie abholen. Obwohl Saschas Schule ganz in der Nähe ist, nehme ich ihn im Auto mit; das gefällt ihm natürlich.
Heute gibt es Schnittblumen im Schönefelder Flughafen, aber dafür hat das Flugzeug aus Bukarest eine Stunde Verspätung. Ein junger Ausländer will nach Westberlin telefonieren. Ich helfe ihm dabei und wechsle ihm ein Fünfmarkstück; gut gewechselt: es sind – fünf D-Mark!
Nadja kommt endlich. Ich soll ihr für die Westmäuse im Intershop Kosmetik kaufen, doch was sie sucht, ist nicht da. So kaufe ich für Sascha Süßigkeiten, die er nur aus der Reklame im Westfernsehen kennt; der wird Augen machen.
Montag, 11.09.89
Nach Feierabend nimmt mich Siegmar in seinem Wartburg mit nach Bohnsdorf. Von da fahre ich mit dem Bus nach Schönefeld zum Zug nach Dresden. Morgen will ich das Sprengstoffwerk Gnaschwitz bei Bautzen besuchen.
Siegmar erzählt mir, dass neben seinem Haus ein hochgestellter Klassenkämpfer seine Datsche hat. Dessen Gärtner oder Fahrer hätte ihm anvertraut, der Kämpfer besäße andernorts noch zwei Datschen. Als ich Anfang der achtziger Jahre Bekannten half, ihre Datsche zu bauen, mussten sie vom Beschäftigungsbetrieb eine Erklärung beibringen, dass sie noch kein Wochenendgrundstück besitzen. So sieht sie aus, die Gleichheit in den Farben der Deutschen Demokratischen Republik.
Ich fahre mit dem Metropol Berlin–Budapest (aber nur bis Dresden, ich will ja nicht weg). Einen Erster-Klasse-Wagen finde ich nicht. Der Mann neben mir hat sich für sieben Mark eine Flasche ungarisches Delikatbier gekauft; ich verkneife mir das und erreiche Dresden mit Bierdurst, aber ohne Verspätung.
Dienstag, 12.09.89
Der D-Zug Dresden–Görlitz ist selten unpünktlich. Elf Minuten vor acht ist er in Bautzen; ich hab noch nicht mal das Wichtigste im „ND“ gelesen. Die Bahnhofshalle ist frisch vorgerichtet, recht hübsch. Sogar an einen Geldautomaten hat man gedacht, alles ist schon vorbereitet, nur der Automat fehlt noch.
Die Frau an der Stadtbuskasse darf mir angeblich nicht zwei Einzelfahrscheine für den C-Bus verkaufen; in Neubrandenburg war das überhaupt kein Problem. Ich muss eine Karte mit sechs Fahrten nehmen, die kostet eine Mark. Na gut, dafür sind die Busse auch immer pünktlich.
Nach meinem Baustellenbesuch mache ich einen ausgedehnten Geschäftsbummel in Bautzen. Am Autoladen ist mir die Schlange zu lang. (Ich suche immer noch die Pedalgummis für den Trabi.) In der volkseigenen Buchhandlung erfahre ich, dass Mockers „Gedankengänge nach Kanossa“ (Aphorismen, zum Beispiel: „Wir können uns nur ganz selten des Eindrucks erwehren, dass wir recht haben.“), also dass seine Aphorismen schon im vorigen Jahr in ganz kleiner Auflage erschienen sind. Das heißt: Alibiauflage (politisch brisant?) und ansonsten so tun, als ob alles ganz normal wäre. Aber das Buch kann man nicht kaufen. Die „Einheit“ liegt in jeder Konsumhalle rum, nur hat eben Mocker noch nie was in der „Einheit“ veröffentlicht. Nach „Claus und Claudia“ von Neutsch frage ich auch vergebens, Platanows „Baugrube“ ist angekündigt. Den Platanow bekomme ich später für zwölf Mark in der christlichen Buchhandlung.
Dann entdecke ich ein Geschäft mit Sanitärartikeln. Im Schaufenster steht geschrieben, es sei aus einer über hundert Jahre alten Klempnerei hervorgegangen. Der Laden hat Westniveau. Dort sind Ersatzteile ausgestellt (auch für meinen Flachspülkasten!), die ich in all den verschlampten HO-Buden noch nie gesehen habe. Und das alles bringt eine einzige, real existierende private Handwerkerin zuwege. Dabei ist sie auf dieselbe vierzigjährige Er-Volkswirtschaft angewiesen, die auch allen anderen zur Verfügung steht. Spitze, die Frau. Doch was heißt das schon: An der Spitze stehen ist immer noch zu weit hinten.
Im Bahnhofsrestaurant warte ich sage und schreibe vierzig Minuten auf ein Bier. Die beiden korpulenten Vertreter der herrschenden Klasse beherrschen vielleicht nicht so sehr ihr Kellnerhandwerk, dafür aber die Gäste um so mehr.
Mittwoch, 13.09.89
Die Halle bietet zur Abwechslung mal wieder großes Berliner an und außerdem Melonen. Nadja ist Südrussin und in Krasnodar mit Melonen aufgewachsen, da nehme ich ihr natürlich eine mit.
Donnerstag, 14.09.89
In Kaulsdorf-Süd habe ich für 4,80 Mark zwei Räucherforellen gekauft. Beim Essen erzählt uns Nadjas Mutter, im alten Russland hätten sie die Forelle Zarenfisch genannt. Da müssten wir eigentlich froh sein, dass heute nicht nur die „Zaren“, sondern auch wir Fußvolk Forellen essen können.
Nach dem Forellenschmaus schau ich noch mal nach Nadjas Schuhen und dann passiert’s: Sie sind fertig. Auftrag vom 29. Juni: Absätze neu beziehen. Das dauert zehn Wochen und kostet 12,35 Mark. Im Keller ist es duster ...
Dienstag, 19.09.89
Heute hab ich mein persönliches Gespräch. Auf Weisung des Zentralkomitees sind von Zeit zu Zeit mit allen Parteimitgliedern „persönliche“ Gespräche zu führen. Vielleicht wollen die SED-Oberen auf diese Weise erfahren, was der Genosse an der Basis denkt und fühlt. Wahrscheinlich ist es aber doch nur eine der vielen Disziplinierungsmaßnahmen.
Diesmal will ich ein gerüttelt Maß Kritik an der großen wie der kleinen Politik meiner Führung vorbringen. Ich übergebe drei Streitschriften und eine Protestnote zum „Sputnik“-Verbot. Das hab ich auch alles schon dem „ND“ geschrieben, aber solcherlei Kritik hat in der Fürstenfibel natürlich keinen Platz. Dann zieh ich mächtig vom Leder. Ich kann, sag ich den Männern von der Parteileitung, ich kann die Politik meiner Parteiführung in zunehmendem Maße nicht mehr nachvollziehen. Dabei hoffe ich auf Widerspruch, Zurechtweisung – und irgendwo im Hinterkopf flüstert es: Parteiausschluss. Doch Lutz redet kaum, und Christian ermuntert mich gradezu, richtig auszupacken. Oder will er mich nur aus der Reserve locken? Am Ende loben mich die beiden; ich wäre einer der wenigen, die sich gut vorbereitet hätten. Verdammt noch mal! Bin ich denn nun ein guter Genosse?
Während des Prager Frühlings habe ich mit Radio Prag korrespondiert; von Dubček war ich begeistert. Ein Sozialismus, aus dem keiner abhauen will, das wär’s doch gewesen. Damals lebte ich in Dresden und arbeitete im Projektierungsbüro Süd (auch so ein Deckname). Das PBS untersteht dem Ministerium für Nationale Verteidigung und projektiert für die NVA Schutzbauwerke, sprich: Atombunker. Alles streng geheim, versteht sich.
Zu der Zeit war ich noch parteilos und hab mich mit den Leuten von der SED oft gestritten. Später versuchten sie mich für die Partei zu gewinnen. Von außen könnte ich an der Politik nichts ändern, da sollt ich es doch lieber als Mitglied versuchen. Das hörte sich gut an, war aber eine sehr törichte Illusion. Kann denn heute der kleine Katholik die