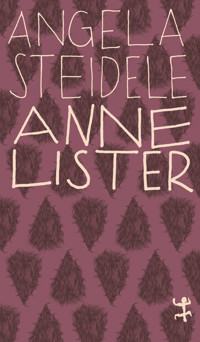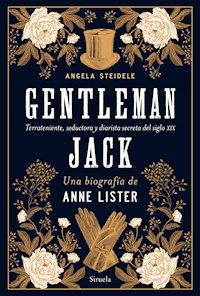14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Angela Steidele bringt die Epoche der Aufklärung zum Leuchten.« Denis Scheck
Leipzig im 18. Jahrhundert, seiner glänzendsten Zeit. Von den Messen tragen die Händler nicht nur Waren, sondern auch Ideen nach ganz Europa. Johann Sebastian Bach vermisst das Universum in Tönen, unterstützt von seiner Frau, der Kammersängerin Anna Magdalena, und seiner ältesten Tochter Dorothea. Derweil erforscht das Ehepaar Gottsched die deutsche Sprache und verbreitet unermüdlich das Licht der Aufklärung. Empört über die Biographie, die Johann Christoph Gottsched nach dem frühen Tod seiner Frau Luise veröffentlicht, beschließt Dorothea Bach, ihre eigenen Erinnerungen zu Papier zu bringen. Es war doch alles ganz anders mit Voltaire, Lessing und dem jungen Goethe! Schließlich leben wir im Zeitalter des hochgelahrten Frauenzimmers!
Leichthändig und heiter zeichnet Angela Steidele in ihrem Roman ein gewitztes Porträt der Aufklärung aus Frauensicht. Mitreißend erzählt sie von Musikern und Buchdruckern, Dichterinnen und Schauspielerinnen, von Turbulenzen des Geistes, wissenschaftlichen Höhenflügen und von der Weltweisheit in der Musik. Historisch versiert, unsere Gegenwart im Blick, schildert sie Schicksalsjahre einer Epoche, in der es kurz möglich schien, Frauen und Männer könnten gemeinsam die Welt zur Vernunft bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cover
Titel
Angela Steidele
Aufklärung
Ein Roman
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
www.insel-verlag.de/steideleAuf dieser Sonderseite finden Sie Links zu Einspielungen der im Text genannten Werke Bachs sowie zu einigen Buchtiteln.
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 4. Auflage der Erstausgabe, 2023.Korrigierte Fassung, 2023.
Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Louise d'Épinay, Pastell von Jean-Étienne Liotard, um 1759, Musée d’Art et d’Histoire, Genf, Foto: André Held/akg-images, Berlin
eISBN 978-3-458-77493-8
www.suhrkamp.de
Motto
Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie: Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. … Manchmal hör' ich sie fließen unaufhaltsam. Manchmal steh' ich auf, mitten in der Nacht, und lass' die Uhren alle stehen. Allein, man muss sich auch vor ihr nicht fürchten.
Monolog der Marschallin, Hugo von Hofmannsthal/Richard Strauss, Der Rosenkavalier, 1911
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Motto
Inhalt
Licht erhellt Papiere und Bücher
Im Zimmermannischen Kaffeehaus
Auf gut Deutsch
In der Thomasschule
Empörung
Fünf Paukenschläge
Türspalt
Wissen
Parodie
Briefe
Heiligabend
Weihnachtsoratorium
Licht
Druck
Erfunden und verbessert
Fleischbänke
Krönung
Die starke Frau
Anmutige Gelehrsamkeit
Deutsche Gesellschaft
Zwiesprache
Scheinfromm
Zwist
Hanswurst
Kontrapunkt
Drei Finger
Nachhilfe
Die vernünftigen Tadlerinnen
Austreten
Zwitschern
Wohltemperiert
Erwünschte Zeit
Falsche Zungen
Buch der Bücher
Leibespein
Lebendige Kräfte
Schön schreiben
Zeichen setzen
Schnütchen
Weißt du noch?
Der allerkostbarste Schatz
Bibergeil
Freuden des Lebens
Goldberg
Dresden
Spuren
Kuchendörfer
Intellegentia artificiosa
Wehen
Federn
Zärtliche Schwestern
Opfer
Blitze
Ich und sie
Sprachkunst
Kaiser und Reich
Es dunkelt
Nacht
Requiem
Ach du liebe Zeit
Lose
Asmodi
Kanon
Das Rosental
Der Teufel ist los
Orangenschalen
Stimmen
Die Gräfin
Aneignen
Kreisfuge
Kanonikus
Windspiele
Kanonade
Sicht
Säbel- und Federkriege
Blut
Klein-Paris
Sind's böse Zeiten?
Aimable ignorante
Witz
Wählen
Zukunftsmusik
Eröffnung
Herr Gugl
Personenverzeichnis
In der Thomasschule
Kinder aus seiner ersten Ehe mit Maria Barbara Bach (1684-1720):
Kinder von Johann Sebastian und Anna Magdalena Bach:
Im Goldenen Bären
An der Universität
Im Theater
Zu Hause oder zu Gast in Leipzig
Auswärts
An der Regierung
Roman. Eine Aufklärung
Dank
Bildteil
Fußnoten
Abbildungsnachweis
Informationen zum Buch
Licht erhellt Papiere und Bücher auf einem Tisch, an dem sie liest und schreibt; ich verharre an der Tür. So sehe ich Luise manchmal vor mir. Zuweilen lächelte sie beim Denken, das weiß ich noch; aber ihre Gesichtszüge verblassen schon in meiner Erinnerung. Dabei ist es noch kein Dreivierteljahr her.
Im Zimmermannischen Kaffeehaus
Lichter scheint mir die Erinnerung an unsere erste Begegnung. Vor über achtundzwanzig Jahren war das, im Herbst 1734. Das Zimmermannische Kaffeehaus war gedrängt voll. Die wenigsten Gäste hatten einen Platz gefunden, alles schob und stieß sich, lachte und schwatzte durcheinander. Die Aufwärterinnen mussten ihre Ellenbogen einsetzen, um die Tabletts mit den dampfenden Kaffeetassen an die Tische zu bringen. Kienspäne leuchteten auf. O nein! Da stopften einige Herren doch tatsächlich ihre Tonpfeifchen. Und woher sollte ich gleich die Luft nehmen für meine Partie? Im Publikum entdeckte ich Lorenz Mizler, der damals bei uns in der Thomasschule ein und aus ging. Er fing meinen Blick auf und wandte sich an die Raucher. Unbeirrt von dem Getümmel saß mein Vater am Cembalo und schlug immer wieder denselben Ton für die drei Streicher und den Flötisten an. Als alles stimmte, fehlte Scheibe der Schuft. Bernhard musste ihn vom Abort zerren. Endlich blitzte uns mein Vater an. Ein erster, energisch gegriffener Akkord, und Bernhard rief mehr, als dass er sang:
»Schweigt stille, plaudert nicht!«
Überrascht verstummten die Leute tatsächlich – und mein Bruder verstolperte glucksend fast seinen nächsten Einsatz. Ach, war das übermütige Musik. Herrn Schlendrian hörte man erst schwerfällig im Bass des Cembalos, bevor Scheibe nach vorne schlurfte. Er war natürlich viel zu jung für die Rolle als mein Vater, wir waren ja zusammen konfirmiert worden. Aber der eigentlich vorgesehene Sänger war unpässlich, und Adolph Scheibe hatte angeboten, die nicht leichte Partie in nur einem Tag einzustudieren. Anna Magdalena hatte ihm dabei geholfen, da Scheibe großen Respekt, man könnte sagen Angst vor meinem Vater hatte. Während des Vorspiels zu seiner Arie seufzte und stöhnte er hörbar. Das Publikum schmunzelte, im Glauben, er brumme, wie die Rolle von ihm verlangte, wie ein Zeidelbär. Unmerklich gab ihm Anna Magdalena aus der ersten Reihe mit dem Kinn seinen Einsatz.
»Hat man nicht mit seinen Kindern hundert-ta-ha-ha-ha-hausend Hudelei?«
Schon bei seiner ersten Koloratur fingen die Gäste laut an zu lachen. Anna Magdalena hatte Scheibe ein Kissen vor den Bauch gebunden und ihm einen alten, in der Stadt gut bekannten Rock ihres Mannes angezogen. Das Publikum ergötzte sich am Scherz des Kapellmeisters auf eigene Kosten, stand er doch mit zweien seiner vielen Kinder auf der Bühne. Und gerade Bernhard war für allerlei Hudeleien bekannt. Er hatte damals – ach, ich höre Luise sagen: Bleib bei deiner angefangenen Geschichte. Also.
Während Scheibe sich durch immer vertracktere Koloraturen hudelte, musterte ich unauffällig die Reihen. Mizler, der keinen Hausmusikabend bei uns verpasste und mich oft am Klavier begleitete, sprach mir stumm Mut zu. Neben ihm saß eine junge, mir unbekannte Frau. Sie war nicht sonderlich schön, aber auch nicht hässlich, nicht zu dünn und nicht zu dick; ihr Kleid entsprach nicht der Mode, meines allerdings auch nicht. Im Nachhinein würde ich sagen: Es war ihr wacher Blick, der sie von anderen unterschied, Frauen wie Männern. Und dabei beseelte ihre Augen – ja, wie soll ich das beschreiben? Neugier und Skepsis gleichermaßen? Heiterkeit und Melancholie in einem? Ironie gepaart mit Lebenslust? Wahrscheinlich stelle ich mir heute, jetzt, nur vor, was ich damals zu erkennen glaubte. Es ist so schwer, sich in diese Zeit zu versetzen.
Offensichtlich hatte sie Scheibes heikle Lage schon begriffen. Amüsiert flogen ihre Blicke zwischen ihm und Anna Magdalena hin und her. Mein Vater drohte Scheibe zwar mehrfach mit dem Finger, weil er nicht auf sein Dirigat achtete, musste sich aber darauf verlassen, dass Anna Magdalena hinter seinem Rücken dafür sorgte, dass alles gut ging. (O Luise, jetzt habe ich in einem Satz zweimal ›dass‹ gebraucht.)
So selbstvergessen beobachtete ich die beobachtende Frau im Publikum, dass ich fast meinen eigenen Auftritt verpasst hätte. Mein Vater musste im Takt mit dem Fuß in meine Richtung stampfen, damit ich aufstand und mein Rezitativ sang: Dürfe ich nicht dreimal am Tag Kaffee trinken, würde ich
»ein verdorrtes Ziegenbrätchen«.
Die Frau im Publikum blinzelte mit den Wimpern, als bliese ein Windstoß sie an. Ich fühle noch heute, wie rot ich anlief. Doch während sich Traversflöte und Streicher zart umschmeichelten, dachte ich, der werd ich's zeigen! Die wird sich wundern, wie schön ich singen kann!
»Ei! wie schmeckt der Coffee süße,
Lieblicher als tausend Küsse.«
Mein Vater hatte das voller Schalk komponiert. Mit gespielter Unschuld kostete ich auf süße die schmelzenden Cantilenen aus. Doch ich war ja nicht dumm und alt genug, um zu wissen – und mit hochgezogener Augenbraue wissen zu lassen –, dass die Tochter in der Kaffeekantate[1] nicht nur vom Kaffee träumt. Meine Stimme saß, und alles, selbst die großen Intervallsprünge und die zahlreichen Triller, flossen mir leicht aus der Kehle. Die Gäste lauschten hingerissen, sogar mein Vater schien zufrieden – nur jene Frau tuschelte hinter ihrem Fächer lebhaft, allerdings nicht mit Mizler, sondern mit dem Mann an ihrer anderen Seite. Lachte sie mich aus?
Scheibe bekam davon nichts mit. Angestachelt von den Rufen aus dem Publikum, wurde er in seiner nächsten Arie übermütig und warf mir feurige Blicke zu.
»Mädchen, die von harten Sinnen
Sind nicht leichte zu gewinnen.«
Damals, im Konfirmandenunterricht, hatten wir ein bisschen geäugelt. Aber ich hatte nichts zugelassen und Ewigkeiten nicht daran gedacht. Jetzt trieb er mich vor allen Leuten in die Enge. Was sollte das denn bloß? Das passte doch gar nicht zu seiner Rolle als mein Vater! Wie hatte ich mich auf diesen Auftritt gefreut, mein erster großer, und jetzt stand ich kreuzunglücklich auf der Bühne. Neben mir ein impertinenter Bassist und vor mir diese Frau, die sich über mich lustig machte. Als ich wieder dran war und sang
»Ach, ein Mann! Ach, ein Mann!
Wahrlich, dieser steht mir an!
Wenn es sich doch balde fügte,
Dass ich endlich vor Coffee,
Eh ich noch zu Bette geh,
Einen wackern Liebsten kriegte!«,
sprühte beißende Häme aus ihren Augen! Obwohl das Publikum tobte, die Studenten pfiffen, und gleich zweie ihre Mütze nach mir warfen, schämte ich mich in Grund und Boden.
Und als wäre alles nicht schon schlimm genug, stand mitten in unserem Schlussterzett auf einmal Herr Henrici wutschnaubend auf, ballte die Faust in Richtung meines Vaters und bahnte sich eine Schneise zum Ausgang. Bernhard, Scheibe und ich wären fast aus dem Takt geflogen, als die schwere Flügeltür des Kaffeehauses mit einem gewaltigen Rumms zuknallte. Jene Frau aber verfolgte das alles genau und machte sich im seitwärts getuschelten Gespräch bereits einen Reim darauf. Jetzt erst erkannte ich Professor Gottsched. Wie hatte ich so blind sein können? Sie musste die Danzigerin sein, die er gerade geheiratet hatte! Ihr war schon ein Ruf vorausgeeilt, hatte sie doch bei Breitkopf bereits zwei Bücher veröffentlicht. Die Damenwelt Leipzigs war daher hoch gespannt, was für ein Wundertier sich der Herr Professor da aus der Ostsee geangelt hatte. Sehr vertraut, ja verliebt steckten sie hinter ihrem Fächer die Köpfe zusammen.
Am Ende klatschten sie zu meiner großen Verwunderung begeistert, erhoben sich sogar, sodass sich mein Vater dankend in ihre Richtung verbeugen musste. Eigentlich sah sein grünblauer schlichter Rock kaum besser aus als der alte, den Scheibe trug. Warum ließ er sich nicht endlich einmal einen besseren schneidern? Sein Hemd war nur plissiert, kein Kragen, kein Spitzentüchlein, nichts durfte seinen Hals einengen. Und die Perücke erst, die seinen Kopf wie eine Frauenhaube umgab und ihn behäbiger aussehen ließ, als er war. Schlecht gepudert war sie außerdem. Ich weiß noch, ich nahm mir vor, Elisabeth gehörig auszuschelten.
Ein Blick zu Anna Magdalena beruhigte mich. Sie war sitzen geblieben, schließlich gehörte sie als Frau des Kapellmeisters mit zur Truppe, und es wäre ungehörig gewesen, wenn sie mehr wie nur höflich applaudiert hätte. (Hach, als höflich, natürlich. Luise! Dass mir das immer noch passiert!) Jetzt lächelte sie mir zu. Wie oft schon hatte sie mir im Unterricht gesagt: Du musst singen, als gelte es dein Leben! Heute hatte ich sie zum ersten Mal verstanden.
Da hakte mich mein Vater unter und ging von der Bühne ausgerechnet zu der Unbekannten.
»Herr Kapellmeister, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen.« Professor Gottsched strahlte über das ganze Gesicht. »Mme Gottschedin, jüngst gewesene Jungfer Luise Kulmus aus Danzig.«
Sie war so groß wie ich, gut geschnürt, das Dekolleté recht geizig ausgeschnitten. War sie etwas jünger als ich?
»Madame werden hoffentlich unser Leipzig als angenehmes Asyl empfinden«, sagte mein Vater in seinem verbindlichsten Ton. »Liegen wir auch nicht am Meer, so haben wir hier doch weitläufigen Verkehr mit der Welt und möchten nicht weniger genau wissen, was in ihr geschieht, als in Ihrer Heimat.«
Mme Gottschedin blinzelte, wie vorhin. ›Lieschen wir ooch nischt am Määr‹, hatte er gesagt. Sie überlegt bestimmt, wo der herkommt, dachte ich. »Ja, in Danzig ist man ebenfalls gut unterrichtet, was in der Welt so geschieht. So kennt, übt und liebt man dort Ihre wundervolle Clavier-Übung, Herr Kapellmeister.«[2]
»Ich habe mir erlaubt, Ihr Opus meiner jungen Freundin zu schicken, als ich noch nur hoffen durfte.« Gottsched deutete scherzhaft einen Diener an. »Sie, mein werter Herr, haben also gewissermaßen für mich geworben.«
Mein Vater dankte. »Und wie sind Madame mit den Stückchen zurechtgekommen?« Er sagte ›Schdüggschen‹. Ich hörte das zum ersten Mal so, es war mir noch nie bewusst geworden. Ich sagte ja auch ›Schdüggschen‹.
»Ich muss ges-tehen, sie sind so schwer wie schön. Wenn ich sie zehnmal ges-pielt habe, komme ich mir immer noch wie eine Anfängerin darin vor.«
Wie? Sie hatte allen Ernstes ›ges-tehen‹ und ›ges-pielt‹ gesagt. Dass sie mit Papas Clavier-Übung nicht zurechtkam, freute mich, wie ich zu meiner Schande zugeben muss. Nur Friedemann, Carl und, schon mit Einschränkung, Anna Magdalena konnten sie so spielen wie er.
»Hatten Sie denn einen guten Lehrmeister?«
»Meine selige Mutter hat mich unterrichtet. Die Laute liegt mir vielleicht mehr.«
Mein Vater hob anerkennend die Augenbrauen.
»Vielleicht, weil die Stunde schon halb um ist, bevor das Ding gestimmt ist?« Gottsched grinste. Ich merkte, dass sie es so unhöflich fand wie ich: Weder er noch mein Vater hatten es für nötig befunden, uns einander vorzustellen.
»Nun ja, die neuartige wohltemperierte S-timmung des Klaviers erleichtert das Lernen schon sehr, nicht wahr? Ich habe das Buch des Herrn Werckmeister aus Halbers-tadt gelesen und –«
Anna Magdalena und Bernhard gesellten sich zu uns.
»Darf ich nun meinerseits vorstellen? Mme Gottschedin, das ist meine Frau, Mme Bachin, mein dritter Sohn Bernhard, und das hier ist meine älteste Tochter, Jungfer Catharina Dorothea.«
Na endlich.
»Ihr Gesang war bezaubernd.« Mme Gottschedin reichte mir die Hand. Ich wusste genau, was in ihrem Kopf vorging. Anna Magdalena konnte unmöglich meine Mutter sein, so jung, wie sie war, und auch vom Äußeren her. Ich sah ja mein ganzes Leben aus wie mein Vater in weiblicher Gestalt. Jetzt im Alter gleiche ich geradezu gespenstisch dem Porträt, das Herr Haußmann von ihm gemalt hat. Leider habe ich auch die Neigung zur Korpulenz von ihm geerbt, während Anna Magdalena von Natur aus hager war und sich kaum schnüren musste.
»Ja, sie schlägt nicht schlimm ein«, hörte ich meinen Vater sagen. Hatte er mich gemeint?
»Und Sie haben ebenfalls exzellent gesungen«, wandte sich Mme Gottschedin an Bernhard. »Kaum haben Sie angefangen, wurde es mucksmäuschens-till.«
»Hat der Dichter sehr gut gemacht, nicht? Wie wenn Herr Henrici die Situation vorhergesehen hätte.«
»Das war aber auch das Einzige«, versetzte unser Vater. »Und wo steckt eigentlich der Scheibe? Will Organist an der Thomaskirche werden und setzt auf der drei statt auf der zwei ein. Wenn der –«
Anna Magdalena warf ihm einen Blick zu und wandte sich an Mme Gottschedin. »Haben Sie sich denn schon gut eingerichtet?«
Komisch. Anna Magdalena sprach fast so, wie man schreibt. Das machte sie doch sonst nicht. Neben ihrem untersetzten Mann wirkte sie überaus schmal, zumal sie größer war als er und einen nur wenig ausladenden Rock trug. Die Gottscheds gaben ein harmonischeres Paar ab, obwohl sie ein ähnlicher Altersabstand zu trennen schien. Der Professor war ein unglaublich großer und stattlicher Mensch. Ist er immer noch, obwohl er mittlerweile gebeugt geht. Er musste als junger Mann vor den Häschern fliehen, die Lange Kerls für den Soldatenkönig einfangen wollten. Er kam ein Jahr nach uns nach Leipzig und – aber von ihm wollte ich doch gar nicht erzählen.
»Möchten Sie uns nicht einmal –«, Mme Gottschedin unterbrach sich. Wahrscheinlich wusste sie nicht, ob es sich schickte, uns einzuladen. »Möchten Sie uns nicht verraten, welche geheimen Zeichen Sie dem Bassisten während der Aufführung gegeben haben?«
Anna Magdalena winkte ab. »Nichts Besonderes. Adolph Scheibe war so nett, die Rolle in nur einem Tag zu lernen, da habe ich ihm sicherheitshalber beigestanden.«
»So sind Sie auch eine Sängerin?«
»Meine Frau singt einen überaus sauberen Sopran! – Aber warum setzen wir uns nicht und lassen uns von Herrn Zimmermann den Durst löschen?« Mein Vater winkte dem Wirt und ließ sich mit einem Ächzen nieder.
Professor Gottsched nahm den Arm seiner Frau. »Dann wohl bekomm's und noch einmal schönen Dank für die gelungene Musik.«
Wir waren halt doch nur eine Musikantenfamilie.
»Vielleicht könnten Sie mir bei Gelegenheit eine S-tunde geben, Mme Bachin«, sagte Mme Gottschedin.
»Aber sicher, kommen Sie einfach mal vorbei. Die linke von den drei Haustüren der Thomasschule.«
Lorenz Mizler trat zu uns. Professor Gottsched stellte ihn seiner Frau vor. »Der junge Mann, der neben dir saß. Studiert bei mir. Wird bald promovieren. Ah, und das ist Christian Gottlieb Ludwig, der eigenhändig Löwen in Afrika gefangen hat. Und das hier ist« – den Namen verstand ich nicht, zu sehr überraschte mich der Blick, den er mir im Gehen zuwarf – »mein Alter Ego.«
Auf gut Deutsch
Nachdem Christian Friedrich Henrici das Portal des Zimmermannischen Kaffeehauses hinter sich zugeschlagen hatte, schickte er meinem Vater einen Zettel: Ihre Zusammenarbeit sei für immer beendet. Ich war darüber nicht unglücklich. Sein Pseudonym sagte ja alles. Mit einem schmierigen Kompliment hatte mir ›Picander‹ mal sein Buch Die Kunst zu küssen überreicht.[1]
Lasst den Mund, der küssen will, auf den Lippen grade liegen,
Dass kein Tischler Brett und Brett könnte mehr zusammen fügen.
Manche schließen sich in Armen oder sitzen in dem Schoß.
Da vergisst man Sehn und Hören, denn die Lust ist gar zu groß.
Tut es nicht vor allen Leuten, weil man gar gewöhnlich schließt,
Dass ihr es noch ärger machet, wenn sonst niemand bei euch ist.
Seine geistlichen Vorgesetzten im Konsistorium hatten meinem Vater schon öfters nahegelegt, sich einen anderen Librettisten zu suchen, aber das war nicht so einfach. Leipzig beherbergte Drucker und Verleger genug, aber keine Dichter von Rang.
»Und was, wenn du es mal wieder mit der Zieglerin versuchst?« Anna Magdalena erinnerte ihn an deren geistliche Kantaten, die er vor etlichen Jahren vertont hatte. Und so ließ er sich von mir den Rock ausbürsten und die Perücke pudern, um noch am selben Abend den Salon der Frau von Ziegler zu besuchen. Auch Anna Magdalena putzte sich mehr heraus als sonst. Doch als sie den Kindern Gute Nacht sagte, fühlte sich Regina ganz heiß an. Sofort suchte Anna Magdalena die Tücher für die Wadenwickel und zerkleinerte Senfkörner im Mörser. »Dorothea, begleite du deinen Vater, die Zieglerin freut sich genauso über dich. Ich hätte dort keine ruhige Minute, und hier komme ich auch ohne dich aus.« Entschlossen zog sie ihr schönes Fichu aus dem Ausschnitt und reichte es mir. Freudig fuhr ich in meine seidenen Schuhe mit dem Absatz.
Unten auf dem Thomaskirchhof verbreiteten die Straßenlaternen ihr angenehmes Licht. Am Markt bog mein Vater jedoch nicht nach links in Richtung Katharinenstraße ab, sondern ging weiter geradeaus, die hell erleuchtete Grimmaische Straße entlang. »Zuerst schauen wir bei Henrici vorbei.«
Dessen bescheidene Wohnung lag am Eselsplatz, fünf finstere Stiegen hoch. Vor der Tür trafen wir zu unserer Verwunderung den Verleger Breitkopf. »Herr Henrici ist gerade vom Oberpostsekretär zum Oberpostkommissar befördert worden!«
»Glückwunsch!« Aber auch uns bat Henrici nicht herein. Misstrauisch wartete er ab, was wir wollten. Neben dem wuchtigen Breitkopf wirkte er noch kleiner und schmächtiger, als er war.
»Angesichts des weiteren Besuchs will ich mal zur Sache kommen.« Breitkopf räusperte sich. »Henrici, jetzt, wo Ihr alter Verleger gestorben ist, könnten wir doch ins Geschäft kommen. Ich schlage vor, wir nehmen die zweite Auflage des zweiten Bands Ihrer Gedichte zum Anlass, auch den ersten Band in gleicher Ausstattung bei uns drucken zu lassen, sodass Ihr gesamtes Werk künftig einheitlich bei mir erscheint.«[2]
»Und der dritte Band?«
»Der ist doch erst vorletztes Jahr erschienen. Da sind doch noch Bögen vorrätig. Warten wir die nächsten Messen ab, dann reden wir noch einmal. Die Vertonung Ihrer Kaffeekantate durch Herrn Bach, so gelungen sie ist« – Breitkopf nickte meinem Vater zu –, »hat dessen Absatz jetzt noch nicht allzu stark erhöhen können.«
»Er hat ja auch nicht meine Kantate vertont.« Henrici maß meinen Vater mit Blicken. »Herr Bach hat nämlich eigenmächtig einen Schluss dazu erfunden und mein Werk dadurch ganz verhunzt.«
»Ihr Werk – verhunzt?«
In Wahrheit war ich es gewesen, die den Erzähler, der Henrici im Verlauf der Kantate entfallen war, noch einmal auf die Bühne geholt und ein Schlussterzett erfunden hatte, wie es sich gehört.
»Henrici, jetzt groll mir nicht länger. Ich mach dir einen Vorschlag. Schreib mir ein neues Werk, es soll groß werden, weit ausgreifen, das wird das Herzstück des vierten Bands deiner Gedichte, für den Herr Breitkopf wird Papier nachbestellen müssen.«
»Und was soll es werden?« Henrici klang unverhohlen skeptisch.
»Ich will zu Weihnachten ein Oratorium komponieren. In sechs Teilen für die sechs Festtage. Erster, zweiter und dritter Weihnachtsfeiertag, Fest der Beschneidung Christi, Sonntag nach Neujahr und Epiphanias. Ein Werk, das vierzehn Tage dauert, aber Text und Musik so verzahnt, dass man sich am Ende noch gut an den Anfang erinnert.«
»Vergiss es.«
»Nein.«
»Kann nicht gelingen.«
»Doch.«
»Ich sage dir, lass es bleiben. Wer erinnert sich denn heute noch daran, welches Liedlein er vor zwei Wochen gepfiffen hat? Das ist wieder so ein Einfall von dir. Und am Ende änderst du abermals meine Worte. Ohne mich.«
Im Nebenraum zerschellte etwas am Boden. Ein Schrei, ein Klatschen, ein Aufheulen. Henrici wandte sich um, und wir zogen ab. Unten vor dem Haus schloss Breitkopf sich uns an. Wir gingen durch die Ritterstraße.
»Herr Bach, hätten Sie nicht mal Lust, mir ein Werk zu überlassen?«
»Ich?«
»Vielleicht ein reines Instrumentalwerk für kleine Besetzung oder Cembalo solo. Ich würde meinen Verlag gern auch in den Musikalia stärken, und wer wäre dafür besser geeignet als Sie?«
»Mein Freund Telemann in Hamburg, oder der große Händel, unser Landsmann in London.«
»Aber in Leipzig, nein in Sachsen, ach was, wenigstens in ganz Mitteldeutschland regieren nun mal Sie. Und Sie könnten Ihre Herrschaft stark erweitern, wenn man Ihre Sachen auch in Paris spielen könnte oder in Prag.«
»Warum soll ich teuer Geld ausgeben, damit Stümper in der ganzen Welt meine Musik verpfuschen?«
Man glaubt es heute nicht mehr, weil sich die Technik so rasch entwickelt hat, aber damals, vor dem Druck mit beweglichen Notenköpfen, musste man noch die ganze Seite stechen lassen, und das war vielleicht teuer! Kein Verleger kam für diese Kosten auf. Auch Breitkopf bot nur an, den Vertrieb zu übernehmen.
»Wäre es nicht eine Befriedigung für Sie, wenn überall in Deutschland Menschen sich an Ihren Werken erfreuten?«
»Ich kann mir keinen Vorteil davon versprechen. Dann wird meine Musik andernorts schlecht aufgeführt, und ich werde nicht einmal dafür entlohnt. Das wäre ja, wie wenn ein Dieb in meine Komponierstube einbräche und mir meine Noten stähle!«
Im Brühl mussten wir einem Lichtputzer ausweichen, der das Öl in einer der Laternen auffüllte.
»Aber Ihr Renommee würde sich steigern, es kämen vielleicht vorteilhafte Anfragen von auswärts, weitere Schüler würden sich einstellen.«
»Ich habe genügend zu tun. Aber danke der Nachfrage, bester Herr Breitkopf.«
Wir waren am Romanushaus angekommen. Helles Licht fiel aus seinen zahlreichen Fenstern auf den Brühl sowie die Katharinenstraße. Es war und ist immer noch eins der schönsten und prächtigsten Häuser ganz Leipzigs. Sein Erbauer, der Vater der Zieglerin, saß freilich schon seit dreißig Jahren im Gefängnis. Als mein Vater und ich durch das herrschaftliche Portal traten – aber ich merke, ich muss erst etwas zu der Zieglerin schreiben. (Oder, Luise?) Denn Christiane Mariane von Ziegler ist ja heute völlig vergessen. Damals hingegen war sie die berühmteste Frau Deutschlands. Als wir nach Leipzig kamen, ließ sich mein Vater bei ihren Gesellschaften regelmäßig am Cembalo hören. Sie hat ihm in den Anfangsjahren sehr geholfen, sich in der Leipziger guten Gesellschaft zurechtzufinden. Selber spielte sie Traversflöte; dass sich dieses Instrument für Damen nicht schickt, war ihr herzlich egal, und ich mochte sie darum noch mehr. Neben der Musik ritt die Zieglerin ein weiteres Steckenpferd, die Dichtung. Sie hatte schon zwei Bände mit Versen veröffentlicht.[3] Im ersten fand mein Vater die neun Kantaten von Sonntag Jubilate bis Trinitatis, die er schon vertont hatte. Die waren aber das einzig Fromme. Ansonsten suchten und fingen sich Chloris und Cupido, küssten und neckten sich Sylvia und Seladon, scherzten und tändelten Doris und ihr Schäfer. Friedemann, der damals noch bei uns war, meinte, so etwas gehöre sich nicht, und schon gar nicht für eine Dame. Auch mir gefiel ihr Band mit Briefen besser, die, nach dem Vorbild der Französinnen, wie ein aufgeschriebenes Gespräch wirkten. Vor allem aber imponierte mir, dass sie sich in den Vorreden zu ihren Büchern stets für die Bildung von Mädchen einsetzte, die schließlich mit dem gleichen Verstand wie die Knaben geboren würden. Nachdem die Zieglerin auch Professor Gottsched in seinen Anfangsjahren hier in Leipzig protegiert hatte, revanchierte er sich, indem er sie als erste Frau überhaupt in die Deutsche Gesellschaft aufnahm. Alles, was ihre Person betraf, konnte man im ganzen Reich in den Neuen Zeitungen von Gelehrten Sachen nachlesen.
Als mein Vater und ich ihren Salon in der Beletage betraten, waren die Räume schon gut gefüllt. Auf den Sofas erspähte ich keinen freien Platz mehr, zumal nicht alle Damen so höflich gewesen waren, auf ausladende Reifröcke zu verzichten. Ich versuchte ja stets, meine so viel praktischeren Poschen als Ausdruck bewusst gewählter Bescheidenheit zu maskieren. Gott sei Dank hatte mir Anna Magdalena ihr feines Fichu geliehen. Ich sah, wie Mme von Ziegler ihrem Gesprächspartner verbindlich beide Hände drückte, zu uns eilte – und doch haarscharf an uns vorbeizielte. »Das ist ja schön – Mme Gottschedin! Endlich! Herzlich willkommen!«
Verwundert machten mein Vater und ich einen Schritt zur Seite. Die Gottscheds waren gleich nach uns eingetreten.
»Unser Freund hat uns schon so viel von Ihnen erzählt, und so Gutes, ja Staunenswertes, dass wir unsere Neugier kaum zu zügeln wussten.« Mme von Ziegler hielt Luise Gottschedin spielerisch von sich weg und betrachtete sie von oben bis unten.
Da er nicht begrüßt wurde, verneigte sich mein Vater und suchte im Saal Bekannte. Ich blieb verdattert an der Tür stehen und wurde Zeugin des Moments, auf den die ganze Stadt – oder sagen wir, die ganze weibliche Hälfte der Stadt – gewartet hatte: das erste Aufeinandertreffen der beiden hochgelahrten Frauenzimmer. Bis eben war die Zieglerin die unangefochtene Königin im geistigen Leben Leipzigs gewesen. Wie würde sie sich mit der jungen Schriftstellerin aus Danzig vertragen? Doch damit nicht genug. Die Leipziger Damen erwarteten die erste Begegnung zwischen Mme Zieglerin und Mme Gottschedin auch deshalb so gespannt, weil man munkelte, die lustige Witwe und der unverheiratete Professor hätten sich in jeder Beziehung auf gut Deutsch verstanden.
»Haben Sie sich das mit der Ehe auch gründlich überlegt? Ich bevorzuge ja den Stand als Witwe. Nur als Witwe ist die Frau wirklich frei.« Mme von Ziegler war selber zweimal verheiratet gewesen; ihre Männer waren beide schnell gestorben, und ihre Kinder auch. Sie warf einen Blick auf den Professor und lachte hell auf. »Nun, bei dem Altersunterschied dürfen Sie hoffen, einen Gutteil ihres Lebens im schönsten Stand zu verbringen. Obwohl er ja sehr agil ist, nicht wahr?«
»Wer könnte das besser beurteilen als Sie, Mme von Ziegler? Die Freude ist ganz meinerseits. Unser beider Freund hat auch mir schon viel von Ihnen erzählt. Wie trefflich Ihr poetischer Witz, wie lodernd Ihr Feuer, wie mitreißend Ihr Rhythmus, wie geschickt Ihre Zunge!«
Wie bitte? Hatte ich recht gehört?
Später, viel später erzählte mir Luise, dass sie sich diese Worte zurechtgelegt hatte. Erst jetzt, bei der zweiten Begegnung mit ihr, wurde mir deutlich, wie unweiblich ihr neugieriger Blick war, fast gegen die Sitte. Was sie sah, musste sie beunruhigen. Mme von Ziegler war zwar nicht nur viel älter als sie selbst, sondern älter auch als Gottsched. Bald vierzig, vermutete ich. Da sie ihr eigenes, kunstvoll gelocktes und hochgestecktes Haar weiß puderte, konnte man nicht sicher sein. Ihr Busen, den sie nach Leipziger Art großzügig den Blicken feilbot, wirkte jedoch noch fest, und das Korsett musste ihrer Gestalt nicht allzu grobe Gewalt antun, um ihre Figur schlank erscheinen zu lassen. Die Zieglerin war eine schöne, reife, kluge und selbstbewusste Frau mit einem leicht spöttischen Zug um den Mund.
»Das Kompliment muss ich aber zurückgeben, Teuerste. Den Sieg der Beredsamkeit[4] haben Sie großartig aus dem Französischen übersetzt. Ich freue mich, dass Sie in meine Fußstapfen treten! Und nein, streiten Sie es nicht ab, ich weiß auch genau, wer hinter den Neuen Betrachtungen über das Frauenzimmer steckt.[5] Unser gemeinsamer Freund hat ja zuerst mich um die Übersetzung gebeten. Aber warum haben Sie denn bloß den Untertitel weggelassen? Métaphysique d'amour.« Mme Zieglerin betonte jede Silbe.
»Den Untertitel hat Herr Breitkopf ges-trichen. Vermutlich gefiel ihm die Verbindung von Frauenzimmer und Metaphysik nicht.«
»Ja, unser Gottsched ist anders. Er hat sehr viel für die Bildung von uns Frauen übrig.« Die Zieglerin ließ ihren Blick über die etwas altfränkische Garderobe der Gottschedin gleiten. »Er bemüht sich um uns, wo und wie er nur kann. Eine gut gebildete Frau gilt ihm als das Schönste in der Welt, nicht wahr?«
Mir stockte der Atem.
»Stellen Sie sich vor, beste Zieglerin, dies Kind hier hat schon das gesamte Bayle'sche Wörterbuch[6] gelesen, von vorne bis hinten!«, fiel Professor Gottsched ein. »Und die ganze Prinzessin von Cleve[7] hat sie übersetzt, will mir das Manuskript aber nicht zur Veröffentlichung aushändigen, und warum? Weil es sich um einen Roman handelt und also nur um dumme, erfundene und längst vergangene Liebeshändel!«
Oder verstand ich alles falsch?
»Ich kann auch keine Romane leiden, liebe Mme Gottschedin.« Die Zieglerin zückte ihr Balsam-Büchslein. »Was gehen einen fremde Liebesgeschichten an?« Geschickt streute sie einige Tabakkrümel auf den Handrücken und sog sie genüsslich ein.
Mme Gottschedin hielt ihrem Blick eine Weile stand, bevor sie sich endlich an mich wandte. »Jungfer Bachin! Wie schön, Sie wiederzusehen. – Sie haben letzte Woche im Zimmermannischen Kaffeehaus eine überaus ergötzliche Aufführung verpasst, Mme Zieglerin.«
»Leider war ich an dem Abend unpässlich.« Die Zieglerin reichte mir die Hand. »Aber ich habe von dem großen Erfolg gehört. Einige unserer Musikfreunde hoffen seitdem, Ihr Vater würde uns endlich einmal eine Oper schenken. Gehen wir doch zu ihm, ich habe vorhin versäumt, Sie beide zu begrüßen.« Mme Zieglerin hakte sich bei mir und bei Mme Gottschedin ein. Mein Vater plauderte mit Lorenz Mizler, der mich herzlich anstrahlte. In der Thomasschule trieb er mit dem Rektor Ernesti Hebräisch, mit dem Lehrer Winkler Physik und mit meinem Vater Musik. Die Raucher im Zimmermannischen Kaffeehaus hatten ihn nur ausgelacht.
»Und wo ist meine liebste musikalische Begleiterin, Herr Bach?« Die Zieglerin klang ehrlich enttäuscht.
»Meine Frau lässt sich entschuldigen, Madame. Meine jüngste Tochter ist krank geworden, da hat sie mir meine älteste mitgegeben.«
Diener in Livree boten Kaffee an, aber auch Wein. Ich griff zu einem Schälchen mit einer bräunlichen Flüssigkeit. Zimt und Nelke stiegen mir in die Nase. Ein Schluck – und ich musste vor Wonne kurz die Augen schließen, weshalb ich kaum bemerkte, dass Gottlieb Ludwig zu uns trat. Mme Gottschedin übernahm die Konversation. »Herr Magister, wollten Sie mir nicht noch die Geschichte mit dem Löwen erzählen?«
Was war das nur in meiner Schale?
»Ja, richtig, Madame.« Ludwig wirkte schrotkörnig neben dem zarten Mizler, der Wadenattrappen in den Strümpfen trug. »Also, vor drei Jahren hatte ich die Ehre, der Leipziger Expedition anzugehören, die in Afrika seltene Pflanzen und wilde Tiere für August den Starken einsammeln sollte.«
»Herr Ludwig hat gerade sein Medizinstudium abgeschlossen«, erklärte Gottsched seiner Frau. »Als Botaniker schwärmt er für schöne Blumen.« Zwinkerte er Ludwig zu?
»Und für ihre Heilkräfte. Wir sind nach Marseille gereist und von dort mit dem Schiff nach Algier, Tunis und Tripolis. Eigentlich wollten wir um die ganze Westküste Afrikas segeln, den Senegal-Fluss ins Innere des Kontinents hinauffahren, dann weiter zum Kap der Guten Hoffnung und, wenn möglich, sogar nach China, aber da erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres Kurfürsten. Während sich die anderen schnurstracks nach Hause begaben, habe ich noch allerlei Tiere gejagt und mich mit ihnen nach Hamburg eingeschifft. Drei Monate lang musste ich die zwei Löwen und das Tigertier, eine Hyäne und einen Schakal davon abhalten, meine Antilopen, Strauße, Stachelschweine und Affen aufzufressen.«
»Man fragt sich, wie Noah auf der Arche Frieden hielt.« Mme Gottschedin erntete Schmunzeln. Ich wartete darauf, dass sie etwas mit st oder sp sagte.
»In Hamburg und die ganze Elbe hoch hätte mir der Plebs dann fast die Tiere geraubt. Für Leipzig habe ich übrigens auch allerlei Wunderliches mitgebracht und dem Apotheker Link anvertraut. Wenn Sie wollen, führe ich Sie gerne einmal durch sein Naturalienkabinett. Die Schlangensammlung ist unübertroffen.«
»Geradezu verboten reizvoll, nicht wahr?« Gottsched spitzte die Lippen. »Magister Ludwig ist übrigens auch ein Dichter. Die Neuberin hat schon ein Drama von ihm aufgeführt.[8] Sehnlichst warten wir auf die Fertigstellung der Komödie, die Sie mir von Algier aus versprochen haben, Magister. Stell dir vor, liebste Freundin, darin soll eine Frau in Hosen auftreten!«
Alles machte »Oho!«.
Aber hatte der Professor seine Frau gerade Freundin genannt?
»Ja, die Barbarinnen dort tragen tatsächlich Hosen, sehr lange, sie reichen bis zum Boden! Es wird aber eher ein Trauerspiel.«
»Wie schade, dass Sie in Ihren Käfigen nicht auch eine solche Barbarin mitgebracht haben, Magister Ludwig.«
»Es soll Selim und Zaphira heißen. Und es wird zeigen, dass wir die Sitten der barbarischen Völker nur deshalb verurteilen, weil wir sie gar nicht recht kennen.«
Während die Herren mit Mme Gottschedin redeten, wandte sich die Zieglerin an meinen Vater. »Herr Bach, kommt Sie nicht bald mal wieder ein großer Künstler besuchen? Ich habe Sehnsucht nach guter Musik.«
Wann immer ein durchreisender Musiker meinem Vater seine Aufwartung machte, konnte er auf einen Auftritt bei der Zieglerin und ein gerechtes Honorar hoffen.
»Die Hasses sollen demnächst wieder kommen. Sowie ich Genaueres weiß, gebe ich Ihnen Bescheid. In der Zwischenzeit könnte Ihnen immer mein bester Schüler, Hans Krebs, etwas vorspielen oder auch mein eigener Bernhard. Beide brauchen noch etwas Auftrittspraxis. – Aber, Madame, ich hätte da noch ein eigenes Anliegen. Wir haben doch vor Jahren öfters glücklich zusammengearbeitet. Hätten Sie jetzt nicht vielleicht Lust, mir ein Libretto zu schreiben? Auf das Fest der Geburt unseres Erlösers, sechs Teile vom ersten Weihnachtsfeiertag bis Dreikönig. Ein großes abwechslungsreiches Werk, voll orchestriert, Chöre und so weiter.«
Frau von Ziegler blickte ihn prüfend an. »Aber Herr Bach – das habe ich Ihnen doch schon geschrieben!«
Mein Vater stutzte.
»Im zweiten Band meiner Gedichte habe ich einen ganzen Kantatenjahrgang veröffentlicht, auch für die Feiertage, die Sie jetzt brauchen.«
O weh. Daran hatte ich nicht gedacht. Mein Vater auch nicht. Er hatte damals das Buch gelesen, das die Zieglerin ihm geschenkt hatte, und, weil unbrauchbar, sogleich wieder vergessen. Er fasste sich. »Von der Anlage her soll es etwas anderes werden als sechs Kantaten hintereinander. Mit einem Evangelisten, der die Weihnachtsgeschichte erzählt und zusammenhält.«
»Herr Bach, alles was recht ist. Ich freue mich, wenn Sie vertonen, was ich schon geschrieben habe, aber zu Neuem fühle ich mich nicht in der Lage. Das letzte meiner Gedichte lautet ja Abschied von der Poesie. Wenn ich jetzt wieder dichte, fangen die Leute doch an zu lachen.«
Mit halbem Ohr folgte ich weiterhin der Unterhaltung neben uns. Von einer Italienerin war die Rede, Laura Bassi oder so ähnlich.
»Sie ist das erste Weib überhaupt, das statt einer Haube einen Doktorhut trägt.« Lorenz Mizler schob anerkennend die Unterlippe vor.
»Da wird dir ganz mulmig, nicht wahr? – Herrn Mizlers eigene Verteidigung ist für den 30. November angesetzt«, erläuterte Ludwig der Runde. »Um was soll's gehen?«
»Dass die Musik zur gelehrten Weltweisheit zählt.«[9]
»Herr Mizler will kein Praktikus, sondern ein Theoretikus der Musik werden.« Mein Vater und die Zieglerin hatten ihre Unterredung beendet.
»Die Bassi ist nicht nur promoviert worden«, wusste Mme von Ziegler. »Vor kurzem wurde sie auch zur Professorin ernannt. Sie lehrt in Bologna Physik.«
»Mme Zieglerin hat uns in der Deutschen Gesellschaft gerade die Leviten gelesen.« Lorenz Mizler hob sein Glas. »Mit einem Gedicht auf die Bassi. Oder eher über die Gelehrten in Deutschland, die ihr den verdienten Beifall vorenthalten.«
»Sie scheint sich auf die Seite Newtons zu schlagen, was die Infinitesimalrechnung angeht. Gegen Leibniz.« Mizler, Ludwig, mein Vater und ich sahen die junge Gottschedin erstaunt an.
»Njudn?« Was für ein dummes Ding ich damals noch war!
»Sie meint den Herrn Nefton aus England. Der mit dem Apfel«, flüsterte Mizler mir zu. »Darf ich Ihnen noch ein Schälchen Schokolade bringen?«
»Vermutlich wird diese Doktorin in der ersten Vorlesung sehr viele Zuschauer bekommen, später dann aber kaum noch Zuhörer.«
Was meinte Mme Gottschedin denn damit?
Den halbherzigen Widerspruch der Herren übertönte auf einmal Gottsched, der sich mit lauter Stimme an alle wandte, ein Blatt in der Hand. »Meine Damen, meine Herren! Meine Freude und mein Stolz sind unendlich, Ihnen allen mein liebstes Eheweib vorstellen zu dürfen. Damit Sie sie rasch kennen- und wie ich lieben lernen, möchte ich Ihnen ein Gedicht vortragen, das ich aus Anlass meiner Vermählung als glücklichster Ehemann von allen verfasst habe.« Er räusperte sich.
»Wollen wir nicht eine Runde Jeu des contraires spielen?« Mme von Ziegler wedelte mit einem Heft und Stift. Es war eines ihrer Lieblingsspiele. Man musste auf eine neue Seite immer das genaue Gegenteil dessen schreiben, was auf der Seite davor stand. Weiter nach vorne linsen war verboten. War das Heft voll, wurde vorgelesen. Es war immer schreiend komisch. »Den ersten Satz habe ich schon geschrieben.« Die Zieglerin reichte Lorenz Mizler das Heft.
Doch Professor Gottsched ließ sich nicht beirren. »Wie gesagt, hier mein Gedicht. Hören Sie!
An meine geliebte Ehegattin
Wie glücklich bin ich doch, mein auserwähltes Licht!
Wie süß gewährst du mir die eheliche Pflicht.
Dein anmutsvoller Mund, dein Umgang, Witz und Scherz,
Dein kluges Häuslichsein, dein philosophisch Herz,
Dein ungemeiner Kiel, der Männerwitz besieget,
Hat mich bisher weit mehr als alle Welt vergnüget.«
Der Professor musste kurz schlucken.
»Soll nicht jeder versuchen, aus den Reimworten dieses wunderbaren Gedichts ein neues zu machen?« Das war ein weiteres Spiel, das oft der Zieglerin Gäste amüsierte. »Also, wenn ich's recht behalten habe, auf Licht/Pflicht, Scherz/Herz und besieget/vergnüget. Zeigen Sie Ihren Erfindungsgeist, meine Herren, aber auch meine Damen!«
Gottsched hatte sich gefangen. »Es geht aber noch weiter:
Du hassest Stolz und Pracht und liebst die Reinlichkeit;
Die Kleidung ziert nicht dich, du zierst ein jedes Kleid.
Dich reizt kein töricht Spiel, der Abgott schwacher Sinnen;
Ein Buch und die Musik kann dich weit mehr gewinnen.«
»À propos gewinnen«, unterbrach ihn die Zieglerin. »Wie wär's mit L'Ombre? Die Einsätze aber nicht unter einem Groschen!«
Der Professor nutzte die Pause nach ihrer Frage.
»Gott stärke künftig nur des schwachen Körpers Kraft,
Und schenk ihm ehestens des Geistes Eigenschaft,
Der Männerstärke zeigt: so wird die Nachwelt lesen,
Dass niemand so beglückt, als ich, durch dich, gewesen.«
So glücklich strahlte er in die Runde, dass niemand ihm Beifall versagen konnte. Schließlich gab er seiner Frau einen Handkuss und sah ihr dabei in die Augen.
»Trefflich, trefflich, Meister.« Frau von Ziegler trat zu ihnen. »Aber wie geht denn dieses Gedicht zusammen mit Ihrer Meinung, dass des Dichters Gefühl schon reichlich abgeklungen sein müsse, bevor er erfolgreich zur Feder greift?«
»Wie, Madame?«
»Ich meine, ich hätte das in Ihrer Dichtkunst gelesen. Im Kapitel vom Charakter des Poeten.«[10]
Fest hakte Gottsched den Arm seiner Frau unter. »Es ist richtig, dass ich das geschrieben habe, und ich meine es auch genauso. Ein Dichter, der, überwältigt vom Gefühl, nur von seiner Liebe schwatzen will, sollte besser mit seiner Liebsten schwatzen. Will er aber ein Gedicht über die Liebe machen, muss er insofern abkühlen, als er sich auf die Regeln besinnt, die Wörter im richtigen Versmaß setzt und mit reinen Reimen verbindet, ganz zu schweigen vom guten Geschmack und Ton.«
»So sind Ihre Liebesgedichte also kalte Wissenschaft?« Die Zieglerin suchte Gottscheds Blick.
In diesem Moment stand wie aus dem Nichts mein Bruder Bernhard vor uns, völlig abgehetzt. »Ihr sollt sofort nach Hause kommen und einen Arzt mitbringen.«
In der Thomasschule
Als Mme Gottschedin das erste Mal zu Besuch kam, saßen Hans Krebs und ich am großen Tisch und zogen aus einer Partitur die einzelnen Stimmen für die Musik im nächsten Gottesdienst. Über uns brannte eine Öllampe, denn das spärliche Tageslicht reichte an diesem Novembervormittag nicht aus. Anna Magdalena brütete am Klavichord über den Worten einer Arie, die mein Vater seinem Weihnachtsoratorium einverleiben wollte. Als es schellte, rannte Elisabeth zum Seilzug, mit dem man die Haustür unten entriegeln konnte, und öffnete die Tür zur Treppe. Sie war damals acht.
»Sag: Sie wünschen, bitte?« Anna Magdalena spielte konzentriert weiter.
»Wer bist du?«, hörten wir Elisabeth fragen.
Fritz war auf seinen kurzen Beinchen ebenfalls zur Tür gestapft und hielt sich am Kleid seiner großen Schwester fest. Mme Gottschedin reichte den Kindern eine Tüte Räbchen, noch heiß aus der Zuckerbäckerpfanne. Begeistert führten die beiden sie in unser Zimmer. Anna Magdalena stand vom Klavichord auf und begrüßte sie mit einem angedeuteten Knicks.
»Oh, hier wird gearbeitet!« Neugierig musterte Mme Gottschedin das Rastral, mit dem ich gerade fünf Notenlinien gleichzeitig und exakt parallel auf Blankopapier zog.
»Himmelarsch!«
Leicht befremdet drehte sie sich um. Hinter der Wand hatte jemand zwei falsch singende Knaben zum Schweigen gebracht.
Hans, mit einem Mal blass, machte einen linkischen Diener vor Mme Gottschedin. Anna Magdalena stellte ihn vor. »Johann Ludwig Krebs, ein sehr begabter Schüler meines Mannes. Komponiert auch schon selbst. An der Orgel ist er nicht zu schlagen – außer von seinem Meister.« Sie sprach wieder so komisch rein.
»Und Friedemann.« Hans flüsterte fast. Er war furchtbar schüchtern. Unser Vater hatte Sorge, dass ihm sein ängstliches Gemüt im Weg stehen würde. Musiker müssen schließlich etwas Draufgängerisches haben.
»Ja, vielleicht. Dafür versteht der nichts von der Laute. Hans ist auch ein großer Lautenist.«
»Mein Lieblingsinstrument!«, rief Mme Gottschedin. »Gerne möchte ich Sie bald einmal spielen hören. Ich dilettiere auch ein wenig darauf.«
Spielen. Sie hatte ›schpielen‹ gesagt.
Hans starrte sie mit schreckgeweiteten Augen an.
»Das wird sich einrichten lassen, nicht wahr?« Anna Magdalena musterte ihn verwundert. Hans errötete bis in die Haarwurzeln und musste auf einmal kolossal husten. »Was ist denn mit dir?« Sie prüfte mit dem Handrücken seine Wange. »Leg dich lieber ins Bett. Wir brauchen dich am Sonntag im Tenor. Ich mach nachher weiter, wo du aufgehört hast.«
Hans schien erleichtert und doch unfroh. »Bin beim Bass. Scheibe will's versuchen, braucht aber Zeit zum Üben. Danach muss die Oboe transponiert werden.« Er verbeugte sich tief vor Mme Gottschedin. Von der Wendeltreppe hoch zu seiner Kammer wandte er sich noch einmal verstohlen um. Elisabeth setzte sich auf seinen Stuhl und zog seine Papiere zu sich. Ich nahm ihre Hände und überprüfte, ob sie sich auch das Räbchen-Fett von den Fingern gewischt hatte.
Von irgendwo im Haus drang übendes Gefiedel. Mme Gottschedin nahm Platz und sah Elisabeth zu. »Und du kannst auch schon Noten schreiben?«
»Besser als der Heinrich!«
Unser Gast blickte uns fragend an.
»Das ist mein Ältester. Also von meinen eigenen. Mein ältester Stiefsohn Friedemann, den Hans gerade erwähnt hat, ist Organist an der Sophienkirche in Dresden. Und der zweite, Carl, studiert in Frankfurt an der Oder. Den dritten, Bernhard, haben Sie ja schon kennengelernt.«
Am Cembalo zwei Türen weiter scheiterte jemand immer wieder an derselben Stelle. Mme Gottschedin lauschte aufmerksam. Mir war es lange nicht mehr aufgefallen: Das ganze Haus summte und brummte wie ein Bienenstock.
»Und Sie wollen ebenfalls in die Thomasschule eintreten?« Anna Magdalena lächelte sie an. Mme Gottschedin wollte antworten, da sauste irgendwo ein Rohrstock klatschend nieder und ein Knabe schrie auf.
»Vielleicht überlege ich es mir lieber noch einmal?«
Wir schmunzelten.
»Die Clavier-Übung meines Mannes war Ihnen zu schwer, sagten Sie neulich. Was spielen Sie denn auf der Laute?«
»Ehrlich gesagt phantasiere ich meist so vor mich hin.«
»Und singen möchten Sie auch lernen? Sie müssen doch schon gesungen haben.«
»Ja, aber die Höhe macht mir Mühe. Und ich merke selbst, dass ich den Takt nicht halte, weil mir der Atem nicht reicht.«
»Das ist nur eine Frage von Übung, Einteilung und Phrasierung. Oder bleibt Ihnen die Luft weg, weil Sie Mutter werden?«
Anna Magdalena! War das nicht ein bisschen zu neugierig?
»Nein, noch kein Anzeichen, und ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll.«
»Lachen Sie, das Weinen kommt von allein.«
»Mein herzliches Beileid übrigens, Mme Bachin, zu Ihrem Verlust. Ich hatte zwei jüngere Schwestern, die sind auch früh gestorben. Ich vermisse sie jeden Tag.«
Regina war erst vier und ein besonders liebreizendes Mädchen gewesen. Sie hatte die Liebe ihrer Mutter zu Blumen geerbt und im zurückliegenden Sommer die Töpfe auf der Fensterbank zusammen mit ihr gepflegt. Anna Magdalena schluchzte sich jeden Abend schier das Herz aus dem Leib. Im Frühjahr war Johann August Abraham auf die Welt gekommen und gleich wieder gestorben. Ich hab's mal nachgezählt. Als Luise nach Leipzig kam, hatte Anna Magdalena schon zehn Kinder geboren, sieben aber auch schon wieder verloren.
»Wussten Sie, dass selbst Martin Luther und Katharina von Bora an Gott zweifelten, als ihnen ein Kind geraubt wurde? Mein Mann hat mir die Stelle in einem Buch gezeigt.«
Mme Gottschedin schien nach Worten zu suchen und betrachtete die Nelken auf der Fensterbank.
Anna Magdalena folgte ihrem Blick. »Unser Glaube sagt, die unschuldigen Kinder sind entschlafen im Herrn und haben es besser als wir hier in diesem Jammertal, nicht wahr?«
»Ja, gewiss. Aber –« Mme Gottschedin verstummte.
»Aber?«, fragte ich.
»Vielleicht müssen wir uns damit nicht zufriedengeben. Mit dem Jammertal hienieden.«
Ich wollte wissen, was sie damit meinte.
»Mein seliger Vater war Arzt, wie mein Onkel auch. Beide sagten mir oft, wir müssten die Natur ganz anders s-tudieren, damit sie ihre Geheimnisse preisgibt. Müssten neue Fragen s-tellen, um neue Antworten zu finden, müssten das Lernen neu lernen, ja, recht eigentlich das Denken neu denken. Die Wissenschaften –«
»– spenden keinen Trost.« Anna Magdalena starrte trübe vor sich hin.
»Sagen Sie, vorhin, als ich gekommen bin, haben Sie so schön Klavier gespielt. Wo haben Sie das denn gelernt? In der Thomasschule doch nicht?«
»Nein, zu Hause natürlich. Mein Vater war Hoftrompeter, erst in Zeitz, dann in Weißenfels. An solchen Höfen gibt es immer Damen, die sich beim Rummelpiket etwas vorspielen lassen wollen, und da kann es aus Schicklichkeit von Vorteil sein, wenn kein Mannsbild bestellt werden muss, sondern eine Jungfer bei der Hand ist. Von daher hatte ich in meiner Jugend Unterricht nicht nur im Gesang, sondern auch am Klavier.«
»Und du warst die Jüngste.«
Anna Magdalena sah mich erst fragend an, dann nickte sie. »Stimmt schon. Ich bin die Jüngste von fünfen, und viele der weiblichen Arbeiten blieben an meinen drei älteren Schwestern hängen.«
Ich dagegen hatte nie ein Stück am Klavichord bis zur Fertigkeit üben dürfen, sondern war immer als Erste in die Waschküche gerufen worden, und zwar von meiner leiblichen wie von meiner Stiefmutter. »Eigentlich bist du die einzige Meisterschülerin, die Papa je hatte.«
»Also so weit würde ich nicht gehen, Dorothea.«
Ich schon. Gerade weil sie bereits gut Klavier spielte, bevor sie sich kennenlernten, konnte er ihr in den Anfangsjahren ihrer Ehe noch so viel beibringen. In ihr erstes Clavier-Büchlein[1] hat er einige seiner Französischen Suiten[2] eingetragen, mit denen ich nie zurechtkommen werde; sie dagegen hat bis kurz vor ihrem Tod noch ihre Finger damit gelenkig gehalten.
»Was war das denn, was Sie da vorhin gespielt haben?«
»Mein Mann will doch ein Oratorium für künftige Weihnachten schaffen. Dafür braucht er ein Wiegenlied, Maria an der Krippe. Ich singe es Ihnen mal vor.«
Anna Magdalena setzte sich wieder ans Klavichord. Bevor sie zu spielen anfing, gähnte sie jedoch erst willentlich und ließ ihre Stimme aus dem höchsten Kopf- bis ins tiefste Brustregister sausen. Unbekümmert schmierte sie im Anschluss Quinten von verschiedenen Tonhöhen aus auf brrr. Mme Gottschedin konnte ihre Verwunderung nicht verbergen, aber Anna Magdalena nahm keine Notiz davon. Schließlich legte sie die Hände auf die Tasten für ein Vorspiel, aus dessen Melodie sie die Gesangslinie übernahm.
»Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh.«[3]
Elisabeth ließ das Rastral sinken und ich die Feder. Anna Magdalenas Sopran war dunkel timbriert, im Gegensatz zu meiner jugendlich leichten Stimme. Die langen Haltetöne ließ sie sanft kommen, aufblühen und mit zartem Vibrato enden. Mme Gottschedin lauschte bass erstaunt. Wieder glaubte ich zu bemerken, was sie wahrnahm. Anna Magdalena wiegte die kleine Regina in den ewigen Schlaf. Ich hörte es ja auch und musste mir mit dem Ärmel die Augenwinkel trocknen. Dann kam ein Zwischenstück.
»Labe die Brust,
empfinde die Lust
wo wir unser Herz erfreuen.«
Mme Gottschedin blinzelte. Auf die Silbe freu- bewegte sich die Melodie in schmeichelnden Girlanden modulierend abwärts. Bei der Wiederholung zierte Anna Magdalena den ersten Teil mit Vorschlägen, Prallern und Trillern aus, wie nebensächlich, aber voll blendender Brillanz. Musikalischer Schmuck für die Gottesmutter. So würde ich nie singen können.
»Mein Gott, war das schön!«
»Ach, das war doch gar nichts.«
»Ich habe noch nie so schönen Gesang gehört. Sie sagten, Sie haben in Weißenfels auch singen gelernt?«
»Bei der großen Pauline Kellerin persönlich.«
Ja richtig. Die hatte ihr auch die feine meißenische Diktion beigebracht, in der sie auf einmal auch redete.
»Und lassen Sie sich auch öffentlich hören?«
»Die Zeiten sind lang vorbei. Als junge Frau, ja.«
»Erzähl, dass du bei Gastspielen das Doppelte von dem verdient hast, was dein Vater erhalten hat.«
»Ach Doro.«
Elisabeth staunte ihre Mutter an.
»Meine beste Zeit war vor und kurz nach meiner Hochzeit. Mein Mann hat mich irgendwo gehört, nach Köthen eingeladen, wo er selber Hofkapellmeister war, und sein Fürst, der musikalische Leopold, hat mich engagiert. Eigentlich wollten mich meine Eltern nicht unverheiratet an einen fremden Hof ziehen lassen. Aber täglich mit dem damals schon bekannten Johann Sebastian Bach zu musizieren, das konnten sie mir nicht missgönnen.«
Auch das sagenhafte Gehalt konnte man unmöglich ablehnen. Ich biss mir auf die Zunge. Anna Magdalenas bester Zeit ging ein Alptraum für uns Kinder voraus. Während unser Vater für den musikalischen Leopold in Karlsbad renommierte, fühlte sich unsere Mutter erst nicht gut, legte sich ins Bett, und zwei Tage später war sie tot. Ich war damals elf, Friedemann neun, Carl sechs und Bernhard fünf Jahre alt. Heute glaube ich, dass ein Kind in ihrem Leib gestorben und nicht abgegangen ist. Unser Vater erfuhr erst auf der Türschwelle bei seiner Rückkehr von ihrem Tod. Ach Gott, ich mag gar nicht daran denken, es schnürt mir noch heute die Kehle zu. – Wir Kinder hofften danach, er würde einfach Tante Friedelena heiraten. Sie lebte seit meiner Geburt bei uns, also schon immer, half ihrer Schwester im Haushalt und war uns Kindern eine zweite Mutter. Aber auf einmal war da diese strahlende junge Sopranistin. Unser Vater hat zweimal aus Liebe geheiratet, und Tante Friedelena konnte er wohl nicht als Frau lieben. Und so kam Anna Magdalena zu uns. Sie erzählte mir später, dass ihr Tante Friedelena das Ja-Wort bedeutend erleichtert hat. Ohne ihre Unterstützung hätte sie doch zögern müssen, als Zwanzigjährige die Verantwortung für vier Stiefkinder zu übernehmen. Tante Friedelena blieb denn auch weiter bei uns, sie starb 1729 hier in Leipzig, die Gute. Von ihr habe ich kochen gelernt. Aber ich schweife ab.
»Sind Sie denn nach Ihrer Eheschließung gar nicht mehr aufgetreten?«, fragte Mme Gottschedin.
»Doch, in der ersten Zeit schon. Aber wir sind dann ja bald hierhergezogen. Fürst Leopold heiratete eine Amusa, wie mein Mann sagte, und wir mussten sehen, wo wir bleiben. So kamen wir nach Leipzig. Anfangs haben wir noch auswärts Gastspiele gegeben, aber hier nie. Die Frau des Thomaskantors, das schickt sich nicht. Und außerdem war ich ja immer schwanger.«
»Jetzt auch?«
»Gerade nicht.«
Hätte mich auch überrascht. Ich sah ihr das mittlerweile an, manchmal bevor sie es selbst wusste. Ich habe ihr bei jeder Entbindung beigestanden. Ich war fünfzehn, als sie ihr erstes Kind bekam, Christiana Sophia Henrietta. Starb mit drei. Ich habe nie Mama zu Anna Magdalena gesagt, sie hat es auch nie verlangt. Sie hat für mich gesorgt wie eine große Schwester, wo doch für alle anderen ich die große Schwester war und bin. Dass ich zuweilen mit am Tisch sitzen und lernen durfte, wenn der Lehrer bei Friedemann und Carl war, habe ich allein ihr zu verdanken. Auch im Gesang hat nur sie mich unterrichtet. Mein Vater dachte ja, Mädchen können's oder können's halt nicht, da müsse man sich nicht drum kümmern.
Anna Magdalena forderte Mme Gottschedin auf, die gerade vorgetragene Arie mit ihr zu wiederholen. Sie schlug sich nicht schlecht, sang so sauber, wie geübte Instrumentalisten eben singen, aber dünn, ohne Körper, ohne Gefühl für ihr eigenes Instrument. In den Höhen hatte sie Mühe.
»Kann man dran arbeiten.« War Anna Magdalena nicht ein bisschen streng?
»Wohl eher ein Alt. Die Lieblingstonlage meines Vaters. Er sagt, der Wert einer Komposition entscheidet sich in den Mittelstimmen. Spielt er mit den Streichern im Stegreif, nimmt er immer die Bratsche, damit der Satz dicht klingt.«
»Der Wert einer Komposition –«, griff Mme Gottschedin meinen Faden auf. »Das S-tück, das Schtück meine ich, das Sie da gesungen haben, also die Musik, ist überaus ergreifend. Die Worte jedoch – darf ich das so offen sagen? – sind doch recht hanebüchen. Vielleicht könnte man hier und da noch etwas ändern?«
Anna Magdalena schluckte. Es waren ja ihre Worte. Den ganzen Morgen hatte sie am Bleistift gekaut, um der alten Arie einen neuen Text unterzulegen. Nachdem mein Versuch als Librettistin im Zerwürfnis mit Henrici geendet hatte, volontierte jetzt Anna Magdalena. Mme Gottschedin fand, sie drücke einen einfachen Gedanken viel zu umständlich aus. »Eigentlich sagt die Mutter doch nur zu ihrem Kind: ›Schlaf jetzt, denn später musst du auf alle aufpassen‹.«
»Ja, aber so geht das halt nicht, das gibt die Silbenverteilung nicht her.«
»Genieße der Ruh mag ja noch angehen, obwohl Genieße die Ruh doch richtiger wäre, oder? Aber warum heißt es denn Wache nach diesem vor aller Gedeihen? Es müsste doch Wache nach dieser lauten, also nach dieser Ruh. Mein ehelicher Freund hält übrigens ›vor‹ für falsch, man müsse ›für‹ sagen. Für das Gedeihen aller oder von allen.«
Ehelicher Freund? Meinte sie Professor Gottsched?
Anna Magdalena runzelte die Stirn und zog einen Notenstapel zu sich. »Schauen Sie doch mal, das hier ist die Vorlage, ein Dramma per musica, das mein Mann letztes Jahr mit seinem Collegium Musicum aufgeführt hat, zum Geburtstag unseres Kurprinzen. Wollust und Tugend streiten darin um Herkules.«
»Herkules?«
»Ja, warum nicht?«
»Mit großer Besetzung, war ein triumphaler Erfolg«, warf ich ein. Doch schlagartig wurde mir klar, weshalb sich Mme Gottschedin wunderte. Unser damaliger Kurprinz Friedrich Christian war gehbehindert und ließ sich in einem Sessel auf Rädern herumfahren. Ihm als Herkules zu huldigen – hatten wir die Geschmacklosigkeit damals alle nicht bemerkt? Oder hatten es mein Vater und Henrici sogar darauf angelegt?
»Einige Arien will mein Mann jetzt für sein Weihnachtsoratorium wiederverwenden. Das hier ist die Vorlage für das Wiegenlied, das wir gerade gesungen haben. Es gilt, einen neuen Inhalt zu erfinden, aber Metrum und Versschema nachzubilden. Reimen muss es sich auch, und die Betonung der Wörter muss natürlich bleiben, so wie man sie spricht. Und alles zusammen hat den Ausdruck der Musik zu treffen. Es muss so wirken, als seien gerade diese Worte vertont worden, verstehen Sie?«
Mme Gottschedin überflog Musik und Text. »Die Wollust singt
Schlafe, mein Lieber, und pflege der Ruh,
Folge der Lockung entbrannter Gedanken.
Schmecke die Lust
Der lüsternen Brust
Und erkenne keine Schranken.[4]
Das hat doch Herr Henrici geschrieben, oder?«
»Ja, wie immer.«
»Schmecke die Lust der lüsternen Brust?«
»Und erkenne keine Schranken.«
Meine Stiefmutter und Mme Gottschedin blickten einander an. Dann prusteten sie gleichzeitig los. Ich glaube, befragt, hätten beide den Beginn ihrer Freundschaft auf diesen Moment gelegt. Ich war außen vor. Obwohl ich Luise näher im Alter stand, obwohl sie mir zuerst aufgefallen war, gehörte ich zu den Kindern, denen man Tüten mit Räbchen mitbrachte. Der Stich tat sehr weh, damals.
»Denken wir dasselbe?«
Natürlich. Ich dachte es ja auch. Es lag ja so nahe.
»Mein Mann hat gesagt, Sie hätten schon das ein oder andere geschrieben und sogar veröffentlicht?«
»Wissen Sie was? Es würde mich reizen. Vielleicht könnte ich mich mal an einem Stück versuchen?«
Anna Magdalena zog einen anderen Stapel Noten heran. »Hier, das eilt am meisten, weil es der Anfang werden soll. Stammt ebenfalls von einem hohen Geburtstag letztes Jahr, von unserer Kurfürstin: Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten![5] Mein Mann will daraus den Eingangschor für sein Weihnachtsoratorium gewinnen, die festliche Eröffnung, irgendwie erhaben freudig. Ich sagte ihm, was willst du denn mit Pauken und Trompeten, die erschrecken doch das Jesuskind, aber er sagt nein, eine Fanfare müsse den Herrscher der Welt ankündigen, das Kindlein selber werde erst später geboren. So ungefähr – aber mir ist noch nichts eingefallen. Lassen Sie also ihrer dichterischen Phantasie freien Lauf.«
»Kann ich die Noten denn mitnehmen?«
»Natürlich, aber – ähem, sagen Sie Ihrem Mann besser nichts.«
»Nein? Wieso?« Mme Gottschedin wirkte weniger irritiert als interessiert. »Mein Mann mag Musik.«
»Ja, sicher, aber –« Anna Magdalena warf mir einen hilfesuchenden Blick zu.
»Also – vielleicht hat er Ihnen noch nichts davon erzählt. Er und mein Vater haben es zwar miteinander versucht, als sie beide noch neu in Leipzig waren, aber, nun ja. Zuerst erhielten sie gemeinschaftlich den Auftrag für eine Hochzeitskantate. Ihr Mann schrieb den Text, mein Vater die Musik.«[6]
»War ein großes gesellschaftliches Ereignis«, übernahm Anna Magdalena wieder. »Herr Gottsched war ja noch gar kein Professor damals und konnte stolz sein, sich zeigen zu dürfen. Ich glaube aber, dass, tja –«
»– dass es ihn fuchste, im Schatten meines Vaters zu stehen. Librettisten sind nun mal Wasserträger.«
»Bei ihrer zweiten Zusammenarbeit wollte er nicht mehr nur zuarbeiten, sondern, wie soll ich sagen, selber glänzen. Unsere alte Kurfürstin war gestorben, und die Universität richtete eine akademische Trauerfeier aus. Ihr Mann dichtete eine regelmäßige Ode mit stets gleich vielen Versen pro Strophe in strengem Reimschema und verlangte von meinem Mann, diese Symmetrie Silbe für Silbe in Musik zu setzen.«[7]
Wir verstummten verlegen.
»Verstehe. Das war natürlich Blödsinn. Was in der Dichtung überzeugt, wirkt als Musik noch lange nicht.«
»Eben. Und so zerstückelte mein Mann Herrn Gottscheds Ode und vertonte ein paar Verse als Rezitativ, andere als Arie oder Chorstück. Das missfiel aber Ihrem Mann, der so viel Mühe auf das edle Gleichmaß des Textes verwendet hatte.«
»Ich weiß noch, besonders störte er sich an den Wiederholungen einzelner Wörter, wie es doch in einer Komposition ganz üblich ist.« Mit tief verstellter Stimme ahmte ich Gottsched nach. »›Der Zuhörer versteht doch den Sinn des Satzes gar nicht mehr! Der Sänger muss ja halbe Stunden verweilen bei Wörtern wie Ächzen, Klagen, Heulen oder Zittern.‹« Wie er damals schlug ich mit der Faust auf den Tisch. »Er polterte mit großem Tremolo, und da er, mit Verlaub, nicht singen kann, klang das, äh, äh –« Gott, was war bloß in mich gefahren? Und wie sah mich Mme Gottschedin denn nur an?
»– nicht schön. Ich verstehe. Meine Damen, Sie schließen mir eine Stelle in seiner Critischen Dichtkunst auf, über die ich mich schon mit meiner seligen Mutter gewundert habe, im Kapitel über Kantaten, die nur sparsam vertont werden sollten. Je mehr die Musik gewinne, desto mehr verliere die Poesie. Bekomme das Ohr viel zu hören, habe der Verstand desto weniger zu denken. So etwas kann nur ein grundunmusikalischer Mensch schreiben. Wären wir damals schon verheiratet gewesen, nie hätte ich ihm erlaubt, diesen Unfug zu veröffentlichen.« Mme Gottschedin lachte lauter als Anna Magdalena und ich.
»Sein Werk ist gewiss sehr bedeutend und verdienstvoll. Und unsere Männer haben sich ja auch wieder vertragen. Wir sehen uns regelmäßig bei der Zieglerin.«
»Es hat meinen Vater übrigens wirklich gefreut, dass der Professor Ihnen seine Clavier-Übung geschickt hat.«
»Aber wegen damals wird er ihn nie wieder um einen Text bitten. Und unsere Idee vorhin war vielleicht –«
Mme Gottschedin deutete mit dem Kinn auf den Notenstapel. »Darf ich es trotzdem versuchen?«
Empörung
Caroline und Susanna haben mich gestern Abend gefragt, was ich denn schreibe. Erst habe ich sie abgewimmelt. Ich weiß ja selber nicht recht, was ich hier tue. Ich habe mich halt so über die Biographie Luises geärgert, die der Professor veröffentlicht hat.[1]