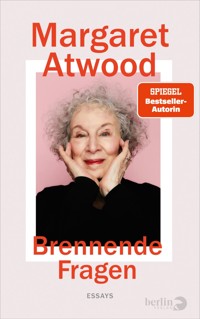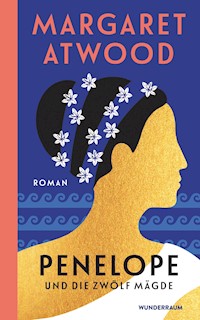Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Als der Journalist Caspar Shaller Margaret Atwood im Herbst 2018 in Toronto trifft, ist er erstaunt, wie klein »die kanadische Königin der Literatur« (Freundin) ist und wie groß ihre Sonnen- brille. Im Café sprechen sie zwei Tage lang über Atwoods Gedichte und Romane, über Totalitarismus und Religion, über die Post- Truth-Ära, die verschiedenen Facetten von Feminismus, die #MeToo-Debatte und über Beyoncé. Trumps Amerika kennt Atwood so gut wie Kanadas Wälder, wosie ihre Kindheit fernab städtischer Zivilisation verbracht hat. Die unfreiwillige Prophetin der ökologischen Katastrophe und des wiedererstarkenden Faschismus erzählt auch davon, wie die rot-weißen Roben der Figuren aus ihrem dystopischen Roman »Der Report der Magd« zu einem Meme der Anti-Trump-Bewegung wurden und wie sie selbst sich heute politisch engagiert. Hellwach, kämpferisch und mit tiefer Menschenkenntnis analysiert Atwood das Zeitgeschehen und beweist, dass sie auch mit achtzig Jahren nichts an intellektueller Brillanz, politischem Gespür und Gerechtigkeitsstreben eingebüßt hat - ebenso wenig wie an Humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margaret Atwood
Aus dem Wald hinausfinden
Ein Gespräch mit Caspar Shaller
Kampa
Vorwort
Es ist nicht ganz einfach, mit Margaret Atwood in Kontakt zu treten. Will man die kanadische Schriftstellerin per E-Mail erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine automatische E-Mail oder eine biologische Assistentin antwortet, »Margaret« sei gerade in unwegsamem Gelände unterwegs. Auf hoher See, im borealen Urwald oder auf der kubanischen Zuckerrohrplantage habe sie leider nur unregelmäßig Zugang zu einem Telefon oder gar zum Internet. Vielleicht, denkt man dann, versucht man es mit einer Kristallkugel, Margaret Atwood ist schließlich berühmt für ihr Interesse an EsoterikEsoterik und kultiviert mit großem Genuss ihr Image als Orakel und HexeHexe. Muss man dazu eine Nummer eingeben? Haben Kristallkugeln Wählscheiben?
Mit solchen Fragen fühlt man sich gleich ganz nah an diesem Überwesen der kanadischen Literatur, das sich so gerne den ganz großen Problemen widmet: der KlimakatastropheKlimawandel/Klimakatastrophe, dem technologischen WandelWandel, technologischerWandel, technologischer, dem Ende der Welt, dem Menschsein. Doch dabei lässt sie mit sanftem Lächeln und spitzen, pragmatischen Fragen die Luft aus diesen aufgeblasenen Themen. Schließlich steht Margaret Atwood trotz HexenimageHexe mit beiden Beinen auf dem Boden der Naturwissenschaften und der angelsächsischen Tradition der analytischen PhilosophiePhilosophie.
Wie funktioniert eine neue TechnologieTechnologieTechnologie genau? Was verändert sich dadurch wirklich? Wie verhalten sich Menschen in einer politischen Extremsituation? Diese Fragen begleiteten unser Gespräch, als ich Margaret Atwood 2017 zum ersten Mal begegnete. Vom Jetlag gezeichnet irrte ich durch die Straßen von Brooklyn, vorbei an meterhoch aufgetürmtem Schnee, auf der Suche nach ihrem New Yorker Lieblingscafé, wo ich sie für das Feuilleton der Zeit interviewen sollte. Zu meinem Glück war es im Café bereits zu einem Stau von Journalisten gekommen, sodass meine leichte Verspätung nicht bemerkt wurde. Die Journalisten waren alle erstaunlich jung, denn obwohl Atwood bereits 1969 ihren ersten Roman Die essbareFrauAtwood, Margaret<i>Die essbare Frau</i> veröffentlichte, hat sie sich in den vergangenen Jahren vor allem unter jüngeren Lesern einen Ruf als unfreiwillige Prophetin der aufziehenden ökologischen Katastrophe und der wiedererstarkten Rechten gemacht. Ihr Interesse an technologischem WandelWandel, technologischer und ihre Verwurzelung in den Werten des FeminismusFeminismus und Humanismus machen sie zu einer literarischen Heldin vieler Millennials, die auch durch die Fernsehserie The Handmaid’sTale<i>The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd (Fernsehserie)</i>, die auf Margaret Atwoods Roman Der Report derMagdAtwood, Margaret<i>Der Report der Magd</i> von 1985 basiert, auf sie aufmerksam geworden sind. Ihre neue Rolle schien ihr zu gefallen, in einem Hipster-Laden in Brooklyn Audienz haltend vor einer Horde Mittzwanziger, die ihren langen, ausufernden Antworten gespannt folgten, bei denen sie schon mal gerne die vergangenen hundertfünfzig Jahre politischer oder literarischer Geschichte Revue passieren lässt.
Eine Privataudienz, um das Gespräch zu führen, das Sie in diesem Band lesen können, erhalte ich ein Jahr später, im Herbst 2018, in einem seelenlosen, aber sehr lauten Café in der Nähe der University of Toronto. Als ich vor dem Café warte, erscheint in der Ferne zwischen den Hochhäusern Torontos, die mitten in die kanadische Tundra gestellt sind, um ein Stadtzentrum zu simulieren, eine erstaunlich kleine Frau, die tapfer gegen den Wind ankämpft. Ihre gigantische Sonnenbrille, die fast ihr ganzes Gesicht verdeckt, lässt sie wie ein hochintelligentes Insekt von einem anderen Planeten erscheinen – passend für eine Schriftstellerin, die gerne in ihrem berühmten staubtrockenen Tonfall scherzt, sie stamme eigentlich vom Mars. Im Café angekommen, wo wir zwei Tage lang über ihre Gedichte und Romane, ihr Leben im Wald und in der Stadt, Totalitarismus und ReligionReligion sprechen werden, schrumpft dieses Überwesen auf das handlichere Format einer älteren kanadischen Dame zusammen.
In Toronto erweist sie sich wie bereits in New York als sehr eigensinnige Denkerin, die ihre Gesprächspartner als Gegner in einem sportlichen Duell betrachtet. Oder als Tanzpartner – Margaret Atwood hat einst gesagt, Interviews zu geben sei wie Walzer zu tanzen: Ihre Antwort hänge davon ab, wie agil, elegant und intelligent die andere Person sei. Manche tanzten gut, andere behäbig, manche träten ihr versehentlich auf die Füße, andere mit Absicht. Die Interview-Veteranin antwortet manchmal bloß, zu dieser oder jener Frage habe sie doch gerade ein Interview gegeben, eine Rede gehalten, ein Essay verfasst oder gar ein ganzes Buch geschrieben. Wobei »gerade« auch vor fünf Jahren bedeuten kann. Bei ihrem enormen schriftstellerischen Output ist es kein Wunder, dass manchmal Sätze druckfertig aus Margaret Atwoods Mund purzeln. Manchmal ist sie nicht zu bremsen, der Journalist weiß aber, dass sie das schon an anderer Stelle gesagt hat. Die Frage hatte ein anderes Ziel, aber ihr ist das egal. Beim Tanzen führt Margaret Atwood.
Dabei ist es nicht immer einfach, ihr durch alle Ellipsen und assoziativen Sprünge zu folgen. Margaret Atwood liest, wie sie selbst sagt, alles, was ihr in die Finger kommt, nicht nur Romane und Zeitungen, sondern auch wissenschaftliche Studien und Forschungsergebnisse. So springen ihre Sätze von der Erbauungsliteratur des 18. Jahrhunderts zur Genforschung, von aktuellen politischen Debatten zur Architektur von Steinburgen im mittelalterlichen Irland. Dabei ist sie oft erstaunlich prosaisch, sie flucht mehr, als man erwarten würde, wenn man ihre Bücher kennt oder sie vor sich sitzen sieht – kaum hundertsiebzig Zentimeter groß, eingehüllt in einen Cardigan, einen Filzhut auf dem grauen, widerspenstigen Haar, das sie selbst auch schon mit einer Stahlbürste verglichen hat.
Einer Frage ist sie jedoch gezielt ausgewichen. Als ich wissen will, woran sie gerade arbeite, antwortet sie bloß, es werde eine große Sache. Mehr dürfe sie jedoch noch nicht verraten, die PR-Abteilung ihres Verlages habe ihr einen Maulkorb angelegt. Wenige Wochen später wird klar: Margaret Atwood schreibt an einer Fortsetzung von Der Report derMagdAtwood, Margaret<i>Der Report der Magd</i>. DieZeuginnenAtwood, Margaret<i>Die Zeuginnen</i> soll im September 2019 erscheinen. Auch auf die Nachfrage, ob es nicht vielleicht nachträglich noch möglich sei, ihr per E-Mail ein paar Sätze zu dem neuen Buch abzuringen, die in diesen Gesprächsband einfließen sollten, ließ sich der Verlag nicht erweichen. Ihre Assistentin hingegen ließ mich wissen: Margaret sei gerade ohnehin nicht verfügbar – sie habe sich in den Wald zurückgezogen.
Berlin, im Sommer 2019
C.S.
»Bitte nicht stören!«
Seit 1961 haben Sie siebzehn Romane geschrieben, zehn Bände mit Erzählungen, zwanzig Gedichtbände, zehn Sachbücher, sieben Kinderbücher, mehrere Theaterstücke und Libretti und sogar eine Graphic Novel. Wie schafft man einen solchen Output? Haben Sie beim SchreibenSchreiben eine Routine? Halten Sie sich an einen starren Zeitplan wie Thomas MannMann, Thomas?
Ich fände es großartig, mich an eine fixe Routine zu halten, aber das ist Männersache. Es gibt eine Kurzgeschichte von Henry JamesJames, Henry, die diesen Unterschied zeigt: Ein Schriftsteller wohnt in einer charmanten Villa auf dem Land. Er hält sich an eine wundervoll ausgearbeitete Routine, er steht morgens auf, jemand serviert ihm ein schön zubereitetes Frühstück, er geht in sein schönes Arbeitszimmer und schreibt, und jemand bringt ihm ein silbernes Tablett mit etwas Tee, und dann bringt ihm jemand die Post, und er schaut sich das an, und dann hat er ein charmantes Mittagessen mit ein paar ausgewählten geladenen Gästen, wo seine charmante Frau die charmante Gastgeberin spielt. Mein Leben hat nie so ausgesehen. Ihr Leben hat wohl auch nie so ausgesehen. Also diese romantische Vorstellung, dass man sich an eine Routine hält und nicht unterbrochen wird, die habe ich noch nie erlebt. Ich sammle Schilder von Hotels auf denen steht: »Bitte nicht stören!«, »Ich schlafe!«, »!no molestar!«, all diese Dinge, und ich hänge sie an meinen Türknauf. Aber niemand schenkt diesen Schildern die geringste Beachtung. Mein Ehemann, meine Kinder, Freunde von meinen Kindern, Leute, die mit mir arbeiten, sie alle marschieren in mein Arbeitszimmer und unterbrechen mich ständig.
In den Siebzigerjahren haben Sie auf einer Farm in Ontario gelebt. Hatten Sie wenigstens da Ruhe?
Schon gar nicht auf dem Bauernhof! Da waren es auch noch zusätzlich die Nachbarn, die auf eine Tasse Kaffee vorbeikamen. Wir mussten sie reinlassen. Man kann nicht Nein sagen, geh weg, ich schreibe. Das kann man seinen Nachbarn, den Bauern, nicht antun. Denn wenn dein Auto im Winter in einen Graben fährt, ziehen sie dich vielleicht nicht raus!
Von Zeit zu Zeit habe ich was gemietet, um einen ruhigen Ort zum Schreiben zu haben. Ich habe oft gewechselt, manchmal schriebSchreiben ich zu Hause, mal irgendwo in der Stadt. Manchmal habe ich mich in die Ecke eines obskuren Frozen-Yogurt-Cafés zurückgezogen. Niemand trinkt wirklich etwas in einem Frozen-Yogurt-Café. Die Leute kommen nur herein, um ihren Frozen Yogurt zu kaufen und gehen wieder weg. Niemand erwartet, mich dort zu sehen, also sehen sie mich auch nicht.
Es gibt im SchreibenSchreibenund GeschlechtSchreiben also einen Unterschied zwischen Frauen und Männern?
Es gab einmal einen Unterschied, vielleicht ist das heute anders. Vielleicht sind Frauen strenger geworden, vielleicht schreien sie heute die Leute an, die sie unterbrechen. Geht weg! Das ist nicht direkt eine Folge der wirtschaftlichen Situation, die Frauen und Männer dabei unterscheidet. Es geht darum, wer Regeln festlegen darf und erwarten kann, dass andere sie befolgen. Die Regel ist also, dass ich nicht unterbrochen werden will. »Papa ist in seinem Arbeitszimmer und arbeitet, stört ihn nicht.« Niemand sagt, dass Mama in ihrem Arbeitszimmer ist. »Aber ich habe mir in den Finger geschnitten!« »Oh, Schatz, ich gebe dir ein Pflaster.«
Das ist wie die Geschichte mit den Schmerzen. Es gibt dieses Altweibermärchen, dass Männer sich mehr beschweren, wenn sie krank sind oder Schmerzen haben, weil sie eigentlich Weicheier sind. Frauen wollen sich, wenn sie diese Geschichte erzählen, stärker machen und den Männern, die sie unterdrücken, hinter ihren Rücken die Macht absprechen. Dabei beschweren sich Männer nicht mehr, weil sie schmerzempfindlicher sind, sondern weil sie erwarten, dass jemand sich um sie kümmert, wenn sie sich beklagen. Niemand kümmert sich aber um Frauen, wenn sie sich beklagen.
In einem anderen Gesprächsband von Kampa Salon sagt der Philosoph, Schriftsteller und Kulturkritiker George SteinerSteiner, George, wenn man ein Kind habe, sei es weniger wichtig, das Leben auf ästhetische, philosophische oder moralische Weise zu gestalten – so erklärt er, dass es weniger Schriftstellerinnen gibt als Schriftsteller. Es hat mich ziemlich überrascht, so etwas im 21. Jahrhundert zu lesen. Die Journalistin, die das Interview führt, die französische Literaturkritikerin Laure AdlerAdler, Laure, antwortet dann mit einer Liste von drei berühmten Schriftstellerinnen: Hannah ArendtArendt, Hannah, Simone de BeauvoirBeauvoir, Simone de, Simone WeilWeil, Simone. Aber dann sagt sie, dass keine von ihnen Kinder hatte.
Das ist bullshit. Es gibt viele Schriftstellerinnen, die Kinder haben. Was sich im 20. Jahrhundert geändert hat ist, dass Frauen nicht mehr fünfzehn Kinder bekommen. Wenn Sie fünfzehn Kinder haben, ist es viel unwahrscheinlicher, dass Sie ein Buch schreibenSchreibenund Geschlecht, es sei denn, Sie haben viele Bedienstete. Frauen waren meist sehr beschäftigt. Wenn sie tatsächlich beeinflussen konnten, wie viele Kinder sie bekamen, änderte sich alles. Schriftstellerinnen hatten manchmal ein, zwei, drei oder sogar vier Kinder, aber nicht fünfzehn. Virginia WoolfWoolf, Virginia hatte keine Kinder, sodass das berühmte »Zimmer für sich allein« wirklich ihr allein gehörte. Sie musste es nicht mit einem Schild versehen, auf dem stand: »Bitte nicht stören!« Aber wie gesagt, selbst mit so einem Schild kommt dein Kind rein und sagt: »Mama, ich kann die Spaghetti nicht finden! Mama!«
»Wenn Sie fünfzehn Kinder haben, ist es viel unwahrscheinlicher, dass Sie ein Buch schreiben, es sei denn, Sie haben viele Bedienstete.«
Glauben Sie, dass das zu einem Unterschied im Schreibstil führt?
Ich habe keine Ahnung. Der einzige Weg, wie wir rausfinden könnten, ob Frauen und Männer anders schreiben, wäre, die Texte von vielen männlichen und weiblichen Autoren zu analysieren und diese Daten dann auszuwerten. Zu Ihrem Glück haben wir das 1970 an der Uni auch getan. Wir haben uns viele verschiedene Romane angesehen und sind dann zu dem Schluss gekommen: Es gibt keine nennenswerten Unterschiede im Schreibstil von Männern und Frauen.
Der Unterschied zwischen Texten aus verschiedenen literaturgeschichtlichen Epochen war viel größer als der innerhalb einer Epoche zwischen Autorinnen und Autoren. Zum Beispiel findet man im 19. Jahrhundert viele lange, verschachtelte Sätze, unabhängig vom GeschlechtSchreibenund Geschlecht. Ein großer Bruch erfolgt in der englischen Literatur im Verlauf des 17. Jahrhunderts, als Romane aufkommen. Da taucht Jonathan SwiftSwift, Jonathan auf mit seinem klaren Stil. Aber auch in dieser Epoche konnten wir keinen Unterschied finden im Schreiben von Frauen und Männern, was uns ziemlich erstaunt hat. In den frühen Zwanzigerjahren erlebt die englische Literatur noch einmal einen höchst interessanten Bruch: Der Schreibstil wird viel einfacher, direkter, unvermittelter, weniger gedrechselt. Das berühmte Beispiel dafür ist HemingwayHemingway, Ernest, aber dieselbe Veränderung haben wir auch bei Texten gefunden, die von Frauen geschrieben wurden.
Die Variable, die das SchreibenSchreiben anders wirken lässt, ist also nicht das GeschlechtSchreibenund Geschlecht, sondern die Epoche. Wo wir allerdings einen großen Unterschied fanden, ist bei den Themen, über die Schriftsteller oder Schriftstellerinnen schrieben. Es geht nicht darum, wie man über etwas schreibt, sondern worüber man schreibt. Und dieser Unterschied ist im 20. Jahrhundert zuerst größer geworden, bevor er sich wieder etwas angeglichen hat. Denn davor, im 19. Jahrhundert, wo erstmals viele Frauen geschrieben und auch veröffentlicht haben, war SexSchreibenund Sex als Thema in der Literatur ohnehin verboten. Zum Glück für die Schriftstellerinnen.
Warum zum Glück?
Weil Schriftstellerinnen nicht über SexSchreibenund Sex schreiben konnten. Sie konnten den Besuch im Puff nicht beschreiben – denn sie kamen ja nicht rein, sie wussten gar nicht, wie es ist im Puff. Außer sie arbeiteten dort, aber diese Frauen haben nun mal selten Bücher verfasst, sie hatten andere Probleme. Jungen sehen Frauen immer dabei zu, was sie den ganzen Tag so machen. Aber irgendwann gehen diese Jungen los, um Männersachen zu machen, wie Krieg führen oder in den Puff gehen. Dahin konnten ihnen die Frauen, die wahrscheinlich Schriftstellerinnen werden würden, nicht folgen. Frauen durften zum Beispiel nicht an die Kunsthochschule, weil sie da nackte Frauen hätten malen müssen! Das durfte nicht sein, Frauen durften keine nackten Frauen sehen.
Es gab also viele Erfahrungen, die FrauenSchreibenund Geschlecht nicht machen konnten, die sie nicht einmal beobachten konnten. Also observierten sie aus ihrer Warte, was zur Observation zur Verfügung stand. Deswegen schreibt Jane AustenAusten, Jane auch über das Leben von Hauslehrerinnen und nicht über die Schlacht von Waterloo, was für sie eher schwierig gewesen wäre. Damals schrieb aber ohnehin niemand darüber, wie es sich anfühlte in einer Schlacht zu kämpfen und um sein Leben zu fürchten, außer in Tagebüchern, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. Wir haben das Glück, heute einige Tagebücher von Menschen lesen zu können, die die Schlacht von Waterloo überlebt haben. Aber so etwas stand damals nicht in den Zeitungen.
Männer konnten also viel leichter sehen, was im Leben der Frauen vor sich ging. Deshalb gibt es all diese weiblichen Hauptfiguren in Romanen wie Jahrmarkt derEitelkeitenThackeray, William Makepeace<i>Jahrmarkt der Eitelkeiten</i> oder bei TolstoiTolstoi, Lew. Die Autoren waren in der Lage, diese weiblichen Figuren nah an der Lebensrealität zu erschaffen. Eine Autorin wie George EliotEliot, George schuf zwar männliche Figuren, aber nicht in ihrer Gesamtheit, denn wenn sie ins Bordell gingen, oder genauso in den Operationssaal oder in die Kanzlei, verschwanden sie aus ihrem Blick. Frauen konnten über Männer berichten, was sie von ihnen in den Gesprächen im Salon oder am Esstisch mitbekamen, aber da wurde nicht darüber gesprochen, was hinter den Kulissen passierte. Das war für die damalige Literatur natürlich kein Problem, denn Bade- und Hinterzimmer waren in der Literatur sowieso nicht erlaubt. Man hat diese Art von Privatleben schlicht nicht in die Bücher aufgenommen. Bei Thomas HardyHardy, Thomas zum Beispiel sind die sexuellenSchreibenund Sex Ereignisse absolut entscheidend für die Handlung und die Charakterentwicklung – aber sie finden allesamt abseits der Bühne statt. Wir wissen, was da gerade passiert ist, aber Hardy zeigt es uns nicht.
Das erinnert mich an den Roman Pamela oder die belohnteTugendRichardson, Samuel<i>Pamela oder die belohnte Tugend</i> von Samuel RichardsonRichardson, Samuel, den ich im Studium lesen musste. Ein Wälzer der moralischen Erbauungsliteratur aus dem 18. Jahrhundert, in dem die titelgebende Hausangestellte Pamela von ihrem Herrn über Hunderte von Seiten sexuell bedrängt wird. Sie gibt sich nicht her und wird dafür am Schluss von ihrem Herrn mit einem Heiratsantrag belohnt.
PamelaRichardson, Samuel<i>Pamela oder die belohnte Tugend</i> ist der auf unbestimmte Zeit aufgeschobene Orgasmus.
»Meines Wissens bin ich die einzige Person in der Geschichte der Menschheit, die dieses Buch jemals zu Ende gelesen hat – und das hat einen sehr guten Grund.«
Ich weigere mich einfach, das Buch zu lesen, aber eine Freundin, die mit mir studierte, las es tatsächlich. Nach fünfhundert Seiten kam sie endlich zu der Szene mit der Hochzeitsnacht – die einfach abbricht. Sie hat das Buch frustriert an die Wand geworfen.
(Lacht.) »Leser, hier lassen wir das Geschehen hinter einem Schleier verschwinden.« Hinter PamelaRichardson, Samuel<i>Pamela oder die belohnte Tugend</i> steckt eine Geschichte: Samuel RichardsonRichardson, Samuel verfasst diesen Roman über einen ungezogenen Landadeligen. Dann schreibt er ClarissaRichardson, Samuel<i>Clarissa</i>, die Geschichte eines noch schlimmeren englischen Gentlemans. Clarissa wird verführt, bekommt Zwillinge und stirbt. Der Mann ist Hunderte Seiten lang voll der Reue, aber wen juckt’s, Clarissa musste ja schon dran glauben. Das Buch ist viel zu lang. Nachdem ClarissaRichardson, Samuel<i>Clarissa</i> erschienen ist, geht ein englischer Gentleman zu Samuel RichardsonRichardson, Samuel und sagt: »Sie haben dem englischen Gentleman einen wirklich schlechten Ruf eingebracht. Wir sind nicht alle so, not all men! Wir denken, Sie sollten über einen gut erzogenen Gentleman schreiben.« Samuel RichardsonRichardson, Samuel nimmt die Herausforderung an und veröffentlicht 1753Geschichte des Herrn CharlesGrandisonRichardson, Samuel<i>Geschichte des Herrn Charles Grandison</i>.
Meines Wissens bin ich die einzige Person in der Geschichte der Menschheit, die dieses Buch jemals zu Ende gelesen hat – und das hat einen sehr guten Grund. Man fängt an, und denkt: Super, die Erzählerin wird von Straßenräubern entführt, spannend. Leider reitet Charles Grandison vorbei und rettet sie, bringt sie auf sein Landgut, und der Rest des sechshundert Seiten langen Buches besteht aus Berichten, wie Charles Grandison sich anständig benimmt. Man hofft ständig, dass die Erzählerin in den Keller steigt und dort entdeckt, dass Grandison heimlich Geld fälscht, oder Drogen schmuggelt, oder Menschen zerstückelt oder so etwas. Man hofft auf irgendeine Handlung. Aber nein, Grandison ist einfach gut erzogen und stellt ein perfektes Vorbild dafür dar, wie wir alle uns verhalten sollten. Stellen Sie sich vor, wie viel spannender dieses Buch hätte sein können, wären ein paar Menschen ermordet worden!
Mit Toten verhandeln
Tod, Schmerz und KörperlichkeitKörper/Körperlichkeit allgemein sind zentrale Elemente Ihres Werkes. Sie haben einmal geschrieben, Autoren hätten zwei Körper: den eigentlichen Körper des Schriftstellers, das physische Selbst, das sich an den Schreibtisch setzt, und die öffentliche Person. Mit welchem Ihrer Körper habe ich es gerade zu tun?
Es gibt den einen KörperKörper/Körperlichkeit, der mit den Hunden spazieren und Vollkorn-Cornflakes kaufen geht. Und es gibt den anderen KörperKörper/Körperlichkeit, der verzweifelt Hotelschilder an den Türknauf hängt, um endlich in Ruhe schreiben zu können. Gerade sitzen Sie aber noch einer weiteren Persönlichkeit gegenüber, nämlich der, die Interviews gibt.
Wer ist diese öffentliche Margaret Atwood?
Ich weiß nicht, was mein »Image« ist. Ich habe kein Interesse an der »Marke« Atwood. Dieses Vokabular stammt aus der Werbung: »Wir wollen unser Bier auf dem Markt positionieren als das Bier, das man beim Kanufahren trinkt. Also pappen wir ein Bild von einem Kanu auf die Flasche.« Ich bin aber keine Bierflasche, auf die man irgendein Etikett kleben kann. Viele meinen, sie könnten sich vermarkten, als seien sie ein Produkt. Aber das funktioniert nicht, denn wir sind Menschen, keine Bierflaschen, wir passen nicht einfach so in ein Marketingkonzept. Man hat ohnehin viel weniger Kontrolle darüber, wie man auf dem Markt wahrgenommen wird, als man denkt. Man kann darauf pfeifen, oder man kann versuchen, sich in eine Flasche Bier zu verwandeln. Raten Sie mal, was nicht funktionieren wird.
»Wenn man wie eine leere Leinwand scheint, auf der nichts abläuft, wird man zur Projektionsfläche. Natürlich erfährt man den besten Tratsch über einen selbst auch nie.«
Man kann natürlich versuchen, sich einer Vermarktung zu entziehen, aber Sie sind nun mal ziemlich berühmt. In Ihrem englischen Wikipedia-Artikel habe ich einen erstaunlichen Satz gelesen. Dort wird ein kanadisches Magazin zitiert, das Sie in den Siebzigerjahren betitelte als »die Schriftstellerin, über die in Kanada am meisten getratscht wird«. Worüber wurde denn da getratscht?
Das ist interessant. Wahrscheinlich ist es sogar wahr. Aber ich habe keine Ahnung, was über mich getuschelt wurde, ich war ja nicht dabei. Wir lebten zu dieser Zeit auf unserer Farm auf dem Land. Also wurden wahrscheinlich Gerüchte über mich verbreitet, weil ich unsichtbar war. Wenn man wie eine leere Leinwand scheint, auf der nichts abläuft, wird man zur Projektionsfläche. Natürlich erfährt man den besten Tratsch über einen selbst auch nie.