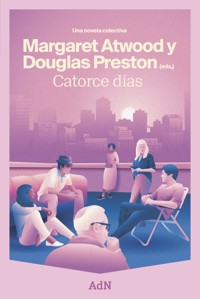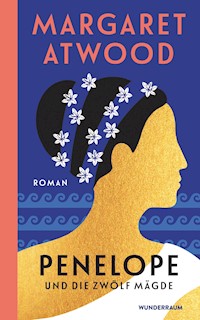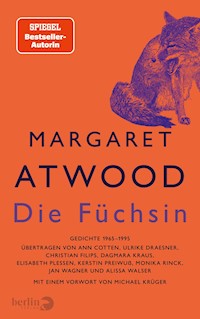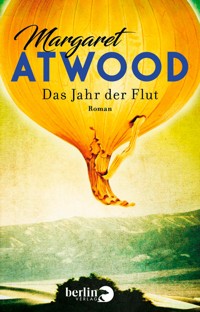4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rache ist zeitlos: Booker-Preisträgerin Margaret Atwoods Verneigung vor dem großen Bühnenmagier William Shakespeare.
Felix ist ein begnadeter Theatermacher, ein Star. Seine Inszenierungen sind herausfordernd, aufregend, legendär. Nun will er Shakespeares »Der Sturm« auf die Bühne bringen. Dies soll ihn noch berühmter machen – und ihm helfen, eine private Tragödie zu vergessen. Doch nach einer eiskalten Intrige seiner engsten Mitarbeiter zieht sich Felix zurück, verliert sich in Erinnerungen und sinnt auf Rache. Die perfekte Gelegenheit kommt zwölf Jahre später, als ein Zufall die Verräter in seine Nähe bringt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Margaret Atwood
Hexensaat
Roman
Aus dem kanadischen Englischvon Brigitte Heinrich
Knaus
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Hag-Seed« bei Hogarth, einem Imprint der Penguin Random House Group, LondonDieser Roman ist Teil der Reihe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.2. Auflage
© der Originalausgabe Margaret Atwood 2016
© der deutschsprachigen Ausgabe 2017 beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: bridgemanimages/Catherine Abel
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-16143-9V005www.knaus-verlag.de
Inhalt
PROLOG: Die Aufführung
IIm dunklen Damals
1. Küste
2. Meine Zauber wirken
3. Usurpator
4. Mantel
5. Armselige Zelle
6. Im Loch der Zeit
7. Verzückt von dunklem Forschen
8. Geh, bring das Volk
9. Seine Augen Meerkristalle
II Sauber, so ein Königreich
10. Von einem guten Stern
11. Dein Volk
12. So gut wie unzugänglich
13. Felix spricht zu den Schauspielern
14. Erste Aufgabe: Kraftausdrücke
15. Du Wunder, du
16. Unsichtbar für jedes Auge sonst
17. Die Insel ist voll Klang
18. Diese Insel ist mein
19. Ein oberlausiges Monster
III Da unsere Mimen
20. Zweite Aufgabe: Gefangene und Gefängnisaufseher
21. Prosperos Geister
22. Die Personen des Stücks
23. Miranda Wunderbar
24. Zum gegenwärtigen Vorgang
25. Böser Bruder Antonio
26. Mechanismen
27. Die du nichts von dem weißt, was du bist
28. Hexensaat
29. Annäherung
IV Grober Zauber
30. Von meiner Kunst vorführn
31. Schicksals Güte, meine Fee
32. Felix spricht zu den Trollen
33. Jetzt ist die Stunde da
34. Sturm
35. Seltsames und Hehres
36. Labyrinthisch
37. Mein Zauber hält
38. Nicht mehr zum Stirnerunzeln
39. Fröhlich, ja fröhlich
V Dies Ding der Finsternis
40. Letzte Aufgabe
41. Team Ariel
42. Team Böser Bruder Antonio
43. Team Miranda
44. Team Gonzalo
45. Team Hexensaat
46. Die Zauber …
47. … sind vorbei
EPILOG Setz Mich Frei
Der Sturm: Das Original
Dank
Richard Bradshaw, 1944 – 2007
Gwendolyn MacEwen, 1941 – 1987
Zauberer
So viel ist gewiss, dass jemand, der Rache brütet,
seine eigenen Wunden frisch erhält, die sonst
heilen und verharschen würden.
Sir Francis Bacon, »Über die Rache«
»… obwohl es auf der Bühne nette Menschen gibt, sind etliche darunter, die einem die Haare zu Berge stehen lassen würden.«
Charles Dickens
Other flowering isles must be
In the sea of Life and Agony:
Other spirits float and flee
Over that gulf …
Percy Bysshe Shelley,»Lines Written Among the Euganean Hills«
PROLOGDie Aufführung
Mittwoch, der 13. März 2013
Die Lichter werden gedimmt. Das Publikum kommt allmählich zur Ruhe.
AUF DEM GROSSEN FLACHBILDSCHIRM:Unregelmäßige gelbe Schrift auf schwarzem Grund
DER STURM
von William Shakespeare
mit der
Theatertruppe der Fletcher-Justizvollzugsanstalt
AUF DEM BILDSCHIRM:Ein handgeschriebenes Schild, das von einem Ansager in einem kurzen purpurfarbenen Samtumhang in die Kamera gehalten wird. In der anderen Hand schwenkt er einen Federkiel.
SCHILD:EIN PLÖTZLICHER STURM
ANSAGER: Gleich werdet ihr’s sehn,Einen Sturm auf See,Die Winde pfeifen, die Matrosen keifen,Den Passagieren geht’s schlimm, und es wirdNoch schlimmer:Geschrei ist zu hören, Albträume stören,Aber nicht alles ist, wie es scheint,Ich sag’s bloß.
Grinst.Jetzt legen wir los.
Er fuchtelt mit dem Federkiel. Schnitt: Auf dem Bildschirm ist jetzt eine Windhose zu sehen, ein Mitschnitt aus den Wetternachrichten. Dazu Donner und Blitze. Archivaufnahme von Meereswellen. Archivaufnahme von Regen. Sturmgeheul.
Die Kamera zoomt auf ein Spielzeugsegelboot, das auf einem blauen, mit Fischen bedruckten Plastikduschvorhang auf und ab geworfen wird; die Wellen werden von unten mit der Hand gemacht.
Nahaufnahme des Bootsmanns in einer schwarzen Strickmütze. Von der Seite kommt ein Schwall Wasser. Er ist klatschnass.
BOOTSMANN: Ranhalten, sputen, oder wir rammen Grund!Bewegung! Bewegung!Hussa! Hussa! Heisassa! Heisassa!Legen wir los,Am besten gleich,Trimmt die Segel,Trotzt den Stürmen,Oder wollt ihr zu den Fischen?
STIMMEN AUS DEM OFF: Wir ersaufen alle!
BOOTSMANN: Aus dem Weg da! S’ist keine Zeit für Spielerei!
Ein Eimer Wasser wird ihm ins Gesicht geschüttet.
STIMMEN AUS DEM OFF: Hört uns aus! Hört uns aus!Wisst ihr nicht, wir sind aus königlichem Haus?
BOOTSMANN: Hussa! Hussa! Die Brecher schert’s nicht!Es bläst, es gießt,Und ihr, ihr steht und starrt!
STIMMEN AUS DEM OFF: Du bist besoffen!
BOOTSMANN: Du bist ein Idiot!
STIMMEN AUS DEM OFF: Wir sind verloren! Wir saufen ab!
Nahaufnahme von Ariel mit blauer Badekappe und verspiegelter Skibrille, die untere Hälfte seines Gesichts ist blau geschminkt. Er trägt einen mit Marienkäfern, Bienen und Schmetterlingen bedruckten transparenten Plastikregenmantel. Hinter seiner linken Schulter ein merkwürdiger Schatten. Er lacht lautlos, deutet mit der rechten Hand, die in einem blauen Gummihandschuh steckt, nach oben. Zuckende Blitze, Donnergrollen.
STIMMEN AUS DEM OFF: Wir wollen beten!
BOOTSMANN: Was sagst du da?
STIMMEN AUS DEM OFF: Wir sinken! Wir saufen ab!Wir seh’n den König nimmer wieder!Ab ins Wasser, auf ans Ufer!
Ariel wirft den Kopf in den Nacken und lacht. In jeder seiner blauen Gummihände hält er eine starke, blinkende Taschenlampe.
Der Bildschirm wird schwarz.
STIMME AUS DEM PUBLIKUM: Was ist los?
EINE ANDERE STIMME: Stromausfall.
WEITERE STIMME: Das muss der Schneesturm sein. Irgendwo ist ein Strommast umgefallen.
Absolute Finsternis. Lärmendes Durcheinander außerhalb des Raums. Geschrei. Schüsse fallen.
STIMME AUS DEM PUBLIKUM: Was ist los?
STIMME VON DRAUSSEN: Abriegelung! Abriegelung!
STIMME AUS DEM PUBLIKUM: Wer hat hier das Sagen?
Drei weitere Schüsse.
EINE STIMME IM RAUM: Keine Bewegung! Ruhe! Nehmt die Köpfe runter! Bleibt, wo ihr seid!
IIm dunklen Damals
1. Küste
Montag, der 7. Januar 2013
Felix putzt sich die Zähne. Dann putzt er seine anderen Zähne, die falschen, und schiebt sie sich in den Mund. Trotz der Haftcreme, die er aufgetragen hat, passen sie nicht besonders gut; vielleicht schrumpft sein Mund. Er lächelt: die Illusion eines Lächelns. Verstellung, Maske, aber wem wird das schon auffallen?
Früher hätte er seinen Zahnarzt angerufen und einen Termin vereinbart, und der luxuriöse Kunstledersessel wäre sein gewesen, so wie das besorgte, nach Pfefferminzmundwasser riechende Gesicht und die geschickten, mit den glänzenden Instrumenten hantierenden Hände. Ah ja, hier liegt das Problem. Keine Sorge, wir beheben das für Sie. Als würde er sein Auto zur Inspektion in die Werkstatt bringen. Vielleicht hätte man ihn sogar mit Musik aus Kopfhörern und einer Betäubungstablette beglückt.
Aber heute kann er sich einen so professionellen Service nicht mehr leisten. Seine Krankenversicherung entspricht dem Billigtarif, deshalb ist er seinen unzuverlässigen Zähnen ausgeliefert. Zu dumm, denn das kann er für das anstehende Finale wirklich nicht gebrauchen: einen Gebiss-Gau. Die Zauber sind vorbei. Da unssere Mimen, wie ich dir ssagte … Beim Gedanken an eine solche Demütigung erröten sogar seine Lungen. Kommen die Worte nicht glasklar, ist die Tonhöhe nicht exakt getroffen, die Modulation nicht peinlich genau, dann versagt der Zauber. Die Zuschauer werden unruhig auf ihren Sitzen, sie husten, und in der Pause gehen sie nach Hause. Es ist wie der Tod.
»Mi-ma-mo-mu«, sagt er zu dem zahnpastagesprenkelten Spiegel über der Küchenspüle. Er zieht die Augenbrauen zusammen, reckt das Kinn. Dann grinst er: das Grinsen eines in die Ecke getriebenen Schimpansen, teils Wut, teils Drohung, teils Niedergeschlagenheit.
Wie tief er gefallen ist. Wie ernüchtert er ist. Wie gedemütigt. Eine zusammengeschusterte Existenz. Er haust in einer Bruchbude, vergessen irgendwo in der gottverlassenen Provinz, während Tony, dieser Parvenü, dieser großspurige kleine Scheißer, sich mit den Granden amüsiert, Champagner schlürft, Kaviar, Lerchenzungen und Ferkel in sich hineinschaufelt, Bankette besucht und sich in der Bewunderung seiner Entourage, seiner Helfershelfer, seiner Handlanger sonnt …
Die früher einmal Felix’ Handlanger waren.
Das schwärt. Das gärt. Da brauen sich Rachegelüste zusammen. Wenn nur …
Genug. Schultern gerade, befiehlt er seinem grauen Spiegelbild. Halt die Luft an. Er weiß, ohne hinzusehen, dass er ein Bäuchlein ansetzt. Vielleicht sollte er sich ein Korsett anschaffen.
Denk nicht daran! Zieh den Bauch ein! Es gibt viel zu tun, Intrigen müssen erdacht, Winkelzüge ersonnen, Schurken in die Irre geführt werden! Fischers Fritze fischt frische Fische. Ein Student in Stulpenstiefeln stolperte über einen Stein und starb. Zwanzig spitze Spatzenschnäbel zwitschern zwischen zwei schwatzenden Zwetschgensammlern.
Na also. Nicht eine Silbe verpatzt.
Er kann es noch. Er wird es schaffen, allen Hindernissen zum Trotz. Sie zuerst in Verzückung versetzen, nicht dass er an dem Anblick unbedingt Gefallen fände. Vor Staunen soll ihnen Hören und Sehen vergehen, wie er zu seinen Schauspielern sagt. Lasst uns zaubern!
Und diesem heimtückischen, hinterhältigen Scheißkerl Tony das Maul stopfen.
2. Meine Zauber wirken
Dieser heimtückische, hinterhältige Scheißkerl Tony ist Felix’ eigene Schuld. Oder größtenteils seine Schuld. Im Laufe der letzten zwölf Jahre hat er sich häufig selbst kasteit: Er hat Tony zu viel Spielraum gelassen, er hat ihn nicht kontrolliert, hat ihm nicht über die geschniegelte, gepolsterte, nadelstreifengewandete Schulter geschaut. Er hat nicht auf die Warnzeichen geachtet, wie jeder andere halbwegs klar denkende Mensch es vielleicht getan hätte. Schlimmer noch: Er hat diesem bösartigen Aufsteiger, diesem machiavellistischen Speichellecker vertraut. War auf ihn hereingefallen: Lass mich das für dich erledigen, delegier das, schick mich stattdessen. Was für ein Idiot er gewesen war.
Seine einzige Entschuldigung war, dass seine Trauer ihn damals abgelenkt hatte. Kurz zuvor hatte er sein einziges Kind verloren, und das auf so schreckliche Weise. Hätte er nur, hätte er nur nicht, wenn er nur darauf geachtet hätte …
Nein, es war immer noch zu schmerzhaft. Denk nicht darüber nach, sagt er sich, als er sein Hemd zuknöpft. Verdräng es, so gut du kannst. Tu so, als wäre es nur ein Film.
Selbst wenn es dieses mit einem Nachdenkverbot belegte Ereignis nicht gegeben hätte, er wäre höchstwahrscheinlich dennoch in die Falle getappt. Er hatte sich angewöhnt, Tony das Kommando über den prosaischen Teil der Veranstaltung zu überlassen, denn schließlich war Felix der künstlerische Leiter, wie Tony ihm immer wieder ins Gedächtnis rief, und auf dem Gipfel seiner Möglichkeiten, zumindest wurde das von den Kritikern immer wieder behauptet; deshalb sollte er sich höheren Zielen widmen.
Und das hatte er auch getan. Um die prächtigste, schönste, ehrfurchtgebietendste, einfallsreichste, numinoseste Theatererfahrung aller Zeiten zu schaffen. Um die Messlatte bis zum Mond hochzusetzen. Um jede Inszenierung zu einem Erlebnis zu machen, das kein Zuschauer jemals vergessen würde. Um das kollektive Atemanhalten, den kollektiven Seufzer zu beschwören, und ein Publikum, das später, beim Hinausgehen, ein wenig schwankte, als hätte es zu viel getrunken. Um das Makeshiweg-Festival zum Maß all dessen zu machen, woran mindere Theaterfestivals gemessen würden.
Das waren hochgesteckte Ziele.
Um sie zu erreichen, hatte Felix die fähigsten Helferteams zusammengestellt, die er durch gutes Zureden gewinnen konnte. Er hatte die Besten angeheuert, hatte die Besten inspiriert – beziehungsweise die Besten, die er sich leisten konnte. Er hatte die Technikgnome und -kobolde, die Beleuchter, die Tontechniker handverlesen. Er hatte die meistbewunderten Bühnen- und Kostümbildner seiner Zeit abgeworben, zumindest die, die sich hatten abwerben lassen. Jeder von ihnen musste ein Meister seiner Zunft sein oder noch besser. Wenn möglich.
Dafür hatte er Geld gebraucht.
Das Geld aufzutreiben war Tonys Aufgabe gewesen. Eine Handlangerarbeit: Das Geld war nur Mittel zum Zweck, der Zweck Transzendenz. Das hatten sie beide verstanden. Felix, der Zauberer und Wolkenkutscher, und Tony, das erdenschwere Faktotum, der Goldschürfer. Das war ihnen angesichts ihrer jeweiligen Talente als die angemessene Aufgabenteilung erschienen. Wie Tony selbst es ausgedrückt hatte, sollte jeder das tun, was er am besten konnte.
Idiot, schimpft Felix sich selbst. Er hatte nichts verstanden. Und was den Gipfel seiner Möglichkeiten anbetraf: Der Gipfel ist immer gefährlich. Vom Gipfel aus kann der Weg nur abwärtsführen.
Tony war allzu sehr darauf erpicht gewesen, Felix von den verhassten Ritualen zu befreien, wie zum Beispiel Cocktailpartys zu besuchen, Sponsoren und Förderern Honig um den Mund zu schmieren, freundschaftlichen Kontakt mit dem Präsidium zu pflegen und auf diversen Regierungsebenen Subventionen zu beschaffen und effektive Berichte zu schreiben. Somit – sagte Tony – konnte Felix sich den Dingen widmen, die wirklich zählten, wie zum Beispiel seinen scharfsichtigen Textanmerkungen, der avantgardistischen Lichtregie und dem exakten Einsatz der Glitzerkonfettischauer, für die er berühmt war.
Und seiner Regiearbeit natürlich. Felix hatte pro Saison immer ein oder zwei Stücke eingeschoben, bei denen er persönlich Regie führte. Hin und wieder übernahm er auch eine Hauptrolle, wenn es etwas war, das ihn faszinierte. Julius Cäsar. Oder der Schottenkönig. Lear. Titus Andronicus. Jede einzelne dieser Rollen war ein Triumph für ihn! Genau wie jede einzelne seiner Inszenierungen!
Zumindest ein Triumph bei der Kritik, auch wenn die Theaterbesucher und sogar die Förderer gelegentlich murrten. Die fast nackte, freizügig blutende Lavinia im Titus sei allzu anschaulich und verstörend, hatten sie gejammert, wenn auch, wie Felix betonte, durch den Text mehr als gerechtfertigt. Warum musste Perikles mit Raumschiffen und Außerirdischen inszeniert werden, statt mit Segelschiffen und fremden Ländern, und warum wurde die Mondgöttin Artemis mit dem Kopf einer Gottesanbeterin dargestellt? Selbst wenn es – wie Felix dem Präsidium zu seiner Verteidigung auseinandersetzte – absolut passte, sobald man nur genau genug darüber nachdachte. Und Hermiones Rückkehr ins Leben als Vampir in Ein Wintermärchen: Dafür hatte es tatsächlich Buhrufe gegeben. Felix war darüber hocherfreut: Was für ein Effekt! Wer sonst hatte das je getan? Wo Buhrufe sind, da ist Leben!
Diese Eskapaden, diese Höhenflüge der Fantasie, diese Triumphe waren Geistesprodukte eines früheren Felix. Es waren Akte des Jubels, des glücklichen Überschwangs. In der Zeit kurz vor Tonys Coup hatten sich die Dinge verändert. Waren düsterer geworden, und das so plötzlich. Heul, heul, heul …
Aber er konnte nicht heulen.
Seine Frau Nadia verließ ihn als Erste, kaum ein Jahr nach ihrer Hochzeit. Für ihn eine späte und unerwartete Ehe: Er hatte nicht gewusst, dass er zu solcher Liebe fähig war. Er entdeckte gerade erst ihre Vorzüge, lernte sie gerade erst richtig kennen, als Nadia unmittelbar nach der Geburt ihrer Tochter an einer schnell fortschreitenden Staphylokokken-Infektion erkrankte. Solche Dinge passierten trotz moderner Medizin. Er versucht noch immer, sich ihr Bild vor Augen zu rufen, sie noch einmal lebendig werden zu lassen, aber im Laufe der Jahre hat sie sich sachte von ihm zurückgezogen, ist verblasst wie ein altes Polaroidfoto. Jetzt ist sie wenig mehr als ein Schattenriss; ein Schattenriss, den er mit Trauer füllt.
Und so war er mit seiner neugeborenen Tochter Miranda allein. Miranda: Wie sonst hätte er, ein vernarrter Vater mittleren Alters, ein mutterloses kleines Mädchen nennen können? Sie war es, die ihn davon abgehalten hatte, im Chaos zu versinken. Er hatte sich zusammengerissen, so gut es ging, was nicht allzu gut war; dennoch, er war zurechtgekommen. Natürlich hatte er Hilfe angeheuert – er brauchte ein paar Frauen, da er von der praktischen Seite der Kinderpflege keine Ahnung hatte, und weil er wegen seiner Arbeit nicht die ganze Zeit bei Miranda sein konnte. Doch er hatte jede freie Minute mit ihr verbracht. Auch wenn es nicht viele freie Minuten gab.
Er war von Anfang an von ihr hingerissen gewesen. Er wachte, er staunte. So vollkommen, ihre Finger, ihre Zehen, ihre Augen! So eine Freude! Als sie sprechen konnte, nahm er sie sogar mit ins Theater; sie war so klug. Sie saß da und sog alles in sich auf, zappelte nicht gelangweilt herum, wie eine unbedeutendere Zweijährige das vielleicht getan hätte. Er schmiedete so viele Pläne: Sobald sie älter war, würden sie miteinander reisen, er würde ihr die Welt zeigen, er konnte ihr so vieles beibringen. Doch dann, im Alter von drei Jahren …
Hohes Fieber. Meningitis. Sie hatten versucht, ihn zu erreichen, die Frauen, doch er war in der Probe und hatte strikte Order erlassen, ihn nicht zu stören, und sie hatten nicht gewusst, was sie tun sollten. Als er schließlich nach Hause kam, flossen verzweifelte Tränen, dann die Fahrt zum Krankenhaus, doch es war zu spät, zu spät.
Die Ärzte taten, was sie konnten: Jede Plattitüde wurde aufgefahren, jede Entschuldigung aufgeboten. Doch nichts half, und dann war sie nicht mehr da. Dahingerafft, wie sie gewöhnlich sagten. Doch wohin? Sie konnte nicht einfach aus dem Universum verschwunden sein. Er weigerte sich, das zu glauben.
Lavinia, Julia, Cordelia, Perdita, Marina. All die verlorenen Töchter. Einige von ihnen wurden wiedergefunden. Warum nicht auch seine Miranda?
Was machte man mit solchem Kummer? Er war wie eine gewaltige schwarze Wolke, die sich jenseits des Horizonts zusammenbraute. Nein: wie ein Schneesturm. Nein: Er konnte es nicht in Worte fassen, konnte es nicht direkt damit aufnehmen. Er musste diesen Kummer umformen, ihn zumindest verkapseln.
Unmittelbar nach dem Begräbnis mit dem mitleiderregend kleinen Sarg hatte er sich in den Sturm gestürzt. Eine Ausweichstrategie, sogar damals schon besaß er so viel Selbsterkenntnis, doch auch so etwas wie eine Wiederauferstehung.
Miranda sollte zu der Tochter werden, die nicht verloren war; ein Schutzengel, der dem ins Exil getriebenen Vater beistand, während sie in einem leckgeschlagenen Boot gemeinsam über das dunkle Meer trieben. Sie wäre nicht gestorben, sondern zu einem hübschen Mädchen herangewachsen. Was er im Leben nicht haben konnte, dessen konnte er durch seine Kunst vielleicht noch ansichtig werden: nur ein kurzer Blick aus dem Augenwinkel.
Er würde dieser wiedergeborenen Miranda, die er durch seinen Willen zum Leben erweckte, ein unvergleichliches Bühnenbild schaffen. Er würde sich als Schauspieler/Regisseur selbst übertreffen. Er würde sämtliche Grenzen verschieben, die Wirklichkeit strapazieren, bis sie ächzte. Fieberhafte Verzweiflung lag in diesen Bemühungen, aber lag Verzweiflung nicht aller wahren Kunst zugrunde? War sie nicht immer eine Herausforderung an den Tod? Ein trotzig erhobener Mittelfinger am Rande des Abgrunds?
Sein Ariel, entschied er, würde von einem Transvestiten auf Stelzen gespielt, der sich in bedeutungsvollen Momenten in einen riesigen Leuchtkäfer verwandelte. Sein Caliban wäre ein schrundiger Penner – schwarz, vielleicht auch indianischer Herkunft – und zudem querschnittsgelähmt, der sich auf einem überdimensionierten Skateboard über die Bühne schob. Stephano und Trinculo? Er hatte sie noch nicht ausgearbeitet, aber Melonen und Hosenbeutel würden eine Rolle spielen. Und Jonglieren: Trinculo sollte mit ein paar Gegenständen jonglieren, die er am Strand der Zauberinsel aufgelesen hatte, mit Tintenfischen zum Beispiel.
Seine Miranda wäre großartig. Ein Wildfang – als Schiffbrüchige war sie zwölf Jahre lang über die Insel gestromert, höchstwahrscheinlich barfuß, denn wie hätte sie an Schuhe kommen sollen? Sie musste Fußsohlen gehabt haben wie Stiefelsohlen.
Nach einer erschöpfenden Suche, während der er all die nur Jungen und nur Hübschen abgelehnt hatte, besetzte er die Rolle mit einer ehemaligen Kinderturnerin, die es bei den nordamerikanischen Meisterschaften sogar bis zur Silbermedaille gebracht hatte und danach an der staatlichen Schauspielakademie angenommen worden war: ein starkes, geschmeidiges, verwahrlostes Kind, das gerade erst aufblühte. Anne-Marie Greenland war ihr Name. Sie war so enthusiastisch, so energiegeladen: kaum älter als sechzehn. Sie hatte kaum Schauspielerfahrung, doch er wusste, er könnte aus ihr herauslocken, was er brauchte. Eine so frische Vorstellung, dass es nicht einmal eine Vorstellung wäre. Sondern Wirklichkeit. Durch sie würde seine Miranda ins Leben zurückkehren.
Felix selbst wollte den Prospero spielen, ihren liebenden Vater. Der sie beschützte – vielleicht allzu sehr, aber nur, weil er ihr Bestes wollte. Und klug war: klüger als Felix. Doch selbst der kluge Prospero vertraute naiv auf diejenigen, die ihm nahestanden, und war zu sehr darauf aus, seine Zauberkünste zu vervollkommnen.
Prosperos Zaubermantel sollte aus Tierfellen bestehen – nicht von echten Tieren, sondern von Plüschtieren, denen man die Füllung herausgenommen und sie dann zusammengenäht hatte: Eichhörnchen, Kaninchen, Löwen, etwas Tigerähnliches und diverse Bären. Sie würden die ursprüngliche Natur von Prosperos übernatürlichen und dennoch natürlichen Kräften beschwören. Felix hatte künstliche Blätter, goldbesprühte Blüten und schreiend bunte Federn bestellt, die zwischen die pelzigen Kreaturen geflochten werden sollten, um dem Umhang zusätzlichen Pep und tiefere Bedeutung zu verleihen. Er würde einen Stab schwingen, den er in einem Antiquitätengeschäft aufgetan hatte: ein eleganter edwardianischer Gehstock mit einem silbernen Fuchskopf als Knauf, aussen Augen, möglicherweise aus Jade. Für einen Zauberstab war er eigentlich zu kurz, doch Felix gefiel es, Extravaganz mit Understatement zu paaren. So ein altertümliches Requisit konnte in entscheidenden Momenten ironisch aufspielen. Am Ende des Stücks, während Prosperos Epilog, plante er als Effekt einen Sonnenuntergang, bei dem Glitzerkonfetti wie Schnee vom Himmel rieseln sollte.
Dieser Sturm wäre hervorragend geworden: das Beste, was er je geschaffen hatte. Er war – das ist ihm nun klar – auf ungesunde Weise davon besessen. Es war sein Taj Mahal, ein überladenes Mausoleum zu Ehren eines geliebten Schattens, oder eine Urne, die mit Juwelen von unschätzbarem Wert besetzt war und doch nur Asche enthielt. Und doch war es mehr, denn seine Miranda würde dank der von ihm geschaffenen Zauberblase wieder zu neuem Leben erweckt.
Umso niederschmetternder für ihn, als diese Blase zerplatzte.
3. Usurpator
Sie standen kurz vor den Proben, als Tony seine Karten auf den Tisch legte. Zwölf Jahre danach kann Felix sich immer noch an jede Einzelheit dieser Begegnung erinnern.
Das Gespräch hatte ganz normal begonnen, während eines ihrer regelmäßigen Dienstagnachmittagstreffen. Bei diesen Treffen legte Felix Tony eine Liste vor, die er für ihn abarbeiten sollte, und Tony informierte Felix über die Dinge, die seiner Aufmerksamkeit oder seiner Unterschrift bedurften. Im Allgemeinen waren das nicht viele, denn Tony war so tüchtig, dass er das wirklich Wichtige immer schon erledigt hatte.
»Wir wollen es kurzhalten«, hatte Felix wie üblich das Treffen eröffnet. Abschätzig hatte er Tonys rote Krawatte mit dem Muster aus Hasen und Schildkröten betrachtet: zweifellos ein Versuch, witzig zu sein. Tony hatte eine Vorliebe – eine zunehmend geckenhafte Vorliebe – für teuren Schnickschnack. »Meine heutige Liste: Erstens, wir müssen den Beleuchter ersetzen, er gibt mir nicht, was ich brauche. Außerdem müssen wir für den Zaubermantel …«
»Felix, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten«, sagte Tony. Er trug schon wieder einen neuen, wie immer adretten Anzug; gewöhnlich deutete das auf eine Präsidiumssitzung hin. Felix hatte sich angewöhnt, diesen Sitzungen fernzubleiben: der Vorsitzende, Lonnie Gordon, war ein anständiger Mann, allerdings gähnend langweilig, und die übrigen Präsidiumsmitglieder waren nichts als ein Haufen Jasager. Er verschwendete jedoch kaum einen Gedanken an sie, da Tony sie fest im Griff hatte.
»Oh? Und worum geht’s?«, fragte Felix. Schlechte Nachrichten, das hieß gewöhnlich ein belangloser Beschwerdebrief eines verstimmten Förderers. Musste Lear sich unbedingt komplett ausziehen? Manchmal ging es auch um eine Reinigungsrechnung, wenn ein Zuschauer aus der ersten Reihe zum unfreiwilligen Teilnehmer einer Splatter-Szene geworden war: Macbeths mit geronnenem Blut getränkter Schädel, der mit zu viel Schwung auf die Bühne geschleudert wurde, Gloucesters ausgestochener Augapfel, der dem Täter aus der Hand rutschte und ekliges Gallert auf das geblümte Seidenkleid spritzte, aus dem es so schwer herauszubekommen war.
Es war Tony, der solche empörten Beschwerden handhabte, und er handhabte sie gut – er brachte eine angemessen unterwürfige Entschuldigung vor, hielt Felix aber im Falle eines unangenehmen Zusammentreffens am Bühneneingang gern auf dem Laufenden. Wenn man ihn kritisiere, reagiere Felix manchmal mit einem Übermaß vollmundiger Adjektive, behauptete Tony. Felix sagte, seine Ausdrucksweise sei der jeweiligen Situation stets angemessen, und Tony meinte, natürlich, aber aus der Perspektive eines Förderers sei das nicht ideal. Und außerdem könne es an die Presse gelangen.
»Unglücklicherweise«, sagte Tony jetzt und hielt inne. Sein Gesichtsausdruck war merkwürdig. Kein Lächeln, sondern herabgezogene Mundwinkel mit einem Lächeln darunter. Felix spürte, wie sich ihm die Nackenhaare sträubten. »Unglücklicherweise«, sagte Tony schließlich in verbindlichem Tonfall, »hat das Präsidium abgestimmt und entschieden, deinen Vertrag zu beenden. Als künstlerischer Direktor.«
Jetzt war es an Felix innezuhalten. »Was?«, sagte er. »Das ist doch wohl ein Scherz, oder?« Das können sie nicht tun, dachte er. Ohne mich geht das ganze Festival in Flammen auf! Die Geldgeber werden die Flucht ergreifen, die Schauspieler alles hinschmeißen, die gehobenen Restaurants, Geschenkeläden und Pensionen eingehen, und die Stadt Makeshiweg wird wieder genau in der Vergessenheit versinken, aus der er sie Sommer für Sommer so geschickt herausgeholt hatte – denn was hatte sie sonst zu bieten außer einem Rangierbahnhof? Ein Rangierbahnhof war kein Event. Um einen Rangierbahnhof herum konnte man kein Menü zusammenstellen.
»Nein«, sagte Tony, »ich fürchte, es ist kein Scherz.« Erneut eine Pause. Felix starrte Tony an, als sähe er ihn zum ersten Mal. »Sie haben das Gefühl, dass du deinen Elan verlierst.« Und noch eine Pause. »Ich habe ihnen erklärt, dass du unter Schock stehst, seit deine Tochter … seit deinem tragischen Verlust, dass ich mir aber sicher bin, dass du darüber hinwegkommen wirst.« Das war ein solcher Tiefschlag, dass es Felix den Atem raubte. Wie konnte er es wagen, das als Ausrede vorzubringen? »Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand«, fügte Tony hinzu.
Das war eine Lüge. Das wussten sie beide. Lonnie Gordon, der Vorsitzende, hätte sich nie einen solchen Putsch ausgedacht, und die übrigen Präsidiumsmitglieder waren Nullen. Handverlesene Männer, handverlesen von Tony. Und handverlesene Frauen, davon gab es zwei. Tonys Empfehlungen, alle miteinander.
»Meinen Elan?«, fragte Felix. »Meinen verdammten Elan?« Wer hatte denn je mehr Elan gehabt als er?
»Nun, deinen Bezug zur Wirklichkeit«, sagte Tony. »Sie glauben, du hast psychische Probleme. Das ist verständlich, habe ich ihnen gesagt, angesichts deiner … Aber sie wollten das nicht einsehen. Der Umhang mit den Tierfellen war eine Spur zu viel. Sie haben die Entwürfe gesehen. Sie sagen, du würdest uns die Tierschutzaktivisten auf den Hals hetzen wie einen Hornissenschwarm.«
»Das ist lächerlich. Das sind keine echten Tiere, das ist Kinderspielzeug!«
»Du musst verstehen«, sagte Tony mit gönnerhaftem Langmut, »dass das nicht der Punkt ist. Sie sehen wie Tiere aus. Und der Umhang ist nicht das Einzige, was sie beanstanden. Ein querschnittsgelähmter Caliban, da ziehen sie wirklich die Grenze, sie sagen, das geht weit über schlechten Geschmack hinaus. Die Zuschauer würden glauben, du machtest dich über Behinderungen lustig. Manche von ihnen würden aufstehen und gehen. Oder mit dem Rollstuhl hinausgeschoben werden: Wir haben einen substanziellen Anteil an … Demografisch gesehen, kommen nicht die unter Dreißigjährigen zu uns.«
»Ist das denn die Möglichkeit! So viel politische Korrektheit schießt weit über das Ziel hinaus! So steht es im Text, er ist missgebildet! Caliban ist heutzutage doch der Liebling, alle jubeln ihm zu, ich mache nur …«
»Ich verstehe das, aber die Sache ist die, dass wir ausreichend Sitzplätze füllen müssen, um die Subventionen zu rechtfertigen – die Kritiken zuletzt waren … gemischt. Besonders in der vergangenen Saison.«
»Gemischt? Die Kritiken in der vergangenen Saison waren sensationell!«
»Ich habe die Verrisse von dir ferngehalten. Es waren unzählige. Ich habe sie hier in meinem Aktenkoffer, falls du sie dir ansehen möchtest.«
»Warum hast du das getan, verdammt noch mal?«, fragte Felix. »Sie von mir ferngehalten? Ich bin schließlich kein Kind.«
»Schlechte Kritiken machen dich gereizt. Dann lässt du es am Personal aus. Das ist schlecht für die Moral.«
»Ich bin nie gereizt!«, schrie Felix.
Tony ignorierte das. »Hier ist das Kündigungsschreiben«, sagte er und zog einen Umschlag aus der Innentasche seines Jacketts. »Das Präsidium hat eine Ruhestandsregelung beschlossen, als Dank für deine vielen Dienstjahre. Ich habe versucht, sie aufzustocken.« An dieser Stelle eindeutig ein Grinsen.
Felix nahm den Umschlag entgegen. Sein erster Impuls war, ihn in Fetzen zu reißen, doch er war wie gelähmt. In seiner Karriere hatte es zwar schon früher Auseinandersetzungen gegeben, er war aber noch nie entlassen worden. Hinausgeworfen! Zu Fall gebracht! Ausrangiert! Sein ganzer Körper war taub. »Aber mein Sturm«, sagte er. »Der wird doch aufgeführt?« Er bettelte bereits. »Wenigstens das?« Sein bestes Werk, sein wundersamer Schatz, zerstört. In den Boden gestampft. Gelöscht.
»Ich fürchte, nein«, sagte Tony. »Wir … Sie meinten, ein sauberer Schnitt wäre das Beste. Die Produktion wird abgesagt. Die persönlichen Habseligkeiten aus deinem Büro findest du draußen bei deinem Auto. Ich brauche übrigens deinen Sicherheitsausweis. Wenn du so weit bist.«
»Das bringe ich vor den Minister für Kultur- und Denkmalpflege«, sagte Felix schwach. Er wusste, dass das eine leere Drohung war. Er war mit Sal O’Nally zur Schule gegangen, damals waren sie Rivalen gewesen. Wegen eines gestohlenen Bleistifts hatte es seinerzeit eine Auseinandersetzung gegeben, die Felix gewonnen und Sal offensichtlich nicht vergessen hatte. In etlichen Fernsehinterviews – die direkt auf Felix’ Eier abzielten – hatte er seine Meinung kundgetan, dass das Makeshiweg-Festival öfter Noël-Coward-Komödien und Andrew-Lloyd-Webber-Musicals aufführen sollte. Nicht, dass Felix etwas gegen Musicals gehabt hätte, er hatte seine Theaterlaufbahn in einer Studentenproduktion von Guys and Dolls begonnen, aber ausschließlich Musicals …
The Sound of Music, meinte Sal. Cats. Crazy for You. Stepptanz. Dinge, die ein gewöhnlicher Mensch verstehen konnte. Doch der gewöhnliche Mensch konnte Felix’ Herangehensweise bestens verstehen! Was war so schwierig an einem Macbeth mit Kettensäge? Es passte zum Thema. Unmittelbar.
»Der Minister für Kultur- und Denkmalpflege stimmt voll mit diesem Entschluss überein«, sagte Tony. »Natürlich haben wir unsere Entscheidung vor der endgültigen Abstimmung mit Sal – mit Minister O’Nally – abgesprochen, um sicherzugehen, dass wir den richtigen Weg einschlagen. Es tut mir leid, Felix«, fügte er unaufrichtig hinzu. »Ich weiß, dass das ein Schock für dich ist. Und sehr schwierig für uns alle.«
»Du hast vermutlich bereits einen Ersatz im Sinn, nehme ich an«, sagte Felix und zwang seine Stimme in eine vernünftige Tonlage. Sal. Demnach nannten sie einander beim Vornamen. So also standen die Dinge. Er würde nicht die Beherrschung verlieren. Er würde einen Rest seiner Würde bewahren.
»Ja, in der Tat«, sagte Tony. »Sal … das Präsidium hat, hm, mich gebeten, die Sache zu übernehmen. Natürlich nur vorübergehend. Bis ein Kandidat passenden Kalibers gefunden werden kann.«
Von wegen vorübergehend, dachte Felix. Jetzt war ihm alles klar. Die Heimlichkeiten, die Sabotage. Die heimtückischen Ausflüchte. Der gewaltige Verrat. Tony war der Drahtzieher, er hatte von Anfang an die Strippen gezogen. Hatte gewartet, bis Felix am verletzlichsten war, und dann zugeschlagen.
»Du heimtückischer, hinterhältiger Scheißkerl«, schrie er, was ihm eine gewisse Befriedigung verschaffte. Wenn auch angesichts des Ganzen nur eine kleine.
4. Mantel
Dann kamen zwei Männer vom Wachdienst ins Zimmer. Sie hatten offenbar vor der Tür gestanden und auf ihr Stichwort gewartet, höchstwahrscheinlich Felix’ Geschrei. Jetzt könnte er sich selbst ohrfeigen, weil er so berechenbar war.
Tony musste die Wachleute vorher instruiert haben: Eines musste man ihm lassen, er war gründlich. Sie nahmen zu beiden Seiten von Felix Aufstellung, der eine schwarz, der andere braun, mit vor der Brust gekreuzten, muskelbepackten Armen und undurchdringlichen Mienen. Sie waren neu, Felix kannte sie nicht. Wichtiger, sie kannten Felix nicht und würden deshalb auch keine Loyalität empfinden. Noch einer von Tonys Geniestreichen.
»Das ist nicht nötig«, sagte Felix, doch Tony hielt es nicht einmal mehr für nötig zu antworten. Er zuckte nur knapp mit den Schultern, nickte – das Schulterzucken der Macht, das Nicken der Macht –, und Felix wurde höflich, aber entschieden auf den Parkplatz hinauseskortiert, eine eiserne Hand dicht an jedem Ellbogen.
Neben seinem Auto stapelten sich Kartons. Sein rotes Auto, ein Mustang Cabrio, gekauft in einem Anfall von Midlife-Crisis-Trotz, als er sich noch sportlich gefühlt hatte. Lange vor Miranda und dann keine Miranda. Schon damals hatte die Karre Rost angesetzt, und seither war es mehr geworden. Er hatte eigentlich vorgehabt, sich ein anderes Auto anzuschaffen, etwas Nüchterneres. So viel zu diesem Plan: Er hatte den Umschlag mit der Abfindung noch nicht geöffnet, wusste aber schon jetzt, dass er nur das schiere Minimum enthalten würde. Nicht genug für Extravaganzen wie ein halbwegs neues Auto.
Es nieselte. Die Wachmänner halfen Felix, die Kartons in seinen rostenden Mustang zu laden. Sie sagten nichts, und auch Felix blieb stumm – was gab es schon zu sagen?
Die Kartons waren durchgeweicht. Was enthielten sie? Papiere, Memorabilien, wer wusste das schon? In diesem Moment war es Felix scheißegal. Er überlegte, ob er mit großer Geste den ganzen Haufen auf den Parkplatz kippen und in Brand stecken sollte, doch wozu? Dazu würde er Benzin brauchen oder irgendeinen Brennstoff; beides hatte er nicht. Und warum sollte er Tony noch zusätzlich Munition liefern? (Die Feuerwehr informiert, die Polizei gerufen, Felix brabbelnd und krakeelend in Ketten davongezerrt, dann wegen Brandstiftung und Ruhestörung angeklagt. Ein Psychiater hinzugezogen, auf Tonys Rechnung. Eine Diagnose gestellt. Seht ihr?, würde Tony dem Präsidium sagen. Paranoid. Psychotisch. Dem Himmel sei Dank, dass es uns gelungen ist, uns rechtzeitig von ihm zu trennen, bevor er mitten im Theater durchgedreht wäre.)
Während sie zu dritt die letzten durchweichten Kartons in Felix’ Auto luden, kam eine einsame, rundliche Gestalt über den Parkplatz gewatschelt. Es war Lonnie Gordon, der Vorsitzende des Festivalpräsidiums, der einen Regenschirm über seinen mit spärlichen Strähnen bedeckten Kopf hielt und eine Plastiktüte, eine Art Stock und noch etwas in der Hand hatte, das aussah wie ein Armvoll Stinktiere, gekrönt von einer toten weißen Katze.
Dieser verräterische alte Kauz. Felix ließ sich nicht dazu herab, ihn eines Blickes zu würdigen.
Schlurf, schlurf, watschel, watschel, plitsch-platsch kam der fette Lonnie, schnaufend wie ein Walross, durch die Pfützen auf sie zu. »Es tut mir wirklich leid, Felix«, sagte er, als er den hinteren Kotflügel des Autos erreicht hatte.
»Lass gut sein!«, sagte Felix.
»Ich war es nicht«, sagte Lonnie trübsinnig. »Ich wurde überstimmt.«
»Bockmist«, sagte Felix. Bei dem Stock handelte es sich um seinen Gehstock mit dem Fuchsknauf; die Katze war sein falscher Prospero-Bart; das Stinktier-Ding, das sah er erst jetzt, sein Zaubermantel. Vielmehr: was sein Zaubermantel hätte werden sollen. Er war feucht, das Fell zerzaust. Zahllose runde Plastiktiere starrten ihm mit glänzenden Augen aus dem Fell entgegen, die vielen Schwänze hingen schlaff herab. Im grauen Tageslicht wirkte das Ding albern. Doch auf der Bühne, in fertigem Zustand, mit eingeflochtenen Blättern und aufgesprühten Goldakzenten, durch Pailletten hervorgehoben, hätte es großartig ausgesehen.
»Es macht mich traurig, dass du so empfindest«, sagte Lonnie. »Ich dachte, du würdest das hier vielleicht haben wollen.« Er hielt Felix den Umhang, den Bart und den Gehstock entgegen, aber der machte keine Anstalten, die Sachen entgegenzunehmen, und starrte ihn nur wütend an. Ein peinlicher Moment. Lonnie war tatsächlich bedrückt: Er war ein sentimentaler alter Trottel, der am Schluss von Tragödien weinte. »Bitte«, sagte er. »Als Erinnerungsstücke. Nach all deiner Arbeit.« Wieder hielt er ihm die Sachen hin. Der schwarze Wachmann nahm sie ihm ab und legte sie oben auf die Kartons.
»Die Mühe hättest du dir sparen können«, sagte Felix.
»Und das«, sagte Lonnie und hielt ihm die Plastiktüte entgegen. »Der Sturm. Mit deinen Anmerkungen. Ich war so frei, sie mir anzusehen … er wäre wunderbar geworden«, fuhr er mit zitternder Stimme fort. »Vielleicht kannst du sie eines Tages gebrauchen.«
»Du hast sie ja wohl nicht mehr alle«, sagte Felix. »Du und dieses Miststück Tony, ihr habt meine Karriere ruiniert, und das weißt du auch. Genauso gut hättet ihr mich erschießen können.« Das war eine Übertreibung, für Felix aber auch eine Erleichterung, sein Elend jemandem unter die Nase zu reiben. Jemandem mit weichem Herzen und schwachem Rückgrat und deshalb, im Unterschied zu Tony, anfällig dafür, etwas unter die Nase gerieben zu bekommen.
»Oh, ich bin mir sicher, es wird sich alles zum Besten wenden«, sagte Lonnie. »Bei so viel Kreativität, so viel Talent … Da muss es eine Menge, nun, andere Möglichkeiten geben … ein Neuanfang …«
»Andere Möglichkeiten?«, sagte Felix. »Ich bin fünfzig, mein Gott. Etwas über das Ablaufdatum für einen Neuanfang hinaus, meinst du nicht?«
Lonnie schluckte. »Ich verstehe durchaus, was du … Wir werden bei der nächsten Präsidiumssitzung ein Dankesschreiben an dich veranlassen, und jemand hat ein Standbild vorgeschlagen, weißt du, eine Büste oder so was, vielleicht auch einen Brunnen in deinem Namen …«
Kreativität. Talent. Die zwei überstrapaziertesten Wörter in diesem Geschäft, dachte Felix bitter. Und die drei unnötigsten Dinge auf Erden: der Schwanz eines Priesters, die Titten einer Nonne und ein tiefempfundenes Dankesschreiben. »Steck dir deine Büste sonst wohin«, sagte er. Doch dann gab er nach. »Danke, Lonnie«, sagte er. »Ich weiß, du meinst es gut.« Er streckte die Hand aus. Lonnie schüttelte sie.
War das tatsächlich eine Träne, die diese allzu rote Wange hinunterrollte? Ein Zittern des Kiefers? Lonnie sollte auf der Hut sein, mit Tony am Ruder, dachte Felix. Insbesondere wenn er weiterhin so tränenfeucht Gewissensbisse zur Schau stellte. Tony hätte keinerlei Gewissensbisse; er würde jede Opposition niederschmettern, jedes Zögern bestrafen, würde sich mit Schlägern umgeben und das Totholz abhauen.
»Wenn du eine Empfehlung brauchst, jederzeit«, sagte Lonnie. »Ich würde mich freuen … oder … soviel ich weiß, gibt es … vielleicht nach einer Ruhepause … Du hast zu schwer gearbeitet, seit deiner, deiner schrecklichen, traurigen, es tat mir so leid, das ist bei Weitem zu viel, niemand sollte …«
Lonnie war bei dem Begräbnis gewesen, bei beiden, dem von Nadia zuerst. Bei Miranda war er sehr verstört gewesen. Er hatte ein Sträußchen rosafarbener Teerosen in das winzige Grab geworfen, ziemlich theatralisch, wie Felix damals fand, obwohl er die Geste zu schätzen wusste. Dann war Lonnie restlos zusammengebrochen und hatte in ein weißes Taschentuch geschluchzt von der Größe einer Tischdecke.
Auch Tony war bei dem Begräbnis gewesen, diese hinterhältige Ratte, mit einer schwarzen Krawatte und Trauermiene, obwohl er vermutlich damals schon an seinem Coup gefeilt hatte.
»Danke«, sagte Felix und schnitt Lonnie das Wort ab. »Es wird schon wieder werden. Und danke«, sagte er zu den beiden Wachmännern. »Sie haben mir geholfen. Das weiß ich zu schätzen.«
»Gute Fahrt, Mr Phillips«, sagte einer von ihnen.
»Ja«, sagte der andere. »Wir machen nur unseren Job.« So etwas wie eine Entschuldigung. Wahrscheinlich wussten sie, wie es war, gefeuert zu werden.
Dann stieg Felix in sein schäbiges Auto, fuhr vom Parkplatz und davon, in den Rest seines Lebens.
5. Armselige Zelle
Der Rest seines Lebens. Wie lang ihm diese Zeit einmal vorgekommen war. Wie schnell sie verflogen ist. Wie viel davon er vergeudet hat. Wie schnell alles vorbei sein wird.
Als er den Parkplatz des Festivalgeländes verließ, hatte Felix nicht das Gefühl, das Auto zu steuern. Stattdessen fühlte er sich getrieben, wie von einem heftigen Wind vor sich hergeweht. Ihm war kalt, obwohl das Nieseln mittlerweile aufgehört hatte und die Sonne schien, außerdem hatte er die Heizung aufgedreht. Stand er unter Schock? Nein: Er zitterte nicht. Er war ruhig.
Das Theater mit seinen flatternden Wimpeln und dem wasserspeienden Delfinbrunnen, dem offenen Innenhof, den blühenden Rabatten und den Theaterbesuchern, die festlich gestimmt Eiscreme schleckten, verschwand alsbald. Die Hauptstraße von Makeshiweg mit den teuren Restaurants und den mit den Köpfen von alten Poeten, Schweinen, Renaissanceköniginnen, Fröschen, Zwergen und Hähnen geschmückten Pubs, mit den keltischen Wollwaren-Outlets, den Läden mit den Inuit-Schnitzereien und englischem Porzellan und den hübschen gelben viktorianischen Backsteinhäusern, das eine oder andere mit einem Bed-and-Breakfast-Schild, ging allmählich in eine Vorortstraße mit Drogerieläden, Schuhreparaturwerkstätten und thailändischen Nagelstudios über. Dann, nach ein paar weiteren Ampeln, lag auch der Stadtrand mit seinen Gewerbeflächen, den Teppich-Outlets, mexikanischen Schnellimbissen und Hamburgerparadiesen hinter ihm. Nun war Felix dem Schicksal preisgegeben.
Wo war er? Er hatte keine Ahnung. Um ihn herum erstreckten sich weite Felder, das zarte Grün des Frühlingsweizens, das dunklere Grün der Sojabohnen. Bauminseln reckten ihre fedrigen oder glänzenden Blätter um jahrhundertealte Bauernhäuser, deren graue Holzscheunen immer noch ihren Zweck erfüllten und deren Silos Satzzeichen in die Horizontale setzten. Die Straße hatte mittlerweile nur noch einen Kiesbelag und war in schlechtem Zustand.
Er fuhr langsamer und schaute sich um. Er sehnte sich nach einer Höhle, einem Versteck, einem Ort, wo er niemanden kannte und niemand ihn kannte. Ein Rückzugsort, wo er sich erholen könnte, denn nun begann er sich einzugestehen, wie schwer er getroffen war.
In ein, zwei, höchstens drei Tagen würde Tony eine Lügengeschichte in den Zeitungen platzieren. Darin würde es heißen, dass Felix als künstlerischer Direktor zurückgetreten sei, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, doch diese Version würde niemand glauben. Wenn er in Makeshiweg blieb, würden böswillige Reporter ihn ausfindig machen und sich am Sturz des Mächtigen laben. Sie würden ihn anrufen, ihm auflauern, ihn in einer Bar in die Enge treiben, vorausgesetzt, er wäre dumm genug, eine Bar zu besuchen. Sie würden ihn fragen, ob er Lust hätte, einen Kommentar abzugeben, und dank seines Rufs darauf hoffen, einen cholerischen Anfall zu provozieren. Doch was würde er damit schon erreichen?
Die Sonne sank allmählich tiefer, und das schräg fallende Licht wurde weicher. Wie lange war er schon hier draußen? Wo auch immer hier war. Er fuhr weiter.
In einiger Entfernung von der Straße, am Ende einer grasüberwucherten Zufahrt, befand sich ein merkwürdiges Konstrukt. Es sah aus, als wäre es in einen niedrigen Hang hineingebaut, von Erde umschlossen, sodass nur die Vorderseite sichtbar war. Das Konstrukt hatte ein Fenster und eine Tür, die halb offen stand. Aus der Wand ragte ein metallenes Schornsteinrohr, das nach einem rechtwinkligen Knick himmelwärts zeigte und oben mit einer Blechkappe versehen war. Es gab eine Wäscheleine mit einer einzigen Wäscheklammer, die noch immer einen Fetzen Spüllappen festhielt. Es war der letzte Ort, an dem irgendjemand nach ihm suchen würde.
Nachzusehen schadete nicht. Also sah Felix nach.
Er parkte sein Auto am Straßenrand und ging die Zufahrt entlang; feuchtes Gras und Unkraut strichen um seine Hosenbeine. Die Tür knarrte, als er sie weiter aufstieß, ein Tropfen Öl auf den Scharnieren würde das aber richten. Die Decke war niedrig, die Balken waren runde Holzpfosten, früher weiß getüncht und jetzt voller Spinnweben. Das Innere roch nicht allzu unangenehm nach Erde und Holz und einem Hauch Asche: Der stammte von dem eisernen Herd mit zwei Kochstellen und einem kleinen Ofen, der zwar verrostet, aber noch intakt war. Zwei Räume, der Hauptraum und noch ein weiterer, der einmal das Schlafzimmer gewesen sein musste. Er hatte ein Oberlicht – das Glas sah einigermaßen neu aus – und an der Seite eine Tür, die mit einem Haken verschlossen war. Felix löste den Haken. Hinter der Tür befanden sich ein zugewachsener Pfad und dann ein Abort. Glücklicherweise würde er sich nicht so weit erniedrigen müssen, eine Abortgrube auszuheben: Das hatten andere für ihn erledigt.
Außer einem schweren alten Holzschrank im Schlafzimmer und einem Küchentisch mit Resopalplatte, rot mit silbernen Wirbeln, gab es kein Mobiliar. Keine Stühle. Der Fußboden bestand aus breiten Dielenbrettern: wenigstens nicht aus gestampfter Erde. Sogar eine Spüle war da, mit einer Handpumpe. Es gab elektrisches Licht, und wunderbarerweise funktionierte es. Jemand musste in jüngerer Zeit, also nach 1830, hier gewohnt haben.
Nicht einmal das Allernötigste war vorhanden, doch wenn er den Besitzer ausfindig machen, sich mit ihm einigen und die Zimmer ein wenig herrichten konnte, würde es gehen.
Sich in dieser Hütte zu verkriechen, die damit einhergehenden Entbehrungen auf sich zu nehmen, hieße natürlich, dass er sich in den Schmollwinkel zurückzog. Dass er sich ein härenes Hemd überstreifte, den Flagellanten gab, den Einsiedler. Seht her, ich leide. Er erkannte sein eigenes Theaterstück, bei dem er der einzige Zuschauer war. Kindisch, dieser selbst auferlegte Trübsinn. Er benahm sich nicht wie ein Erwachsener.
Doch was blieb ihm anderes übrig? Er war zu bekannt, um eine neue Stelle zu finden; zumindest keine gleichwertige, keine, die zu ihm gepasst hätte. Und Sal O’Nally, dessen Hand auf der Schatztruhe mit den Subventionen lag, würde geschickt jede einigermaßen interessante Berufung zu blockieren wissen: Tony würde keine Konkurrenz wollen, von einem Felix, der das Makeshiweg-Festival von anderer Stelle aus übertrumpfte. Tony und Sal würden zusammenarbeiten, wie sie es offenbar bereits getan hatten, um sicherzustellen, dass er mit dem Kopf unter Wasser blieb. Warum ihnen also die Befriedigung verschaffen?
Er fuhr auf demselben Weg nach Makeshiweg zurück, auf dem er gekommen war, und parkte vor dem kleinen Backsteincottage, in dem er in der laufenden Saison zur Miete gewohnt hatte. Seit jener unvorstellbar lange vergangenen Zeit … seit er keine Familie mehr hatte, hatte er kein Haus mehr besessen. Er hatte sich dafür entschieden, die Häuser anderer zu mieten. Er nannte immer noch ein paar Möbelstücke sein eigen: ein Bett, einen Schreibtisch, eine Lampe, zwei alte Holzstühle, die er und Nadia auf einem Flohmarkt aufgelesen hatten. Persönlichen Nippes. Die Überbleibsel eines einst vollständigen Lebens.
Und das Foto von Miranda natürlich. Es war immer in seiner Nähe, wo er es sich ansehen konnte, wenn er spürte, dass er anfing, ins Dunkel abzugleiten. Er hatte das Bild selbst aufgenommen, als Miranda fast drei war. Sie saß zum ersten Mal auf einer Schaukel. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt und lachte vor Freude; sie flog durch die Luft, und ihre kleinen Fäuste umklammerten die Seile; das Morgenlicht legte einen Strahlenkranz um ihr Haar. Der Rahmen, der sie einfasste, war silberfarben, ein silberner Fensterrahmen. Auf der anderen Seite dieses magischen Fensters war sie immer noch am Leben.
Jetzt würde sie hinter dem Glas eingesperrt bleiben müssen, denn mit der Zerstörung seines Sturms war die neue Miranda – die Miranda, die er hatte schaffen, möglicherweise zu neuem Leben erwecken wollen – gestorben.
Tony hatte nicht einmal den Anstand besessen, ihm ein Treffen mit den Mitarbeitern zu gestatten, den technischen Helfern, den Schauspielern. Um sich zu verabschieden. Und seinem Bedauern Ausdruck zu verleihen, dass sein Sturm nicht realisiert werden würde. Man hatte ihn vom Hof gejagt wie einen Verbrecher. Hatten Tony und seine Günstlinge Angst vor ihm? Angst vor einem Aufruhr, einem Gegenputsch? Glaubten sie ernsthaft, Felix wäre so mächtig?
Er rief ein Umzugsunternehmen an und erkundigte sich, wie schnell sie kommen könnten. Es sei ein Notfall, sagte er; alles müsse so bald wie möglich gepackt und eingelagert werden; wegen der Eile würde er einen Zuschlag bezahlen. Er schrieb seinem Vermieter einen Scheck aus und beglich die Miete für die laufende Saison. Er ging zur Bank, zahlte Tonys beschissenes Rauswurf-Geld ein, informierte den Filialleiter, dass er bald eine andere Adresse haben und ihn brieflich darüber informieren würde.