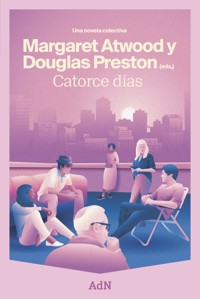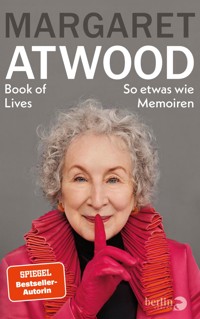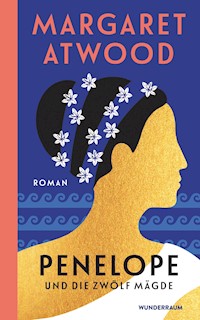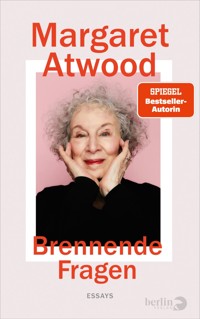
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dieser lustigen, gelehrten, unendlich neugierigen und gespenstisch weitsichtigen Essaysammlung fragte die Kultur-Ikone Margaret Atwood: - Warum erzählen Menschen aller Kulturen überall Geschichten? - Wieviel kann man von sich presigeben, ohne zu verschwinden? - Wie können wir auf unserem Planeten leben? - Stimmt das? Und ist das gerecht? - Was haben Zombies mit Autoritarismus zu tun? In über fünfzig Texten richtet Atwood ihren erstaunlichen Intellekt und frechen Humor wie einen Scheinwerfer auf unsere Welt und berichtet uns dann, was sie dabei entdeckt. Die Achterbahn-Zeitspanne, in der diese Essays entstanden bescherten uns das Ende des Endes der Geschichte, eine Finanzkrise, den Aufstieg Donald Trumps und eine Pandemie. Ob zu Schulden oder zur Tech-Welt, zur Kilimakrise oder zur Freiheit, von der Frage, wann man der jüngeren Generation seine Weisheit überhelfen soll (nur wenn man gefragt wird) zur Frage was Granola eigentlich ist - es gibt niemand der bessere Fragen stellt zu den zahllosen so unterschiedlichen Fragen unseres menschlichen Universums. »Brilliant und witzig« Joan Didion »Sie nimmt sich unsere Zeiten vor und macht uns klüger dafür .« Ali Smith »In der gesamten lesenden Welt werden die Geschichtsbücher auf der nächsten leeren Seite aufgeschlagen und obendrüber steht Atwoods Name.« Anne Enright, ›Guardian‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Für Graeme – und für meine Familie
Übersetzung aus dem Englischen von von Eva Regul, Jan Schönherr und Martina Tichy
© O. W. Toad, ltd, 2022. Titel der englischen Originalausgabe: »Burning Questions«, Chatto and Windus, London, 2022
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Suzanne Dean
Covermotiv: Luis Mora
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
VORWORT
TEIL I
2004 BIS 2009
WAS PASSIERT DANN?
SCIENTIFIC ROMANCING
›DER EISIGE SCHLAF‹
Vorwort
›FROM EVE TO DAWN‹
POLONIA
SOMEBODY’S DAUGHTER
FÜNF BESUCHE BEIM WÖRTERHORT
›DAS ECHO DER ERINNERUNG‹
FEUCHTGEBIETE
BÄUME DES LEBENS, BÄUME DES TODES
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
›ANNE AUF GREEN GABLES‹
ALICE MUNRO: EINE WÜRDIGUNG
URALTE RECHNUNGEN
SCROOGE
Ein Vorwort
LEBEN UND SCHREIBEN
TEIL II
2010 BIS 2013
DIE KUNST IST UNSERE NATUR
SCHRIFTSTELLER ALS POLITISCHE AKTEURE? IM ERNST?
LITERATUR UND DIE UMWELT
ALICE MUNRO
›DIE GABE‹
Vorwort
›FALKEN‹
50 JAHRE ›DER STUMME FRÜHLING‹ VON RACHEL CARSON
FASZINATION ZUKUNFT – WAS WIR UNS ÜBER KOMMENDE ZEITEN ERZÄHLEN
WARUM ICH ›DIE GESCHICHTE VON ZEB‹ GESCHRIEBEN HABE
›SIEBEN PHANTASTISCHE GESCHICHTEN‹
Vorwort
›DOCTOR SLEEP‹
DORIS LESSING
WIE KANN MAN DIE WELT VERÄNDERN?
TEIL III
2014 BIS 2016
WER IST DER STÄRKERE?
IM LAND DER ÜBERSETZUNGEN
ÜBER DIE SCHÖNHEIT
DER SOMMER DER STROMATOLITHEN
KAFKA – DREI BEGEGNUNGEN
FUTURE LIBRARY
BETRACHTUNGEN ZU ›DER REPORT DER MAGD‹
WIR SIND DOPPELPLUS-UNFREI
KNÖPFE ODER SCHLEIFCHEN?
GABRIELLE ROY: IN NEUN TEILEN
1. Vorbemerkung
2. Gabrielle Roy in den Händen von Madame Wiacek
3. Gabrielle Roy, eine Berühmtheit
4. Eine Art Aschenputtelgeschichte
5. Montreal, Stadt der Sünde
6. Qualität und Reiz von ›Gebrauchtes Glück‹
7. Das Zweitroman-Syndrom
8. Porträts der Künstlerin
9. Gabrielle Roy: Botin der Zukunft
SHAKESPEARE UND ICH – EINE STÜRMISCHE LIEBESGESCHICHTE
MARIE-CLAIRE BLAIS – DIE SPRENGMEISTERIN
›DER KUSS DER PELZKÖNIGIN‹
WIR HÄNGEN AM SEIDENEN FADEN
TEIL IV
2017 BIS 2019
WIE HEIKEL IST DIE LAGE?
WELCHE KUNST UNTER TRUMP?
›DER ILLUSTRIERTE MANN‹
Vorwort
BIN ICH EINE SCHLECHTE FEMINISTIN?
WIR HABEN URSULA LE GUIN VERLOREN, ALS WIR SIE AM DRINGENDSTEN BRAUCHTEN
DREI TAROT-KARTEN
Erste Geschichte: Wie ich eine Art Schriftstellerin wurde
Zweite Geschichte: Wie ich 1969/70 einmal einen Satz Tarot-Karten in einem Schreibkurs in Edmonton, Alberta, Kanada eingesetzt habe
Dritte Geschichte: Wie ich 2017 in Mailand einen Satz Viconti-Tarot-Karten geschenkt bekam.
EIN SKLAVINNENSTAAT?
›ORYX UND CRAKE‹
Vorwort
SEID GEGRÜSST, ERDLINGE! WAS SIND DIESE MENSCHENRECHTE, VON DENEN IHR SPRECHT?
›PAYBACK‹
Vorwort zur Neuauflage
›ERINNERUNG AN DAS FEUER‹
Vorwort
SAG. DIE. WAHRHEIT.
TEIL V
2020 BIS 2021
DENKEN UND ERINNERN
KINDHEIT IM QUARANTÄNELAND
›THE EQUIVALENTS‹
›DIE UNZERTRENNLICHEN‹
Vorwort
›WIR‹
Vorwort
›DIE ZEUGINNEN‹ SCHREIBEN
›THE BEDSIDE BOOK OF BIRDS‹
Vorwort
›TAUMEL‹ UND ›GENTLEMAN DEATH‹
Vorwort
IM STROM DER ZEIT GEFANGEN
›BIG SCIENCE‹
BARRY LOPEZ
DIE MEERES-TRILOGIE
Vorwort
DANKSAGUNG
QUELLENVERZEICHNIS
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
VORWORT
›Brennende Fragen‹ ist mein dritter Sammelband mit Essays und weiteren Gelegenheitsarbeiten. Der erste, ›Second Words‹, setzt 1960 ein, als ich begann, Buchrezensionen zu veröffentlichen, und endet mit dem Jahr 1982. Der zweite, ›Moving Targets‹, versammelt Materialien von 1983 bis Mitte 2004. ›Brennende Fragen‹ reicht von Mitte 2004 bis Mitte 2021. Das wären also plus minus zwanzig Jahre für jeden Band.
All diese Zeitspannen waren je auf ihre Weise mehr als bewegt. Gelegenheitsarbeiten werden, wie schon der Name sagt, aus Anlass einer bestimmten Gelegenheit geschrieben und sind daher fest in Zeit und Ort verankert – zumindest für meine trifft dies zu. Auch sind sie damit verbunden, wie alt ich zum Zeitpunkt des Verfassens war und wie meine jeweiligen Lebensumstände aussahen. (Hatte ich einen Job? War ich noch Studentin? Brauchte ich das Geld? War ich bereits eine bekannte Schriftstellerin und konnte unbeschwert meinen Interessen frönen? Arbeitete ich gratis, auf einen Hilferuf hin?)
1960 war ich zwanzig Jahre alt, Single, Collegestudentin mit begrenzter Garderobe und hatte noch nichts in Buchform veröffentlicht. 2021 war ich einundachtzig, eine einigermaßen bekannte Autorin, dazu Großmutter und Witwe, ebenfalls mit begrenzter Garderobe, weil gescheiterte Experimente mich gelehrt hatten, manches lieber ungetragen zu lassen.
Natürlich habe ich mich verändert – meine Haarfarbe ist nicht mehr die gleiche –, und das gilt auch für die Welt. Die vergangenen sechzig Jahre waren eine Achterbahnfahrt mit vielen Schocks und Turbulenzen, mit vielen Tumulten und Umschwüngen. 1960 lag das Ende des Zweiten Weltkriegs gerade mal fünfzehn Jahre zurück. Unserer Generation erschien dieser Krieg sehr nah – wir hatten ihn miterlebt, in unseren Familien gab es Veteranen und Gefallene, manche unserer Lehrer an der Highschool waren dabei gewesen – und zugleich weit, weit weg. Die Zeit zwischen 1950 und 1960 bescherte uns die McCarthy-Ära und mit ihr eine Ahnung von der Zerbrechlichkeit der Demokratie, aber auch Elvis, der Gesang und Tanz auf den Kopf stellte. Die Bekleidung hatte sich ebenfalls radikal geändert: In den 1940er-Jahren war sie trist, robust, kantig und mutete militärisch an, in den 1950ern dagegen zeigte sie sich duftig, trägerlos, bauschig und in Pastelltönen mit Blumenmustern. Weiblichkeit stand hoch im Kurs. Die dunklen, geschlossenen Limousinen der Kriegsjahre hatten sich zu farbenprächtigen Kabrioletts mit Zierleisten aus Chrom gemausert. Drive-in-Kinos entstanden quasi über Nacht. Es gab Transistorradios und erstmals Kunststoffe.
Ab 1960 gab es zaghaften Wandel. Bei den ernsthaften jungen Leuten traten Folksongs an die Stelle formeller Tanzgesellschaften. Und bei den winzigen Künstlergruppen, die damals in Cafés von Toronto zu finden waren, erfreuten sich – schließlich hegte man Neigungen zum französischen Existenzialismus – schwarze Rollkragenpullover und schwarzer Lidstrich großer Beliebtheit.
Dennoch unterschieden sich die frühen 1960er-Jahre im Grunde nicht wesentlich von dem vorangegangenen Jahrzehnt. Der Kalte Krieg hielt an. Kennedys Ermordung stand noch bevor. Die Antibabypille war nicht für alle Welt verfügbar. Es gab keine Miniröcke, wiewohl man unlängst noch sehr kurze Shorts gesehen hatte. Es gab keine Hippies, keine zweite Welle der Frauenbewegung. In dieser Zeit schrieb ich meine ersten Buchrezensionen, meine erste Gedichtsammlung und meinen allerersten Roman – der zum Glück immer noch in der Schublade liegt – sowie den ersten Roman, der es bis zur Veröffentlichung brachte, ›Die essbare Frau‹. Als dieses Buch 1969 erschien, war die Welt, die darin beschrieben wird, bereits Geschichte.
Ab der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre wurde es unruhig. Die großen Bürgerrechtsdemonstrationen in den Vereinigten Staaten, die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die US-amerikanischen Kriegsdienstverweigerer, die zu Tausenden nach Kanada strömten. Ich selbst befand mich dauerhaft auf der Durchreise: Ein paar Jahre lang belegte ich einen Masterstudiengang in Cambridge, Massachusetts, dann hatte ich unbedeutende Lehraufträge an Orten wie Montreal oder Edmonton. Ich zog sechzehn- oder siebzehnmal um. In dieser Zeit wurden in Kanada eine Reihe neuer Verlage gegründet, häufig in Zusammenhang mit den postkolonialen Anstrengungen des Landes, zu sich selbst zu finden. Mit einem dieser Verlage hatte ich näher zu tun und musste ab da zahlreiche Essays schreiben.
Dann kamen die 1970er: die zweite Welle der Frauenbewegung mit ihren Gärungen, den nachfolgenden Gegenbewegungen und dem völligen Burn-out zum Schluss. In Kanada beherrschten die Quebecer Abspaltungstendenzen die politische Bühne. In jenen Tagen gelangten etliche autoritäre Regime an die Macht: in Chile Augusto Pinochet, in Argentinien die Junta, die politische Gegner ermorden oder verschwinden ließ, in Kambodscha die Regierung unter Pol Pot mit ihrem generellen Gemetzel. Manche waren »rechts«, andere »links«, doch so viel war klar: Keine Ideologie hatte die Grausamkeit für sich allein gepachtet.
Ich schrieb weiterhin viele Buchrezensionen sowie die Romane, Erzählungen und Gedichte, die ich als mein eigentliches Werk betrachtete, nahm aber auch Artikel und Vorträge in meinen Kanon auf. Nicht wenige von Letzteren hatten Dinge zum Inhalt, die mein schrumpfendes Hirn immer noch beschäftigen: »Frauenthemen«, Schreiben und Schreibende, Menschenrechte. Mittlerweile war ich Mitglied der Organisation Amnesty International, die sich hauptsächlich durch Briefkampagnen um die Freilassung sogenannter »politischer Gefangener« bemühte.
Nach 1972 hörte ich auf, an Universitäten zu lehren und war auf mich gestellt, deshalb nahm ich jeden Auftrag an, der Geld brachte. Wir lebten auf einer Farm, hatten eine kleine Tochter und ein schmales Budget. Dabei waren wir nicht arm, auch wenn ein Gast nach einem Besuch bei uns herumerzählte, wir hätten »nichts weiter als eine Ziege«. (Das mit der Ziege stimmt nicht, es waren Schafe.) Aber wir schwammen auch nicht gerade in Geld. Wir bauten Unmengen von Gemüse an, hielten Hühner und hatten noch weitere, nicht menschliche Mitbewohner. Dieses Mini-Agrarunternehmen war zeitaufwändig und verlustreich – wenn ich also mit Schreiben eher etwas verdienen konnte als mit dem Verkauf von Hühnereiern: umso besser.
Die 1980er-Jahre begannen mit unserem Umzug von der Farm nach Toronto (unter anderem aus schulischen Gründen), mit der Wahl von Ronald Reagan zum Präsidenten der USA und mit dem Aufstieg der religiös geprägten Rechten. 1981 spukte mir erstmals ›Der Report der Magd‹ durch den Kopf, das eigentliche Schreiben schob ich allerdings bis 1984 hinaus, weil mir das Konzept zu weit hergeholt schien. Ich produzierte mehr und mehr »Gelegenheitsarbeiten« – zum einen, weil ich mit einem Schulkind nun tagsüber mehr Zeit zur Verfügung hatte, zum anderen, weil sich die Anfragen häuften. Wenn ich mir die sporadischen und wenig informativen Einträge in meinen oft arg vernachlässigten Tagebüchern anschaue, so durchzieht sie als ein Leitmotiv die ständige Klage darüber, mir zu viel aufzuladen. »Das muss ein Ende haben«, steht dort immer wieder. Manche meiner Arbeiten waren Hilferufen geschuldet, und so ging es immer weiter.
»Sag einfach Nein«, bekam ich zu hören und sagte ich mir selbst. Allerdings: Wird man zehnmal pro Jahr gebeten, einen Essay zu schreiben, und sagt zu 90 Prozent Nein dazu, bleibt ein Essay pro Jahr. Wird man hingegen vierhundertmal pro Jahr um Beiträge gebeten und lehnt weiterhin 90 Prozent davon ab – brav und standhaft, wie man nun mal ist! –, sind das immer noch vierzig Beiträge pro Jahr. In dieser Größenordnung habe ich mich durchschnittlich während der letzten Jahrzehnte bewegt. Es gibt eine Grenze. Das muss ein Ende haben.
Zurück zu unserer Chronologie: Mit dem Fall der Berliner Mauer zerbröselten sowohl der Kalte Krieg wie auch das sowjetische Staatensystem. Dies sei das Ende der Geschichte, bekamen wir zu hören: Nur mit dem Kapitalismus gehe es noch voran, Konsum und Shopping stünden an oberster Stelle, wie man lebe und sich gebe, definiere einen selbst – Frau, was willst du mehr? Ganz zu schweigen von »Minderheiten«, die in Kanada von Politikern und Regierungsangestellten, soweit es mir aus kundiger Quelle zugetragen wurde, als »multi-eths« (Menschen, die weder Französisch noch Englisch sprachen) und »visi-mins« (Nicht-»Weiße«) tituliert wurden. Beide Gruppen hatten erhebliche Ansprüche, die in den 1990er-Jahren allerdings noch nicht manifest wurden. Es regte sich etwas, es rumorte; anderswo gab es Kriege, Staatsstreiche und Konflikte, aber noch keine fulminanten Ausbrüche. »Hier bei uns ist so was nicht denkbar«, lautete weiterhin die gängige Antwort.
Mit den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon im Jahr 2001 wurde alles anders. Was bisher als sicher gegolten hatte, wurde nun infrage gestellt; auf das vermeintlich Felsenfeste war mit einem Mal kein Verlass mehr, auf bislang verteidigte Wahrheiten konnte man pfeifen. Furcht und Misstrauen bestimmten fortan das Leben.
An diesem Punkt setzt ›Brennende Fragen‹ ein.
Warum der Titel? Vielleicht, weil die Fragen, mit denen wir im einundzwanzigsten Jahrhundert bisher konfrontiert waren, mehr als dringlich sind. Natürlich denkt man das in jedem Zeitalter über die jeweiligen Krisen, aber diese Ära erscheint definitiv ein anderes Kaliber zu sein. Da ist erstens unser Planet. Verbrennt die Welt sich buchstäblich selbst? Haben wir sie in Brand gesteckt? Können wir die Feuer löschen?
Wie steht es mit der eklatanten Ungleichverteilung von Reichtum, nicht nur in Nordamerika, sondern praktisch überall? Kann ein derart kopflastiges und instabiles Modell von Dauer sein? Wie schnell werden die restlichen 99 Prozent die Nase voll haben und – bildlich gesprochen – die Bastille in Rauch und Flammen aufgehen lassen?
Dann die Demokratie. Schwebt sie in Gefahr? Was meinen wir überhaupt mit »Demokratie«? Hat es sie denn je gegeben, im Sinne von Gleichberechtigung aller Bürger? Meinen wir es ernst mit aller? Aller Geschlechter, aller Religionen, aller ethnischen Ursprünge? Ist das System, das wir Demokratie nennen, erhaltenswert – beziehungsweise, sollten wir weiter danach streben? Was meinen wir mit »Freiheit«? Wie viel darf frei geäußert werden und von wem und zu welchem Thema? Die Revolution im Bereich der sozialen Medien hat Online-Gruppierungen von Menschen, die je nachdem, ob man sie mag oder nicht, als »Bewegungen« oder »Mob« bezeichnet werden, bisher ungekannte Macht verliehen. Ist das gut, ist es schlecht oder nur eine neue Spielart der Massen, die etwas umtreibt?
»Alles niederbrennen« – ein verbreiteter Slogan in unserer Zeit – heißt das, wirklich alles?
Heißt alles beispielsweise: alle Wörter? Was ist mit den »Kreativen«, wie sie von manchen gern genannt werden? Was ist mit den Schriftstellern und ihren Werken? Sollen sie – sollen wir – nur noch Sprachrohre sein und allseits akzeptierbare Plattitüden herunterspulen, die angeblich gut für die Gesellschaft sind, oder haben wir noch andere Funktionen? Wenn sich darunter eine Funktion befindet, die anderen missfällt, sollen unsere Bücher dann verbrannt werden? Warum nicht? Es wäre nicht das erste Mal. Kein Buch ist per se unantastbar.
Dies sind einige der brennenden Fragen, die man mir im Verlauf der vergangenen beiden Jahrzehnte gestellt hat und die ich mir selbst stelle. Hier nun ein paar Antworten darauf. Oder sollte ich lieber sagen, ein paar Versuche dazu? Denn das ist ein Essay ja seiner Bedeutung nach: ein Versuch. Ein Bestreben.
Ich habe dieses Buch in fünf Teile untergliedert, die jeweils von einem Ereignis oder einem Wendepunkt bestimmt werden.
Der erste Teil beginnt mit dem Jahr 2004. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon herrschte immer noch Krieg im Irak. Ich befand mich weiterhin auf Lesereisen für ›Oryx und Crake‹ (2003), den ersten Band der ›MaddAddam‹-Trilogie, der gleich zwei Krisen zum Inhalt hat: die Klimakrise und das daraus resultierende Artensterben sowie eine durch Genspleißen herbeigeführte Pandemie. Diese Prämissen erschienen in den Jahren 2003 und 2004 weit hergeholt; mittlerweile sind sie etwas näher gerückt.
Der erste Teil endet 2009 – die Welt stand nach der schweren Finanzkrise im Oktober 2008 immer noch unter Schock, und ich hatte just in jenem Oktober ›Payback: Schulden und die Schattenseite des Wohlstands‹ veröffentlicht. (Manche glaubten, ich hätte eine Kristallkugel. Stimmt nicht.)
Der zweite Teil behandelt die Zeitspanne von 2010 bis 2013. In diesen vier Jahren regierte Obama im Weißen Haus, und die Welt erholte sich allmählich von dem Finanzcrash. Ich war hauptsächlich mit ›Die Geschichte von Zeb‹, dem dritten Teil der ›MaddAddam‹-Trilogie, beschäftigt. Wenn man ein Buch geschrieben hat, wird man oft nach dem Grund dafür gefragt – als hätte man einen Aschenbecher geklaut –, und in einem Beitrag zu diesem Teil bemühe ich mich pflichtschuldig, Rechenschaft für mein Vergehen abzulegen.
Mein Leben als Essayistin war ziemlich breit gefächert. Ich verfasste weiterhin Rezensionen, Vorwörter und – leider – auch Nachrufe. Da die Klimakrise sich als zunehmend heißeres Thema entpuppte, schrieb ich häufiger als zuvor auch darüber.
2012 wurde bei meinem Lebensgefährten Graeme Gibson beginnende Demenz diagnostiziert. »Wie lautet die Prognose?«, fragte er. »Es kann langsam voranschreiten, es kann schnell voranschreiten oder stagnieren, wir wissen es nicht«, bekam er zu hören. Ganz ähnlich stand es um die Welt. Es war eine unruhige, von Ungewissheit, jedoch nicht von irgendeiner herausragenden Katastrophe geprägte Phase. Die Menschen fürchteten sich, doch ihre Furcht blieb verschwommen. Wir hielten den Atem an. Machten weiter. Taten, als wäre alles im Lot. Und doch lag schon der Hauch eines Wandels zum Schlimmeren in der Luft.
Der dritte Teil versammelt Essays aus den Jahren 2014 bis 2016. Die 2016 anstehenden US-Präsidentschaftswahlen warfen im Vorfeld ihre Schatten. Zugleich liefen die Vorbereitungen für die Fernsehserie zu ›Der Report der Magd‹ – die eigentlichen Dreharbeiten begannen im August 2016. Als Miniserie verfilmt wurde auch ›Alias Grace‹, die Geschichte einer Gefangenen und mutmaßlichen Mörderin im neunzehnten Jahrhundert.
Von daher war Freiheit und alles ihr Zuwiderlaufende ein Thema, das mich stark beschäftigte. Um diese Zeit begann ich mit der Arbeit an ›Die Zeuginnen‹, dem Folgeband zum ›Report der Magd‹, der 2019 erschien.
Gegen Ende des Jahres 2016 hatte sich der Zeitgeist für uns spürbar verändert. Mit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA befanden wir uns nunmehr mitten in jener seltsamen, postfaktischen Welt, die wir bis 2020 bevölkerten – manche allerdings wirken wild entschlossen, auch weiterhin an ihr festzuhalten.
Der vierte Teil setzt 2017 ein, als Amerika fürchten musste, ›Der Report der Magd‹ sei am Ende keine reine Erfindung. Auf den Amtsantritt von Präsident Trump folgten umgehend und weltweit massive Demonstrationen der Frauenbewegung. In den USA gab es viel Händeringen und Besorgnis: Wie würde es weitergehen? Wie drohend war die Gefahr eines Rückschritts in Bezug auf die Rechte der Frauen? Stand uns ein autoritäres Regime bevor? Als die erste Folge von ›Der Report der Magd‹ im April ausgestrahlt wurde, mussten die Zuschauer von der Botschaft nicht lange überzeugt werden. Im selben Jahr dann wurde auch die Miniserie zu ›Alias Grace‹ gestreamt. ›Alias Grace‹ beschreibt unsere Vergangenheit, ›Der Report der Magd‹ unsere mögliche Zukunft.
Nach einem hartnäckigen Versuch, das Manuskript vorab online zu stehlen – eine der bizarreren Episoden in meinem Schriftstellerleben –, wurde ›Die Zeuginnen‹ am 10. September 2019 veröffentlicht.
In diese Zeit fiel auch der Aufstieg der #MeToo-Bewegung. Insgesamt ist ihre Wirkung meiner Meinung nach insofern positiv zu bewerten, als klar wurde, dass man ein Verhalten à la Harvey Weinstein nicht länger würde durchgehen lassen. Doch um das Für und Wider der Anprangerungen in den sozialen Medien wird immer noch debattiert, und die »Kulturkriege« toben weiter. Vor diesem Hintergrund schrieb ich, wie auch die Chronisten der Fälle Weinstein, Crosby und vieler anderer, über das, was nottat: Wahrheit, Faktenüberprüfung und Fairness.
Für Graeme und mich waren es drei schwierige Jahre. 2017 und 2018 verschlechterte sein Zustand sich schrittweise, in der ersten Hälfte von 2019 dann rasanter. Wir wussten, dass uns nur noch eine sehr begrenzte gemeinsame Zeit blieb – Monate, nicht etwa Jahre. Graeme wollte abtreten, solange er noch er selbst war, und dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Eineinhalb Tage nach der ersten öffentlichen Lesung aus ›Die Zeuginnen‹ im National Theatre in London erlitt er eine massive Gehirnblutung, fiel ins Koma und starb fünf Tage später.
Manche hat vielleicht überrascht, dass ich nach seinem Tod meine Lesereise fortsetzte. Doch wenn Sie zwischen Hotelzimmern, Veranstaltungen und vielen Menschen einerseits und einem leeren Haus mit einem freien Stuhl wählen müssten, wofür hätten Sie sich da wohl entschieden, liebe Leserinnen und Leser? Das leere Haus und der freie Stuhl waren natürlich nur aufgeschoben. Sie holten mich später ein, wie das eben in solchen Fällen ist.
Der fünfte Teil beginnt 2020 – ein Wahljahr in den Vereinigten Staaten, und zwar ein reichlich bizarres. Hinzu kam Covid-19, das ab März ernsthaft zuschlug.
Ich wurde um eine Reihe von Beiträgen zum Thema Covid gebeten – was tat ich den ganzen Tag, was waren unsere Perspektiven?
Vor allem aber beschäftigte ich mich mit totalitären Systemen; die weltweite Tendenz in diese Richtung war ebenso erschreckend wie diverse autoritäre Ansätze in den Vereinigten Staaten. Erlebten wir als Zeitzeugen schon wieder den Zerfall einer Demokratie?
Im Herbst 2020 wurde mein Gedichtband ›Innigst/Dearly‹ veröffentlicht; ein Beitrag im fünften Teil hat ihn zum Inhalt. Meine Gedanken kreisten sehr um Graeme, und es war mir eine Freude, die Vorwörter zu seinem ›Bedside Book of Birds‹ und seinen letzten zwei Romanen zu schreiben, die beide wieder aufgelegt wurden.
Ich beende ›Brennende Fragen‹ mit Essays über zwei Schlüsselfiguren zum Thema Umweltschutz – Rachel Carson und Barry Lopez; ihr Wirken, so meine Voraussage, wird sich angesichts der immer unsichereren Zukunft, der wir auf unserem Planeten entgegensehen, als zunehmend wichtig erweisen. Ihre Nachfahren und die vielen anderen Stimmen, die uns schon früh vor der wachsenden Klimakrise gewarnt haben, gehören der jungen Generation der Post-Millennials an, mit Greta Thunberg als bekanntestem Sprachrohr. Als um die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erstmals Beiträge von Rachel Carson veröffentlicht wurden, war es ein Leichtes, ihre Bedenken zu leugnen, zu umgehen und auf die lange Bank zu schieben, doch dies ist heute nicht mehr möglich – wenn wir als Gattung auf diesem Planeten am Leben bleiben wollen.
Die Post-Millennials werden schon bald Machtpositionen innehaben. Hoffen wir, dass sie ihre Macht weise gebrauchen. Und zwar bald.
TEIL I
2004 BIS 2009
WAS PASSIERT DANN?
›DER EISIGE SCHLAF‹
Vorwort
(2004)
›Der eisige Schlaf‹ von Owen Beattie und John Geiger gehört zu den Büchern, die nicht mehr weichen wollen, wenn sie einmal Eingang in unsere Fantasie gefunden haben. Das Buch erregte großes Aufsehen, widmete es sich doch den erstaunlichen Enthüllungen, die Dr. Owen Beattie gelungen waren und zu denen die Erkenntnis zählte, dass zu dem tödlichen Ausgang der Franklin-Expedition von 1845 mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bleivergiftung beigetragen hatte.
Ich las ›Der eisige Schlaf‹ im Jahr seines Erscheinens bei uns, 1987. Die Bilder darin bescherten mir Albträume. Sie und die Geschichte selbst nahm ich als Subtext und erweiterte Metapher in eine Kurzgeschichte mit dem Titel Das Bleizeitalter auf, die 1991 in der Anthologie ›Tipps für die Wildnis‹ veröffentlicht wurde. Neun Jahre später lernte ich bei einer Schiffstour in der Arktis John Geiger, einen der beiden Autoren, kennen. Ich hatte sein Buch gelesen, er wiederum meins, und es hatte ihn zu weiteren Überlegungen veranlasst, welche Rolle Blei bei Nordpolarexpeditionen und ganz allgemein bei gescheiterten Seereisen im neunzehnten Jahrhundert gespielt haben mochte.
Franklin, sagte Geiger, war der Kanarienvogel im Bergwerk, auch wenn man dies zunächst nicht begriff: Bis in die letzten Jahre des neunzehnten Jahrhunderts erlagen ganze Schiffsmannschaften auf langen Reisen dem giftigen Blei in Dosennahrung. Die Ergebnisse seiner Recherchen nahm Geiger in die erweiterte Neuausgabe von ›Der eisige Schlaf‹ auf. Das neunzehnte Jahrhundert, sagte er, sei wahrhaftig ein »Bleizeitalter« gewesen. So verflechten sich Leben und Kunst.
Zurück zum Vordergrund. Im Herbst 1984 erregte ein faszinierendes Foto in Zeitungen aus aller Welt große Aufmerksamkeit. Es zeigte einen jungen Mann, der weder mausetot noch quicklebendig zu sein schien. Er trug archaische Gewänder und war ganz und gar von Eis umgeben. Das Weiße seiner halb geschlossenen Augen hatte die Farbe von Tee. Seine Stirn war dunkelblau verfärbt. Trotz der abmildernden und respektvollen Adjektive, welche die Autoren von ›Der eisige Schlaf‹ ihm beigaben, hätte man in diesem Mann niemals einen harmlosen Burschen gesehen, der gerade einnickt. Er wirkte wie eine Mischung aus einem ›Raumschiff Enterprise‹ entsprungenen Außerirdischen und dem Opfer eines Fluchs in einem zweitklassigen Film: kein Mensch, mit dem man Tür an Tür wohnen möchte, vor allem nicht bei Vollmond.
Wann immer die gut erhaltene Leiche eines vor Urzeiten Verstorbenen gefunden wird – eine ägyptische Mumie, ein gefriergetrocknetes Menschenopfer der Inka, eine ledrige skandinavische Moorleiche, der berühmte Eismensch aus den europäischen Alpen –, löst sie eine ähnliche Faszination aus. Da hat sich jemand der allgemeinen Regel »Asche zu Asche, Staub zu Staub« widersetzt und ist noch immer als individuelles Menschenwesen zu erkennen, wo doch die meisten anderen längst nur noch Erde und Knochen sind. Im Mittelalter vermutete man hinter unnatürlichen Ergebnissen ebenso unnatürliche Ursachen, und solch eine Leiche wäre entweder als etwas Heiliges verehrt oder gepfählt worden. So sehr wir heutzutage auch um Rationalität bemüht sind, etwas aus den Horrorklassikern bleibt uns erhalten: Die Mumie wandelt, der Vampir erwacht. Es fällt mehr als schwer zu glauben, dass jemand, der so nahezu lebendig wirkt, von uns nichts mitbekommt. Wir sind uns sicher, dass ein solches Wesen ein Botschafter sein muss. Es ist durch die Zeit gereist, die ganze lange Strecke aus seiner Ära bis in unsere, um uns etwas mitzuteilen, das wir unbedingt erfahren möchten.
Der Mann auf dem sensationellen Foto war John Torrington, einer von den dreien, die 1845 bei der unseligen Franklin-Expedition als Erste starben. Erklärtes Ziel der Expedition war es, die Nordwestpassage zum Orient zu finden und sie für Britannien zu beanspruchen – letztendlich überlebte kein einziger Teilnehmer dieses Unternehmen. Torrington war in einem sorgsam ausgehobenen Grab beigesetzt worden, tief im Permafrost an der Küste von Beechey Island, Franklins Basislager im ersten Winter der Expedition. Die beiden anderen – John Hartnell und William Braine – wurden neben Torrington begraben. Der Anthropologe Owen Beattie und sein Team exhumierten die drei Leichen mühevoll, weil sie ein seit Langem bestehendes Rätsel lösen wollten: Warum hatte Sir John Franklins Expedition solch ein katastrophales Ende genommen?
Beatties Suche nach Hinweisen auf die restlichen Teilnehmer der Expedition, die Freilegung der drei bekannten Gräber und seine nachfolgenden Entdeckungen wurden zunächst in einer TV-Dokumentarsendung und dann, drei Jahre nach der Erstveröffentlichung des Fotos, in ›Der eisige Schlaf‹ festgehalten. Dass die Geschichte – hundertvierzig Jahre nachdem Franklin in Stromness auf den Orkney-Inseln die Süßwasserfässer aufgefüllt hatte, um dann seinem rätselhaften Schicksal entgegenzusegeln – immer noch auf ein solch breites Interesse stieß, ist als Verneigung vor der außerordentlichen Beständigkeit der Franklin-Legende zu werten.
Viele Jahre lang war eben das Rätselhafte an diesem Fall die stärkste Zugnummer. Zunächst schien es, als hätten sich Franklins zwei Schiffe mit den unheilschwangeren Namen Terror und Erebus (der griechische Gott der Finsternis) in Luft aufgelöst. Selbst nach der Entdeckung der Gräber von Torrington, Hartnell und Braine fand sich keine Spur von ihnen. Es ist einigermaßen entnervend, wenn Menschen – ob tot oder lebendig – nicht zu lokalisieren sind. Das bringt unser Raumgefühl durcheinander – irgendwo müssen die Vermissten ja sein, aber wo? Bei den alten Griechen fanden die Toten, die nicht geborgen und zeremoniell beigesetzt wurden, keine Aufnahme in die Unterwelt, sondern verweilten als ruhelose Geister unter den Lebenden. Und so ist es immer noch mit den Verschollenen: Sie suchen uns heim. Das viktorianische Zeitalter hatte eine besondere Neigung für solche Heimsuchungen, wie Tennysons Gedicht In Memoriam als beispielhafte Klage um einen auf See gebliebenen Mann bezeugt.
Noch interessanter wurde Sir John Franklins Geschichte durch die arktische Landschaft, die den Leiter, die Schiffe und die Männer in sich aufgesogen hatte. Bis zum neunzehnten Jahrhundert waren mit Ausnahme von Walfängern nur sehr wenige Europäer je im hohen Norden gewesen. Er zählte zu den gefahrvollen Regionen, die ein Publikum faszinierten, das noch im Geist des literarischen Romantizismus schwelgte – ein Ort, an dem ein Held allen Widrigkeiten trotzte, unsäglich litt und mit außergewöhnlicher Seelenstärke gegen Übermächte ankämpfte. Die Arktis war öde, einsam und leer – wie die winddurchtosten Heidelandschaften und Furcht einflößenden Berge, die Liebhaber des Erhabenen so schätzten. Doch die Arktis war auch eine machtvolle Anderswelt, man stellte sie sich als schönes und verlockendes, potenziell aber auch unheilvolles Feenland vor: das Reich einer Schneekönigin mit allem Drum und Dran – mit Lichteffekten wie aus einer anderen Sphäre, mit glitzernden Eispalästen, Fabeltieren – Narwale, Eisbären, Walrösser – und zwergenhaften Bewohnern in exotischen Fellkostümen. Zahlreiche Zeichnungen aus jener Periode bezeugen die Faszination, die von jener Region ausging. Die Viktorianer waren ganz versessen auf Feen jeder Spielart; sie malten sie, schrieben Geschichten über sie und gingen mitunter sogar so weit, an sie zu glauben. Sie kannten die Regeln: Wer sich in eine Anderswelt begibt, geht ein hohes Risiko ein. Du könntest von nicht menschlichen Lebewesen gefangen genommen werden. Du könntest in eine Falle geraten. Womöglich kommst du nie wieder heraus.
Seit Franklins Verschwinden hat jedes Zeitalter sich seinen Franklin erschaffen, der den jeweiligen Umständen und Bedürfnissen entsprach. Vor Beginn der Expedition gab es den »echten« Franklin – so könnten wir ihn nennen – oder gar den Ur-Franklin: vielleicht nicht der knackigste Keks in der Packung, so das Urteil seiner Kollegen, aber solide und erfahren, auch wenn manche seiner Erfahrungen sich einem Fehlurteil verdankten (wie die unselige Reise auf dem Coppermine River 1819 bezeugt). Dieser Franklin wusste, dass seine aktive Laufbahn zu Ende ging, und sah in der Möglichkeit, die Nordwestpassage zu entdecken, die letzte Chance für dauerhaften Ruhm: Fortgeschrittenen Alters und behäbig, war er nicht gerade die Traumvorstellung eines romantischen Helden.
Dann kam der Interims-Franklin; er trat auf den Plan, nachdem der erste Franklin nicht zurückgekehrt war und man in England begriff, dass irgendetwas entsetzlich schiefgelaufen sein musste. Dieser Sir John Franklin war weder tot noch lebendig, und dass er möglicherweise beides sein könnte, machte ihn in den Augen der britischen Öffentlichkeit zu einer bedeutsamen Person. In dieser Zeit legte man ihm das Eigenschaftswort tapfer zu, so, als hätte er bei einer militärischen Großtat mitgewirkt. Es wurden Belohnungen ausgesetzt und Suchtrupps ausgesandt. Auch von diesen Männern kamen einige nicht mehr zurück.
Der nächste Sir John Franklin, den wir Franklin im Höhenflug nennen könnten, erschien, nachdem feststand, dass er und all seine Männer umgekommen waren. Und nicht nur das, sie waren verreckt, sogar jämmerlich verreckt. Doch viele Europäer hatten in der Arktis unter ähnlich fatalen Bedingungen überlebt. Warum war genau diese Gruppe zugrunde gegangen, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Terror und die Erebus die bestausgerüsteten Schiffe ihrer Zeit und technisch auf dem neuesten Stand waren?
Eine Niederlage von solchem Ausmaß verlangte nach Reaktionen in gleicher Stärke. Berichte, wonach etliche von Franklins Männern einige andere aus der Mannschaft verzehrt hätten, wurden rigoros abgewürgt; die Berichterstatter – so etwa der kühne John Rae, dessen Geschichte Ken McGoogan in seinem 2002 erschienenen Buch ›Fatal Passage‹ erzählt – wurden von der Presse niedergemacht; und die Inuit, die Zeugen der schaurigen Vorfälle gewesen waren, stempelte man als bösartige Wilde ab. Angeführt wurde die Kampagne zur Ehrenrettung Franklins und seiner Mitsegler von Lady Jane Franklin, deren gesellschaftliche Stellung auf der Kippe stand: Die Witwe eines Helden ist nicht ganz das Gleiche wie die Witwe eines Kannibalen. Dank Lady Janes Bemühungen um Einflussnahme schwoll Franklin, in absentia, auf Zeppelingröße an. Er galt nun – eine fragwürdige Entscheidung – als Entdecker der Nordwestpassage, erhielt eine Gedenktafel in Westminster Abbey und eine Grabinschrift von Tennyson.
Nach einer derartigen Überhöhung ließ die Gegenreaktion nicht lange auf sich warten. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts bekamen wir es mit Franklin dem Schwachkopf zu tun – angeblich so vertrottelt, dass er sich kaum selbst die Schnürsenkel binden konnte. Franklin war dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen – das Eis, das im Sommer normalerweise schmolz, hatte dies nicht nur ein, sondern gleich drei Jahre lang nicht getan –, doch in der Lesart von Franklin dem Schwachkopf zählte dies wenig. Die Expedition wurde als Musterbeispiel europäischer Anmaßung gegenüber der Natur hingestellt. Sir John war nichts mehr als einer dieser Arktisaffen, die in Schwierigkeiten gerieten, weil sie nicht nach den Regeln der Ureinwohner lebten und deren Ratschläge nicht befolgten – »Geh da nicht hin« wäre unter den gegebenen Umständen Ratschlag Nr. 1 gewesen.
Doch das Ansehen gleicht in seiner Gesetzmäßigkeit einem Bungeeseil: Man stürzt in die Tiefe und schnellt wieder empor, ein jedes Mal mit kleinerem Ausschlag. 1983 veröffentlichte Sten Nadolny ›Die Entdeckung der Langsamkeit‹. In diesem Roman finden wir einen nachdenklichen Franklin – nicht direkt ein Held, aber ein ungewöhnliches Talent und ganz gewiss kein Schurke. Die Rehabilitierung war im Gang.
Dann kamen Owen Beatties Entdeckungen und ihr schriftlicher Niederschlag in ›Der eisige Schlaf‹. Nunmehr stand fest, dass Franklin kein arroganter Idiot gewesen war. Stattdessen wurde er zu einem Opfer dessen, was eigentlich typisch für das zwanzigste Jahrhundert war: schlechte Verpackung. Die Dosennahrung an Bord hatte seine Männer vergiftet, geschwächt und ihre Urteilskraft umwölkt. 1845 waren Konservendosen noch recht neu auf dem Markt, und diese Dosen waren schlampig mit Blei versiegelt, das schließlich einsickerte. Doch damals wurden die Symptome einer Bleivergiftung nicht als solche erkannt, weil sie leicht mit denen von Skorbut zu verwechseln waren. Man kann Franklin also kaum der Nachlässigkeit beschuldigen, und Beatties Enthüllungen entlasteten ihn in gewisser Weise.
Entlastungen gab es auch noch in zwei anderen Punkten. Auf den Spuren von Franklin und seinen Männern erfuhr Beatties Team die physischen Bedingungen, denen die überlebenden Mitglieder von Franklins Mannschaften ausgesetzt gewesen waren, am eigenen Leib. Selbst im Sommer zählt King William Island zu den widrigsten und trostlosesten Orten auf Erden. Niemandem wäre gelungen, was diese Männer versucht hatten – sich auf dem Landweg in Sicherheit zu bringen. Geschwächt und benebelt, wie sie waren, gab es für sie keine Hoffnung. Dass sie es nicht schafften, war nicht ihre Schuld.
Die dritte Entlastung war – unter dem Aspekt der historischen Gerechtigkeit betrachtet – vielleicht die wichtigste. Nach mühseliger Suche mit zunehmend tauben Fingern fand Beatties Team menschliche Knochen mit Messerkerben und Schädel ohne Gesichter. Also hatten John Rae und seine Zeugen von den Inuit mit ihrer Behauptung, die letzten Mitglieder von Franklins Trupp hätten Kannibalismus betrieben, doch recht gehabt. Nun war ein Großteil des Rätsels um Franklin gelöst.
Seither ist ein neues Rätsel aufgetaucht: Warum ist Franklin in Kanada zu solch einer Ikone geworden? Wie Geiger und Beattie berichten, waren die Kanadier an dem Ganzen anfangs nicht sonderlich interessiert: Franklin war Brite, der Norden war weit weg, und das kanadische Publikum gab komischen Vögeln wie Tom Thumb den Vorzug. Doch im Lauf der Jahrzehnte nahmen die Kanadier Franklin als einen der Ihren auf. Da gab es zum Beispiel Folksongs wie The Ballad of Sir John Franklin, den in England kaum jemand mehr kennt, und Stan Rogers bekanntes Lied Northwest Passage. Auch Autoren nahmen sich seiner an. Gwendolyn MacEwens Radiodrama ›Terror and Erebus‹ wurde zu Beginn der 1960er-Jahre erstmals ausgestrahlt; der Dichter Al Purdy war von Franklin fasziniert; der Romanautor und Satiriker Mordecai Richler betrachtete ihn als Ikone, die reif für den Bildersturm sei, und fügte in seinem Roman ›Solomon Gursky war hier‹ den Beständen von Franklins Schiffen ein Versteck mit weiblicher Transvestitenkleidung bei. Wie lässt sich eine solche Vereinnahmung erklären? Identifizieren wir uns mit gutwilligen Nichtgenies, die von schlechtem Wetter und bösen Nahrungsmittellieferanten auf tragische Weise zugrunde gerichtet werden? Vielleicht. Vielleicht verhält es sich aber auch so, wie es in Porzellanläden immer heißt: Was du zerbrichst, gehört dir. Kanadas Norden hat Franklin zerbrochen und damit offenbar so etwas wie einen Besitztitel erworben.
Es freut mich sehr, dass ›Der eisige Schlaf‹ in dieser überarbeiteten und erweiterten Ausgabe wieder auf den Bücherregalen zu finden ist. Ich zögere, ihn als bahnbrechend zu bezeichnen, um nicht eines Wortspiels verdächtigt zu werden, und doch war es genau das – bahnbrechend. Dank diesem Buch wissen wir sehr viel mehr über ein herausragendes Ereignis in der Geschichte der Erkundung des Nordens. Es ist auch ein Tribut an die ungebrochene Zugkraft dieser Geschichte, die alle Formen durchlaufen hat, die eine Geschichte nur annehmen kann. Sie war Rätsel, Mutmaßung, Gerücht, Legende, heroisches Abenteuer und nationale Ikonografie; hier, in ›Der eisige Schlaf‹, wird sie zum Kriminalroman, umso packender, als er wahr ist.
›FROM EVE TO DAWN‹
(2004)