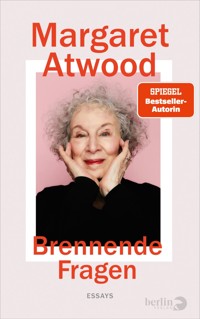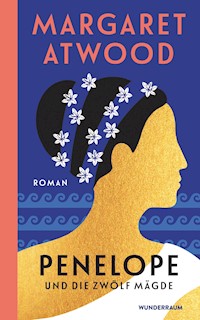11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die provozierende Vision eines totalitären Staats, in dem Frauen keine Rechte haben: Die Magd Desfred besitzt etwas, was ihr alle Machthaber, Wächter und Spione nicht nehmen können, nämlich ihre Hoffnung auf ein Entkommen, auf Liebe, auf Leben ... Margaret Atwoods »Report der Magd« ist ein beunruhigendes und vielschichtiges Meisterwerk, das längst zum Kultbuch avanciert ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Mary Webster und Perry Miller
Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Helga Pfetsch
ISBN 978-3-492-97059-4
April 2017
Die Originalausgabe erschien 1985 unter dem Titel »The Handmaid’s Tale« im Verlag McClelland & Stewart, Houghton Mifflin, 1985; Cape, 1985
© by O.W. Toad Ltd. 1985
Copyright für die deutsche Übersetzung von Helga Pfetsch :
© by Claassen Verlag GmbH, Düsseldorf 1987
Neuauflage im Piper Verlag GmbH, München 2017
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Zero Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: St. Moritz, 1929 (oil on panel), Lempicka, Tamara de (1898–1980)/Musee des Beaux-Arts, Orleans, France/ Bridgman Images
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Da Rahel sah, dass sie dem Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder; wo nicht, so sterbe ich.
Jakob aber ward sehr zornig auf Rahel und sprach: Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will.
Sie aber sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha: Gehe zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie aufgebaut werde.
1. Moses 30, 1–3
Doch ich, der ich mich viele Jahre lang damit aufgerieben hatte, eitle, müßige utopische Gedanken anzubieten, und schließlich vollständig daran verzweifelt war, verfiel zu meinem Glück auf diesen Vorschlag …
Jonathan Swift,
Ein bescheidener Vorschlag
In der Wüste gibt es kein Schild, das besagt:
Du sollst keine Steine essen.
Sufi-Sprichwort
INacht
Kapitel eins
Wir schliefen in dem Raum, der einst die Turnhalle gewesen war. Der Fußboden war aus Holz, versiegelt, mit aufgemalten Linien und Kreisen für die Spiele, die früher dort gespielt wurden; die Ringe für die Basketballnetze waren noch an ihrem Platz, doch die Netze fehlten. Eine Empore verlief rings um den Raum, für die Zuschauer, und ich meinte, ich könnte, schwach wie ein Nachbild, den säuerlichen Schweißgeruch riechen, durchsetzt vom süßlichen Kaugummi- und Parfümduft der zuschauenden Mädchen – Mädchen in Filzröcken, wie ich von Bildern wusste, später in Miniröcken, dann Shorts, dann mit einem einzigen Ohrring, mit stachligem, grün gesträhntem Haar. Vermutlich hatten hier Tanzfeste stattgefunden; die Musik klang noch nach, ein Schicht um Schicht beschriebenes Palimpsest nicht gehörter Töne, Stil auf Stil, ein untergründiger Trommelwirbel, ein einsamer Klagelaut, Blumengirlanden aus Seidenpapier, Pappteufel, eine mit Spiegeln besetzte, sich drehende Kugel, die einen Schnee von Licht über die Tanzenden stäubte.
Es roch nach früherem Sex und nach Einsamkeit in dem Raum und nach Erwartung, Warten auf etwas, das weder Form noch Namen hatte. Ich erinnere mich an dieses Sehnen nach etwas, das immer drauf und dran war, sich zu ereignen, und doch niemals das Gleiche war wie die Hände, die dort und damals auf uns lagen, auf dem Rücken, im Kreuz, oder draußen auf dem Parkplatz oder im Fernsehraum, wo der Ton leise gestellt war und nur die Bilder über die sich aufbäumenden Körper flimmerten.
Wir sehnten uns nach der Zukunft. Woher hatten wir das, dieses Talent zur Unersättlichkeit? Es lag in der Luft; und es lag jetzt noch immer in der Luft, ein Nachhall, wenn wir zu schlafen versuchten, in Feldbetten, die in Reihen aufgestellt waren, mit genügend Abstand, damit wir nicht miteinander sprechen konnten. Wir hatten Flanellbetttücher wie kleine Kinder und Armeedecken, alte, auf denen noch U. S. stand. Wir falteten unsere Kleider ordentlich zusammen und legten sie auf die Hocker an den Bettenden. Die Lichter waren schwächer gestellt, wurden aber nicht gelöscht. Tante Sara und Tante Elizabeth machten die Runde; sie hatten elektrische Stachelstöcke wie zum Viehtreiben, die an ihren Ledergürteln hingen.
Jedoch keine Schusswaffen. Selbst ihnen wurden keine Waffen anvertraut. Pistolen waren den Wachen vorbehalten, die aus der Heerschar der Engel sorgfältig ausgesucht wurden. Die Wachen durften das Gebäude nicht betreten, außer wenn sie gerufen wurden, und wir durften es nicht verlassen, außer zu unseren Spaziergängen zweimal täglich, bei denen wir zu zweit um das Footballfeld gingen, das jetzt von einem mit Stacheldraht gekrönten Kettengliedzaun umgeben war. Die Engel standen draußen, mit dem Rücken zu uns. Sie waren für uns Gegenstand der Furcht, aber ebenso auch Gegenstand von etwas anderem. Wenn sie doch herüberschauen würden! Wenn wir doch mit ihnen sprechen könnten! Man könnte etwas tauschen, dachten wir, einen Handel abschließen, Geschäfte machen, immerhin hatten wir noch unsere Körper. Das war unser Tagtraum.
Wir lernten, fast lautlos zu flüstern. Im Halbdunkel konnten wir die Arme ausstrecken, wenn die Tanten nicht hersahen. Wir konnten einander über den Abstand hinweg mit den Fingerspitzen berühren. Wir lernten, von den Lippen zu lesen, auf der Seite liegend, den Kopf flach auf dem Bett, einander auf den Mund blickend. So tauschten wir Namen aus, von Bett zu Bett:
Alma. Janine. Dolores. Moira. June.
IIEinkaufen
Kapitel zwei
Ein Stuhl, ein Tisch, eine Lampe. Darüber, an der weißen Zimmerdecke, ein Relief-Ornament: ein Kranz und in der Mitte eine leere Fläche, zugegipst, wie die Stelle in einem Gesicht, wo ein Auge herausgenommen worden ist. Dort muss einmal ein Kronleuchter gehangen haben. Sie haben alles entfernt, woran man einen Strick befestigen könnte.
Ein Fenster, zwei weiße Gardinen. Unter dem Fenster ein Fenstersitz mit einem kleinen Kissen. Wenn das Fenster einen Spalt geöffnet ist – es lässt sich nur einen Spalt öffnen –, kann die Luft herein und die Gardinen bewegen. Ich kann auf dem Stuhl sitzen oder auf dem Fenstersitz, mit gefalteten Händen, und zuschauen. Auch Sonnenlicht strömt durch das Fenster herein und fällt auf den Fußboden, der aus Holz ist, schmale Dielenbretter, auf Hochglanz poliert. Ich rieche das Bohnerwachs. Auf dem Fußboden liegt ein Teppich, oval, aus Stoffresten geflochten. Das ist die Note, die sie mögen: Volkskunst, archaisch, von Frauen in ihrer Freizeit gemacht aus Dingen, die sonst nicht mehr zu gebrauchen sind. Eine Rückkehr zu traditionellen Werten. Nichts entbehrt, wer der Verschwendung wehrt. Ich werde nicht verschwendet. Warum entbehre ich so viel?
An der Wand über dem Stuhl ein Bild, gerahmt, aber ohne Glas: Blumen, blaue Iris, die Reproduktion eines Aquarells. Blumen sind noch erlaubt. Ob alle von uns das gleiche Bild haben, den gleichen Stuhl, die gleichen weißen Vorhänge? Eigentum der Regierung?
Stellt euch vor, ihr wärt beim Militär, sagte Tante Lydia.
Ein Bett. Schmal, die Matratze mittelhart, darüber eine weiße Wollflockendecke. Nichts spielt sich in diesem Bett ab als Schlaf. Oder Schlaflosigkeit. Ich versuche, nicht zu viel zu denken. Wie manches andere neuerdings muss auch das Denken rationiert werden. Es gibt vieles, was kein Nachdenken verträgt. Nachdenken kann dir die Chancen verderben, und ich beabsichtige durchzuhalten. Ich weiß, warum vor dem Aquarell mit der blauen Iris kein Glas ist und warum das Fenster sich nur einen Spaltbreit öffnen lässt und warum die Fensterscheibe aus bruchsicherem Glas ist. Dass wir weglaufen, davor haben sie keine Angst. Wir würden nicht weit kommen. Es sind die anderen Fluchtwege, die, die wir in uns selbst öffnen können, sofern ein scharfer Gegenstand zur Hand ist.
Nun ja. Abgesehen von solchen Kleinigkeiten, könnte dies ein Gästezimmer in einem College sein, für die weniger vornehmen Besucher. Oder ein Zimmer in einer Pension, wie es sie in früheren Zeiten gab, für Damen in beschränkten Verhältnissen. Genau das sind wir jetzt. Die Verhältnisse sind beschränkt worden – für diejenigen von uns, die noch Verhältnisse haben.
Immerhin, ein Stuhl, Sonne, Blumen: Das darf man nicht von der Hand weisen. Ich bin am Leben, ich lebe, ich atme, ich strecke die Hand aus, geöffnet, ins Sonnenlicht. Ich bin hier nicht im Gefängnis, sondern ich genieße ein Privileg, wie Tante Lydia sagte, die in das Entweder-oder verliebt war.
Die Glocke, die die Zeit misst, schlägt. Die Zeit wird hier mit Glocken gemessen, wie einstmals in Nonnenklöstern. Ebenfalls wie im Nonnenkloster gibt es hier nur wenige Spiegel.
Ich stehe von meinem Stuhl auf und schiebe die Füße vorwärts ins Sonnenlicht, in ihren roten Schuhen, die keine Tanzschuhe sind, sondern flache Absätze haben, weil das besser für die Wirbelsäule ist. Die roten Handschuhe liegen auf dem Bett. Ich nehme sie und streife sie über die Hände, Finger für Finger. Alles, außer den Flügeln, die mein Gesicht umgeben, ist rot: die Farbe des Bluts, die uns kennzeichnet. Der Rock ist knöchellang, weit, zu einer flachen Passe gerafft, die sich über die Brüste spannt; die Ärmel sind weit. Die weißen Flügel sind ebenfalls vorgeschrieben: Sie sollen uns am Sehen hindern, aber auch am Gesehenwerden. Rot hat mir noch nie gestanden, es ist nicht meine Farbe. Ich nehme den Einkaufskorb und hänge ihn mir über den Arm.
Die Tür des Zimmers – nicht meines Zimmers, ich weigere mich, mein zu sagen – ist nicht zugeschlossen. Sie schließt nicht einmal richtig. Ich gehe hinaus in den gebohnerten Flur. In der Mitte ein Läufer, blassrosa. Wie ein Pfad durch den Wald, wie ein Teppich für königlichen Besuch weist er mir den Weg.
Der Läufer knickt ab und führt die Treppe hinunter, und ich folge ihm, eine Hand auf dem Geländer, das einst ein Baum war und in einem anderen Jahrhundert gedrechselt und zu warmem Glanz gerieben wurde. Spätviktorianisch ist das Haus, ein Familienwohnhaus, für eine große, reiche Familie erbaut. In der Diele steht eine großväterliche Standuhr, die Zeit austeilt, und dann kommt die Tür zu dem matronenhaften Wohnzimmer mit seinen fleischfarbenen Tönen und Anspielungen. Ein Wohnzimmer, in dem ich nicht wohne, sondern nur stehe oder knie. Am Ende der Diele, über der Haustür, befindet sich ein fächerförmiges Buntglasfenster: Blumen, rote und blaue.
Bleibt noch der Spiegel an der Dielenwand. Wenn ich den Kopf so drehe, dass die weißen Flügel, die mein Gesicht rahmen, meinen Blick in seine Richtung lenken, kann ich ihn sehen, während ich die Treppe hinuntergehe, rund, konvex, ein Pfeilerspiegel, wie ein Fischauge, und mich selbst darin, ein verzerrter Schatten, eine Parodie, eine Märchengestalt in einem roten Umhang, absteigend zu einem Moment der Unbekümmertheit, die das Gleiche ist wie Gefahr. Eine Ordensschwester, in Blut getaucht.
Am Fuß der Treppe befindet sich ein Hut- und Schirmständer aus Bugholz, lange, gerundete Holzsprossen, die sich sanft zu Haken in der Form sich öffnender Farnwedel emporschwingen. Mehrere Schirme stehen darin: ein schwarzer für den Kommandanten, ein blauer für die Frau des Kommandanten und der für mich bestimmte, der rot ist. Ich lasse den roten Schirm stehen, denn vom Blick aus dem Fenster weiß ich, dass die Sonne scheint. Ich überlege, ob die Frau des Kommandanten wohl im Wohnzimmer sitzt. Sie sitzt nicht immer. Manchmal höre ich, wie sie hin und her geht, ein schwerer Schritt und dann ein leichter und das leise Pochen ihres Gehstocks auf dem altrosa Teppich.
Ich gehe durch die Diele, an der Wohnzimmertür und an der Tür, die ins Esszimmer führt, vorbei. Ich öffne die Tür am Ende der Diele und gehe hindurch in die Küche. Hier herrscht nicht mehr der Geruch nach Möbelpolitur. Rita ist da. Sie steht am Küchentisch, dessen Platte mit weißer, angeschlagener Emaille überzogen ist. Sie trägt ihr übliches Martha-Kleid, das dunkelgrün ist, wie ein Chirurgenkittel in der Zeit davor. Das Kleid ist im Schnitt meinem sehr ähnlich, lang und verhüllend, aber mit einem Servierschürzchen davor und ohne die weißen Flügel und den Schleier. Sie legt den Schleier an, wenn sie ausgeht, obwohl sich niemand weiter darum zu kümmern scheint, wer das Gesicht einer Martha zu sehen bekommt. Ihre Ärmel sind bis zu den Ellbogen aufgekrempelt, sodass man ihre braunen Arme sieht. Sie ist dabei, Brot zu backen, und teilt gerade den Teig ein, ehe sie die Laibe ein letztes Mal kurz knetet und formt.
Rita sieht mich und nickt, ob zum Gruß oder einfach nur zum Zeichen, dass sie meine Anwesenheit wahrgenommen hat, ist schwer zu sagen. Sie wischt sich ihre mehligen Hände an der Schürze ab und sucht in der Küchenschublade nach dem Gutscheinheft. Stirnrunzelnd reißt sie drei Gutscheine heraus und gibt sie mir. Ihr Gesicht könnte freundlich sein, wenn sie lächeln würde. Doch das Stirnrunzeln ist nicht persönlich gemeint: Es ist das rote Kleid, was ihr missfällt, und das, wofür es steht. Sie meint, ich wäre womöglich ansteckend, wie eine Krankheit oder irgendein anderes Unglück.
Manchmal horche ich an geschlossenen Türen. In der Zeit davor hätte ich das nie getan. Ich horche nicht lange, weil ich nicht dabei ertappt werden möchte. Einmal habe ich jedoch gehört, wie Rita zu Cora sagte, sie selber würde sich nicht derartig entwürdigen.
Von dir verlangt es ja auch keiner, sagte Cora. Im Übrigen, was könntest du dagegen tun, wenn es von dir verlangt würde?
In die Kolonien gehen, sagte Rita. Man hat die Wahl.
Zu den Unfrauen, und dort verhungern und weiß Gott was sonst?, sagte Cora. Dich möchte ich sehen!
Sie palten Erbsen aus; sogar durch die fast geschlossene Tür hörte ich das leichte Aufprallen der harten Erbsen, die in die Metallschüssel fielen. Ich hörte, wie Rita ein Grunzen oder einen Seufzer von sich gab, Protest oder Zustimmung.
Immerhin tun sie es für uns alle, sagte Cora. Oder behaupten es jedenfalls. Wenn ich mich nicht hätte sterilisieren lassen, hätte es auch mich treffen können, wäre ich, sagen wir, zehn Jahre jünger. So schlimm ist es auch wieder nicht. Schwere Arbeit kannst du es nicht gerade nennen.
Besser sie als ich, sagte Rita, und ich öffnete die Tür. Ihre Gesichter sahen so aus, wie Gesichter von Frauen aussehen, die hinter deinem Rücken über dich gesprochen haben und denken, du hast es gehört: verlegen, aber auch ein bisschen herausfordernd, als hätten sie ein Recht darauf. An diesem Tag war Cora liebenswürdiger zu mir als sonst, Rita dagegen mürrischer.
Heute würde ich, trotz Ritas verschlossenen Gesichts und ihrer zusammengepressten Lippen, lieber hierbleiben, in der Küche. Cora würde vielleicht dazukommen, von irgendwoher im Haus, ihre Flasche Zitronenöl und ihr Staubtuch in der Hand, und Rita würde Kaffee kochen – in den Häusern der Kommandanten gibt es noch echten Kaffee –, und wir würden an Ritas Küchentisch sitzen, der genauso wenig Ritas Küchentisch ist, wie mein Tisch meiner ist, und wir würden reden, über Schmerzen und Beschwerden, Krankheiten, über unsere Füße, unsere Rücken, über all die verschiedenen Unarten, die unsere Körper sich wie aufsässige Kinder einfallen lassen. Wir würden zur Bekräftigung dessen, was jede von uns sagte, mit den Köpfen nicken und einander zu verstehen geben, dass wir, natürlich, über alles Bescheid wissen. Wir würden Heilmittel austauschen und versuchen, einander bei der Aufzählung unserer körperlichen Wehwehchen zu übertreffen; leise würden wir klagen, unsere Stimmen sanft und in Moll und trauervoll wie Tauben in der Dachrinne. Ich weiß, was du meinst, würden wir sagen. Oder, eine seltsame altmodische Redensart, die man zuweilen noch von älteren Menschen hört: Ich höre wohl, woher du kommst, als sei die Stimme selbst eine Reisende, die von einem fernen Ort kommt. Und das wäre sie ja auch, das ist sie ja auch.
Wie ich solches Gerede früher immer verachtet habe! Jetzt sehne ich mich danach. Zumindest wurde geredet, war es eine Art Austausch.
Oder wir würden Klatschgeschichten erzählen. Die Marthas wissen manches, sie reden untereinander, verbreiten die inoffiziellen Neuigkeiten von Haus zu Haus. Bestimmt horchen sie, wie ich, an Türen und sehen manches, auch mit abgewandten Augen. Ich habe ihnen manchmal dabei zugehört, Fetzen ihrer privaten Gespräche aufgeschnappt. Totgeboren, ja. Oder: Mit einer Stricknadel erstochen, richtig in den Bauch. Eifersucht muss es gewesen sein, nagende Eifersucht. Oder noch verlockender: Mit Toilettenreiniger hat sie es gemacht. Hat fabelhaft funktioniert. Obwohl man denken sollte, er hätte es schmecken müssen. Muss der betrunken gewesen sein. Nur dass sie ihr leider auf die Schliche gekommen sind.
Oder ich würde Rita beim Brotbacken helfen, meine Hände in diese weiche, widerstandsfähige Wärme tauchen, die so sehr wie die Wärme eines Körpers ist. Mich hungert danach, etwas zu berühren, etwas anderes als Stoff oder Holz. Mich hungert danach, den Akt des Berührens zu vollziehen.
Doch selbst wenn ich fragen würde, selbst wenn ich derart die Regeln verletzen würde, Rita würde es nicht zulassen. Zu groß wäre ihre Angst. Die Marthas dürfen nicht mit uns fraternisieren.
Fraternisieren heißt, sich wie ein Bruder verhalten. Das hat Luke mir gesagt. Er sagte, es gebe kein entsprechendes Wort, das sich wie eine Schwester verhalten bedeutet. Sororisieren müsste es heißen, sagte er. Vom Lateinischen abgeleitet. Es machte ihm Spaß, über solche Einzelheiten Bescheid zu wissen. Die Ableitungen von Wörtern, sonderbare Redewendungen. Ich zog ihn immer damit auf, dass er pedantisch sei.
Ich nehme die Gutscheine aus Ritas ausgestreckter Hand. Es sind Bilder darauf, Bilder von den Gegenständen, die dafür eingetauscht werden können: zwölf Eier, ein Stück Käse, ein braunes Etwas, das ein Steak sein soll. Ich stecke die Gutscheine in die Reißverschlusstasche in meinem Ärmel, in der ich meinen Pass aufbewahre.
»Sag ihnen, frisch sollen sie sein, die Eier«, sagt sie. »Nicht wie letztes Mal. Und ein Hähnchen, sag ihnen das! Kein Suppenhuhn. Sag ihnen, für wen es ist, dann drehen sie dir nichts an.«
»Gut«, sage ich. Ich lächle nicht. Warum sie zur Freundschaft verführen?
Kapitel drei
Ich gehe durch die Hintertür hinaus in den Garten, der groß und gepflegt ist: ein Rasen in der Mitte, eine Trauerweide, Weidenkätzchen; ringsherum an den Rändern die Blumenrabatten, wo die Narzissen jetzt verblassen und die Tulpen ihre Kelche öffnen, Farbe verschütten. Die Tulpen sind rot, ein dunkleres Karmesinrot zum Stängel hin, als hätten sie dort Schnittwunden, die eben zu heilen beginnen.
Der Garten ist die Domäne der Frau des Kommandanten. Wenn ich durch mein bruchsicheres Fenster hinausschaue, sehe ich sie dort oft, die Knie auf einem Kissen, einen blauen Schleier über ihrem breitkrempigen Gartenhut, einen Korb mit Gartenschere und Bast zum Anbinden der Blumen neben sich. Ein Wächter, der dem Kommandanten zugeteilt ist, besorgt die schwere Arbeit des Umgrabens. Die Frau des Kommandanten leitet ihn an, sie zeigt mit dem Stock. Viele der Kommandantenfrauen haben solche Gärten – es ist etwas, das sie in Ordnung und instand halten und wofür sie sorgen können.
Ich hatte auch einmal einen Garten. Ich erinnere mich noch an den Geruch der umgegrabenen Erde, an die prallen Formen der Blumenzwiebeln in den Händen, die Fülle, an das trockene Rascheln von Samen zwischen den Fingern. Die Zeit verging mir darüber viel schneller. Manchmal lässt sich die Frau des Kommandanten einen Stuhl herausbringen und sitzt einfach nur darauf, in ihrem Garten. Aus der Entfernung sieht es friedlich aus.
Jetzt ist sie nicht da, und ich überlege, wo sie ist: Ich schätze es nicht, wenn ich der Frau des Kommandanten unerwartet begegne. Vielleicht ist sie im Wohnzimmer und näht, den linken Fuß auf dem Schemel, wegen ihrer Arthritis. Oder sie strickt Schals für die Engel an der Front. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Engel Bedarf an solchen Schals haben, und die von der Frau des Kommandanten gestrickten sind ohnehin zu kunstvoll. Mit dem Kreuz-und-Stern-Muster, das viele der anderen Ehefrauen wählen, gibt sie sich gar nicht erst ab. Es ist ihr nicht schwierig genug. Tannenbäume stehen an den Enden ihrer Schals stramm oder Adler oder steife androide Gestalten, Junge und Mädchen, Junge und Mädchen. Es sind keine Schals für ausgewachsene Männer, sondern für Kinder.
Manchmal denke ich, dass diese Schals gar nicht an die Engel geschickt, sondern aufgeribbelt und wieder in Wollknäuel verwandelt werden, damit die Frauen sie von Neuem verstricken. Vielleicht dient das Stricken nur dazu, die Ehefrauen zu beschäftigen, ihnen das Gefühl der Nützlichkeit zu vermitteln. Aber ich beneide die Frau des Kommandanten um ihr Strickzeug. Es ist gut, kleine Ziele zu haben, die leicht erreicht werden können.
Worum beneidet sie mich?
Sie spricht nicht mit mir, sofern sie es irgend vermeiden kann. Ich bin für sie ein Tadel, ein Vorwurf – und eine Notwendigkeit.
Vor fünf Wochen standen wir uns zum ersten Mal gegenüber, als ich hier eintraf, um diese Stellung anzutreten. Der Wächter von der früheren Stelle brachte mich bis an die Haustür. Am ersten Tag dürfen wir durch die Haustür eintreten, aber danach sollen wir die Hintertür benutzen. Es hat sich alles noch nicht richtig eingespielt, es ist noch zu früh, man ist sich noch nicht klar über unseren genauen Status. Wenn noch eine Weile vergangen ist, werden wir alle nur noch die Haustür oder nur noch die Hintertür benutzen dürfen.
Tante Lydia sagte, sie setze sich dafür ein, dass es die Haustür sei. Ihr habt schließlich eine ehrenhafte Stellung, sagte sie.
Der Wächter klingelte für mich, aber noch bevor Zeit war, die Glocke zu hören und herbeizueilen, ging die Tür nach innen auf. Sie muss dahinter gestanden und gewartet haben. Ich war auf eine Martha gefasst, aber stattdessen war sie es, unverkennbar in ihrem langen taubenblauen Gewand.
Du bist also die Neue, sagte sie. Sie trat nicht beiseite, um mich einzulassen. Sie stand einfach nur in der Tür und versperrte den Eingang. Sie wollte mir zu verstehen geben, dass ich nur auf ihr Geheiß das Haus betreten konnte. Es gibt heute oft harte Rangeleien um solche Machtpositionen.
Ja, sagte ich.
Lass das auf der Veranda. Das sagte sie zu dem Wächter, der meine Tasche trug. Die Tasche war aus rotem Vinyl und nicht sehr groß. Ich hatte noch eine andere Tasche, die den Winterumhang und wärmere Kleider enthielt, aber die würde später nachkommen.
Der Wächter setzte die Tasche ab und salutierte. Dann hörte ich hinter mir seine sich entfernenden Schritte und das Klicken des Gartentors, und ich hatte das Gefühl, als würde mir ein schützender Arm entzogen. Die Schwelle eines neuen Hauses ist ein einsamer Ort.
Sie wartete, bis der Motor angelassen wurde und das Auto davonfuhr. Ich sah ihr nicht ins Gesicht, sondern auf den Teil von ihr, den ich mit gesenktem Kopf sehen konnte: die blaue, dick gewordene Taille, die linke Hand auf dem Elfenbeinknauf ihres Gehstocks, die großen Diamanten am Ringfinger, der einmal sehr hübsch gewesen sein musste und jetzt noch gepflegt aussah mit dem zu einer sanft gerundeten Spitze gefeilten Fingernagel am Ende des knöchernen Fingers. Er wirkte an diesem Finger wie ein ironisches Lächeln, wie etwas, das sich über sie lustig machte.
Dann komm nur herein, sagte sie, wandte mir den Rücken zu und hinkte durch die Diele. Mach die Tür hinter dir zu.
Ich trug die rote Tasche nach drinnen, wie sie es zweifellos gewollt hatte, dann schloss ich die Tür. Ich sagte nichts zu ihr. Tante Lydia sagte immer, es sei das Beste, nur zu sprechen, wenn sie uns eine direkte Frage stellten. Versetzt euch einmal in ihre Lage, sagte sie, die Hände gefaltet und fest aneinandergedrückt, mit ihrem nervösen, flehenden Lächeln. Es ist nicht leicht für sie.
Hier herein, sagte die Frau des Kommandanten. Als ich ins Wohnzimmer trat, saß sie schon auf ihrem Stuhl, den linken Fuß auf dem Schemel mit dem Petit-Point-Polster: Rosen in einem Korb. Ihr Strickzeug lag auf dem Boden neben dem Stuhl, mit durchgesteckten Nadeln.
Ich stand mit gefalteten Händen vor ihr. Also, sagte sie. Sie hielt eine Zigarette zwischen den Fingern, die sie in den Mund steckte und mit den Lippen festhielt, während sie sie anzündete. Ihre Lippen waren in dieser Haltung schmal, mit dünnen vertikalen Linien ringsherum, wie man sie früher in Anzeigen für Lippenkosmetik sah. Das Feuerzeug war elfenbeinfarben. Die Zigaretten mussten vom Schwarzmarkt stammen, sagte ich mir, und das gab mir Hoffnung. Obwohl kein richtiges Geld mehr in Umlauf ist, gibt es auch jetzt noch einen Schwarzmarkt. Es gibt immer einen Schwarzmarkt, es gibt immer etwas zum Tauschen. Dann war sie also eine Frau, die in der Lage war, die Vorschriften zu umgehen. Aber was hatte ich zum Tauschen?
Ich starrte sehnsüchtig auf die Zigarette. Für mich sind Zigaretten, wie Alkohol und Kaffee, verboten.
Dann hat es bei dem alten Wieheißterdoch also nicht geklappt, sagte sie.
Nein, Ma’am, sagte ich.
Sie stieß etwas aus, was ein Lachen sein mochte, dann hustete sie. Pech für ihn, sagte sie. Dies ist dein Zweiter, nicht wahr? Mein Dritter, Ma’am, sagte ich.
Für dich auch nicht so gut, sagte sie. Ein weiteres hustendes Lachen. Du kannst dich setzen. Ich will es nicht zur Regel machen, nur dieses Mal.
Ich setzte mich auf die Kante eines der Stühle mit den hohen geraden Lehnen. Ich wollte nicht in dem Zimmer umherschauen, ich wollte nicht unaufmerksam erscheinen; deshalb blieben der marmorne Kamin zu meiner Rechten und der Spiegel darüber und die Blumensträuße an diesem Tag nur Schatten am Rand meines Gesichtsfelds. Später sollte ich mehr als genug Zeit haben, sie genau zu betrachten.
Jetzt war ihr Gesicht auf einer Höhe mit meinem. Ich meinte sie wiederzuerkennen, oder zumindest war irgendetwas Vertrautes an ihr. Unter dem Schleier war ein wenig von ihrem Haar zu sehen. Es war noch blond. Ich dachte damals, dass sie es vielleicht bleichte, dass sie auch Haarfärbemittel über den Schwarzmarkt bekommen konnte. Doch inzwischen weiß ich, dass es wirklich blond ist. Die Augenbrauen waren zu dünnen, gebogenen Linien gezupft, was ihr einen Ausdruck permanenter Überraschung oder Empörung oder Neugier verlieh, wie man ihn manchmal vielleicht bei einem aufgeschreckten Kind sieht, aber die Augenlider darunter sahen müde aus. Nicht so ihre Augen, die das matte, feindselige Blau eines Hochsommerhimmels bei strahlender Sonne hatten, ein Blau, das einen ausschließt. Ihre Nase musste einmal das gewesen sein, was man niedlich nennt, war jetzt aber zu klein für ihr Gesicht. Ihr Gesicht war nicht dick, aber es war sehr groß. Zwei Falten zogen sich von den Mundwinkeln nach unten, dazwischen lag das Kinn, geballt wie eine Faust.
Ich möchte dich so wenig wie möglich sehen, sagte sie. Ich nehme an, dir geht es mit mir genauso.
Ich antwortete nicht, da ein Ja eine Beleidigung und ein Nein ein Widersprechen gewesen wäre.
Ich weiß, dass du nicht dumm bist, fuhr sie fort. Sie inhalierte, blies dann den Rauch aus. Ich habe deine Akte gelesen. Soweit es mich betrifft, ist dies eine geschäftliche Transaktion. Aber wer mir Schwierigkeiten macht, kriegt Schwierigkeiten. Du verstehst?
Ja, Ma’am, sagte ich.
Nenne mich nicht Ma’am, sagte sie gereizt. Du bist keine Martha.
Ich fragte nicht, wie ich sie anreden sollte, denn ich sah sehr wohl, dass sie hoffte, ich würde nie Gelegenheit haben, sie irgendwie anzureden. Ich war enttäuscht. Damals hätte ich sie am liebsten zu einer älteren Schwester gemacht, zu einer Mutterfigur, zu jemandem, der mich verstand und mich beschützte. Bei meiner bisherigen Stelle hatte die Ehefrau den größten Teil ihrer Zeit in ihrem Schlafzimmer verbracht; die Marthas sagten, sie trinke. Ich wünschte mir, dass diese anders sei. Ich wollte gern glauben, dass ich sie, zu einer anderen Zeit und an anderem Ort, in einem anderen Leben gern gemocht hätte. Aber ich sah bereits, dass ich sie nie gemocht hätte und sie mich auch nicht.
Sie drückte ihre halb gerauchte Zigarette in einem kleinen verschnörkelten Aschenbecher auf dem Lampentisch neben sich aus. Sie tat dies entschlossen, ein Stoß und ein Drehen, nicht das wiederholte Tippen, wie es viele der Ehefrauen bevorzugen.
Was meinen Mann angeht, sagte sie, so ist er genau das. Mein Mann. Ich möchte, dass das absolut klar ist. Bis dass der Tod uns scheidet. Das ist endgültig.
Ja, Ma’am, sagte ich wieder, versehentlich. Früher gab es Puppen für kleine Mädchen, die sprachen, wenn man am Rücken an einer Schnur zog. Ich sagte mir, dass ich mich genauso anhörte, monoton, wie die Stimme einer Puppe. Wahrscheinlich sehnte sie sich danach, mir ins Gesicht zu schlagen. Sie dürfen uns schlagen, es gibt Präzedenzfälle in der Schrift. Aber nicht mit irgendwelchen Gegenständen. Nur mit der Hand.
Das ist eine der Errungenschaften, für die wir gekämpft haben, sagte die Frau des Kommandanten, und plötzlich schaute sie nicht mehr mich an, sie schaute hinunter auf ihre Knöchel, ihre mit Diamanten besetzten Finger, und ich wusste, wo ich sie schon einmal gesehen hatte.
Das erste Mal hatte ich sie im Fernsehen gesehen, als ich acht oder neun war. Das war die Zeit, als meine Mutter am Sonntagmorgen länger schlief und ich oft früh aufstand und zum Fernsehapparat in ihrem Arbeitszimmer hinüberging und auf der Suche nach Zeichentrickfilmen alle Kanäle durchprobierte. Manchmal, wenn ich nichts fand, sah ich mir die »Andachtsstunde für heranwachsende Seelen« an, in der für Kinder biblische Geschichten erzählt und Choräle gesungen wurden. Eine der Frauen hieß Serena Joy. Sie war der erste Sopran. Sie war aschblond, zierlich, mit Stupsnase und riesigen blauen Augen, die sie bei den Chorälen gen Himmel wandte. Sie konnte zur gleichen Zeit lächeln und weinen, ein oder zwei Tränen kullerten ihr anmutig die Wange hinunter, wie auf Kommando, während ihre Stimme sich zu den höchsten Tönen emporschwang, tremulierend, mühelos. Später hatte sie sich dann anderen Dingen zugewandt.
Die Frau, die vor mir saß, war Serena Joy. Oder war es einmal gewesen. Also war es noch schlimmer, als ich gedacht hatte.
Kapitel vier
Ich gehe den Kiesweg hinunter, der den Rasen hinter dem Haus wie ein säuberlich gezogener Scheitel teilt. In der Nacht hat es geregnet; das Gras zu beiden Seiten ist nass, die Luft feucht. Hier und da liegen Würmer, Beweise für die Fruchtbarkeit des Bodens, von der Sonne überrascht, halb tot; beweglich und rosa, wie Lippen.
Ich öffne die weiße Lattentür und gehe weiter, am vorderen Rasen entlang und auf das vordere Gartentor zu. In der Einfahrt wäscht einer der Wächter, die unserem Haushalt zugeteilt sind, den Wagen. Das muss bedeuten, dass der Kommandant im Haus ist, in seinen Räumen hinter dem Esszimmer, wo er sich meistens aufzuhalten scheint.
Es ist ein sehr teurer Wagen, ein Whirlwind; besser als der Chariot und sehr viel besser als der praktische, aber klobige Behemoth. Natürlich ist er schwarz – die Prestigefarbe und die Farbe der Leichenwagen – und lang und glänzend. Der Fahrer reibt liebevoll mit einem Poliertuch darüber. Zumindest dies hat sich nicht verändert, die Zärtlichkeit, mit der Männer teure Autos liebkosen.
Er trägt die Uniform der Wächter, aber seine Mütze sitzt in einem flotten Winkel auf dem Kopf, und seine Ärmel sind bis zu den Ellbogen aufgerollt, sodass man seine Unterarme sieht, braun gebrannt und mit Tupfen dunkler Härchen. Eine Zigarette hängt ihm im Mundwinkel, was zeigt, dass auch er etwas hat, womit er auf dem Schwarzmarkt handeln kann.
Ich weiß, wie der Mann heißt: Nick. Ich weiß es, weil ich gehört habe, wie Rita und Cora über ihn sprachen, und einmal habe ich gehört, wie der Kommandant zu ihm sagte: Nick, ich brauche das Auto nicht.
Er wohnt hier auf dem Grundstück, über der Garage. Niedriger Status: Ihm ist keine Frau zugeteilt worden, nicht einmal eine. Er gilt nichts: irgendein Makel, ein Mangel an Verbindungen. Aber er verhält sich so, als wüsste er das nicht oder als kümmerte es ihn nicht. Er ist zu lässig, er ist nicht unterwürfig genug. Es mag Dummheit sein, aber das glaube ich nicht. Stinkt nach Fisch, sagte man früher. Oder: Ich rieche eine Ratte. Außenseitertum als Geruch. Ohne es zu wollen, überlege ich, wie er wohl riecht. Nicht nach Fisch oder verwesender Ratte: nach sonnengebräunter Haut, feucht in der Sonne, eingehüllt von Rauch. Ich seufze und atme tief ein.
Er schaut mich an und sieht, wie ich zu ihm hinüberschaue. Er hat ein französisches Gesicht, mager, drollig, nur Flächen und Winkel, mit Falten um den Mund, wo er lächelt. Er zieht ein letztes Mal an der Zigarette, lässt sie auf den Weg fallen und tritt darauf. Er beginnt zu pfeifen. Dann zwinkert er.
Ich senke den Kopf, wende mich ab, sodass die weißen Flügel mein Gesicht verdecken, und gehe weiter. Er ist soeben ein Risiko eingegangen, aber wofür? Was, wenn ich ihn anzeigen würde?
Vielleicht wollte er einfach nur nett sein. Vielleicht hat er meinen Gesichtsausdruck gesehen und ihn irrtümlich für etwas anderes gehalten. In Wirklichkeit wollte ich nur die Zigarette.
Vielleicht war es ein Test, vielleicht wollte er sehen, was ich tun würde.
Vielleicht ist er ein Auge.
Ich öffne das vordere Gartentor und schließe es hinter mir, blicke zu Boden, aber nicht zurück. Der Bürgersteig ist aus rotem Ziegelstein. Auf diese Landschaft richte ich den Blick: ein Feld von Rechtecken, sanft gewellt, wo die Erde darunter eingesackt ist von jahrzehntelangem Winterfrost. Das Rot der Ziegelsteine ist alt und doch frisch und klar. Die Bürgersteige werden sehr viel sauberer gehalten als früher.
Ich gehe bis zur Straßenecke und warte. Früher konnte ich nicht gut warten. Auch jene dienen, die nur stehen und warten, sagte Tante Lydia. Sie ließ uns die Zeile auswendig lernen. Sie sagte auch: Nicht alle von euch werden es schaffen. Etliche von euch werden auf trockenen Boden oder unter die Dornen fallen. Etliche von euch sind nicht tief genug verwurzelt. Sie hatte ein Muttermal am Kinn, das auf und ab hüpfte, während sie sprach. Sie sagte: Stellt euch vor, ihr seid Samen, und dabei wurde ihre Stimme schmeichlerisch, verschwörerisch, wie früher die Stimmen der Frauen, die Kindern Ballettunterricht gaben und die immer sagten: Und jetzt die Arme hoch in die Luft, jetzt tun wir so, als wären wir alle Bäume!
Ich stehe an der Ecke und tue so, als wäre ich ein Baum.
Eine Gestalt, rot, mit weißen Flügeln um das Gesicht, eine Gestalt wie ich, eine nicht näher zu beschreibende Frau in Rot, die einen Korb trägt, kommt über den Ziegelsteinbürgersteig auf mich zu. Sie erreicht mich, und wir spähen einander ins Gesicht durch die weißen Stofftunnel, die uns einschließen. Sie ist die richtige.
»Gesegnet sei die Frucht«, sagt sie zu mir – der übliche Gruß unter uns.
»Möge der Herr uns öffnen«, erwidere ich – die übliche Antwort. Wir drehen uns um und gehen zusammen an den großen Häusern vorbei in Richtung des Zentrums der Stadt. Wir dürfen nur zu zweit in die Stadt gehen. Diese Bestimmung dient angeblich unserem Schutz, obwohl die Vorstellung absurd ist: Wir sind ohnehin bestens geschützt. In Wahrheit ist sie meine Spionin, so, wie ich ihre bin. Falls eine von uns wegen irgendeines Vorkommnisses bei einem unserer täglichen Gänge durch das Netz schlüpft, wird die andere dafür zur Verantwortung gezogen werden.
Diese Frau ist seit zwei Wochen meine Partnerin. Ich weiß nicht, was mit ihrer Vorgängerin passiert ist. Von einem bestimmten Tag an war sie einfach nicht mehr da, und statt ihrer erschien diese. So etwas gehört nicht zu den Dingen, nach denen man fragt, denn die Antworten sind in der Regel Antworten, die man lieber nicht wissen will. Außerdem würde es gar keine Antworten geben.
Diese ist ein wenig rundlicher als ich. Ihre Augen sind braun. Ihr Name ist Desglen, und das ist ungefähr alles, was ich über sie weiß. Sie geht sittsam, den Kopf gesenkt, die rotbehandschuhten Hände übereinandergelegt, mit kurzen Schrittchen wie ein dressiertes Schwein, das auf den Hinterbeinen läuft. Bei unseren Gängen hat sie noch nie irgendetwas gesagt, was nicht streng orthodox gewesen wäre. Andererseits habe ich das auch nicht getan. Vielleicht ist sie eine echte Gläubige, eine Magd nicht nur dem Namen nach. Ich kann das Risiko nicht eingehen.
»Der Krieg geht gut, höre ich«, sagt sie.
»Lob sei dem Herrn«, erwidere ich.
»Gutes Wetter ist uns gesandt worden.«
»Ich empfange es mit Freuden.«
»Sie haben seit gestern noch weitere Rebellen geschlagen.«
»Lob sei dem Herrn«, sage ich. Ich frage sie nicht, woher sie das weiß. »Was für welche waren es?«
»Baptisten. Sie hatten eine Hochburg in den Blauen Bergen. Man hat sie ausgeräuchert.«
»Lob sei dem Herrn.«
Manchmal wünschte ich, sie würde den Mund halten und mich in Frieden meinen Spaziergang machen lassen. Aber ich bin hungrig auf Nachrichten, jede Art von Nachrichten; selbst wenn es gefälschte Nachrichten sind, müssen sie etwas bedeuten.
Wir erreichen die erste Sperre. Sie sieht aus wie die Absperrungen bei Straßenarbeiten oder aufgegrabenen Abwasserkanälen: Holzkreuze, bemalt mit gelben und schwarzen Streifen, ein rotes Sechseck, das Halt bedeutet. Neben dem Durchgang stehen einige Laternen, die jetzt nicht brennen, weil nicht Nacht ist. Über uns, das weiß ich, sind an den Telefonmasten Flutlichtscheinwerfer angebracht, für Notfälle, und in den Bunkern zu beiden Seiten der Straße stehen Männer mit Maschinengewehren. Wegen der Flügel um mein Gesicht sehe ich die Flutlichtscheinwerfer und die Bunker nicht. Aber ich weiß, dass sie da sind.
Hinter der Sperre, neben dem schmalen Durchgang, warten zwei Männer auf uns. Sie tragen die grünen Uniformen der Wächter des Glaubens, mit den Wappen auf den Schulterklappen und den Baretts: zwei gekreuzte Schwerter über einem weißen Dreieck. Die Wächter des Glaubens sind keine richtigen Soldaten. Sie werden für Routinekontrollen und andere untergeordnete Aufgaben eingesetzt. Zum Beispiel graben sie den Garten der Frau des Kommandanten um. Sie sind entweder dumm oder älter oder Invaliden oder sehr jung, abgesehen von denen, die in Wirklichkeit AUGEN sind.
Diese beiden sind sehr jung: Der Schnurrbart des einen ist noch spärlich, das Gesicht des anderen noch picklig. Ihre Jugend ist rührend, aber ich weiß, dass ich mich dadurch nicht täuschen lassen darf. Die jungen sind oft die gefährlichsten, die fanatischsten, die fahrigsten mit ihren Schusswaffen. Sie haben noch nichts über die Kunst des Überdauerns gelernt. Man muss sich mit ihnen Zeit lassen.
Letzte Woche haben sie eine Frau erschossen, ziemlich genau an dieser Stelle. Es war eine Martha. Sie suchte in ihrem Gewand nach ihrem Pass, und sie dachten, sie suche nach einer Bombe. Sie dachten, sie sei ein als Frau verkleideter Mann. Dergleichen ist schon vorgekommen.
Rita und Cora kannten die Frau. Ich habe gehört, wie sie in der Küche darüber sprachen.
Sie tun ja ihre Pflicht, sagte Cora. Sorgen für unsere Sicherheit.
Nichts ist sicherer, als tot zu sein, sagte Rita zornig. Sie hat sich immer nur um ihren eigenen Kram gekümmert. Kein Grund, sie zu erschießen.
Es war ein Unfall, sagte Cora.
So was gibt’s nicht, sagte Rita. Alles ist Absicht. Ich hörte, wie sie mit den Töpfen im Spülbecken klapperte.
Immerhin, bevor einer dieses Haus in die Luft jagt, wird er es sich zweimal überlegen, sagte Cora.
Einerlei, sagte Rita und klapperte heftig mit den Töpfen. Das war ein schlechter Tod.
Ich kann mir einen schlimmeren vorstellen, sagte Cora. Wenigstens ging es schnell.
Das kann man wohl sagen, sagte Rita. Ich hätte lieber ein bisschen Zeit vorher, verstehst du? Um meine Angelegenheiten zu regeln.
Die beiden jungen Wächter grüßen uns, indem sie drei Finger an den Rand ihres Baretts heben – Zeichen der Anerkennung, die man uns gewährt. Sie haben Respekt zu bekunden wegen der Art unseres Dienstes.
Wir ziehen unsere Pässe hervor aus den Reißverschlusstaschen in unseren weiten Ärmeln, und sie werden inspiziert und gestempelt. Einer der Männer geht in den Bunker auf der rechten Seite, um unsere Nummern in den Compuchek einzugeben.
Als er mir meinen Pass zurückgibt, senkt der mit dem pfirsichfarbenen Schnurrbart den Kopf und versucht, einen Blick auf mein Gesicht zu werfen. Ich hebe den Kopf ein wenig, um ihm zu helfen, und er sieht meine Augen, und ich sehe seine, und er wird rot. Sein Gesicht ist schmal und kummervoll wie das eines Schafs, aber er hat die großen runden Augen eines Hundes, eher eines Spaniels als eines Terriers. Seine Haut ist bleich und sieht ungesund zart aus, wie die neue Haut unter Schorf. Trotzdem stelle ich mir vor, ich legte die Hand darauf, auf dieses entblößte Gesicht. Er ist derjenige, der sich abwendet.
Es ist ein Ereignis, ein kleiner Verstoß gegen die Regeln, so klein, dass er nicht zu entdecken ist, aber solche Momente sind die Belohnungen, die ich für mich selbst bereithalte wie die Süßigkeiten, die ich als Kind hinten in der Schublade hortete. Solche Momente sind Möglichkeiten, winzige Gucklöcher.
Was, wenn ich nachts käme, wenn er allein Dienst macht – obwohl man ihm diese Art Einsamkeit nie zugestehen würde –, und ich ihn hinter meine weißen Flügel ließe? Was, wenn ich meine rote Hülle abschälte und mich ihm zeigte, ihnen, im undeutlichen Licht der Laternen? Dergleichen müssen sie sich doch zuweilen vorstellen, wenn sie endlos an dieser Sperre stehen, hinter die niemand gelangt, nur die Beherrscher der Gläubigen in ihren langen schwarzen, summenden Autos oder ihre blauen Ehefrauen und weiß verschleierten Töchter auf ihren genormten Wegen zu Errettungen oder Betvaganzen, oder ihre unförmigen grünen Marthas oder, gelegentlich, das Geburtsmobil oder ihre roten Mägde zu Fuß. Oder manchmal ein schwarz angemalter Gefangenenwagen mit dem geflügelten Auge in Weiß an der Seite. Die Fenster der Gefangenenwagen sind dunkel getönt, und die Männer auf den Vordersitzen tragen dunkle Brillen: doppelte Verdunklung.
Die Gefangenenwagen sind jedenfalls noch leiser als die anderen Autos. Wenn sie vorbeifahren, wenden wir unsere Augen ab. Wenn von drinnen Geräusche herausdringen, versuchen wir, sie nicht zu hören. Niemandes Herz ist erhaben.
Wenn die schwarzen Gefangenenwagen an einen Kontrollpunkt kommen, werden sie ohne Verzögerung weitergewinkt. Die Wächter würden das Risiko hineinzuschauen, die Wagen zu durchsuchen, an ihrer Autorität zu zweifeln, nicht eingehen wollen. Einerlei, was sie denken.
Falls sie denken. Man kann es nicht erkennen, wenn man sie anschaut.
Doch wahrscheinlicher ist, dass sie nicht an Kleidungsstücke denken, die auf dem Rasen abgelegt werden. Wenn sie an einen Kuss denken, dann müssen sie sofort an aufleuchtende Flutlichtscheinwerfer und an Gewehrschüsse denken. Sie denken lieber daran, ihre Pflicht zu tun, an ihre Beförderung zum Engel und daran, dass ihnen möglicherweise erlaubt wird zu heiraten und dass ihnen, falls sie in der Lage sind, genügend Macht zu erringen, und falls sie alt genug werden, eine eigene Magd zugestanden wird.
Der mit dem Schnurrbart öffnet das schmale Fußgängertor für uns und tritt zurück, weit aus dem Weg. Wir gehen hindurch. Während wir weitergehen, weiß ich, dass sie uns beobachten, diese beiden Männer, denen es noch nicht erlaubt ist, Frauen zu berühren. Sie berühren sie stattdessen mit ihren Augen, und ich wiege mich ein wenig in den Hüften und spüre, wie der weite rote Rock dabei um mich schwingt. Es ist, als ob man jemandem hinter einem Zaun hervor eine lange Nase macht oder als ob man einen Hund mit einem Knochen lockt, den man außer Reichweite hält, und ich schäme mich dafür, dass ich es tue, denn nichts von alledem ist die Schuld dieser Männer: Sie sind zu jung.
Ende der Leseprobe