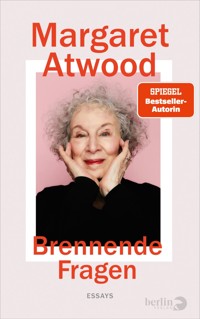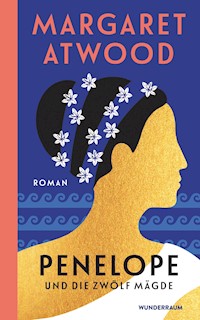21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neben zwei umwerfenden Storysequenzen aus dem Leben eines Paares – mit all den großen und kleinen Momenten, aus denen eine lange Liebe besteht – enthält dieser Band viele weitere Geschichten: Zwei beste Freundinnen streiten über die gemeinsame Vergangenheit; wie rettet man jemand vor dem Ersticken; Kabbale und Liebe unter älteren Akademikerinnen; woher weiß man schon, ob die eigene Mutter wirklich eine Hexe ist ... Es geht um geliebte Katzen, eine verwirrte Schnecke, ein märchenerzählendes Alien, Martha Gellhorn, George Orwell und Hypatia von Alexandria. »Funkelnd vor Lebendigkeit« Sunday Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem Englischen von Monika Baark
© O. W. Toad, Ltd. 2023 Titel der englischen Originalausgabe: »Old Babes in The Wood«, PRH, London/Toronto/New York 2023
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Suzanne Dean
Covermotiv: Illustration: Noma Bar
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
I
TIG & NELL
ERSTE HILFE ODER HIER KOMMEN WIR NICHT LEBEND RAUS
ZWEI VERBRANNTE MÄNNER
MORTE DE SMUDGIE
II
MEINE BÖSE MUTTER
MEINE BÖSE MUTTER
INTERVIEW MIT EINEM TOTEN
UNGEDULDIGE GRISELDIS
SCHLECHTE ZÄHNE
TOD DURCH MUSCHELSCHALEN
HYPATIA VON ALEXANDRIA SPRICHT
FREIZONE
METEMPSYCHOSE ODER: SEELENWANDERUNG
ABGEHOBEN: EIN SYMPOSIUM
III
NELL & TIG
MITTAGSPAUSE IM STAUB
WITWEN
DAS HOLZKÄSTCHEN
OLD BABES IN THE WOOD
DANKSAGUNG
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Widmung
Für meine Leser.
Für meine Familie.
Für Freunde und abwesende Freunde.
Für Graeme Gibson, wie immer.
I
TIG & NELL
ERSTE HILFE ODER HIER KOMMEN WIR NICHT LEBEND RAUS
Eines Tages kam Nell kurz vor dem Abendessen nach Hause, und die Haustür stand offen. Das Auto war weg. Auf den Stufen waren dicke Blutstropfen, und Nell folgte der Spur entlang des Flurläufers bis in die Küche. Auf dem Schneidebrett lag ein Messer, ein Lieblingsmesser von Tig, japanischer Stahl, sehr scharf – und daneben eine blutige Mohrrübe mit abgetrenntem Ende. Von ihrer damals neunjährigen Tochter fehlte jede Spur.
Wie sahen die möglichen Szenarien aus? Schurken waren ins Haus eingedrungen. Tig hatte sich mit dem Messer zur Wehr setzen wollen (aber wie erklärte sich dann die Mohrrübe?) und war verletzt worden. Die Schurken hatten sich mit ihm, ihrer Tochter und ihrem Auto davongemacht. Nell sollte die Polizei rufen.
Oder Tig hatte gekocht, sich geschnitten, entschieden, dass er genäht werden musste, und war mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren, und ihre Tochter hatte er mitgenommen, um sie nicht allein zu lassen. Das klang wahrscheinlicher. Er hatte es bestimmt zu eilig gehabt, um einen Zettel zu schreiben.
Nell holte den Teppichreiniger und besprühte die Blutflecken: Sie würden schlechter rausgehen, wenn sie eingetrocknet waren. Dann wischte sie das Blut vom Küchenfußboden und auch, nach kurzer Überlegung, von der Mohrrübe. Die Mohrrübe war völlig in Ordnung; kein Grund, sie wegzuwerfen.
Die Zeit verging. Die Spannung stieg. Sie war kurz davor, die Krankenhäuser abzutelefonieren und nach Tig zu fragen, da kam er nach Hause, mit verbundener Hand. Er war gut gelaunt, genau wie ihre Tochter. Was für ein Abenteuer! Er habe geblutet wie ein Schwein, berichteten sie. Das Geschirrtuch, das Tig sich um die Wunde gewickelt hatte, war völlig durchnässt gewesen! Ja, das Autofahren habe seine Tücken gehabt, sagte Tig (er sagte nicht, gefährlich), aber auf ein Taxi zu warten – undenkbar, und irgendwie ging’s dann auch, quasi mit einer Hand, denn die andere hatte er hochhalten müssen, und das Blut war ihm vom Ellenbogen getropft, und im Krankenhaus hatten sie ihn schnell zusammengeflickt, denn er hatte alles vollgeblutet, na ja, jedenfalls, da waren sie wieder! Zum Glück war es keine Arterie, das hätte heikel werden können. (Es war heikel gewesen, wie Tig später erzählte: Seine Tapferkeit war nur gespielt gewesen – er hatte ihrer Tochter keine Angst machen wollen –, tatsächlich hatte er befürchtet, zu viel Blut zu verlieren und in Ohnmacht zu fallen, und was dann?)
»Ich brauch einen Drink«, sagte Tig.
»Ich auch«, sagte Nell. »Ich kann uns Rührei machen.« Was immer Tig mit der Mohrrübe hatte kochen wollen, stand nicht mehr auf dem Plan.
Das Geschirrtuch hatte er in einer Plastiktüte mit zurückgebracht. Es war hellrot, begann sich aber an den Rändern braun zu verfärben. Nell legte es zum Einweichen in kaltes Wasser, so ließen sich Blutflecken am besten aus Textilien entfernen.
Aber was hätte ich getan, wenn ich hier gewesen wäre, fragte sie sich. Ein Pflaster hätte es nicht getan. Ein Druckverband? Bei den Pfadfindern hatte sie oberflächlich gelernt, wie so was geht. Auch verstauchte Handgelenke hatten sie durchgenommen. Für die kleineren Notfälle war sie zuständig, aber nicht für größere. Für die war Tig zuständig.
*
Das ist schon länger her. Es war Frühherbst, erinnert sie sich, irgendwann in den späten 1980ern. Es gab schon PCs, klotzige Dinger damals. Und Drucker: Das Papier dafür hing am oberen und unteren Rand zusammen und hatte Löcher entlang der Seiten, perforierte Streifen, die man abreißen musste. Aber es gab noch keine Handys, weswegen Nell nicht schreiben oder anrufen konnte, um Tig zu fragen, wo er sei, und auch nicht, woher das Blut komme.
Wie viel wir früher gewartet haben, denkt sie. Warten, ohne zu wissen. So viele ungefüllte Leerstellen, so viel Rätselhaftes. So wenig Information. Jetzt schreiben wir das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, die Raumzeit ist dichter, sie ist gerammelt voll, man kann sich kaum noch bewegen, weil die Luft von diesem und jenem nur so wimmelt. Ständig hat man Leute auf der Pelle: Sie wollen deine Kontakte, nehmen Kontakt auf, wollen in Kontakt stehen. Ist das besser oder schlechter?
Sie kehrt mit ihren Gedanken in das Zimmer zurück, in dem die beiden gerade sind. Es befindet sich in einem gesichtslosen Hochhaus in der Bloor Street nahe dem Viadukt. Sie und Tig sitzen auf Stühlen, die an Schulmobiliar erinnern – vorne steht sogar ein Whiteboard –, und es redet ein Mann namens Mr Foote. Die Leute auf den anderen Stühlen, die ebenfalls Mr Footes Ausführungen lauschen, sind mindestens dreißig Jahre jünger als Tig und Nell, einige vielleicht sogar vierzig Jahre jünger. Eigentlich noch Kinder.
»Beim Motorradunfall«, sagt Mr Foote, »wollen wir auf keinen Fall den Helm abnehmen, klar. Denn wir wissen nicht, was da drin ist, hab ich recht?« Kreisförmig bewegt er die Hand in der Luft wie beim Fensterputzen.
Stimmt, denkt Nell. Sie stellt sich das verschmierte Visier eines Sturzhelms vor. Das Gesicht darin ist kein Gesicht mehr. Sondern Brei.
Mr Foote hat ein Talent dafür, Bilder wie dieses heraufzubeschwören. Er hat eine deftige Ausdrucksweise, schließlich stammt er aus Neufundland. Ein Leisetreter ist etwas anderes. Ein Kasten von einem Mann: breites Kreuz, stämmige Beine, kurze Distanz zwischen Ohr und Schulter; eine austarierte Gestalt mit tief gelagertem Schwerpunkt. Mr Foote umzustoßen wäre nicht einfach. Nell vermutet, dass das schon versucht wurde, in Kneipen – er sieht aus wie einer, der sich mit Schlägereien auskennt, aber auch wie einer, der sich auf keine einlässt, die er nicht gewinnen kann. Schlimmstenfalls würde er seinen Herausforderer seelenruhig aus dem Fenster schmeißen – »Wir müssen Ruhe bewahren«, hat er jetzt schon zweimal gesagt – und dann nach Knochenbrüchen schauen. In dem Fall würde er sie schienen und anschließend die Schnitt- und Schürfwunden des Opfers behandeln. Mr Foote ist ein Gesamtpaket. De facto ist er Rettungssanitäter, aber das stellt sich erst später am Tag heraus.
Er hat eine schwarze Ledermappe dabei und trägt eine Kapuzenjacke mit St-John-Ambulance-Logo wie ein Trainer, was er in gewisser Hinsicht ja auch ist: Er bringt ihnen Erste Hilfe bei. Am Ende des Tages wird es einen Test geben, und sie werden alle eine Bescheinigung erhalten. Alle sind in diesem Raum, weil sie diese Bescheinigung brauchen: Ihre Firmen haben sie geschickt. Nell und Tig geht es genauso. Dank einer familiären Verbindung von Tig werden sie auf einem Kreuzfahrtschiff Vorträge über Naturthemen halten, er über Vögel, sie über Schmetterlinge: ihre Hobbys. Insofern sind sie streng genommen Mitarbeiter, und alle Mitarbeiter auf diesem Schiff müssen die Bescheinigung haben. Es sei Pflicht, hat ihnen ihr Schiffskontakt gesagt.
Unausgesprochen blieb, dass die Mehrheit der Passagiere – die Gäste, die Klientel – nicht jung sein wird, um es milde auszudrücken. Einige von ihnen werden älter sein als Nell und Tig. Wahrhaft steinalt. Solche Menschen können erwartbarerweise jederzeit umfallen, und dann müssen Bescheinigungsinhaber zur Stelle sein.
Dass Nell und Tig tatsächlich irgendjemanden retten werden, ist unwahrscheinlich: Jüngere Leute werden zur Hilfe eilen, darauf zählt Nell. Wenn’s eng werden sollte, wird Nell herumeiern und behaupten, sie habe vergessen, was zu tun sei, was nicht mal gelogen wäre. Und Tig? Er wird sagen: Abstand halten, machen Sie Platz. Etwas in dieser Art.
Es ist bekannt – es geht das Gerücht –, dass diese Schiffe eigens über Tiefkühltruhen für den Notfall verfügen. Nell stellt sich die Bestürzung eines Mitarbeiters vor, der versehentlich die falsche Truhe öffnet und auf den entsetzten, erstarrten Blick irgendeines unglückseligen Passagiers stößt, dem die Bescheinigung nichts mehr genützt hat.
Mr Foote steht vorne, lässt den Blick über die heutige Schülergruppe schweifen. Sein Gesichtsausdruck ist so etwas wie neutral oder eine Spur belustigt. Ein Haufen ahnungsloser Weichlinge, denkt er höchstwahrscheinlich. Städter. »Es gibt das, was wir tun müssen, und das, was wir lassen müssen«, sagt er. »Ich erklär Ihnen beides. Erstens rennt man nicht schreiend los wie ein kopfloses Huhn. Selbst wenn’s der Kollege ist, der einen Kopf kürzer ist.«
Kopflose Hühner können nicht schreien, denkt Nell. Zumindest nimmt sie das an. Aber schon klar. Bei einem Notfall nicht kopflos werden, heißt es immer. Mr Foote würde hinzufügen: »Sag ich mal.« Sie sollen auf keinen Fall kopflos werden.
»Vieles kriegt man wieder hin«, sagt Mr Foote gerade. »Aber nicht, wenn der Kopf ab ist. Das ist die eine Sache, die ich Ihnen nicht beibringen kann.« Das soll wohl ein Witz sein, vermutet Nell, aber Mr Foote signalisiert nicht, wenn er einen Witz macht. Er guckt völlig ernst.
»Angenommen, wir sitzen im Restaurant.« Motorradunfälle sind abgehakt, und jetzt macht Mr Foote mit Erstickungsfällen weiter. »Und der Kollege fängt an zu husten. Als Erstes müssen wir uns fragen: Kann er sprechen? Fragen wir ihn, ob wir ihm ein paar Schläge auf den Rücken geben sollen. Wenn er Ja sagt, in Worten, ist es halb so schlimm, weil er, sag ich mal, immer noch Luft kriegt. Aber was oft vorkommt – vielen Leuten ist es peinlich, also stehen sie auf, und was machen sie? Gehen zur Toilette, weil sie kein Aufhebens machen wollen. Nicht im Mittelpunkt stehen. Wir müssen aber mitgehen, wir müssen hinterher, weil sie sterben können. Kaum sind sie weg, liegen sie schon tot am Boden.« Er nickt gewichtig mit dem Kopf. So was kommt vor, sagt dieses Nicken. Alles schon erlebt. Aber er war zu spät.
Mr Foote hat Ahnung, denkt Nell. Dasselbe wäre ihr beinahe selbst mal passiert. Das Husten, das Aufsuchen der Toilette, das Vermeidenwollen von Aufhebens. Verlegenheit kann tödlich sein, das versteht sie jetzt. Mr Foote hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
»Dann müssen wir sie vornüberbeugen«, fährt Mr Foote fort. »Fünf kräftige Schläge auf den Rücken – kann sein, dass der Bissen Fleisch, das Klößchen oder die Fischgräte oder was auch immer gleich rausschießt. Aber wenn nicht, kommt das Heimlich-Manöver zum Einsatz. Es ist nur so: Wenn jemand nicht sprechen kann, kann er uns auch nicht direkt die Erlaubnis geben. Außerdem läuft er vielleicht gerade blau an und ist nicht mehr ansprechbar. Dann müssen wir einfach machen. Kann sein, dass wir ihm ’ne Rippe brechen, aber wenigstens ist er am Leben, klar.« Er grinst ein wenig, zumindest vermutet Nell dahinter ein Grinsen. Irgendwie zuckt er mit dem Mund. »Darum geht’s am Ende, klar. Er lebt!«
Sie gehen das Heimlich-Manöver durch und die richtige Art und Weise, jemandem auf den Rücken zu schlagen. Laut Mr Foote funktioniert diese Kombination fast immer, aber man müsse unbedingt schnell genug zur Stelle sein: Timing sei alles beim Erste-Hilfe-Leisten. »Heißt ja nicht umsonst Erste Hilfe, klar. Wir sind nicht das Finanzamt, die, Verzeihung, die Damen, ihren Arsch nicht hochkriegen, wir haben höchstens vier Minuten.«
Jetzt, sagt er, gibt’s Kaffeepause, und dann kommt Ertrinken und Mund-zu-Mund-Beatmung, gefolgt von Erfrierungen; und nach dem Mittagessen Herzinfarkt und Defibrillator. Ganz schön viel für einen einzigen Tag.
Ertrinken ist relativ einfach. »Erst müssen wir das Wasser rauskriegen. Dazu müssen wir die Schwerkraft einfach machen lassen, klar. Drehen Sie den Kollegen auf die Seite, und raus mit dem Wasser, aber flott.« Mr Foote hat mit zahlreichen Ertrinkungsfällen zu tun gehabt: Er lebt am Wasser, schon sein Leben lang. »Auf den Rücken drehen, Atemwege frei machen, geht der Atem? Geht der Puls? Dafür sorgen, dass jemand den Notarzt ruft. Wenn die Atmung ausgesetzt hat, müssen wir ihn beatmen. Was Sie hier sehen, ist eine Beatmungsmaske, weil, manchmal erbrechen sich die Leute, und das wollen wir nicht im Mund haben. Und wegen der Keime, klar. So was sollten Sie immer dabeihaben.« Mr Foote hat einen Vorrat mitgebracht. Sie können am Ende des Tages käuflich erworben werden.
Nell will daran denken, sich eine zuzulegen. Wie hat sie es bloß bisher ohne Beatmungsmaske durchs Leben geschafft?
Um Mund-zu-Mund-Beatmung zu üben, werden die Leute im Raum in Zweierpaare unterteilt. Jedes Paar bekommt einen roten Plastiktorso mit einem weißen Glatzkopf, der sich nach hinten kippen lässt, und zum Hinknien, während sie ihren gemeinsamen Torso wiederbeleben, eine Yogamatte. Die Nase zukneifen, den Mund mit dem eigenen bedecken, fünfmal beatmen, jedes Mal, bis sich der Brustkorb hebt, dann fünf Thoraxkompressionen durchführen. Wiederholen. In der Zwischenzeit ruft die andere Person den Notarzt, woraufhin sie die Thoraxkompressionen übernimmt. Diese können anstrengend werden, sie gehen auf die Handgelenke. Mr Foote pirscht derweil durch den Raum und überprüft die Technik der Einzelnen. »Sieht schon ganz gut aus«, sagt er.
Tig sagt, jetzt, wo er unten auf der Matte hockt, wird Nell den Notarzt rufen müssen, damit ihn jemand wieder aufrichtet mit seinen kaputten Knien. Nell kichert in den Plastikmund hinein, sabotiert ihren Rettungsversuch. »Ich kann nur hoffen, dass keiner ertrinkt, während wir im Dienst sind«, sagt sie. »Der bleibt dann wahrscheinlich ertrunken.« Tig sagt, soweit er wisse, sei das ein relativ schmerzloser Abgang. Angeblich höre man Glocken läuten.
Als sie alle ihre Plastiktorsi wiederbelebt haben, geht es weiter mit Erfrierung und Schockzustand. In beiden Fällen kommen Decken ins Spiel. Mr Foote erzählt eine tolle Geschichte von einem Mann im Skiurlaub, der die Hütte verließ, um pinkeln zu gehen, ohne Taschenlampe, durch den Tiefschnee, und vor einem Baum in eine Senke fiel und nicht mehr rauskam und erst am nächsten Morgen gefunden wurde. Steif wie ’n Brett und kalt wie ’ne Makrele, sagt Mr Foote, kein Atemzug mehr im Leib, und sein Herz war still wie ein Grab. Aber jemand in der Hütte war Ersthelfer, und sie rackerten sich sechs Stunden lang mit dem vermeintlich Toten ab – sechs Stunden lang! – und haben’s geschafft, ihn zurückzuholen.
»Man macht weiter. Man gibt nicht auf«, sagt Mr Foote. »Man weiß nämlich nie.«
Sie machen Mittagspause. Nell und Tig finden in einem der seelenlosen Hochhäuser einen versteckten kleinen Italiener, bestellen je ein Glas Rotwein und essen eine ziemlich gute Pizza. Nell sagt, sie werde sich eine Visitenkarte drucken lassen: »Im Fall eines Unfalls Mr Foote anrufen«, und Tig sagt, Mr Foote sollte als Premierminister kandidieren, dann könnte er das ganze Land Mund zu Mund beatmen. Er glaubt, Mr Foote sei bei der Navy gewesen. Nell sagt, nein, er ist Spion. Tig sagt, vielleicht ist er mal Pirat gewesen, und Nell sagt, nein, er ist mit Sicherheit ein Außerirdischer und Erste-Hilfe-Kurse sind die perfekte Tarnung.
Beide kommen sich albern und außerdem unfähig vor. Nell ist sicher, dass sie angesichts egal welchen Notfalls – Ertrinken, Schock, Erfrieren – panisch werden würde und alles, was Mr Foote ihnen beigebracht hat, weg wäre.
»Aber Schlangenbisse könnte ich hinkriegen«, sagt sie. »Da habe ich mal was bei den Pfadfindern drüber gelernt.«
»Ich glaube, Schlangenbisse macht Mr Foote nicht«, sagt Tig.
»Wetten, doch? Aber nur im Privatunterricht. Das ist Nischenwissen.«
Der Nachmittag ist aufregend. Es werden echte Defibrillatoren verteilt, und die Elektroden werden mit Präzision auf die roten Plastiktorsi aufgesetzt. Jeder kommt an die Reihe. Mr Foote erklärt ihnen, wie man es vermeidet, sich aus Versehen selbst zu defibrillieren – das eigene Herz könnte durcheinanderkommen und aufhören zu schlagen. Nell murmelt Tig zu, dass ein Tod durch Selbstdefibrillierung sehr unwürdig wäre. Nicht so unwürdig wie ’ne Gabel in ’ne Steckdose stecken, gibt Tig murmelnd zurück. Auch wieder wahr, denkt Nell. Mit kleinen Kindern im Haus musste man in der Hinsicht immer auf der Hut sein.
Dann kommt der Test. Mr Foote sorgt dafür, dass ihn alle bestehen: Er deutet die Antworten überdeutlich an und legt ihnen nahe, sich zu melden, wenn sie eine Frage nicht verstehen. Sie werden Ihre Bescheinigung per Post erhalten, sagt er und klappt seine schwarze Ledermappe zu, mit Erleichterung, vermutet Nell. Wieder einen Haufen hoffnungsloser Fälle geschafft, jetzt kann man nur zu Gott beten, dass keiner von ihnen jemals mit einem echten Notfall konfrontiert wird. Nell kauft einen Beatmungsschutz. Sie möchte Mr Foote sagen, dass seine Geschichten ihr Spaß gemacht haben, aber das könnte frivol klingen, als wäre das Ganze hier nur Unterhaltung, als nähme sie ihn nicht ernst. Er könnte beleidigt sein. Also sagt sie einfach nur Danke, und er nickt.
Als sie und Tig wieder zu Hause sind – am nächsten Tag, oder vielleicht am übernächsten –, geht sie sämtliche lebensbedrohlichen Erlebnisse durch, die sie zusammen gehabt haben, oder die Erlebnisse, die potenziell lebensbedrohlich hätten sein können. War sie auf irgendeins davon auch nur im Geringsten vorbereitet gewesen?
Damals, als der Eisenschornstein das Dachgeschoss in Brand setzte und Tig inmitten von giftigen Rauchwolken unter die Balken kroch und eimerweise Wasser aufs Feuer schüttete. Was, wenn er da oben vom Einatmen der Gase umgekippt wäre? Nach diesem Vorfall besorgte Tig eine Feuerdecke, und auf jedem Stockwerk jedes ihrer damals bewohnten Häuser musste ein Feuerlöscher stehen. Auch Hotels machten ihm Sorgen, und er machte immer das Treppenhaus ausfindig, nur für alle Fälle. Auch die Fenster: Ließen sie sich öffnen? Zunehmend ließen sich Fenster in Hotels nicht mehr öffnen, aber man könnte vielleicht die Scheibe einschlagen, wenn man vorher den Arm in ein Handtuch wickelte. Das wiederum wäre sinnlos, wenn das Fenster zu hoch wäre.
Das eine Mal, als Tig in einem dreißigstöckigen Hotel sämtliche Feueralarme auslöste, als er im Flur unter einem der Sensoren eine Zigarre anzündete und sie beide Stockwerk für Stockwerk zu Fuß nach unten gingen und durch die von Feuerwehrleuten wimmelnde Lobby das Gebäude verließen, als hätten sie nichts damit zu tun. Das Ereignis war nicht lebensbedrohlich. Es war nicht mal sonderlich peinlich, da sie ja nicht erwischt worden waren.
Das eine Mal, als ein Holztransporter vor ihnen auf dem Highway seine Ladung verlor: Bretter lösten sich, flogen durch die Luft, sprangen wie wild über den Asphalt und verfehlten sie um Haaresbreite. Dazu noch mitten in einem Schneesturm. Herz-Lungen-Massage zu können hätte nichts genützt.
Das eine Mal, als sie auf einem der Großen Seen mit dem Kanu unterwegs waren und die Riesenwelle eines vorbeifahrenden Ozeandampfers es zum Kentern brachte. Nicht lebensbedrohlich: Sie waren nah am Ufer, das Wasser war warm. Sie wurden nass, mehr nicht.
Das eine Mal, als Tig auf dem Quad mit einem Anhänger voll Holz angedonnert kam, das er mit der Kettensäge zerkleinert hatte, und sein Gesicht von einer unbemerkten Kopfwunde blutüberströmt war. Es war nicht lebensbedrohlich: Er spürte die Verletzung nicht mal.
»Sein Gesicht ist blutüberströmt«, sagte Nell zu den Kindern, als wären sie blind.
»Sein Gesicht ist immer blutüberströmt«, sagte eines der Kinder achselzuckend. Für sie war er unverwüstlich.
»Ich hab anscheinend sehr viel Blut«, sagte Tig und grinste sich einen ab. Wobei hatte er sich die Schürfwunde am Kopf zugezogen? Unwichtig. Kurze Zeit später entlud er den Anhänger, und gleich danach hackte er das Holz: Es war schon trocken, er hatte Totholz gesammelt. Dann, wumms, wurde auch schon die Holzkiste gefüllt. Damals lebten sie im Zeitraffer.
Die Wanderungen, die sie unternahmen, damals, als es noch keine Handys gab: Sie kamen ihnen nicht riskant vor. Hatten sie überhaupt eine Notapotheke dabei? Allenfalls etwas Moleskin für Blasen, antibiotische Salbe, ein paar Schmerztabletten. Was, wenn einer von ihnen sich den Knöchel verstaucht, das Bein gebrochen hätte? Hatten sie überhaupt jemandem erzählt, wohin sie wollten?
Einmal im Herbst zum Beispiel, in einem Nationalpark. Raues Wetter: vorzeitiger Schneefall und Eis.
Mit ihren riesigen Rucksäcken marschierten sie durch den gelben und goldenen Buchenwald, erprobten mit ihren Wanderstöcken zugefrorene Teiche, konsultierten Wanderkarten und waren sich uneins. Sie aßen Schokolade, machten Mittagspause: pflanzten sich auf Baumstämme, verschlangen Minikäse, hart gekochte Eier, Nüsse und Cracker. Rum aus dem Flachmann.
Tig hatte schon damals Knieprobleme, aber wandern ging er trotzdem. Er band sich Halstücher um die Knie, eins drüber und eins drunter. »Wieso laufen Sie immer noch?«, fragte ihn ein Arzt. »Im Grunde haben Sie kein Knie mehr.« Aber das war viel später.
In dem Jahr machte eine Großstadtlegende über Gefahren beim Wandern die Runde, nämlich dass angeblich männliche Elche in der Brunftzeit – im Herbst, also im Moment – sich zu Volkswagen-Käfern sexuell hingezogen fühlten. Es hieß, sie würden von Felsvorsprüngen herunterspringen, um die Käfer zu begatten, und dabei sowohl Auto als auch Fahrer zerquetschen. Nell und Tig hielten das für Schwachsinn, fügten aber »wahrscheinlich« hinzu, denn völlig auszuschließen war es natürlich nicht.
Sie schlugen an einem nahe liegenden Platz ihr Zelt auf, kochten sich abends auf ihrem kleinen Campingkocher eine Mahlzeit, hängten wegen der Bären ihre Essensvorräte in einen etwas abseits stehenden Baum und krochen in ihre eiskalten Schlafsäcke.
Nell lag wach und dachte über die Tatsache nach, dass ihr kuppelförmiges Zelt durchaus etwas von einem VW-Käfer hatte. Würde ein männlicher Elch mitten in der Nacht des Weges kommen und sie bespringen? Und würde er, nachdem er seinen Irrtum erkannt hätte, zornig werden? Brunftige Elche waren für ihren Zorn berüchtigt. Sie konnten zur ernsthaften Gefahr werden.
Im klaren Licht des Morgens schien die Möglichkeit des Zerquetschtwerdens durch Elche eher abwegig. Also kein lebensbedrohliches Erlebnis, außer in Nells Kopf. Ein Jahr später wurde ein Pärchen auf genau demselben Wanderweg in seinem Zelt von einem Bären getötet und halb aufgefressen. Gerade noch mal gut gegangen, fand Tig. Er begann, Nell abends aus einem Buch namens Bärenangriffe vorzulesen. Angreifende Bären traten in zwei Kategorien auf, hieß es: Bären, die Hunger hatten, und Bärenmütter, die ihre Jungen verteidigten. Reagieren sollte man je nachdem, nur gab es nicht direkt eine Methode, um zu wissen, woran man war. Wann sich tot stellen, wann seitwärts zurückweichen, wann sich wehren? Und bei welcher Bärenart: Schwarzbär oder Grizzly? Die Anweisungen waren kompliziert.
»Ich bin nicht sicher, ob wir kurz vor dem Schlafengehen so was lesen sollten«, sagte Nell. Sie waren bei der Geschichte über eine Frau angelangt, deren Arm abgebissen worden war, die es aber trotzdem geschafft hatte, den Bären durch einen Hieb auf die Nase in die Flucht zu schlagen.
»Die muss Nerven wie Stahlseile gehabt haben«, sagte Tig. »Die muss unter Schock gestanden haben«, sagte Nell. »Das kann einem übermenschliche Kräfte verleihen.«
»Immerhin, sie hat überlebt«, sagte Tig.
»Ü-bär-lebt«, scherzte Nell. »Sozusagen.«
Hielt sie das alles auch nur im Geringsten davon ab, weitere Wanderungen ohne entsprechende Ausrüstung zu unternehmen? Nein. Tig besorgte allerdings ein Bärenspray. In den meisten Fällen dachten sie sogar daran, es einzupacken.
Als Nell das alles Revue passieren lässt – denn mit der Zeit führt am Revue-passieren-Lassen nichts vorbei –, fragt sie sich: Hätte Mr Footes Unterricht ihnen, wenn es hart auf hart gekommen wäre, genützt? Vielleicht im Fall des Schornsteinfeuers: Wäre sie in der Lage gewesen, den bewusstlosen Tig aus dem Gebälk zu ziehen, hätte sie ihn beatmen können, während das Haus niederbrannte? Aber von einem Bären gefressen oder einem Elch zerquetscht zu werden? Es hätte keine Rettung gegeben.
Mr Foote hatte recht: Man kann es nie wissen. Niemand kennt den Ausgang. Der zu Recht so heißt. Alle müssen irgendwann hindurch. Und niemand kommt zurück. »Hier kommen wir nicht lebend raus«, hatte Tig früher immer gewitzelt, obwohl es kein Witz war. Und wenn man es doch wissen würde, wenn man es ahnen könnte, wäre das etwa besser? Nein: Man würde sich nur die ganze Zeit verrückt machen, man würde Dinge betrauern, die noch gar nicht passiert wären.
Dann sich lieber in Sicherheit wiegen. Lieber improvisieren. Lieber leidlich vorbereitet durch die herbstlich-goldenen Wälder dahinmarschieren, mit dem Wanderstock eisige Teiche testen, zwischendurch Schokolade essen, auf gefrorenen Baumstämmen sitzen, mit kalten Fingern hart gekochte Eier schälen, während der erste Schnee zur Erde rieselt und die Dämmerung sich herabsenkt. Kein Mensch weiß, wo man ist.
Waren sie wirklich so unbekümmert gewesen, so selbstvergessen? Ja. Selbstvergessenheit hatte ihnen gute Dienste geleistet.
ZWEI VERBRANNTE MÄNNER
»John hat sich in den Heizkörper geschossen«, sagte François. Er lachte sein rotwangiges, lautloses Lachen. »Aber Sie dürfen ihm nicht erzählen, dass Sie’s von mir erfahren haben.«
»Wie meinen Sie das, ›in den Heizkörper‹?«, fragte ich. François war nicht immer einfach zu verstehen.
»Eigentlich wollte er sich erschießen«, sagte François, »aber dann hat er sich’s anders überlegt und stattdessen den Heizkörper erschossen.« Er hielt inne, ließ mir Zeit, um angemessen die Augenbrauen hochzuziehen und Wirklich? zu fragen.
»Ja! Ich glaube schon«, fuhr er fort. »Der Raum ist mit Wasser vollgelaufen. Er hat den Klempner angerufen. Er ist ziemlich außer sich.«
»O weh«, sagte ich. John war den Winter über unser Vermieter gewesen, wobei Tig und ich mittlerweile ein anderes Haus gemietet hatten. John pflegte damals aus Paris zu kommen, um nach uns zu sehen, sagte er, auch wenn ich vermute, dass er in Wahrheit nur ein anderes Publikum wollte als seine skeptische französische Frau. Er übernachtete in einem Zimmer, das er für den Eigengebrauch behalten hatte, und tauchte auf, um übers Grundstück zu schlurfen, sich mit verschiedenen, für Reparaturarbeiten angeheuerten Handwerkern herumzustreiten und hin und wieder mit uns zu essen.
Insofern kannte ich seine Wutanfälle, die jederzeit entfesselt werden konnten. Ich wusste auch, wo sich besagter Heizkörper befand: im Flur hinter der Küche. Dort reinigte John sein Gewehr, oder seine Gewehre. Über die Anzahl wusste ich nichts Genaues. Was schoss er damit? Womöglich Wildschweine, früher mal. Die Hügel wimmelten davon; sie wühlten die Erde unter den Rebstöcken auf, zudem ließen sie sich zu Wurst verarbeiten. Aber bestimmt war die letzte Wildschweinjagd schon eine Weile her: John war nicht mehr fit genug dafür.
»In den Heizkörper! Du lachst dich kaputt«, sagte François und zog noch mehr heitere Gesichter. »Aber Sie dürfen nicht durchblicken lassen, dass Sie es wissen. Er wäre gekränkt.«
So ging es immer mit den beiden. Gelächter hier, Wutanfälle dort. Sie waren enge Freunde: der eine ein schlaksiger, aufbrausender Ire; der andere ein kleiner, rundlicher, freundlicher Franzose. Sie waren ein unwahrscheinliches Paar. Aber obwohl sich Johns Wutanfälle gegen alles und jeden richten konnten, trafen sie niemals François. Und François ging so beflissen mit Johns Gefühlsleben um, als wäre er eine der zahlreichen streunenden Katzen, die François adoptiert hatte.
Und zwar aus folgendem Grund: Beide waren im Krieg gewesen.
Inzwischen sind sie tot. Etwas, das immer öfter vorkommt: Die Leute sterben. Der Vorfall mit dem Heizkörper fand in den frühen Neunzigerjahren statt, da waren die beiden ungefähr – was? Ich zähle rückwärts. John war bei der britischen Navy gewesen, sagen wir, 1939 war er achtzehn, neunzehn oder zwanzig. Zur Zeit des erschossenen Heizkörpers muss er also Anfang siebzig gewesen sein, mehr oder weniger. François war drei oder vier Jahre jünger.
In dem Jahr schenkten mir beide ihre Geschichten. Da sie wussten, was für ein Wesen ich war, wussten sie auch – ja vertrauten darauf –, dass ich eines Tages von ihrem Leben erzählen würde. Warum wollten sie das? Warum will das überhaupt jemand? Uns widerstrebt die Vorstellung, zu einer Handvoll Staub zu werden, also wünschen wir uns stattdessen, zu Worten zu werden. Atem im Munde anderer.
Meine Herren, die Zeit ist gekommen. Ich werde mein Bestes für euch tun. Hört ihr zu?
Zunächst muss ich den Rahmen abstecken, die Rahmenbedingungen, unter denen ich die beiden kennenlernte.
Johns Haus – das Tig und ich in jenem Winter gemietet hatten – stand in einem prototypischen provenzalischen Dorf: ein paar um eine Kreuzung herum verstreute Häuser, die meisten waren Teil eines Bauernhofs. Es gab streunende Schweine (Schimpfen auf die Schweine). Es gab jede Menge Schlamm auf den Straßen (Schimpfen auf den Schlamm). Es gab Nachbarn in dicken Strickjacken und dreckigen Overalls (Schimpfen auf die Nachbarn). Johns Haus jedoch war nicht Teil eines Bauernhofs. Es musste wohl mal einem Angehörigen des niederen Landadels gehört haben, und John erfüllte die Kriterien eines zeitgenössischen Exemplars: eine geräumige Wohnung in Paris in der Nähe der Kirche Saint-Germain; eine Rente, die ihm allerhand Luxus erlaubte, Reisen und Essengehen zum Beispiel, das von uns gemietete Haus auf dem Land.
Das Haus war zweistöckig, aus Stein, 18. Jahrhundert, mit den damals und dort typischen hohen Fenstern und Fensterläden. Es hatte einen schmiedeeisernen Zaun mit Tor, darin einen Garten, einen Portikus nach Süden mit glyzinienumrankten Säulen. Die Einrichtung zählte zu den schönsten, die Tig und ich unabhängig voneinander je gesehen hatten. Trotz ihrer Schönheit wirkte diese Einrichtung immer diffus, wie durch Rauch gesehen: Die Farben waren leicht verblasst, die Konturen leicht verschwommen. Die Möbel waren weder bequem noch praktisch, aber authentisch. John bläute uns das ein, wobei der exquisite Geschmack der seiner Ehefrau war, nicht seiner. (Auf diese ungesehene Ehefrau wurde nie geschimpft, zumindest nicht in unserem Beisein.)
Während des Krieges hatte das Haus einem Engländer von ungewissen Loyalitäten gehört. Kurz vor Kriegsende war er unter dem Säulenvorbau mit den Glyzinien ermordet aufgefunden worden, in dem herrlichen Garten, in der Sonne. Kugel in den Kopf. Kein Gewehr in Sicht, also kein Selbstmord.
»Warum?«, fragte ich John. Ein Achselzucken, gefolgt von einer Minitirade auf das Verbrechertum und die Geheimniskrämerei hier in der Gegend. Niemand wusste, warum. Oder vielmehr, irgendwer muss es gewusst haben, aber niemand packte aus. So sei das damals gewesen, sagte John; so sei es noch immer, unter der Oberfläche. Man könne nie sagen, wann jemand auf Rache sinne, sagte John, wegen irgendeines schmutzigen politischen Verrats oder wegen Verleumdung oder einer Rangelei um irgendein syphilitisches Weibsstück oder eines Tauziehens um ein Stück Land, das war immer möglich, oder wegen der zwei großen Tabus: Schneckenklau – wer die Schnecken eines anderen Mannes auch nur ansah, musste mit standrechtlicher Erschießung rechnen – und Trüffelwilderei, worauf Kastration mit dem rostigen Schälmesser stand.
Selbst schuld, sagte John, wer so dämlich ist.
Die Wälder wimmelten von Hinweisschildern, die zur Abschreckung potenzieller Übeltäter und ihrer trüffelschnüffelnden Hunde mit Fallen oder Gift drohten. Einmal beim Wandern durch die Wälder stießen wir auf einen Baum, in dem ein offenbar aus Rinderknochen zusammengefügtes Andreaskreuz hing. War das eine Art Hexenzeichen? Eine Warnung, aber wovor oder für wen? Wir hatten den gekennzeichneten Weg verlassen; niemand verirrte sich hierher. »Nicht anfassen«, sagte Tig, aber das hatte ich auch nicht vorgehabt. Es tummelten sich schon die Fliegen, und es stank nach verwesendem Fleisch.
Wir erzählten John von dem Knochenarrangement und lösten damit eine neue Tirade über die dunklen Machenschaften in diesen Breiten aus. Boshafte Hinterwäldler, strohdumme, ungehobelte Bauerntölpel, emmerdeurs, Schmuggler, Diebe. Kein Respekt für die Zivilisation, auch nicht für das Gesetz, so wie es aussah.
Aber das liege doch vielleicht am kollektiven Gedächtnis, sagte ich. Am Misstrauen gegen Autoritäten. Über die Jahrhunderte habe es immer wieder Zuwanderung von Nonkonformisten gegeben in dieser Gegend; die Katharer, die Vaudois … (damals las ich eifrig Touristenbroschüren). John stieß einen Lacher aus. Die Katharer! Was redete ich da für eine Grütze! Scheiß auf die Katharer, die »Vollkommenen«, von wegen, selbstgefälliges Pack, kein Hahn krähe nach den Katharern, außer den Leuten, die Billigsouvenirs aus China und das ganze lavendelstinkende Kunsthandwerk verhökerten; und scheiß auch auf die Vaudois, prätentiöse, bibelhörige, miesepetrige Heuchler! Diese beiden Fraktionen – noch zwei Beispiele von jener Art gottgefälliger Kinderfickerei, die sich abspiele, sobald die Religion ins Spiel komme.
Aber sie seien aufs Schlimmste verfolgt worden, sagte ich. Die Katharer. Ob es nicht Simon de Montfort gewesen sei, der Carcassonne – alles innerhalb der Stadtmauern, einschließlich Frauen und Kindern – niedergebrannt und befohlen habe: »Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen«?
Da verschwand Tig in die Küche, um sich einen Scotch einzuschenken. Er interessierte sich nicht sehr für die Dualismen des 13. Jahrhunderts, für Ketzerei im Allgemeinen oder für Massaker; anders als ich. Damals war ich eine Sammlerin der mannigfaltigen Ausreden, die sich die Menschen einfallen ließen, um sich gegenseitig abzuschlachten.
John jedoch kannte sich mit Ketzerei bestens aus. Nein, sagte er, es sei nicht Simon de Montfort gewesen, der den Leuten die Lippen abgerissen und die Augen ausgestochen habe, sondern irgendein geifernder katholischer Abt; und es sei nicht Carcassonne gewesen, sondern Béziers: eine flächendeckende Zerstörungsorgie, ein menschliches Grillfest, es müsse zum Himmel gestunken haben. Wenn ich vorhätte, in französischer Geschichte herumzudilettieren – wovon er mir abrate, da sie aus nichts als Blutbädern und Leichenbergen bestehe –, sollte ich zumindest wenigstens die Fakten kennen. Außerdem, scheiß auf die Verfolgten! Sie waren Ketzer, es war ihre Entscheidung, was hatten sie erwartet? Sie wären enttäuscht gewesen, hätte man sie nicht verfolgt, Masochisten, die sie waren, suhlten sie sich bis zur Ekstase in ihrem Leiden, dieses Scheißgesindel, also hipp, hipp, hurra auf die Katholiken, im Verfolgen waren sie gut, das musste er ihnen lassen.
Nicht, dass er selbst Katholik wäre. Scheiß auf die Katholiken, und vor allem auf die irischen! Für sein Geburtsland hatte er einen Sonderplatz in der Hölle reserviert, und er wurde nie müde, Anekdoten über die Korruptheit der Politik, die Perversität des Klerus und die Dussligkeit des durchschnittlichen irischen Hinterwäldlers vom Stapel zu lassen. Der Diener, der ihm seinerzeit in einem heruntergekommenen Dubliner Grandhotel seine Schuhe mit zwei verschiedenen Farben geputzt hatte, oder der Automechaniker, der ihm Öl nachgefüllt und dabei gemeint hatte: »Wie viel macht das dann?« Zu blöd zum Scheißen, diese Leute.
Ich war noch nicht bereit, die Ketzer auf sich beruhen zu lassen. Aber die Nonkonformisten, sagte ich und versuchte, das Thema noch mal aufzugreifen, vor allem in Südfrankreich. Ihre Weigerung, sich einzureihen. Das sei doch sicherlich mit ein Grund, weshalb der französische Widerstand während des Krieges hier unten so stark gewesen sei. Die vom Maquis zum Beispiel, die sich in den Bergen versteckt und sich nachts ins Tal geschlichen hätten, um Attentate auf die deutschen Besatzer zu verüben und die Eisenbahntrassen in die Luft zu sprengen?
Was sei ich bloß für eine hirntote nordamerikanische Punze, sagte John. Ob ich die geringste Ahnung hätte, wie viele unschuldige Dorfbewohner zusammengetrieben und niedergemäht worden seien, um diese sinnlose und egoistische Maquisard-Nummer zu rächen? Keine ihrer überkandidelten Heldentaten habe auch nur den Ansatz einer Rolle gespielt, es sei ihnen nur ums Abschlachten gegangen! Scheiß auf den Maquis!
Wenn ihm keine Gruppierung mehr einfiel, die er verleumden konnte, schloss er sich in seinem Zimmer ein und weinte (vermute ich). Bei all dem Gepolter war er ein zartes Pflänzchen, wie so viele zornige Menschen. Er muss irgendwann mal eine Vorstellung davon gehabt haben – vielleicht hatte er sie immer noch –, wie die Dinge in einer besseren Welt als dieser eigentlich hätten laufen sollen, aber dahintergekommen bin ich nie.
Ich war mir nicht sicher, was John im Krieg gemacht hatte, aber was immer es war, lustig war es nicht. Er war im Pazifik gewesen, wo eine ungeheure Zahl von Schiffen der Royal Navy versenkt worden und fünfzigtausend Männer zu Tode gekommen waren. War sein Schiff torpediert worden? Wäre er fast ertrunken? Er sprach nicht oft über den Krieg, außer in Form von Schmähungen gegen die Amerikaner, die für den Südpazifik die ganzen Lorbeeren eingeheimst hätten. Kaum jemand wisse heute noch, dass auch die Briten dort gekämpft hätten.
Was das Musical South Pacific angehe, in das ihn eine Frau mitgeschleppt habe, als er mal zu betrunken gewesen sei, um Widerstand zu leisten – er hätte kotzen können. Scheiß auf tanzende Matrosen! Scheiß auf diese blondierte Schabracke, die sich einen Mann aus den Haaren wäscht! Keiner dieser sangeslustigen Witzbolde hat erlebt, wie neben einem ein völlig intakter Kerl steht, und auf einmal, wumms, ist der Kopf ab, nur noch ein blutender … Ach, scheiß drauf!
Nach dem Krieg war er in die Werbung gegangen und ausgesprochen erfolgreich gewesen; daher die gute Altersversorgung. Das war in New York (scheiß auf New York, jeder war ein Ganove) und auch in Toronto (scheiß auf Toronto, schlammiges prüdes Provinzloch), die Ära der hart trinkenden Werbeleute, aber jeder sei jedem in den Rücken gefallen, allesamt Banditen, er nicht ausgenommen.
Die wirklich erfolgreichen Reklameprodukte waren damals Zigaretten und Alkohol; außerdem alles, was mit Seife zu tun hatte, denn der Krieg war so schmierig und schmutzig gewesen, dass sich danach alle nur noch grün und blau schrubben wollten. Quietschsauber, ein Neuanfang, das war’s, was man gewollt hatte. Er selbst hatte sich auf Shampoo spezialisiert. Haarshampoo und Heimdauerwellen – ein ganz großes Ding damals, seinen Kopf im Namen der Schönheit einer Tortur zu unterziehen – und Haarfärbemittel. Er behauptete, der Verfasser eines bekannten Slogans gewesen zu sein: »Nur ihr Friseur kennt die Wahrheit.« Schlichtweg genial, der Spruch: ein Augenzwinkern über ein geteiltes Geheimnis plus der Hinweis auf eine verbotene Liebschaft. Was war da bloß hinter den Kulissen gelaufen, um dieses selige Lächeln ins Gesicht der Frau aus dem Werbespot zu zaubern, diesen schelmischen Seitenblick? Ein Techtelmechtel mit dem Friseur! Rummachen in der Umkleide, die kleine Schlampe.
Untertöne gab es nicht wenige in diesen Werbespots; und die Männer, aus deren Feder sie stammten – ausschließlich Männer, keine kratzbürstigen karrieregeilen Emanzen, die an allem was zu meckern hatten und jeden Karren gegen die Wand fuhren –, hatten reichlich was am Laufen gehabt. John selbst hatte einiges am Laufen gehabt, behauptete er. O ja, wenn er mal richtig auspacken würde, wir würden staunen! Er war gut aussehend gewesen – das sagte er nicht direkt, aber es wurden Fotos hervorgeholt. Goldene Zeiten, als gäb’s kein Morgen. Von einem Bett ins nächste, dafür gab’s immer Freiwillige, gelangweilte Hausfrauen, die nur danach lechzten, ihren Gatten Hörner aufzusetzen, ein bisschen Aufregung, alle Vorsicht in den Wind geschossen, alles völlig unvermittelt, hechelnde kleine rosa Zungen, während er seinen Mann stand, wortwörtlich, und immer gern zur Hand ging.