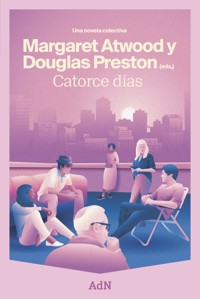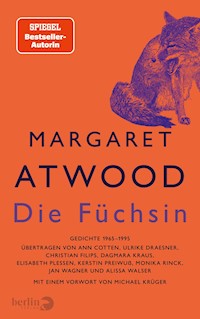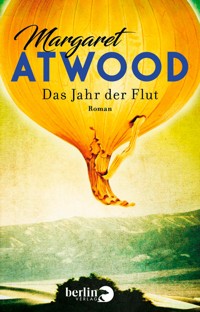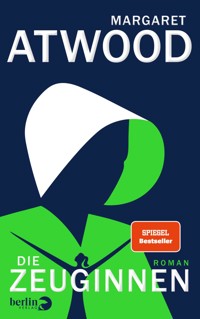2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich hätte ihre Mutter eine Vorzeigemama sein können - aber deren gestärkte Hemdblusenkleider, Perlenketten und geblümte Schürzen täuschten niemand. Auch die sehr merkwürdigen, durchwegs giftigen Pflanzen in ihrem Suburbia-Vorgarten, liessen vermuten, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Wenn sie in Nöten waren, kamen die Nachbarinnen zwar zu geheimnisvollen Treffen zu ihr, luden sie aber nie zum Tee ein ... Es gab genug Hinweise, ihre prophetische Warnungen sehr ernstzunehmen - selbst wenn es um den ersten Freund geht ... Das Leben einer Teenagerin in Kanada in den 1950iger Jahren in der Vorstadt ist schwer genug, auch wenn man keine Mutter hat, die wahrscheinlich eine Hexe ist. Schon der Makel, dass ohne Vater aufzuwachsen hätte gereicht, um als Außenseiterinzu gelten. Aber so wird das, was eine durchscnittliche Pubertät hätte sein können, zu einer Achterbahnfahrt aus Vermutungen und Zweifeln. Als die Tochter irgendwann erwachsen wird und die Behauptungen ihrer Mutter immer haarsträubender werden, beginnt sie, alles in Frage zu stellen, was sie einst für selbstverständlich hielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem Englischen von Monika Baark
»Meine böse Mutter« erschien unter dem Originaltitel »My Evil Mother« erstmals in:
»Old Babes in the Wood«, PRH, Toronto/London/New York, 2023.
© der Originalausgabe: O. W. Toad Ltd., 2023.
Auf Deutsch erscheint »Old Babes in the Wood« unter dem Titel »Hier kommen wir nicht lebend raus«.
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
MEINE BÖSE MUTTER
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
MEINE BÖSE MUTTER
»Du bist so böse«, sagte ich zu meiner Mutter. Ich war fünfzehn, das Alter, in dem man Widerworte gibt.
»Das fasse ich mal als Kompliment auf«, sagte sie. »Ja, im landläufigen Sinne bin ich böse. Aber ich nutze meine bösen Kräfte nur für das Gute.«
»Ach, was du nicht sagst«, entgegnete ich. Wir stritten uns gerade über meinen neuen Freund Brian. »Und außerdem, gut ist ja wohl Ansichtssache.«
Meine Mutter stand in der Küche und war mit Mörser und Stößel zugange. Sie war häufig mit Mörser und Stößel zugange, wobei sie hin und wieder auch die Küchenmaschine benutzte. Wenn ich fragte: »Was ist das?«, sagte sie manchmal: »Knoblauch und Petersilie«, und dann wusste ich, dass sie irgendein Rezept nachkochte. Aber wenn sie sagte: »Schau mal kurz weg«, oder: »Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß«, oder: »Sag ich dir, wenn du alt genug bist«, wusste ich, dass sich irgendjemand warm anziehen musste.
Mit dem Knoblauch war sie ihrer Zeit voraus, das muss ich wirklich sagen: In unserer Art Nachbarschaft hatte sich so etwas noch nicht herumgesprochen.
Wir wohnten damals in einer Gegend am nördlichen Rand von Toronto, einer der vielen Städte, die gerade in rasendem Tempo über Äcker und trockengelegte Sümpfe expandierten, dabei Heerscharen von Wühlmäusen das Fürchten lehrten und massenhaft Klette platt walzten. Aus dem planierten Schlamm waren Nachkriegs-Terrassenhäuser in ordentlichen Reihen gesprossen, allesamt mit Panoramafenster – Häuser im Ranchstil mit Flachdach, wo es im Winter damals noch nicht durchregnete. Die Bewohner dieser Häuser waren moderne junge Leute mit Kindern. Die Väter hatten Jobs, die Mütter nicht. Meine Mutter war eine Ausnahme: kein sichtbarer Ehemann, kein Job im eigentlichen Sinne, wobei sie von irgendwoher doch Unterstützung zu bekommen schien.
Unsere Küche war groß und sonnig, mit kanariengelbem Linoleumboden, einer Frühstücksnische und einer weißen Anrichte mit blauen Tellern und Schälchen in Reihen. Meine Mutter hatte einen Fimmel für blaues Geschirr; sie sagte, es wehre böse Blicke ab, die das Essen verderben wollten.
Ihre gezupften Augenbrauen bildeten zwei ungläubige Bögen, wie es eben noch in Mode gewesen war. Sie war weder groß noch klein, weder pummelig noch dünn. In allem gab sie sich Mühe, den goldenen Mittelweg zu beschreiten. An dem Tag trug sie eine geblümte Schürze – Tulpen und Narzissen – über einem Hemdblusenkleid mit schmalen weißen und mintgrünen Streifen und Bubikragen. Blockabsätze. Einen einzelnen Perlenstrang, echte Perlen, keine Zuchtperlen. (Das war’s wert, sagte sie. Nur die echten haben eine Seele.)
Schützende Farbgebung, so nannte sie ihre Outfits. Sie sah aus wie eine verlässliche Mutter aus einer so respektablen Gegend wie unserer. Wenn sie in der Küche hantierte, sah sie aus, als würde sie für ein Frauenmagazin à la Good Housekeeping ein schnelles Rezept demonstrieren – irgendwas mit Tomatenaspik, denn es waren die Fünfzigerjahre, als Tomatenaspik eine Lebensmittelgruppe darstellte.
Sie hatte keine engen Freundinnen in der Gegend – »Ich bleibe lieber für mich«, sagte sie –, kam aber den erwarteten Nachbarschaftsdiensten nach: Sie brachte den Kranken Thunfischaufläufe, holte Briefe und Zeitungen der verreisten Nachbarn herein, um ihre Häuser vor Einbrechern zu schützen, passte hin und wieder auf Hunde oder Katzen auf. Aber nicht auf Babys: Selbst wenn meine Mutter sich anbot, hielten sich Eltern mit Babys zurück. Nahmen sie womöglich ihre unsichtbare, aber leicht beunruhigende Aura wahr? (Für andere unsichtbar; sie selbst konnte sie angeblich sehen. Lila, behauptete sie.) Vielleicht hatten sie Angst, bei der Rückkehr festzustellen, dass ihr Kind im Bräter gelandet war wie ein Spanferkel. Dabei hätte meiner Mutter nichts ferner gelegen. Sie war böse, aber so böse nun auch wieder nicht.
Manchmal kamen verzweifelte Frauen – immer waren es Frauen – vorbei, und sie kochte ihnen eine Tasse zweifelhaften Tee und hörte ihnen am Küchentisch zu, wobei sie sie eindringlich ansah und wortlos nickte. Hat sie dafür Geld genommen? Hat sie so ihr Leben verdient, zumindest teilweise? Ich könnte nicht drauf schwören, aber mir schwant etwas.
Wenn ich nach oben stapfte, um Hausaufgaben zu machen, sah ich diese Beratungssitzungen, die da im Gange waren. Oder wenn ich vorgab, Hausaufgaben zu machen; nicht selten lackierte ich mir stattdessen die Zehennägel oder suchte mein Gesicht im Spiegel nach Hautunreinheiten ab – zu teigig, zu picklig, Hamstergebiss – oder legte eine dicke Schicht tiefroten Lippenstift auf und bewunderte mein schmollendes Spiegelbild oder flüsterte am Flurtelefon mit Brian. Die Versuchung, meine Mutter zu belauschen, war groß, aber sie wusste immer Bescheid. »Der Lauscher an der Wand«, sagte sie dann. »Ab ins Bett! Schönheitsschlaf!« Als ob man vom Schlafen allein schöner würde.