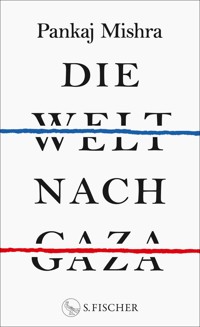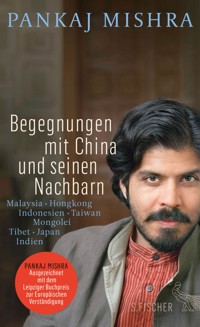12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Asiens Antwort auf den westlichen Imperialismus: »Provokant, beschämend und überzeugend« The Times Nachdem die letzten Erben des Mogul-Reiches getötet und der Sommerpalast in Peking zerstört war, schien die asiatische Welt vom Westen besiegt. Erstmals erzählt der Essayist und Schriftsteller Pankaj Mishra, wie in dieser Situation Intellektuelle in Indien, China und Afghanistan eine Fülle an Ideen entwickelten, die zur Grundlage für ein neues Asien wurden. Sie waren es, die Mao und Gandhi inspirierten und neue Strömungen des Islam anregten. Von hier aus nahmen die verschiedenen Länder ihren jeweiligen Weg in die Moderne. Unterhaltsam und eindringlich schildert Pankaj Mishra die Entstehung des antikolonialen Denkens und seine Folgen. Ein Buch, das einen völlig neuen Blick auf die Geschichte der Welt bietet und den Schlüssel liefert, um das heutige Asien zu verstehen. »Brillant. Mishra spiegelt den tradierten westlichen Blick auf Asien zurück. Moderne Geschichte, wie sie die Mehrheit der Weltbevölkerung erfahren hat - von der Türkei bis China. Großartig.« Orhan Pamuk »Lebendig … fesselnd … ›Aus den Ruinen des Empires‹ hat die Kraft, nicht nur zu belehren, sondern zu schockieren.« Mark Mazower, Financial Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Pankaj Mishra
Aus den Ruinen des Empires
Die Revolte gegen den Westen und der Wiederaufstieg Asiens
Aus dem Englischen von Michael Bischoff
FISCHER E-Books
Mit einem Nachwort von Detlev Claussen
Inhalt
China und Indien liegen gleichsam noch außer der Weltgeschichte …
Wir können uns freilich in die Einzelheiten dieser Geschichte weiter nicht einlassen, die, da sie selbst nichts entwickelt, uns in unserer Entwicklung hemmen würde. G. W. F. Hegel, 1820
Die Europäer möchten ihrer Geschichte, einer »großen«, mit Blut geschriebenen Geschichte, entkommen. Aber andere – viele hundert Millionen – nehmen sie erstmals auf oder kommen gerade darauf zurück. Raymond Aron, 1969
Vorwort
Die heutige Welt nahm erstmals Gestalt an während zweier Tage im Mai 1905, und zwar in den engen Gewässern der Koreastraße. In dieser Meerenge, die heute zu den meistbefahrenen Seewegen der Welt gehört, besiegte eine kleine japanische Flotte unter dem Kommando des Admirals Tōgō Heihachirō einen großen Teil der russischen Flotte, die fast um die halbe Welt gesegelt war, um den Fernen Osten zu erreichen. Die Seeschlacht bei Tsushima – der deutsche Kaiser bezeichnete sie als die wichtigste Seeschlacht seit der ein Jahrhundert zurückliegenden Schlacht bei Trafalgar, und Präsident Theodore Roosevelt nannte sie »das größte Phänomen, das die Welt jemals gesehen hat« – bedeutete das faktische Ende eines Krieges, der im Februar 1904 begonnen hatte und in dem es vor allem darum ging, ob Korea und die Mandschurei künftig von Russland oder von Japan kontrolliert würden. Zum ersten Mal seit dem Mittelalter hatte ein außereuropäisches Land eine europäische Macht in einem größeren Krieg besiegt, und die Nachricht eilte um eine Welt, die von westlichen Imperialisten – und mit Hilfe der Erfindung des Telegraphen – zu einem engen Netz verbunden worden war.
In Kalkutta meinte Lord Curzon, Vizekönig von Indien, dem der Schutz der kostbarsten britischen Besitzung oblag: »Der Widerhall dieses Sieges rast wie ein Donnerschlag durch die flüsternden Galerien des Ostens.«[1] Hier hatte der auf Distanz bedachte und taktlose Curzon einmal den Finger am Puls der einheimischen öffentlichen Meinung. Die wurde am besten von einem damals noch unbekannten Rechtsanwalt in Südafrika namens Mohandas Ghandhi (1869–1948) zum Ausdruck gebracht, als er schrieb: »Die Wurzeln des japanischen Sieges haben sich so weit ausgebreitet, dass wir die Früchte, die er einmal tragen wird, noch gar nicht zu erkennen vermögen.«[2]
In Damaskus jubelte ein junger osmanischer Soldat namens Mustafa Kemal, der später unter dem Namen Atatürk (1881–1938) bekannt werden sollte. Kemal sehnte sich nach einer Reform und einer Stärkung des Osmanischen Reiches gegenüber der Bedrohung durch den Westen, und wie viele Türken erblickte er in Japan ein Vorbild, worin er sich nun bestätigt sah. Der 16-jährige Jawaharlal Nehru (1889–1964), später der erste Premierminister Indiens, hatte die Anfangsphasen des Kriegs zwischen Japan und Russland in seiner Provinzstadt voller Begeisterung in der Zeitung verfolgt und dabei von seiner eigenen Rolle bei der »Befreiung Indiens und Asiens aus europäischer Knechtschaft« geträumt.[3] Vom japanischen Sieg bei Tsushima erfuhr er während einer Zugfahrt von Dover zu seiner englischen Schule Harrow, und sie versetzte ihn sogleich in eine »ausgezeichnete Stimmung«.[4] Der chinesische Nationalist Sun Yat-sen (1866–1925) war gleichfalls in London, als er von dem Sieg erfuhr, und jubelte ebenfalls. Als er 1905 mit dem Schiff nach Hause zurückkehrte, gratulierten ihm arabische Hafenarbeiter am Suezkanal, weil sie ihn für einen Japaner hielten.[5]
Begeisterte Spekulationen über die Folgen des japanischen Sieges füllten türkische, ägyptische, vietnamesische, persische und chinesische Zeitungen. In Indien benannte man Neugeborene nach japanischen Admirälen. In den Vereinigten Staaten sprach der afroamerikanische Führer W. E. B. Du Bois von einem weltweiten Ausbruch »farbigen Stolzes«. Ein ganz ähnliches Gefühl erfasste den pazifistischen Dichter (und späteren Nobelpreisträger) Rabindranath Tagore (1861–1941), der seine Schüler auf einem improvisierten Siegesmarsch um einen kleinen Schulkomplex im ländlichen Bengalen anführte, als die Nachricht aus Tsushima eintraf.
Es spielte kaum eine Rolle, welcher Klasse oder Rasse sie angehörten. Die subalternen Völker der Erde erkannten sogleich die – moralischen und psychologischen – Implikationen des japanischen Triumphs. Und die Vielfalt war erstaunlich. Nehru gehörte einer Familie wohlhabender englischsprachiger Brahmanen an. Über seinen Vater, einen Nutznießer der britischen Herrschaft über Indien, ging das Gerücht, er schicke sogar seine Hemden zur chemischen Reinigung nach Europa. Sun Yat-sen war der Sohn eines armen Bauern; einer seiner Brüder starb während des Goldrauschs in Kalifornien, bei dem chinesische Kulis Hilfsdienste leisteten. Abdurreshid Ibrahim (1857–1944), der führende panislamische Intellektuelle seiner Zeit, der 1909 nach Japan reiste, um Kontakte zu japanischen Politikern und Aktivisten herzustellen, war in Westsibirien geboren. Mustafa Kemal stammte aus Selanik (dem heute in Griechenland gelegenen Thessaloniki), und seine Eltern waren albanischer und makedonischer Herkunft. Seine spätere Mitstreiterin, die türkische Schriftstellerin Halide Edip (1884–1964), die ihren Sohn nach dem japanischen Admiral Tōgō benannte, war eine weltlich gesinnte Feministin. Birmas nationalistische Ikone U Ottama (1879–1939), der sich vom japanischen Sieg über Russland dazu anregen ließ, sich 1907 in Tokio niederzulassen, war ein buddhistischer Mönch.
Die zahlreichen arabischen, türkischen, persischen, vietnamesischen und indonesischen Nationalisten, die sich über die Niederlage Russlands freuten, stammten aus noch unterschiedlicheren Verhältnissen. Aber sie alle teilten eine Erfahrung: die Unterjochung durch die Menschen aus dem Westen, die für sie lange nichts weiter als Emporkömmlinge oder gar Barbaren gewesen waren. Und sie alle zogen dieselbe Lehre aus dem japanischen Sieg: Die Weißen, Eroberer der Welt, waren nicht länger unbesiegbar. Zahlreiche Phantasien – von nationaler Freiheit, rassischer Würde oder einfach von Rache – erblühten in Herzen und Köpfen, die bis dahin missmutig die europäische Herrschaft über ihre Länder ertragen hatten.
Japan, das im 19. Jahrhundert von den westlichen Mächten tyrannisiert wurde und mit Sorge auf die grobe Behandlung Chinas durch diese Mächte schaute, hatte sich 1868 an die ehrgeizige Aufgabe einer inneren Modernisierung gemacht. Dazu gehörten auch der Ersatz eines halbfeudalen Schogunats durch eine konstitutionelle Monarchie und einen einheitlichen Nationalstaat sowie der Aufbau einer am westlichen Vorbild orientierten Wirtschaft mit intensiver Produktion und hohem Konsum. In einem 1886 erschienenen Bestseller mit dem Titel Die Zukunft Japans hatte der führende Journalist des Landes, Tokutomi Sohō (1863–1957), die Kosten einer japanischen Gleichgültigkeit gegenüber den vom Westen vorgegebenen »weltweiten« Entwicklungstrends dargelegt: »Diese blauäugigen, rotbärtigen Rassen werden unser Land wie eine gewaltige Welle überschwemmen und unser Volk auf die Inseln im Meer vertreiben.«[6]
Schon in den 1890er Jahren löste Japans wachsende industrielle und militärische Stärke europäische und amerikanische Ängste vor einer »Gelben Gefahr« aus – ein furchterregendes Bild von asiatischen Horden, die den weißen Westen überrannten. Die Niederlage Russlands bewies, dass Japans Pläne, mit dem Westen gleichzuziehen, erstaunlich erfolgreich gewesen waren. »Wir zerstreuen den Mythos der Unterlegenheit der nichtweißen Rassen«, erklärte Tokutomi Sohō nun. »Durch unsere Stärke zwingen wir alle dazu, uns als eine der größten Mächte der Welt anzuerkennen.«[7]
Auch in den Augen vieler anderer nichtweißer Völker widerlegte die Demütigung Russlands die rassischen Rangordnungen des Westens, indem sie den europäischen Anspruch, die angeblich »rückständigen« Länder Asiens zu »zivilisieren«, ad absurdum führte. »Das Gerede von der ›Bürde des weißen Mannes‹«, erklärte Benoy Kumar Sarkar (1887–1949), ein Pionier der indischen Soziologie, »ist zu einem Anachronismus geworden – außer für die blindesten Fanatiker.«[8] Japan habe gezeigt, dass die asiatischen Länder einen eigenen Pfad in die moderne Zivilisation mit ihrer besonderen Stärke finden könnten. Der jungtürkische Aktivist und spätere Minister Ahmed Riza (1859–1930) fasste diese noch lange nachhallende Bewunderung folgendermaßen zusammen:
»Die Ereignisse im Fernen Osten haben gezeigt, wie nutzlos die häufigen, aber schädlichen Eingriffe Europas zur Reformierung eines Volkes sind. Im Gegenteil, je isolierter ein Volk lebt und je besser es vor dem Kontakt mit europäischen Eindringlingen und Plünderern geschützt ist, desto besser entwickelt es sich in Richtung einer vernünftigen Erneuerung.«[9]
Gandhi, der in Südafrika gegen den institutionalisierten Rassismus kämpfte, zog eine ähnliche moralische Lehre aus dem japanischen Sieg: »Als alle in Japan, ob reich oder arm, zur Selbstachtung fanden, war das Land frei. Es konnte Russland einen Schlag ins Gesicht versetzen (…) Ebenso müssen auch wir das Bedürfnis haben, Achtung vor uns selbst zu haben.«[10] Der chinesische Philosoph Yan Fu (1854–1921) erinnerte an ein Jahrhundert voller Demütigungen Chinas durch westliche »Barbaren«, von den Opiumkriegen bis hin zur Zerstörung des Sommerpalasts in Beijing, und schloss: »Der einzige Grund, weshalb wir nicht ihr Fleisch verschlangen und auf ihrer Haut schliefen, war unsere mangelnde Stärke.«
Japan hatte gezeigt, wie man diese Stärke erlangte. Nach Ansicht vieler Asiaten, die von unfähigen Despoten und räuberischen europäischen Geschäftsleuten gepeinigt wurden, lag das Geheimnis dieser Stärke in der japanischen Verfassung. Mit diesem Vorbild bewaffnet, halfen politische Aktivisten in ganz Asien, eine Reihe vom Volk getragener, auf eine Verfassung zielender Revolutionen einzuleiten, die sich gegen verknöcherte Autokratien wandten (das besiegte Russland taumelte 1905 selbst in solch eine Revolution). Der osmanische Herrscher Sultan Abdulhamid II. (1842–1918) hatte ähnliche Modernisierungsbemühungen unternommen wie Japan, zumal die ständig wachsenden Ansprüche europäischer Mächte die Souveränität Istanbuls auf eine klägliche Fiktion reduzierten. Aber viele Bewunderer Japans in der muslimischen Welt waren weltlich ausgerichtete oder sogar antireligiöse Nationalisten – wie der im Exil lebende Jungtürke und Schriftsteller Abdullah Cevdet, der einmal schrieb, Japan sei der Träger »des Schwertes gegen die Unterdrücker, gegen die dreisten Invasoren; die Fackel für die Unterdrückten, für jene, die sich selbst leuchten«. Durch Japans Sieg ermutigt, zwangen die nationalistischen Jungtürken Sultan Abdulhamid, die seit 1876 ausgesetzte Verfassung wieder in Kraft zu setzen. Unter dem Eindruck des Sieges des verfassungsstaatlich organisierten Japan über das autokratische Russland schufen die Perser 1906 eine Nationalversammlung.
Im selben Jahr erlebte Ägypten die ersten größeren Massendemonstrationen gegen die britische Besatzung. Für nationalistische Muslime in Ägypten war Japan »Die aufgehende Sonne« – so der Titel eines Buchs, das der wichtigste nationalistische Führer Ägyptens, Mustafa Kamil (1874–1908), unmittelbar vor dem Russisch-Japanischen Krieg geschrieben hatte. Studenten aus zahlreichen muslimischen Ländern zogen nach Japan, um die Geheimnisse des dortigen Fortschritts kennenzulernen. Der Dominoeffekt des japanischen Sieges war selbst noch auf dem indonesischen Archipel zu spüren, das gerade erst von den holländischen Kolonialisten geeint worden war. Vertreter der Oberschicht Javas gründeten dort 1908 die erste nationalistische Partei.
Zu den folgenreichsten Veränderungen kam es in China; sie gipfelten 1911 im Sturz einer der ältesten kaiserlichen Dynastien der Welt. Tausende von Chinesen strömten im Gefolge der Ereignisse von 1905 nach Japan und schufen die bis dahin größte Bewegung im Ausland studierender Studenten. Viele der zur ersten Generation im nachkaiserlichen China gehörenden Führer kamen aus dieser Gruppe. 1910 lernte ein Schuljunge namens Mao Zedong (1893–1976) in einer Kleinstadt in der chinesischen Provinz Hunan ein japanisches Lied auswendig, das ihm ein Musiklehrer beibrachte, der einst in Japan studiert hatte:
»Der Sperling singt, die Nachtigall tanzt,
Und im Frühling die grünen Felder sind schön.
Der Granatapfel blüht rot, die Blätter der Weiden sind grün,
Und da zeigt sich ein neues Bild.«[11]
Noch Jahrzehnte später, als Japan China bedrohte, konnte Mao sich genau an den Text erinnern, und er sagte: »Damals kannte und spürte ich die Schönheit Japans, und in diesem Lied über Japans Sieg über Russland spürte ich etwas vom Stolz und von der Größe des Landes.«[12]
Auch anderswo weckte Japans Sieg patriotische Gefühle und trieb sie sogar ins Extrem. Zu den Opfern dieser neuen Stimmung gehörte der liberale Nationalismus, den verwestlichte einheimische Eliten erfolglos übernommen hatten. Die Stimmung in Bengalen, das Lord Curzon aufzuteilen gedachte, war bereits militant antibritisch. Aufruhr und Terroranschläge zeugten von einer Verhärtung der antikolonialistischen Gefühle von 1905, die der Indische Nationalkongress bis dahin nur in milder Form zum Ausdruck gebracht hatte. Radikale in Kalkutta und Dhaka begannen, Reisen bengalischer Studenten nach Tokio zu fördern, und in Europa und Amerika lebende antikolonialistische Aktivisten stellten Verbindungen zu irischen und russischen Revolutionären wie auch zu japanischen und chinesischen Führern her, um Waffen nach Bengalen zu schmuggeln.
Auch gebildete Kreise in Französisch-Indochina begannen an revolutionäre Gewalt zu denken. Der wegweisende vietnamesische Nationalist Phan Boi Chau (1867–1940) lebte von 1905 bis 1909 in Japan und unterrichtete zahlreiche Studenten aus Französisch-Indochina unter dem Dach seiner Dong-Du-Gesellschaft (»Blick nach Osten«). Sozialdarwinistische Vorstellungen eines Krieges der Rassen und des Kampfes ums Überleben infizierten den politischen Diskurs im buddhistischen Ceylon wie auch im konfuzianischen China und im islamischen Ägypten. In Kairo schrieb Rashid Rida (1865–1935), dessen Werk später der ägyptischen Muslimbruderschaft als Inspirationsquelle diente, voller Begeisterung über die Möglichkeit, Japan zum Islam zu bekehren und die »Gelbe Gefahr« der europäischen Phantasie in eine panasiatische Bewegung zur Befreiung von den Ungläubigen zu verwandeln.[13]
Durch das Gemetzel des Ersten Weltkriegs, ein Jahrzehnt nach der Schlacht bei Tsushima, verlor Europa aus asiatischer Sicht viel von seinem verbliebenen moralischen Ansehen. Japans Eroberung Asiens während des Zweiten Weltkriegs wurde zwar rückgängig gemacht, trug aber dennoch dazu bei, dass der Kontinent sich aus dem schwächer werdenden Griff der erschöpften europäischen Reiche löste. Langfristig betrachtet, dürfte es jedoch die Schlacht bei Tsushima gewesen sein, die den Auszug des Westens einläutete.
Was Tsushima allerdings nicht sogleich zu ändern vermochte, war die Überlegenheit der westlichen Waffen sowie der westlichen Wirtschaft, die Asien und Afrika in weiten Teilen des 19. Jahrhunderts aufgezwungen worden war. Das 20. Jahrhundert begann mit Strafexpeditionen deutscher Soldaten gegen antiwestlich eingestellte chinesische »Boxer« (die Bewegung der Yihequan, »Fäuste der Gerechtigkeit und Harmonie«); die Vereinigten Staaten schlugen eine Rebellion auf den Philippinen nieder; die Briten kämpften mit Hilfe indischer Soldaten gegen holländische Siedler in Südafrika. 1905 waren diese Kriege beendet, China war unterworfen, ebenso die Philippinen, und Südafrika war unter britischer Herrschaft vereint. Der Westen sollte noch viele Jahre nicht von der unmittelbaren Herrschaft über seine Territorien im Osten lassen. Aber Japans Sieg über Russland beschleunigte einen irreversiblen Prozess der intellektuellen und teilweise bereits der politischen Entkolonisierung.
Sun Yat-sen erinnerte 1924 an das schläfrige letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, als »die farbigen Rassen in Asien, die unter der Unterdrückung durch die westlichen Völker litten, eine Emanzipation für unmöglich hielten«:
»Die Menschen dachten und glaubten, die europäische Zivilisation sei – in Wissenschaft, Industrie, Manufaktur und Bewaffnung – progressiv, und Asien könne nichts Vergleichbares vorweisen. Folglich nahmen sie an, Asien könne Europa niemals widerstehen, und die europäische Unterdrückung lasse sich niemals abschütteln. Das war das Denken, das vor dreißig Jahren herrschte.«[14]
Japans Sieg über Russland 1905, so schreibt Sun Yat-sen, habe die Völker Asiens mit »neuer Hoffnung« erfüllt, mit der Hoffnung, »das Joch der europäischen Einschnürung und Herrschaft abzuschütteln und die ihnen zustehende Stellung in Asien zurückzugewinnen«. Und innerhalb von zwei Jahrzehnten, fügt er hinzu, seien Unabhängigkeitsbewegungen in Ägypten, der Türkei, Persien, Indien, Afghanistan und China beträchtlich gewachsen. Gandhi sagte 1905 voraus, »die Völker des Ostens« würden endlich »aus ihrer Lethargie erwachen«.[15] Das Geflüster des Ostens, vor dem Lord Curzon sich fürchtete, sollte schon bald zu lauten Erklärungen und Forderungen anschwellen. Verstreute und isolierte Einzelne fanden zusammen, um Massenbewegungen zu bilden und Aufstände anzuzetteln. Gemeinsam führten sie einen revolutionären Wandel von erstaunlicher Geschwindigkeit herbei.
Die europäische Herrschaft über Asien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte, erfuhr eine dramatische Schwächung. Um 1950 – Indien und China waren bereits unabhängige Staaten – besaß Europa in Asien nur noch eine periphere Präsenz, gestützt allein auf die neueste westliche Macht, die Vereinigten Staaten, und zunehmend abhängig von einem informellen Imperium, das sich auf Militärbasen, ökonomischen Druck und politische Handstreiche stützte. Die Europäer und nach ihnen auch die Amerikaner mussten am Ende erkennen, dass sie die Fähigkeit Asiens unterschätzt hatten, moderne Ideen, Techniken und Institutionen – die »Geheimnisse« der westlichen Macht – zu absorbieren und gegen die westliche Welt zu wenden. Sie hatten nicht erkannt, wie stark der Drang nach Freiheit und Würde bei jenen Völkern war, die von Europas einflussreichsten Denkern, von Hegel über Marx bis John Stuart Mill, für unfähig gehalten wurden, sich selbst zu regieren – Denker, deren Ideen sich in einer ironischen Wendung der Geschichte bei diesen »Untertanenvölkern« in Wirklichkeit als äußerst mächtig erweisen sollten.
Heute erscheinen asiatische Gesellschaften von der Türkei bis hin nach China als sehr vital und selbstbewusst. Das hatten jene, die im 19. Jahrhundert das Osmanische Reich und die Qing-Dynastie für »krank« und »todgeweiht« hielten, noch ganz anders gesehen. Die vielbeschworene Verlagerung der wirtschaftlichen Macht vom Westen in den Osten mag eintreten oder nicht, in jedem Fall haben sich jedoch neue Perspektiven für die Weltgeschichte eröffnet. Für die meisten Menschen in Europa und Amerika ist das 20. Jahrhundert immer noch weitgehend definiert durch die beiden Weltkriege und das langjährige atomare Patt mit dem sowjetischen Kommunismus. Inzwischen ist jedoch deutlicher zu erkennen, dass für die Mehrheit der Weltbevölkerung das zentrale Ereignis des letzten Jahrhunderts das Erwachen Asiens und dessen Auferstehung aus den Ruinen asiatischer wie auch europäischer Reiche war. Das zu erkennen heißt, die Welt nicht nur zu erfassen, wie sie heute existiert, sondern wie sie sich auch weiterhin umgestalten wird – nicht so sehr nach dem Bild des Westens, sondern gemäß den Vorstellungen und Zielen der einstmals subalternen Völker.
Wer waren die wichtigsten Denker und Akteure in diesem langjährigen Erneuerungsprozess Asiens? Wie stellten sie sich die Welt vor, in der wir heute leben, und wie jene Welt, in der zukünftige Generationen leben werden? In diesem Buch sollen diese Fragen beantwortet werden, indem die Geschichte der modernen Welt aus mehreren Perspektiven innerhalb Asiens betrachtet wird (wobei der Kontinent hier in der Weise abgegrenzt wird, wie die Griechen dies einst taten, mit dem Ägäischen Meer als Grenze zwischen Asien und Europa, dem Nil als Trennungslinie zwischen Asien und Afrika – eine geographische Vorstellung, die durchaus auch den heutigen geopolitischen Unterteilungen ähnelt).
Der Westen betrachtet Asien von jeher aus der engen Sicht seiner eigenen strategischen und wirtschaftlichen Interessen, ohne dabei die kollektiven Erfahrungen und subjektiven Sichtweisen der asiatischen Völker zu untersuchen oder sie sich überhaupt nur vorzustellen. Es mag verwirrend sein, diese andere Perspektive einzunehmen, und in diesem Buch werden sich zweifellos viele Namen und Ereignisse finden, die westlichen Lesern nicht vertraut sind. Aber es wird hier nicht versucht, eine um Europa oder den Westen zentrierte Perspektive durch eine um Asien zentrierte Sicht zu ersetzen. Vielmehr sollen vielfältige Perspektiven auf Vergangenheit und Gegenwart eröffnet werden, in der Überzeugung, dass die – zunehmend unhaltbaren – Voraussetzungen westlicher Macht keinen zuverlässigen Blickwinkel mehr darstellen und vielleicht sogar auf gefährliche Weise in die Irre führen.
Aus westlicher Sicht mag der Einfluss des Westens sowohl unvermeidlich als auch notwendig erscheinen und keiner sorgfältigen historischen Überprüfung bedürfen. Europäer und Amerikaner halten ihre Länder und Kulturen gewöhnlich für die Quelle der Moderne und finden sich in dieser Auffassung bestätigt durch das außergewöhnliche Schauspiel der weltweiten Verbreitung ihrer Kultur. Heute scheinen alle Gesellschaften, mit Ausnahme einiger isolierter Stammesgemeinschaften auf Borneo oder am Amazonas, zumindest teilweise verwestlicht zu sein oder nach Formen einer westlichen Moderne zu streben. Aber es gab eine Zeit, als der Ausdruck »Westen« nur eine geographische Region bezeichnete und andere Völker unbefangen eine universelle Ordnung unterstellten, in deren Zentrum ihre eigenen Werte standen. Bis ins späte 19. Jahrhundert hinein glaubten Menschen in Gesellschaften, die im Kern von Glaubenssystemen wie dem Islam oder dem Konfuzianismus geprägt waren – und damit weite Teile der bekannten Welt –, dass die menschliche Ordnung noch untrennbar mit der umfassenden, von ihren Vorfahren oder Göttern bestimmten göttlichen oder kosmischen Ordnung verschmolzen war.
In diesem Buch soll in einer weiten Perspektive gezeigt werden, wie einige der intelligentesten und sensibelsten Völker des Ostens mit den (sowohl physischen als auch geistigen) Übergriffen des Westens auf ihre Gesellschaften umgingen. Es wird beschrieben, wie diese Asiaten ihre Geschichte und ihr gesellschaftliches Dasein verstanden und wie sie auf die außergewöhnliche Abfolge von Ereignissen und Bewegungen reagierten, die zusammen über die heutige Gestalt Asiens entschieden – den Indischen Aufstand, die anglo-afghanischen Kriege, den Russisch-Japanischen Krieg, den Ersten Weltkrieg, die Pariser Friedenskonferenz, den japanischen Militarismus, die Entkolonisierung, den postkolonialen Nationalismus und den Aufstieg des islamischen Fundamentalismus.
Die Hauptprotagonisten des Buches sind zwei wandernde Denker und Aktivisten: Jamal al-Din al-Afghani (1838–1897), ein Muslim, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Mittleren Osten und in Südasien eine lange Karriere als scharfzüngiger Journalist und politischer Mahner verfolgte; und Liang Qichao (1873–1929), Chinas vielleicht wichtigster moderner Intellektueller, der an zahlreichen Ereignissen beteiligt war, die zur Zerstörung der alten kaiserlichen Gewissheiten seines Landes und – nach zahlreichen Schrecken – zu dessen Wiedererstehen als wichtiger Weltmacht führten. Viele von al-Afghani und Liang vorgetragene Ideen wurden schließlich zu bedeutsamen Triebkräften des Wandels. Diese frühmodernen Asiaten stehen am Beginn jenes Prozesses, durch den die gewöhnlichen Ressentiments gegen den Westen und die westliche Herrschaft samt den Ängsten hinsichtlich der eigenen Schwäche und des eigenen Niedergangs in ganz Asien in nationalistische und auf Befreiung zielende Massenbewegungen und in ehrgeizige Programme zum Aufbau von Staaten umgewandelt wurden.
Auch viele andere asiatische Denker werden zu Wort kommen – manche nur kurz, wie der vietnamesische Arbeiter, der sich später Ho Chi Minh nannte und 1919 in Paris in seinem geliehenen Anzug Präsident Wilson eine Petition zu überreichen versuchte, die ein Ende des französischen Kolonialismus in Indochina forderte. Andere, wie etwa Sun Yat-sen, der indische Dichter Rabindranath Tagore, der iranische Denker Ali Shariati und der ägyptische Ideologe Sayyid Qutb, tauchen kurz vor wechselndem Hintergrund auf. Wieder andere wie Gandhi übernehmen tragende Rollen in diesem Stück. Seiner Kennzeichnung der westlichen Zivilisation als »satanisch« gingen andere, einflussreichere Kritiken dieser Art in der muslimischen Welt und in China voraus.
Ganz bewusst liegt das Schwergewicht auf weniger bekannten Persönlichkeiten. Ich denke, dadurch treten die wichtigen politischen und geistigen Bestrebungen deutlicher zutage, die vor jenen bekannteren Figuren und auch über sie hinaus Bestand hatten, welche unsere Sicht Indiens, Chinas und der muslimischen Welt prägen und letztlich auch beschränken. Liang Qichao gab seine obsessive Konzentration auf den Aufbau des Staates an Mao Zedong und dessen Erben im kommunistischen China weiter; al-Afghanis Furcht vor dem Westen und sein obsessives Streben nach einer muslimischen Selbstermächtigung bereiteten den Weg für Atatürk und Nasser wie auch für Ayatollah Khomeini und prägen heute noch die Politik islamischer Gesellschaften.
In ihren langen und ereignisreichen Leben durchlebten die in diesem Buch diskutierten Asiaten die drei wesentlichen Reaktionen auf die westliche Macht: die reaktionäre Überzeugung, wenn die Menschen in Asien nur treu an ihren religiösen Traditionen festhielten, die angeblich den Traditionen aller anderen Zivilisationen überlegen waren, würden sie wiedererstarken; die gemäßigte Auffassung, wonach nur wenige westliche Techniken von Asiaten benötigt würden, da deren Traditionen bereits eine gesunde Grundlage für Kultur und Gesellschaft böten; und die entschiedene, von radikalen Säkularisten wie Mao und Atatürk vertretene Überzeugung, wonach die gesamte alte Lebensweise umgestürzt werden musste, um unter den dschungelähnlichen Bedingungen der modernen Welt konkurrieren zu können.
Die Form dieses Buches – teils historischer Essay, teils intellektuelle Biographie – hat ihren Hauptgrund in der Überzeugung, dass die geschichtlichen Linien im Leben einzelner Personen zusammenfließen, auch wenn dieses Leben jeweils seine eigene Gestalt und seinen eigenen Schwung besitzt. Die hier beschriebenen frühmodernen Asiaten reisten und schrieben sehr viel, untersuchten unablässig ihre eigenen und fremde Gesellschaften, dachten über die korrumpierende Wirkung der Macht nach, über den Zerfall der Gemeinschaft, den Verlust an politischer Legitimation und die Verlockungen des Westens. Im Rückblick erscheinen ihre leidenschaftlichen Analysen wie ein einzelner Strang, der scheinbar disparate Ereignisse und Regionen zu einem einzigen Bedeutungsgeflecht verwob. Indem ich die allgemeine intellektuelle und politische Atmosphäre Asiens im frühen 20. Jahrhundert beschreibe, möchte ich vor allem die Streifzüge dieser Männer auf den Nebenwegen der modernen Geschichte und des modernen Denkens nachzeichnen. Denn sie trugen, obschon sie relativ unbekannt sind, zur Schaffung der Welt bei, in der wir leben, ob sie uns nun gefällt oder nicht.
1.Die Unterjochung Asiens
Sie haben den Thron in ihren Händen. Sie haben das ganze Gebiet in ihren Händen. Das Land und die Zuweisung der Lebensgrundlagen sind in ihren Händen (…) Die Quellen der Hoffnung und der Angst sind in ihren Händen (…) In ihren Händen liegt die Macht, darüber zu entscheiden, wer erniedrigt und wer erhöht wird (…) Unser Volk ist in ihren Händen, Erziehung und Bildung sind in ihren Händen (…) Wenn der Westen bleibt, was er ist, und der Osten bleibt, was er ist, werden wir den Tag erleben, da die ganze Welt in ihren Händen ist.
Akbar Illahabadi, 1870er Jahre
Ägypten: »Der Beginn einer Reihe großer Schicksalsschläge«
Am frühen Morgen des 5. Mai 1798 verließ Napoleon Paris, um sich zu einer 40 000 Mann starken Armee zu begeben und mit ihr nach Ägypten zu segeln. Nach seinen Siegen in Norditalien hatte der populäre General sich bei seinen zivilen Vorgesetzten für eine Invasion Britanniens eingesetzt. Aber die Royal Navy war noch zu stark und die Franzosen noch nicht bereit, sie herauszufordern. In der Zwischenzeit brauchte Frankreich zur Mehrung seines Wohlstands Kolonien, das glaubte jedenfalls der Außenminister des Landes, Charles Maurice de Talleyrand. Und eine Präsenz in Ägypten konnte nicht nur einen Ausgleich für den Verlust der französischen Territorien in Nordamerika bieten, sondern auch eine ernsthafte Herausforderung an die britische East India Company darstellen, die mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus ihren indischen Besitzungen hohe Gewinne erzielte.
Als die Briten sich in Indien ausbreiteten, hatten sie die Franzosen aus den meisten ihrer Stützpunkte an der Küste vertrieben. 1798 waren die Briten in einen heftigen Kampf mit einem ihrer geschicktesten indischen Gegner verstrickt, Tipu Sultan, einem Verbündeten der Franzosen. Eine französische Herrschaft über Ägypten könnte das Machtverhältnis in Indien zu Ungunsten der Briten verschieben und zugleich die Russen abschrecken, die ein Auge auf das Osmanische Reich geworfen hatten. Sobald er dafür gesorgt habe, dass England um Indien zittere, erklärte Napoleon, werde er nach Paris zurückkehren und dem Feind den Todesstoß versetzen. Abgesehen von den geopolitischen Zielen seines Landes, hegte Napoleon auch eigene Phantasien von einer Eroberung des Orients. »Großen Ruhm kann man nur noch im Orient erwerben«, glaubte er, »Europa ist dafür zu klein.«[16] Von Ägypten aus gedachte er, im Stile Alexanders des Großen nach Asien vorzudringen, und sah sich selbst auf einem Elefanten reiten, in der Hand einen neuen, von ihm persönlich überarbeiteten Koran als Herold einer neuen Religion.
Napoleon fuhr mit einem großen Gefolge aus Wissenschaftlern, Philosophen, Künstlern, Musikern, Astronomen, Architekten, Landvermessern, Zoologen, Druckern und Ingenieuren nach Ägypten, die festhalten sollten, wie die Sonne der französischen Aufklärung im rückständigen Osten aufging. Dabei war er sich der Bedeutung des Geschehens durchaus bewusst – eines ersten umfangreichen Kontakts zwischen dem auf Modernisierung ausgerichteten Europa und Asien. Auf dem Mittelmeer ermahnte er seine Soldaten: »Ihr steht kurz vor einer Eroberung, deren Auswirkungen auf die Zivilisation und den Handel der Welt unermesslich sind.«[17] Er entwarf auch großartige Proklamationen an das ägyptische Volk, in denen er darlegte, dass die neue Französische Republik auf Freiheit und Gleichheit basiere, aber zugleich auch größte Bewunderung für den Propheten Mohammed und den Islam im Allgemeinen bekundete. Tatsächlich seien auch die Franzosen Muslime, da sie die christliche Dreifaltigkeit ablehnten. Er machte auch einigen Lärm um die Befreiung der Ägypter von ihren despotischen Herren – der uns heute nach 200 Jahren imperialistischer, im Gewande humanitärer Interventionen daherkommender Kriege sehr vertraut ist.
Die Franzosen, die im Juli ohne Vorwarnung in Alexandria auftauchten, überwanden jeden militärischen Widerstand, während sie nach Kairo vorstießen. Ägypten gehörte damals nominell zum Osmanischen Reich, wurde aber von einer Kaste ehemaliger Sklavensoldaten, den sogenannten Mamluken, regiert. Deren schwache Armeen waren nicht ausreichend gerüstet, um den kriegserfahrenen französischen Soldaten zu widerstehen, die gegenüber den Ägyptern in der Überzahl und zudem noch mit der neuesten Militärtechnologie ausgestattet waren.
Als Napoleon Kairo erreicht hatte, requirierte er für sich ein am damaligen Azbakiya-See gelegenes Herrenhaus, brachte die Wissenschaftler aus seinem Tross in einem neu gegründeten Institut d’Égypte unter und begann, Ägypten nach republikanischen Grundsätzen politisch neu zu gestalten. Er erfand einen aus weisen Männern bestehenden Diwan, eine ägyptische Version des Direktorats, das in Paris die exekutive Gewalt ausübte. Aber wo ließen sich die weisen Männer in dem von seiner herrschenden Klasse, den osmanischen Mamluken, verlassenen Kairo auftreiben? Zu ihrem Unbehagen sahen führende Theologen und religiöse Rechtsgelehrte Kairos sich plötzlich in politische Stellungen befördert und häufig auch von Napoleon um Rat gefragt – der erste von vielen zweckdienlichen Versuchen einer politischen Ermächtigung des Islam durch angeblich weltlich gesinnte Vertreter des Westens.
Napoleon unterdrückte seine Loyalität gegenüber der Aufklärung und bemühte sich nach Kräften, den muslimischen Klerus zu beschwichtigen, in der Hoffnung, die Geistlichen könnten ein Bollwerk für die französischen Truppen im Lande bilden. Am Geburtstag des Propheten zeigte er sich in ägyptischer Kleidung und sprach zur Beunruhigung seiner weltlich gesinnten Soldaten in Andeutungen von einer massenhaften Bekehrung der Franzosen zum Islam. Einige kriecherische (und wahrscheinlich als lächerlich empfundene) Ägypter priesen ihn als Ali Bonaparte, nach dem verehrten Schwiegersohn des Propheten. Dadurch ermutigt, machte Napoleon den Geistlichen den Vorschlag, das Freitagsgebet in der al-Azhar-Moschee, einem der größten Heiligtümer des Islam, solle in seinem Namen gesprochen werden. Die frommen Muslime waren verblüfft. Das Oberhaupt des Diwan, Sheikh al-Sharqawi, erholte sich immerhin so weit, dass er sagen konnte: »Ihr wollt den Schutz des Propheten … Ihr wollt, dass die arabischen Muslime unter Eurem Banner marschieren. Ihr wollt den Ruhm Arabiens wiederherstellen … Werdet Muslim!«[18] Napoleon erwiderte ausweichend: »Es gibt zwei große Hindernisse, die meine Armee und mich davon abhalten, Muslime zu werden. Das erste ist die Beschneidung, das zweite der Wein. Meine Soldaten sind seit ihrer Kindheit daran gewöhnt, und ich werde sie niemals dazu bringen können, darauf zu verzichten.«[19]
Napoleons Bemühungen, die ägyptischen Muslime von den Vorzügen der säkularen und republikanischen Prinzipien der Franzosen zu überzeugen, waren ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Die Bewohner von Kairo beklagten die dramatischen Veränderungen im Stadtbild und generell den korrumpierenden Einfluss der Franzosen. Ein Beobachter schrieb: »Kairo ist ein zweites Paris geworden, Frauen spazieren schamlos mit Franzosen umher, berauschende Getränke werden öffentlich verkauft, und es geschehen Dinge, die der Herr des Himmels nicht billigen würde.«[20] Im Sommer 1798 verpflichtete Napoleon alle Ägypter, die blau-weiß-rote Kokarde, das Abzeichen der Republikaner, zu tragen. Als er einmal Mitglieder des Diwan in sein Haus einlud, versuchte er, Sheikh al-Sharqawi ein blau-weiß-rotes Tuch um die Schultern zu legen. Das Gesicht des Scheichs färbte sich rot vor Angst angesichts der Blasphemie, und er schleuderte das Tuch auf den Boden. Ein verärgerter Napoleon bestand darauf, dass die Geistlichen zumindest die Kokarde zu tragen hatten. Am Ende fand man zu einem unausgesprochenen Kompromiss. Napoleon steckte ihnen die Kokarde an die Brust, und sie nahmen sie wieder ab, sobald sie seine Gesellschaft verließen.
Die islamischen Würdenträger mögen versucht haben, sich über ihren sonderbaren Eroberer lustig zu machen, während sie ansonsten ihren Geschäften nachgingen. Viele andere Muslime empfanden dagegen die Unterjochung Ägyptens durch einen Christen aus dem Westen eindeutig als Katastrophe, und in dieser Einschätzung wurden sie bestätigt, als französische Soldaten bei der Unterdrückung der ersten ägyptischen Aufstände gegen die Besetzung des Landes die al-Azhar-Moschee erstürmten, ihre Pferde in den Gebetsnischen unterstellten, mit ihren Stiefeln auf dem Koran herumtrampelten und Wein tranken, bis sie die Kontrolle über sich selbst verloren und auf den Boden urinierten.
Napoleon war zwar bereit, widerspenstige Dörfer niederzubrennen, Gefangene hinzurichten und Moscheen einzureißen, um Straßen zu verbreitern, aber insgesamt beging er in Ägypten weniger Grausamkeiten, als er es andernorts tat. Er war stets darauf bedacht, seiner Bewunderung für den Islam Ausdruck zu verleihen. Dennoch fasste der ägyptische Geistliche und Gelehrte ’Abd al-Rahman al-Jabarti, der die Eroberung Ägyptens durch Napoleon aufzeichnete, das Geschehen in den Worten zusammen: »große Schlachten, schreckliche Ereignisse, verheerende Tatsachen, Katastrophen, Unglück, Leid, Verfolgung, Störungen in der Ordnung der Dinge, Schrecken, Revolutionen, Unordnung, Zerstörung – mit einem Wort, der Beginn einer Reihe großer Schicksalsschläge«.[21] Und das war nur die Reaktion eines relativ wohlwollenden Zeitzeugen. Als die Nachricht von Napoleons Taten in Arabien eintraf, zogen die Bewohner von Mekka das große Tuch herunter, mit dem die heilige Kaaba verhängt war und das traditionell in Ägypten gefertigt wurde.
Die dramatische Geste zeigt deutlich, wie viele Muslime die Besetzung Ägyptens durch Napoleon wahrnahmen. Er hatte nicht weniger als die seit langem bestehende kosmische Ordnung des Islam gestört – etwas, das mehr als nur eine weitverbreitete Illusion darstellte, wie die menschliche Geschichte gezeigt hatte.
Der Ausdruck »Islam«, der ein breites Spektrum muslimischer Glaubensvorstellungen und -praktiken in aller Welt beschreibt, war vor dem 19. Jahrhundert nicht gebräuchlich. Dennoch hätten über die Jahrhunderte nur wenige Muslime bezweifelt, dass sie einer gleichermaßen kollektiven und individuellen Lebensweise, einer starken Solidargemeinschaft angehörten, die auf gemeinsamen Werten, Glaubensüberzeugungen und Traditionen basierte. Ein guter Muslim zu sein hieß Mitglied einer Gemeinschaft gleichgesinnter Verteidiger der moralischen und sozialen Ordnung zu sein. Es hieß auch, sich an der Schaffung und Ausbreitung der Gemeinschaft der Rechtgläubigen zu beteiligen und damit teilzuhaben an der Geschichte des Islam, wie er sich entwickelt hatte, seit Gott dem Propheten befohlen hatte, nach seinen Regeln zu leben. Diese Geschichte begann mit erstaunlichen Erfolgen, und jahrhundertelang schien es, dass Gottes Pläne für die Welt in der Realität umgesetzt werden könnten.
Im Jahr 622, dem ersten Jahr des islamischen Kalenders, gründeten Mohammed und seine Anhänger in einer kleinen Stadt in Arabien die erste Gemeinschaft von Gläubigen. Weniger als ein Jahrhundert später befanden sich arabische Muslime in Spanien. Große Reiche – Persien und Byzanz – fielen der kraftvollen Expansion der muslimischen Gemeinschaft zum Opfer. Von den Pyrenäen bis hin zum Himalaya wurde der Islam rasch zu einem neuen Symbol von Macht, und die von ihm geschaffene Ordnung war nicht nur politischer und militärischer Art. Die Eroberer Jerusalems, Nordafrikas und Indiens schufen eine neue Zivilisation mit eigenen sprachlichen, rechtlichen und administrativen Standards, eigener Kunst und Architektur und einem eigenen Verständnis von Schönheit.
Im 13. Jahrhundert brachen die Mongolen in diese sich selbst genügende Welt ein und bereiteten dem klassischen Zeitalter des Islam ein rasches Ende. Aber innerhalb von 50 Jahren konvertierten sie selbst zum Islam und wurden dessen kraftvollste Verteidiger. Sufi-Orden breiteten sich über die gesamte islamische Welt aus und sorgten für eine Renaissance des Islam in nichtarabischen Ländern. Von Kufa bis Kalimantan verliehen reisende Gelehrte, Händler und die Freitagsversammlung dem Islam eine neue Beweglichkeit.
Tatsächlich war der Islam eine ebenso universalistische Ideologie wie die westliche Moderne heute, und er prägte erfolgreich ganz verschiedene politische Systeme, Volkswirtschaften und kulturelle Einstellungen in einem großen geographischen Raum. Der marokkanische Reisende Ibn Battuta hatte im 14. Jahrhundert ebenso wenig Probleme, eine Stellung an kaiserlichen Höfen in Indien oder Westafrika zu finden, wie ein Harvard-Absolvent heute in Hongkong und Kapstadt. Der Gedanke einer Weltgemeinschaft der Muslime, der umma, die unter der symbolischen Herrschaft eines khalifa (Kalifen) in einem Dar al-Islam (Land der Muslime) lebte, das sich von dem fernen und abgelegenen Dar al-Harb (dem Land des Krieges) unterschied, half den Muslimen von Marokko bis nach Java bei ihrer Vorstellung, dass sie selbst und ihre gemeinsamen Werte eine zentrale Stellung in der Welt einnahmen.
Noch im 17. Jahrhundert verdrängten reisende Kaufleute aus Indien den Hinduismus und Buddhismus in Indonesien und sogar in Indochina. Umfangreiche Handelsnetze und Pilgerwege, die aus aller Welt nach Mekka führten, festigten die Einheit des Dar al-Islam. Tatsächlich hing der Welthandel von muslimischen Kaufleuten, Seefahrern und Bankiers ab. Für einen Muslim in Nordafrika, Indien oder Südostasien behielt die Geschichte ihre moralische, geistige und auch zeitliche Kohärenz; sie konnte als schrittweise Verwirklichung des göttlichen Plans verstanden werden.
Obwohl die muslimischen Reiche im 18. Jahrhundert von internen Problemen bedrängt wurden, hielt man dort die Europäer für nur geringfügig weniger barbarisch als ihre Vorfahren, die besiegten Kreuzfahrer. So legte denn Napoleons Erfolg einen unvorstellbaren Gedanken nahe: dass man von den immer noch primitiven Menschen des Westens überholt wurde.
Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts sollte Europa ein Selbstverständnis zum Ausdruck bringen, das auf vielfältigen Errungenschaften im Bereich der Technologie, des konstitutionellen und säkularisierten Staates und einer modernen Verwaltung basierte. Und dieses Selbstverständnis, das aus der Amerikanischen und der Französischen Revolution hervorging und den Westen zur Vorhut des Fortschritts zu machen schien, ließ sich immer weniger von der Hand weisen. Schon 1789 kennzeichnete ein bemerkenswert hohes Maß an Organisation den nachrevolutionären französischen Staat wie auch das französische Volk, das sich offenbar über eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Territorium und eine gemeinsame Geschichte definierte und so einen gesonderten und eigentümlichen »Nationalstaat« bildete.
Angesichts der unabweisbaren Überlegenheit Europas waren viele Muslime anfangs ratlos und unfähig, die Situation richtig einzuschätzen. »Die neugeschaffene Republik in Frankreich«, bemerkte der osmanische Historiker Asim 1801, »unterscheidet sich von den übrigen fränkischen Verfassungen.« Aber dann heißt es weiter: »Sie basiert letztlich auf einer sündhaften Lehre, die sich von der Religion abwendet und die Gleichheit von Armen und Reichen behauptet.« Und die Beratungen im Parlament glichen dem »Rumpeln und Grollen eines gereizten Magens«.[22] Etwas von dieser kulturellen Arroganz findet sich auch in ’Abd al-Rahman al-Jabartis Augenzeugenberichten über Napoleons Eroberung. Der Geistliche empfand die französischen Bräuche generell als abstoߟend und sogar barbarisch: »Bei ihnen ist es Brauch«, so schrieb er, »die Toten nicht zu begraben, sondern wie die Kadaver von Hunden oder wilden Tieren auf Abfallhaufen zu werfen oder im Meer zu versenken.«[23] »Ihre Frauen verschleiern sich nicht und kennen keine Bescheidenheit (…) (Die Franzosen) haben Verkehr mit jeder Frau, die ihnen gefällt, und umgekehrt.«[24] Al-Jabarti machte sich auch über die französischen Hüte lustig, über den europäischen Brauch, in der Öffentlichkeit zu urinieren, und über die Verwendung von Toilettenpapier. Verächtlich tat er Napoleons Behauptung ab, ein Beschützer des Islam zu sein; er lachte über die schlechte arabische Grammatik der Proklamationen des Franzosen und kicherte, als den Franzosen bei einer ihrer Demonstrationen der wissenschaftlichen Errungenschaften der Europäer der Start eines Heißluftballons misslang.
Al-Jabartis beschränkte Kenntnis der politischen Institutionen ließ ihn die Ideale der französischen Revolutionäre missverstehen: »Mit ›Freiheit‹ meinen sie, dass sie keine Sklaven sind wie die Mamluken«, schloss er allzu übereilt.[25] Er spürte die Feindseligkeit gegenüber seiner Religion, die in Napoleons Behauptung lag, alle Menschen seien »vor Gott gleich«. »Das ist Lüge, Unverstand und Dummheit«, polterte er. »Wie könnte das sein, da Gott doch manche über andere gestellt hat?«[26]
Al-Jabarti, der seine Ausbildung in der al-Azhar-Moschee erhalten hatte, war dennoch beeindruckt, als er das Institut d’Égypte besuchte, wo die Intellektuellen aus Napoleons Gefolge eine gut ausgestattete Bibliothek eingerichtet hatten.
»Wer etwas in einem Buch nachschauen will, fragt nach den Bänden, die er sehen möchte, und der Bibliothekar bringt sie ihm (…) Alle verhalten sich still, und niemand stört seinen Nachbarn (…) Unter den Dingen, die ich sah, befand sich auch die Lebensbeschreibung des Propheten (…) Der glorreiche Koran ist in ihre Sprache übersetzt worden! (…) Ich bin einigen von ihnen begegnet, die ganze Kapitel des Koran auswendig kennen. Sie interessieren sich sehr für die Wissenschaften, vor allem für Mathematik und die Kenntnis der Sprachen, und bemühen sich sehr, die arabische Sprache und die Umgangssprache zu lernen.«[27]
Al-Jabarti war auch erstaunt über die Effizienz und Disziplin der französischen Armee, und mit großer Neugier verfolgte er die Abstimmungsprozesse in dem von Napoleon geschaffenen Diwan. Er berichtete seinen arabischen Lesern, dass die Mitglieder ihre Wahlentscheidung auf Papierstreifen schrieben und die Mehrheitsmeinung den Sieg davontrug.
Al-Jabarti war nicht gänzlich taub für die Lehren aus der Eroberung durch Napoleon: dass die Regierung im ersten modernen Nationalstaat der Welt nicht nur Steuern und Tributzahlungen eintrieb sowie Gesetz und Ordnung aufrechterhielt, sondern auch in der Lage war, eine Armee aus Wehrpflichtigen aufzustellen, gut ausgebildete Soldaten mit modernen Waffen auszurüsten und die politische Führung durch demokratische Prozesse bestimmen zu lassen. Zwei Jahrhunderte später scheint es, als habe al-Jabarti am Anfang einer langen Reihe konsternierter Asiaten gestanden – Männer, die an göttliche Fügung, das geheimnisvolle Wirken des Schicksals und den wiederkehrenden Auf- und Niedergang des politischen Geschicks glaubten, denen aber die bemerkenswerte Stärke kleiner europäischer Nationalstaaten vor Augen führte, dass aus der Organisation menschlicher Energie und Tatkraft, gepaart mit Technologie, eine Macht hervorgehen konnte, die das soziale und politische Umfeld radikal zu verändern vermochte. Obwohl zunächst voll gekränkter Verachtung für Europa, wandten diese Männer sich am Ende gegen ihre eigenen trägen und einfallslosen Herrscher samt ihren schwachen Regierungen. Und sie alle gelangten zu einer ähnlichen Überzeugung: dass ihre Gesellschaften ausreichende Stärke erlangen mussten, um den Herausforderungen des Westens gewachsen zu sein.
Der langsame Zerfall Indiens und Chinas
Napoleons Besetzung eines großen Landes wie Ägypten blieb stets gefährdet. Trotz seines Lobes für den Islam verharrte die Bevölkerung in ihrer Feindseligkeit. In den größeren Städten kam es zu Aufständen, welche die Franzosen zu hässlichen Vergeltungsmaßnahmen provozierten, zu denen auch der Vandalismus und die Trinkgelage in der al-Azhar-Moschee gehörten. Die britische Kriegsflotte machte Napoleons Stellung schließlich durch eine Blockade unhaltbar, die ihn von Frankreich und seinen Nachschublinien abschnitt. Als Napoleon Ägypten im August 1799 ebenso heimlich verließ, wie er einst Paris verlassen hatte, um in Frankreich seinen Aufstieg zur politischen Vorherrschaft anzutreten, hatten die Briten auch seinen indischen Verbündeten Tipu Sultan bereits besiegt. Es gab für ihn in Asien nichts zu erobern. So konzentrierte er sich auf Europa und bemühte sich, wie der türkische Botschafter in Paris besorgt vermerkte, »wie ein bissiger Hund Unglück jeglicher Art über seine Nachbarn zu bringen und alle Staaten in ähnliche Unordnung zu stürzen wie sein eigenes verfluchtes Land«.[28]
Im Rückblick kann man sagen, dass Napoleon zu früh gestartet war. 1798 hatten Holländer, Spanier, Portugiesen und Briten sich allesamt wichtige Brückenköpfe in Asien gesichert. Aber die europäische Eroberung Asiens sollte erst voll in Gang kommen, als Napoleon 1815 endgültig besiegt war. Erschöpft vom Krieg, einigten sich die fünf großen europäischen Mächte – Großbritannien, Frankreich, Preußen, Russland und Österreich – auf ein Machtgleichgewicht in Europa. Da ihre Kampfeslust zu Hause durch Verträge eingeschränkt wurde, wuchs ihre Aggressivität im Osten, und sie begnügten sich nicht länger mit ein paar Brückenköpfen am Rande des riesigen asiatischen Kontinents. Die Briten, die sich in Ostindien festgesetzt hatten, begannen 1824 mit ihrer langwierigen Unterwerfung Burmas. Im selben Jahr bestätigte ein britisch-holländischer Vertrag die britische Herrschaft über Singapur und die malaiischen Staaten auf der Halbinsel, während Java zum niederländischen Einflussbereich erklärt wurde. Andererseits standen weder Briten noch Holländer der französischen Herrschaft in Vietnam im Wege.
Zur Zeit von Napoleons Niederlage 1815 hatten die Briten bereits ein Drittel Indiens erobert. Sie sollten schon bald auch die Oberhoheit über den Rest des Subkontinents und damit eine machtvolle Präsenz in Asien erlangen, die ihnen half, die Öffnung Chinas für europäische Kaufleute zu erzwingen und das übrige Asien in Abhängigkeit von ihnen zu bringen. Die Geschwindigkeit und die Verwegenheit der britischen Eroberungen in Indien erscheinen umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, wie bescheiden ihre jahrhundertelange Präsenz auf dem Subkontinent bis dahin gewesen war. Sir Thomas Roe, der erste akkreditierte englische Gesandte in Indien, der 1616 am glanzvollen Mogulhof in Agra eintraf, hatte hart darum ringen müssen, die Flagge seines Landes hochzuhalten. Roes König in England, Jakob I., der einen förmlichen Handelsvertrag mit dem Mogulkaiser Jahangir abschließen wollte, hatte ihm aufgetragen, »sorgsam auf Ehre und Würde bedacht zu sein«[29], und Roe gelang es auch, die von Gesandten am Mogulhof erwarteten Verbeugungen und Kratzfüße zu vermeiden. Aber ihm war nur allzu bewusst, wie schäbig die Geschenke waren, die er dem Ästheten Jahangir aus England mitgebracht hatte, und er vermochte auch die Skepsis des Mogulkaisers hinsichtlich eines angeblich großen englischen Königs nicht vollständig zu überwinden, der sich mit so gemeinen Dingen wie dem Handel abgab.
Noch 1708 hielt es der Präsident der East India Company für unerlässlich, vor dem Mogulkaiser zu katzbuckeln, wenn er sich an ihn wandte, und er bezeichnete sich selbst »als das kleinste Sandkorn (…), nur wert, am Boden zerrieben zu werden«.[30] Als das Mogulreich, durch endlose Kriege und Invasionen geschwächt, 1750 implodierte und in eine Reihe unabhängiger Staaten zerfiel, war der einzige Ort, an dem die Briten die territoriale Souveränität besaßen, das damals vollkommen unbedeutende Fischerdorf Bombay (Mumbai). Wenige Jahre später wendete sich ihr Glück. 1757, nach einer Schlacht mit dem muslimischen Vizekönig von Bengalen, sah sich die East India Company im Besitz eines Territoriums, das dreimal so groß war wie England. Kaum ein Jahrzehnt später hatte die Company dieselbe Mischung aus politischem Betrug und militärischer Gewalt erfolgreich eingesetzt, um den Herrscher von Awadh, der größten Provinz des Mogulreichs, zu schwächen.
In der Folgezeit kontrollierten die Briten einen großen Teil des östlichen Indien und beuteten das Land rücksichtlos aus. »Niemals sah die Welt so tyrannische und mächtige Männer wie die Leute, die das Britische Empire in Indien gründeten«, schrieb der wegweisende bengalische Romancier Chandra Chatterjee (1838–1894). »Die Engländer, die damals nach Indien kamen, waren von einer Seuche befallen – dem Wunsch, den Reichtum anderer Völker zu stehlen. Das Wort ›Moral‹ war aus ihrem Wortschatz verschwunden.«[31] Chatterjee arbeitete für die britische Verwaltung in Bengalen und musste sich deshalb mit seiner Kritik zurückhalten. Keine derartigen Beschränkungen kannte dagegen der berechtigte Zorn Edmund Burkes, damals Mitglied des britischen Parlaments. 1788 schrieb er über Bengalen:
»Junge Männer (fast noch Knaben) regieren dort, ohne Kontakt zu den Einheimischen und ohne jede Sympathie für sie (…) Getrieben von all der Gier des Alters und der Unbesonnenheit der Jugend, rollt eine Welle nach der anderen heran, und die Einheimischen haben nichts vor Augen als die endlose hoffnungslose Aussicht auf neue Wellen von Raub- und Zugvögeln.«[32]
Der muslimische Historiker Ghulam Hussain Tabatabai (1727–1806), der gleichfalls für die Briten in Bengalen arbeitete, war derselben Ansicht hinsichtlich der Verderbtheit und Isolation seiner Herren. »Keine Liebe und keine Verbindung kann zwischen den Eroberern und den Eroberten entstehen«, schrieb er 1781.[33] Den Briten war das ziemlich gleichgültig. Haji Mustapha, ein zum Islam übergetretener Kreole, der Tabatabais Buch 1786 ins Englische übersetzte, schrieb in seiner Einleitung: »Die allgemeine Einstellung der Engländer in Indien scheint von einer tiefen Verachtung für die Inder (als nationale Gemeinschaft) geprägt zu sein. Sie behandeln sie wie totes Kapital, das man ohne große Rücksicht und nach Belieben einsetzt.«[34] Aufgrund ihres wachsenden Erfolgs in Indien konnten die Briten es sich leisten, in China aggressiver aufzutreten. Seit langem träumten europäische Kaufleute, die dort bislang auf den Hafen von Kanton beschränkt waren, von dem potentiell gewaltigen Binnenmarkt des Landes. Da die Briten im Osten Indiens über fruchtbare landwirtschaftliche Flächen verfügten, waren sie sehr erpicht darauf, Abnehmer für ihre Erzeugnisse, vor allem Opium, zu finden, und sie ärgerten sich über den willkürlichen und undurchsichtigen Charakter der kaiserlichen Herrschaft in China. Ermutigt durch ihre Erfolge in Indien, wechselten die Briten nun bei der Auseinandersetzung mit den chinesischen Herrschern sehr viel häufiger zwischen Bewunderung und Verachtung als zuvor.
Obwohl nicht so groß wie das Land des Islam, war das seit zwei Jahrtausenden bestehende chinesische Reich in hohem Maße auf sich selbst bezogen. Tributzahlende Ausländer aus so weit entfernten Weltgegenden wie Burma erlaubten es den Chinesen, sich als Bewohner des »Reichs der Mitte« zu fühlen. Tatsächlich erreichte nicht einmal der Islam die außergewöhnliche Langlebigkeit und Vitalität des chinesischen Konfuzianismus, der alle Lebensbereiche, von der Familie bis hin zu politischen und ethischen Fragen, regelte und eifrige Nachahmer in Korea, Japan und Vietnam fand.
1793führte der britische Gesandte Lord Macartney eine diplomatische Mission nach Beijing (Peking) an und überbrachte dabei ein Schreiben, in dem König Georg III. Kaiser Qianlong um einen Handelsvertrag, mehr Häfen für britische Kaufleute und eine ständige diplomatische Vertretung an seinem Hof bat. Wie Sir Thomas Roe vor ihm sah Macartney sich zahlreichen Bedrohungen seiner Würde ausgesetzt. Sein Gefolge musste unter einem Spruchband reisen, auf dem in Chinesisch stand: »Gesandter mit Tribut aus England«. Macartney hatte auch einen langen und delikaten diplomatischen Tanz aufzuführen, um zu vermeiden, dass er sich beim zeremoniellen Kotau vor dem Kaiser der Länge nach auf dem Boden ausstrecken musste. Stattdessen beugte er in Anwesenheit des Kaisers ein Knie und übergab diverse Geschenke, welche die fortgeschrittenen technischen und handwerklichen Fähigkeiten der Briten beweisen sollten, darunter eine Haubitze aus Messing und astronomische Instrumente. Der chinesische Kaiser, damals ein rüstiger Achtzigjähriger, erkundigte sich gnädig nach König Georgs gesundheitlichem Befinden und bot Macartney etwas Reiswein an – das alles im Rahmen eines »luxuriösen« Banketts, das in den erstaunten Augen des Engländers eine »stille Würde« besaß, »jenen nüchternen Pomp asiatischer Größe, den europäische Raffinesse noch nicht erreicht hat«.[35]
Die britische Delegation wurde noch ein paar Tage lang mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, bevor man sie unvermittelt aus dem Lande hinauskomplimentierte, versehen mit einem Antwortschreiben des Himmlischen Kaisers, in dem dieser eindeutig erklärte, er habe »erfinderische Gegenstände niemals geschätzt« und er habe auch »nicht den geringsten Bedarf an den Erzeugnissen Englands«. Es sei richtig, dass die »Menschen des westlichen Meeres« die Kultur seines Reiches bewunderten und studieren wollten. Aber er könne keinen englischen Gesandten tolerieren, der so anders spreche und sich so anders kleide, als es das »Zeremonialsystem des Reiches« verlange. Außerdem wäre es gut, fügte der Kaiser hinzu, wenn der englische König »einfach nach unseren Wünschen handelt, indem er seine Loyalität festigt und ewigen Gehorsam schwört«.[36]
Der Brief war schon vor Lord Macartneys Ankunft in Beijing entworfen worden. Der herablassende Ton war Ausdruck der übertriebenen Vorstellungen der chinesischen Elite von der Vorrangstellung ihres Landes wie auch ihrer Entschlossenheit, das alte politische System zu schützen, in dessen Rahmen reiche Familien und Grundherren gut ausgebildete Beamte für die Staatsverwaltung stellten und der Land- und Seehandel mit den Nachbarn abgewickelt wurde. Die Chinesen wussten auch von der wachsenden Macht der »Barbaren« in Asien, wo die Europäer eine führende Rolle im Seehandel übernommen hatten und Militärstützpunkte wie auch Handelsstationen entlang der Küsten Indiens und Südostasiens errichteten. »Es heißt«, schrieb Qianlong an seinen Ersten Minister, »die Engländer rauben die Schiffe der anderen Länder des westlichen Meeres aus, sodass die Ausländer am westlichen Meer in Angst und Schrecken vor deren Brutalität leben.«[37] Der Kaiser hielt es für das Beste, derart aggressive Abenteurer möglichst fernzuhalten.
Die Briten ließen nicht locker und schickten 1816 eine weitere, weniger kostspielige Delegation an den kaiserlichen Hof. Diesmal bestanden die Chinesen uneingeschränkt auf dem Kotau und ließen den Gesandten gar nicht erst in die Stadt, als er die rituelle Selbsterniedrigung vor dem chinesischen Kaiser verweigerte.
Aber Chinas Bluff wurde schon bald durchschaut. Lord Macartney, der Gouverneur von Madras (Chennai) in Britisch-Indien gewesen war, hatte auf seinen Reisen in China scharfsinnig bemerkt, das Land, »ein erstklassiges, aber altes, morschen Kriegsschiff«, sei zwar in der Lage, »seine Nachbarn allein durch seine Masse und Erscheinung über Gebühr zu beeindrucken«, aber es sei dazu verdammt, vom Kurs abzudriften und »am Ufer zu zerschellen«.[38] Die nautische Metapher war durchaus treffend. Als Hegel erklärte, warum China aus der Weltgeschichte herausgefallen war, verwies er auf die Gleichgültigkeit gegenüber der Erforschung der Meere. Und von See her sollten europäische Mächte denn auch bald Chinas Schwäche erkunden und in seinen Wunden bohren. Wie die Moguln und die Osmanen sollten auch die Mandschus die bitteren Folgen ihrer Entschlossenheit kennenlernen, die westlichen Innovationen einer staatlichen Förderung von Industrie und Handel zu ignorieren.
Damals – wie auch in jüngster Zeit wieder – exportierten die Chinesen weit mehr nach Europa und Amerika (hauptsächlich Tee, Seide und Porzellan), als sie von dort importierten, und das daraus resultierende Handelsbilanzdefizit führte dazu, dass die kostbaren Silberbestände des Westens in chinesischen Händen verschwanden. Die britische East India Company stieß auf eine alternative Zahlungsmöglichkeit, als sie ihren Würgegriff auf das fruchtbare Ackerland im Osten Indiens gefestigt hatte, nämlich Opium, das sich dort in großen Mengen anbauen, kostengünstig zu einer konsumierbaren Paste verarbeiten, rasch nach Südchina verschiffen und über Mittelsmänner in Kanton an die chinesischen Massen verkaufen ließ.
Die Einnahmen aus dem Opiumexport stiegen exponentiell und verringerten rasch das britische Handelsbilanzdefizit mit China. Die massenhafte Vergiftung von Chinesen wurde zu einem zentralen Element der britischen Außenpolitik. Aber die leichte Verfügbarkeit des Rauschgifts führte in China schon bald zu einem Drogenproblem. 1800 verboten die Chinesen den Import und die Produktion von Opium, und 1813 verboten sie auch den Konsum des Rauschgifts.
Die Briten hielten dennoch daran fest. 1820 strömte genügend Opium nach China, um eine Million Süchtige zu versorgen, und der Strom des Silbers hatte sich umgekehrt.[39] In den 1830er Jahren erwog Kaiser Daoguang angesichts einer massiven Silberknappheit eine Legalisierung des Opiums. Aber er hatte es mit einer lautstarken Anti-Opium-Lobby zu tun. In einer Petition an den Kaiser hieß es, das Opium sei das Mittel einer gefährlichen Konspiration rothaariger Leute aus dem Westen, die bereits »das geschickte, kämpferische Volk von Java zu dessen Genuss verführt haben, woraufhin es unterdrückt und unterjocht und das Land in Besitz genommen wurde«. Ein anderer Gegner des Opiums behauptete: »Mit der Einfuhr von Opium in dieses Land verfolgen die Engländer das Ziel, das Reich der Mitte zu schwächen. Wenn wir die Gefahr nicht rasch erkennen, werden wir bald den letzten Schritt zu unserem Untergang tun.«[40]
Die Opiumgegner schlugen vor, Opiumraucher mit der Todesstrafe abzuschrecken, aber die gewaltige Zahl der Raucher beschwor das Schreckgespenst von Massenhinrichtungen herauf. 1838 beschloss Daoguang, Handel und Konsum von Opium gänzlich zu unterbinden. Anfangs führten die Chinesen den Kampf gegen das Opium mit friedlichen Mitteln. Staatsbeamte verwiesen auf die konfuzianischen Tugenden der Nüchternheit und des Gehorsams, um Süchtige zum Verzicht auf das Rauschgift zu bewegen und chinesische Mittelsmänner zu veranlassen, den Handel mit Opium aufzugeben. Denselben moralischen Appell richtete man auch an den Westen, etwa in einem Schreiben, das Lin Zexu, der kaiserliche Sonderbeauftrage in Kanton, an Königin Viktoria schickte.
Lin, ein beispielhafter, ganz in der konfuzianischen Tradition stehender Staatsbeamter, hatte sich in seinen Stellungen als Gouverneur mehrerer Provinzen in Zentralchina den Ruf eines rechtschaffenen und kompetenten Staatsdieners erworben. Er wandte sich an die britische Königin und brachte seine Verwunderung zum Ausdruck, dass Kaufleute aus so fernen Regionen wie Britannien nach China kamen, »um großen Profit zu machen«.[41] Er unterstellte naiv, die britische Regierung wisse nichts von den gewissenlosen Schmugglern in Kanton und wolle an den moralischen Grundsätzen des Konfuzius ebenso entschieden festhalten wie der chinesische Kaiser. »Möchtet ihr doch, o König«, schrieb er, »eure niederträchtigen Leute prüfen und die lasterhaften aussondern, bevor sie nach China kommen.«[42] Er drängte die britische Monarchin, den Opiumanbau in Madras, Bombay, Patna und Benares auszumerzen und durch den Anbau von Hirse, Gerste und Weizen zu ersetzen.
Gegenüber den westlichen Kaufleuten verfolgte Lin eine harte Linie. Wenn sie Widerstand leisteten, wurden ihre Faktoreien in Kanton mit einer Blockade belegt, bis sie ihre Opiumvorräte herausgaben, die dann unverzüglich ins Meer geworfen wurden. Wer sich weigerte, schriftlich zu versprechen, sich in Zukunft nicht am Opiumhandel zu beteiligen, wurde des Landes verwiesen. Damals ließ sich eine Gruppe britischer Kaufleute erstmals auf einer felsigen Insel namens Hongkong nieder.
Die Chinesen unterschätzten indessen die Bedeutung, die der Opiumhandel inzwischen für die britische Wirtschaft erlangt hatte. Auch wussten sie nicht, welchen Schub das britische Selbstbewusstsein erfahren hatte, als die Briten Napoleon besiegten und zur wichtigsten Macht in Indien aufstiegen – Lins Brief an Königin Viktoria zum Beispiel wurde nicht einmal mit einer Empfangsbestätigung bedacht.
Ganz allgemein veränderten die wachsende technologische Macht und der wirtschaftliche Erfolg im Westen die Meinung über China. Statt als Gipfel der Aufklärung wie einst bei Voltaire und Leibniz galt das Land nun als Hort der Rückständigkeit. Schon wenn man es als gleich behandelte, wäre das so, schrieb ein amerikanischer Diplomat, »als wollte man ein Kind so wie einen alten Mann behandeln«.[43] Außerdem erschien der »Freihandel« in der wachsenden britischen Wirtschaft des frühen 19. Jahrhunderts ebenso als ein universeller Wert, den man notfalls auch mit militärischer Gewalt durchsetzen musste, wie dies in modernen Zeiten für die »Demokratie« gilt.
Ein Schwarm aggressiver privater Kaufleute in Kanton agitierte für mehr Märkte in China, nachdem die vergleichsweise konservative East India Company 1838 ihr Monopol auf den Asienhandel verloren hatte. Diese Geschäftsleute und ihre Lobbyisten sorgten für solch eine Empörung über die chinesischen Aktivitäten, dass die britische Regierung sich gedrängt fühlte, eine Strafexpedition nach China zu schicken. Als diese Flotte im Juni 1840 dort eintraf, verhängte sie eine Blockade über Kanton, segelte an der chinesischen Küste nordwärts und bedrohte schließlich Tianjin (Tientsin) und darüber hinaus auch den Sitz des Kaisers in Beijing. Im Wissen um ihre militärische Schwäche baten die Qing um Frieden, überließen den Briten Hongkong und erklärten sich bereit, eine Entschädigung von sechs Millionen Pfund zu zahlen und Kanton wieder für britische Kaufleute zu öffnen.
Doch der britischen Regierung war das nicht genug. Die Träume von einem großen chinesischen Markt für britische Erzeugnisse waren in England unkontrolliert gewachsen. Premierminister Lord Palmerston, ein aggressiver Imperialist, schäumte vor Wut, dass seine Vertreter den Chinesen nach deren Einlenken keine strengeren Bedingungen abgerungen hatten. Er schickte 1841 eine weitere Flotte nach China, die Schanghai einnahm, den Verkehr auf dem unteren Jangtsekiang blockierte und mit einem Angriff auf die ehemalige Hauptstadt Nanjing (Nanking) drohte.
Nach weiteren militärischen Niederlagen kapitulierten die Chinesen erneut und unterzeichneten 1842 den demütigenden Vertrag von Nanjing, der den Ausländern fünf Häfen öffnete, darunter Schanghai, und den Briten auf ewig Hongkong überließ. Der indische Kaufmann Jamsetjee Jejeebhoy schrieb warnend an seine Geschäftspartner bei der britischen Firma Jardine, Matheson & Co.: »Die Chinesen haben in dieser Sache genug von uns (…); jetzt auf Distanz zu bleiben ist weitaus besser als zu drohen.«[44] Die Chinesen selbst waren fassungslos angesichts der scheinbar unersättlichen Gier der Briten. Ein Repräsentant des Kaisers schrieb in einem Brief an die Briten:
»Wir schauen mit Verehrung auf die zartfühlende Großzügigkeit des Großen Kaisers gegenüber Ausländern und auf die höchste Gerechtigkeit in all seinem Tun. Dadurch lädt er die ganze Welt ein, an seiner Gunst teilzuhaben und seinen Schutz zu genießen, zur Förderung der Zivilisation – und zum vollen Genuss dauerhafter Vorteile. Aber die englischen Ausländer haben nun (…) wegen der Nachforschungen im Opiumhandel seit zwei Jahren den Gehorsam verweigert und kämpfen unablässig (…) Was mag ihr Ziel sein, und wohin mag ihr Handeln führen?«[45]
Der Kaiser erhielt einen stark geschönten Bericht über den harten Verhandlungsstil der Briten: »Obwohl die Forderungen der Ausländer in der Tat räuberisch sind«, schrieb sein Repräsentant, »wollen sie doch kaum mehr als Häfen und das Handelsprivileg. Dahinter stecken keine finsteren Absichten.«
Das erwies sich als allzu optimistisch. Zum Ausgleich für das vernichtete Opium forderten die Briten weitere Entschädigungszahlungen und dazu noch Lösegeld für Städte wie Hangzhou, die sie nicht besetzt hatten. Weitere westliche Staaten schlossen sich ihnen an, insbesondere die Vereinigten Staaten, die seit ihrer eigenen Befreiung von der britischen Herrschaft in Kanton präsent gewesen waren. Die Amerikaner bestanden darauf, dass die Chinesen protestantischen Missionaren erlaubten, in den Vertragshäfen ihrer Missionsarbeit nachzugehen. Die Franzosen verlangten noch weitergehende Rechte für Katholiken, womit sie die Gleichsetzung des Westens mit dem missionswütigen Christentum, wie es die Chinesen sahen, nur vervollständigten.
Die Verträge gaben den westlichen Mächten das Recht, den Chinesen im nächsten Jahrhundert lebenswichtige Aspekte der Handels-, Sozial- und Außenpolitik vorzuschreiben. Wie sich zeigte, vermochte selbst diese Aufgabe chinesischer Souveränität die Verfechter des Freihandels nicht zufriedenzustellen. Die Vorstellung vom angeblich grenzenlosen chinesischen Markt bewahrheitete sich nicht, und der Opiumhandel, der in den Verträgen nicht erwähnt, aber stillschweigend von allen Seiten akzeptiert wurde, blieb der wichtigste Geschäftsbereich der Handelsbeziehungen zum Westen. Um 1900