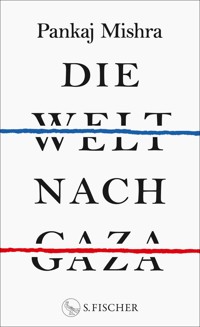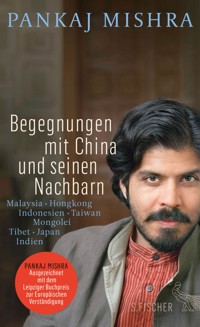
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
+++ Im Schatten des Drachen – ein kluger Blick auf das »Reich der Mitte« und seine Nachbarn +++ Asien ist in Bewegung. Die neue Supermacht China dominiert sowohl den Kontinent als auch den Diskurs über die Region. Um besser zu verstehen, was in seinem Inneren vorgeht, lohnt sich vor allem ein Blick an die Ränder des riesigen Staates. Keiner kann das so meisterhaft und kenntnisreich wie der vielfach ausgezeichnete Publizist und Essayist Pankaj Mishra, der sich der Großmacht China über ihre Grenzen annähert und gekonnt politisches Geschehen, Reisebericht und große Historie miteinander verwebt. Er reist von Beijing über die Mongolei nach Tibet und durch Länder wie Indonesien, Malaysia und Taiwan, um herauszufinden, wie es sich im Schatten des Drachen lebt und welchen Einfluss die unmittelbare Nähe des »Reichs der Mitte« auf seine Nachbarn hat. Erhellende und ungewöhnliche Einblicke in eine der wichtigsten Regionen des 21. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Pankaj Mishra
Begegnungen mit China und seinen Nachbarn
Malaysia – Hongkong – Indonesien – Taiwan – Mongolei – Tibet – Japan – Indien
Biografie
Pankaj Mishra, geboren 1969 in Nordindien, schreibt seit über zehn Jahren regelmäßig für die »New York Review of Books«, den »New Yorker« und den »Guardian« über den indischen Subkontinent, über Afghanistan und China. Er gehört zu den großen Intellektuellen des modernen Asien und hat zahlreiche Essays in »Lettre International« und »Cicero« veröffentlicht; auf Deutsch sind darüber hinaus der Roman ›Benares oder Eine Erziehung des Herzens‹ und der Essayband ›Lockruf des Westens. Modernes Indien‹ erschienen. Pankaj Mishra war u.a. Gastprofessor am Wellesley College und am University College London. Für sein Buch ›Aus den Ruinen des Empires‹, das 2013 bei S.Fischer erschien, erhielt er 2014 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Er lebt abwechselnd in London und in Mashobra, einem Dorf am Rande des Himalaya.
»Ein globaler Intellektueller.«
Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Simone Andjelkovic
Coverabbildung: Nina Subin
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
›A Great Clamour. Encounters with China and Its Neighbours‹
im Verlag Hamish Hamilton, Penguin Group, New Delhi
© Pankaj Mishra, 2013
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403329-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Blick nach Osten. Eine Einführung
[Karte]
Erster Teil Ein Trommelwirbel für die Moderne
Eine Erziehung der Gefühle in Shanghai
Die Hungerjahre
Kein Festmahl: Mao und die Maoisten
Nach Tiananmen
Zweiter Teil Lauter Fragen
Das neue Shanghai und was da kommen wird
Kritik eines Linken an China
Die Dichterin
Wie wichtig es ist, der Dalai Lama zu sein
Ein Zug nach Tibet
Ein Scheiterhaufen chinesischer Eitelkeiten
Dritter Teil Echos von Festlandchina
Hongkong: Das Streben nach Kultur
Mongolei: Aus der Geschichte gefallen
Taiwan: Die vergessenen Chinesen
Malaysia: Jenseits des Schmelztiegels
Indonesien: Demokratie neu definiert
Japan: Leben nach dem Wirtschaftswachstum
Danksagung
Für MNM
Blick nach Osten. Eine Einführung
Eines Nachmittags im Sommer 1992 unterhielt ich mich mit meinem Vermieter und fragte ihn, was hinter den schneebedeckten Gipfeln lag, die ich von meiner Veranda aus sehen konnte. »Tibbat«, antwortete Mr Sharma und betonte das Wort dabei auf nordindische Weise. Ich war erstaunt. War Tibet wirklich so nah? Ich war erst kürzlich in dieses kleine Dorf im Bundesstaat Himachal Pradesh gezogen, um herauszufinden, ob ich zum Schriftsteller taugte. Die physische Isolation schien mein Gefühl der Unzulänglichkeit nur noch zu verstärken. In meiner Vorstellung erschien mir dieses riesige, von Lhasa bis Hokkaido und Surabaya reichende Gebiet, ein schon damals von Politik und Wirtschaft Chinas geprägtes Asien, plötzlich wie eine beklemmende Leerstelle – ein weiterer Beweis für meine Unwissenheit im Blick auf die Welt.
Mr Sharma, ein Sanskritwissenschaftler, teilte diese Schwäche nicht. Er sprach von Tibet ganz selbstverständlich als von einer jener Kreuzungen innerhalb eines weitreichenden indischen Kulturraums, über welche indische Religionen und Philosophien durch den gesamten asiatischen Kontinent gereist und tief in den pazifischen Raum eingedrungen waren. Ich beneidete ihn um dieses Tibbat, das zu seinem privaten Asienbild gehörte, einem Bild, das auch das Bild der übrigen Welt klarer gefasst haben dürfte, ihm den Schmerz der Verständnislosigkeit nahm und ihn in der Erde verwurzelte.
Ich hatte kein solches Tibbat. Mein Asien musste erst noch mit bestimmten Kulturen, Geschichten und Völkern gefüllt werden. Ich hatte die Romane von Lu Xun und ein paar Aufsätze von Mao Zedong gelesen, wusste aber sonst kaum etwas über China, außer dass es Indien 1962 betrogen und Jawaharlal Nehrus Tod beschleunigt hatte und dass man dem Land deshalb nicht trauen durfte. Ich wusste von der nuklearen Einäscherung Hiroshimas und Nagasakis, aber Japan wurde für mich fast vollständig verkörpert von Akio Morita, dem Hersteller des Walkman und des mit einem hellen Holzgehäuse daherkommenden Sony Trinitron Farbfernsehers (die im immer noch recht armen Indien der frühen 1990er Jahre heißbegehrt waren). In meinem Denken belebten keinerlei politische oder intellektuelle Bewegungen den Osten oder Asien, wie dies für Indien und den Westen galt.
In unserer eng vernetzten Welt ist es heute leicht, über quasi-orientalistische Konzepte wie den »Osten« und »Asien« zu spotten. Beide betraten die Bühne gemeinsam mit ihrer dominanten Zwillingsschwester, der Idee Europas. Als Bezeichnung für das barbarische oder unterlegene »Andere« sollten sie ursprünglich das westliche Selbstbewusstsein stärken. Im späten 19. Jahrhundert jedoch nahmen diverse chinesische, japanische und indische Denker den »Osten« und »Asien« in ihre eigenen Dienste und füllten diese Kategorien mit besonderen Werten und Eigenschaften wie der Achtung vor der Natur, Gemeinschaftsorientierung, schlichter Genügsamkeit und spiritueller Transzendenz. Diese angeblich asiatische Tradition des Antimaterialismus stellten sie dann den modernen westlichen Ideologien des Individualismus, der Eroberung und des Wirtschaftswachstums gegenüber. Die Idee Asiens wurde zum Ausdruck einer kulturellen Verteidigungshaltung gegen den arroganten Westen, der ein Monopol auf Zivilisation für sich beanspruchte und solche Völker für unterlegen hielt, denen die offenkundigen Zeichen der westlichen Zivilisation fehlten: Nationalstaat, industrieller Kapitalismus und mechanistische Wissenschaft.
Eine geopolitische Dimension erlangte die vorgeschlagene kulturelle Einheit Asiens während der frühen postkolonialen Kämpfe für nationalen Wohlstand und nationale Macht – ein Vorhaben, bei dem indische, chinesische und indonesische Führer selbstbewusst Solidarität untereinander beschworen. So kam es, dass die gemeinsame Erfahrung der Unterjochung und rassischen Demütigung und die Forderung nach Freiheit und Würde, die einst Rabindranath Tagore mit Liang Qichao und Okakura Tenshin verbunden hatten, nun auch Jawaharlal Nehru mit Mao Zedong und Sukarno verband. Und Künstler wie Satyajit Ray und Akira Kurosawa, die sich mit den großen Umbrüchen und Traumata ihrer Gesellschaften befassten, teilten einen besorgten Humanismus.
Solche imaginierten Gemeinschaften sind heute im In- und Ausland nur noch bruchstückhaft vorhanden; an ihre Stelle sind pragmatische Wirtschaftsvereinigungen wie ASEAN und grenzüberschreitende Netzwerke in Produktion, Handel und Bankwesen getreten. Autoritäre Führer beschwören immer noch »asiatische Werte« und stellen die von Konfuzius geforderte Harmonie in der Gemeinschaft gegen den offensichtlich amoralischen und spalterischen Individualismus des Westens. Das ist jedoch kaum mehr als ein rhetorischer Deckmantel für Regime, die harmonische Beziehungen zu lokalen Plutokraten pflegen, aber der Mehrheit politische Rechte verweigern.
Die Idee Asiens hat heute eine andere Kohärenz. Was als geographisch disparate Erfahrungen erscheint – von ländlichen Migranten in Jakarta, Fabrikarbeitern in Manesar, Stammesangehörigen in Chhattisgarh, Nomaden in Tibet und Kunden der Gated Communities von Hermès und Jimmy Choo in Hangzhou und Gurgaon –, ist die verspätete Ankunft des Kapitalismus. Die großen Veränderungen, welche im 19. Jahrhundert Europa erschütterten, lassen sich heute in ganz Asien beobachten: die Verwandlung des Lebens und des Bodens in Waren, deren Bewertung durch die Mechanismen von Angebot und Nachfrage, der Zerfall der Gemeinschaften zu Aggregaten aus Individuen auf der Suche nach sich selbst, das Streben nach persönlichem Reichtum und Status, die Verzweiflung und Angst der Verlierer sowie der erbitterte Widerstand und die hektischen Improvisationen der Zurückgebliebenen und Zurückgestoßenen.
Die provisorische, über alle Grenzen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der Geographie, der Schicht und der Nationalität hinwegreichende Gemeinsamkeit liegt in der Erfahrung einer oft bitter paradoxen Moderne: des Versprechens der Selbstveränderung und des Wachstums, das häufig verwirklicht wird durch die Zerstörung vertrauter Orientierungspunkte; einer Atmosphäre der Erregung und des Widerspruchs, in der mit der Erneuerung unvermeidlich der Verrat an alten Bindungen und deren Zerfall einhergehen.
Nachdem mir die Nähe Tibbats klargeworden war, brauchte ich noch viele Jahre, um allgemein bekannte Verwerfungen, Gefahren und Chancen in diesem neuen Asien zu erkennen – die gewaltigen kollektiven und individuellen Anstrengungen, die Gewalt, das Leid, die Frustration, die Verzweiflung und den Optimismus. Meine intellektuelle Blindheit hatte viel mit meinem ausgeprägten Wunsch zu tun, ein englischsprachiger Schriftsteller zu sein. In einer anglophonen Kultur geboren zu sein hieß nicht nur, den Westen reflexhaft ins Zentrum zu stellen und den westlichen Literaturen und Philosophien die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Es bedeutete auch die Unterstellung, dass die Institutionen (parlamentarische Demokratie, Nationalstaat), die philosophischen Prinzipien (Säkularismus, Liberalismus), die ökonomischen Ideologien (Sozialismus, gefolgt von Marktkapitalismus) und die ästhetischen Formen (der Roman), die in den langen Jahrzehnten der britischen Herrschaft eingeführt oder übernommen worden waren, zur natürlichen und außerdem auch überlegenen Ordnung der Dinge gehörten.
Dies alles werde, so nahm man einfach an, irrationaler Religion ein Ende setzten, das Regieren verbessern, die private Freiheit ausdehnen, unsere moralische Vorstellungskraft erweitern und vielen hundert Millionen unserer weniger privilegierten Landsleute Wohlstand und Zufriedenheit bringen. Das einst vom Sozialismus versprochene Wohlergehen der Nation wurde in den letzten Jahrzehnten mit einer Reihe anderer, aus dem angloamerikanischen Raum importierter Ideen assoziiert: mit Privatisierung, Deregulierung und einem schlanken Staat.
Nur wenige Menschen dürften heute behaupten, die Ereignisse hätten diese Annahmen bestätigt. Der indische Nationalstaat, der mit seiner Gründung einer überwältigend armen und vielfältigen Bevölkerung das Wahlrecht gab, ist eines der weltweit kühnsten Experimente in Demokratie und politischem Pluralismus. Er darf einige Erfolge für sich beanspruchen, insbesondere die Politisierung von lange Zeit unterprivilegierten Menschen. Doch dieser Fortschritt ist keineswegs stetig und irreversibel; er ist begleitet von großen Verlusten und gekennzeichnet durch Stagnation an mancherlei Punkten; und er bringt mächtige Gegenkräfte hervor. Es fällt leichter, die allgemeine Krise zur Kenntnis zu nehmen: Aufstände ethnischer und religiöser Minderheiten in Grenzstaaten, zu denen inzwischen auch militantere Rebellionen der Enteigneten in zentralindischen Staaten hinzukommen; eine im Zeitlupentempo ablaufende landwirtschaftliche Katastrophe, die ihren Ausdruck im Selbstmord von Hunderttausenden Bauern findet; eine rasch wachsende städtische Bevölkerung, die unmenschlichen Lebensbedingungen ausgesetzt ist; und schließlich eine auf Spaltung ausgerichtete Politik, gelenkt von Männern, die sich ohne jede Reue einer maßlosen Korruption schuldig machen – all das scheint weiter von Liberalismus und Säkularismus entfernt zu sein denn je.
Eine zunehmend amerikanisierte indische Elite sucht weiterhin Bestätigung und Unterstützung bei ihren westlichen Pendants. Aber die alten Herren der Welt, die mit diversen Wirtschaftskrisen, wachsender Ungleichheit und politischer Unzufriedenheit kämpfen, haben ihr Modell universellen Fortschritts aus den Augen verloren und glauben nicht mehr so recht an die Möglichkeit, ihre geschätzten Werte zu exportieren. Die Staaten Europas und Amerikas leben – oder überleben – inzwischen wie alle anderen von einem Tag zum nächsten, sind zwar mit ihrem Militär und ihren Überwachungstechniken auf finstere Weise allwissend, aber nicht länger eine lebendige Quelle rettender moralischer und politischer Ideen. Selbst die analytische Anleitung, die Europas alte intellektuelle und philosophische Tradition bot, erscheint immer weniger verlässlich in einer Zeit verwirrend heterogener politischer und kultureller Formen.
Die Fixierung Indiens auf den Westen, die radikale chinesische und japanische Denker im frühen 20. Jahrhundert mit entsetzter Faszination und schlimmen Vorahnungen betrachteten, erscheint in diesem Zusammenhang noch lähmender als früher. Nicht nur Indien kämpft gegen die verschärften Konflikte zwischen den Forderungen der politisierten Massen und den Imperativen des transnationalen Kapitalismus. Aber wir wissen außerhalb der wissenschaftlichen Welt zu wenig über politische und soziale Experimente in anderen asiatischen Gesellschaften: worin sie bestehen, wie sie sich entwickeln und wohin sie am Ende führen mögen (eine euphemistische Meinungsmache hinsichtlich der Möglichkeiten, China »einzudämmen« oder mit ihm »gleichzuziehen«, ist hier kein Ersatz). Noch weniger wissen wir darüber, wie die speziellen Herausforderungen und Dilemmata Chinas und seiner Nachbarländer ihren Niederschlag in Regierungsformen, Technologien, Religionen und Kunst gefunden haben.
Außerdem ist es nicht immer einfach, über den durch die eigene Erziehung und Tätigkeit bestimmten Horizont hinauszublicken. Ende 1995 führte mich meine erste Auslandsreise nach Indonesien. Ich hatte gerade ein Buch über die Ankunft der neokapitalistischen Moderne in den Kleinstädten Indiens veröffentlicht. Einige der durch diese Prozesse lautstark entfesselten politischen und kulturellen Energien, die Indien radikal veränderten, fanden sich auch in Indonesien, das sich schon sehr viel früher dem Projekt der Schaffung privaten Wohlstands zugewandt hatte. Aber es waren die aus dem 9. Jahrhundert stammenden Tempel von Prambanan und die Stupas von Borobudur, die den Schock des Wiedererkennens auslösten. Und Bali, das Nehru denkwürdig und mit untypisch präzisem Gefühlsüberschwang den »Morgen der Welt« genannt hat, ließ mich weniger ratlos hinsichtlich der Sanskrit-Kosmopolis zurück, von der Mr Sharma gesprochen hatte.
Tatsächlich schien das erst spät von den Holländern eroberte und nur fleckenweise modernisierte Bali auf bezaubernde Weise zur alten Hindu-Welt mit ihren Familienschreinen, ihrer Gamelan-Musik, ihren moosbewachsenen Statuen, Schattenspielen und Reisfeldern zu gehören. Ich wusste nicht, dass die verehrte »antike« Kultur der Insel in weiten Teilen neueren Ursprungs war. Ganz unerwartet für mich, gab es in der nordbalinesischen Stadt Singaraja ein arabisches Viertel, das von alten spirituellen – und solide materialistischen – Verbindungen der Insel zur übrigen Welt zeugte. Aber ich verharrte in einem touristischen Stupor. Java mit seinen glatten Mautstraßen und seinen Wolkenkratzern löste bloßes Staunen aus, weckte aber keine Neugier.
Indonesien wurde damals von Suharto geführt, einem wirtschaftsfreundlichen Despoten mit standhaften amerikanischen und europäischen Verbündeten. Sein auf Vetternwirtschaft basierender Kapitalismus hatte eine kleine, aber loyale Mittelschicht und willfährige Medien entstehen lassen. Kündigte diese Achse bereits den Reiz eines autoritären Kapitalismus in unserer Zeit an? Erlaubte sie – durch die Zeitalter Deng Xiaopings in China und Thaksin Shinawatras in Thailand hindurch – bereits einen Blick in das Zeitalter Narendra Modis? Meine in ostasiatischer Geschichte und den langweiligen, aber aufschlussreichen Fakten der politischen Ökonomie ungeschulten Augen konnten nicht viel erkennen. Es bedurfte einiger Erfahrung und vieler Neuausrichtungen der Perspektive, bevor ich 2011 mit einem Schreibauftrag nach Indonesien zurückkehren konnte.
In dieser langen Zwischenzeit verdankte sich meine persönliche Entdeckung Asiens einer Reihe von Zufällen. Viele meiner intellektuellen Reisen führten mich nach China. Bei den Vorarbeiten zu einem Buch über den Buddha erfuhr ich von der Weitergabe seiner Ideen über Kashmir und Tibet nach Ostasien, wo sie sich mit dortigen Glaubenssystemen und ethischen Philosophien wie dem Konfuzianismus und dem Daoismus vermischten. Auf diesem indirekten Weg begann ich langsam zu verstehen, dass China gleichsam das Griechenland Asiens gewesen war und seine konfuzianischen Kulturen an die koreanischen, japanischen und vietnamesischen Nachbarn weitergegeben hatte. Die chinesischen Reiche bildeten das Zentrum eines Handelsnetzes und eines diplomatischen Netzwerks, welche beide von Nepal bis Java, von der Amur-Region an der Grenze von Russland und China bis Burma reichten. Chinas Wirtschaft war von zentraler Bedeutung für die Region. Im Ausland lebende chinesische Kaufleute und Händler sollten später zu wichtigen Spielern in der Wirtschaft Südostasiens werden.
Diese Geschichte machte deutlich, wie China, das in unserer Zeit aus Jahrzehnten wirtschaftlicher Autarkie hervortrat, rasch die Vormachtstellung in Asien erlangen, Taiwan in den Schatten stellen, Hongkong wiederbeleben, der Mongolei zu Reichtum verhelfen und ein ängstliches Japan zu einem atavistischen Nationalismus zwingen konnte. Auf meinen Reisen nach Malaysia und Indonesien wurde mir klarer, warum die dort lebenden Chinesen trotz institutionalisierter Diskriminierung und Vernachlässigung zur größten Wirtschaftsmacht Südostasiens aufsteigen konnten. Mit der Zeit wurde mir klar: Wer das heutige Asien als Ganzes verstehen will, muss zunächst China verstehen – heute mehr denn je. Und dorthin begann nun mein Kompass zu zeigen.
Ab 2004 begann ich regelmäßig nach China zu reisen. Natürlich verleiht persönliche Erfahrung keinen besonderen Zugang zur Realität, auch wenn sie zwei überschätzten Figuren der bürgerlichen westlichen Kultur Autorität und Glanz verleiht: dem Auslandskorrespondenten und dem Reiseschriftsteller. Man muss immer noch lernen, zu sehen und die richtigen Vermittler zu finden. Es waren chinesische Schriftsteller und Denker, die mir die gegenwärtig dort stattfindenden großen Veränderungen vor Augen führten. Sie zeigten mir, dass der Fortschritt auch dort in Sprüngen und Schüben erfolgt, neue Turbulenzen auslöst und oft mehr Opfer als Nutznießer hat.
Mein frühes Wissen über China stammte weitgehend aus Arbeiten westlicher Kalter Krieger und liberaler Internationalisten, die dem autoritären China reflexhaft das »demokratische« Indien entgegenstellten. So brauchte ich eine Weile, um zu erkennen, dass der ideologische Dualismus, der amerikanischen Denkfabriken half, solvent zu bleiben – freie versus unfreie Welt, Anhänger des totalitären Kommunismus versus buddhistische Tibeter –, nahezu nutzlos war, wenn es darum ging, zum Beispiel die in raschem Wandel begriffene Lage in Tibet zu verstehen.
In Tibet gibt es heute mehr religiöse Freiheit als zu irgendeiner Zeit nach der Kulturrevolution. Auch ist das Wachstum des Bruttosozialprodukts dort höher als in anderen Provinzen Chinas. Dennoch hat die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu politischer Passivität geführt (wie andernorts in China). Einer der Gründe liegt in der Tatsache, dass die neue Ökonomie mit ihrer deutlichen Bevorzugung von städtischen gegenüber ländlichen Regionen uralte bäuerliche und nomadische Lebensweisen zu vernichten droht. Nachdem der moderne Kapitalismus überall Einzug gehalten hat, führt die »Rationalisierung« des alltäglichen Lebens auch zu einer beschleunigten »Entwicklung der Unterentwicklung« – zur Entstehung moderner Armut und Ungleichheit. Außerdem zeigt sich, dass es den Tibetern wie anderen vornehmlich ländlichen ethnischen Minderheiten am Temperament oder an der Übung fehlt, die für einen leidenschaftlichen Glauben an die Utopie der Moderne erforderlich sind, wie das postmaoistische China sie verspricht – einen am Konsum ausgerichteten Lebensstil in städtischen Zentren. Da die Tibeter zu einem umfassenden Umbau ihres öffentlichen und privaten Lebens gezwungen werden, sind sie auch zu einer unbeugsameren Verteidigung ihrer kulturellen und religiösen Identität gezwungen – eine verbreitete Erscheinung in asiatischen Ländern, die im 19. Jahrhundert Modernisierungsbewegungen nach westlichem Vorbild ausgesetzt waren.
Mobiles Kapital, multinationale Konzerne und digitale Kommunikation, welche in ihrem Zusammenspiel die transnationalen Netzwerke der Eliten hervorbringen, tragen gleichfalls zur Neuausrichtung »mittelalterlicher« und anderer scheinbar anachronistischer Identitäten bei. Tatsächlich sind die vertieften und sich wechselseitig verstärkenden Verbindungen zwischen kosmopolitischem Globalismus und den quasi-provinziellen Meutereien ethnischer und religiöser Minderheiten zutiefst charakteristisch für unsere Zeit.
Dasselbe galt für die Ambivalenzen und Widersprüche der Moderne, die opportune Gegensätze zwischen Demokratie und Autoritarismus auflösten. Die Tibeter, so wurde mir klar, teilen ihre Misere mit Bauern und Stammesangehörigen in Indien, die zwar in der größten Demokratie der Welt leben, aber mit einer mörderischen Achse aus Politikern, Geschäftsleuten und Militärs zu kämpfen haben.
Die folgenden Seiten beschreiben einen komprimierten Prozess der Selbstbildung, insbesondere in China, verwirklicht durch reale Reisen, aber auch durch geistige Ausflüge in Politik, Geschichte und Literatur. Ich besaß keinen institutionellen Kompass, und meine frühen, zufällig gewählten Reiseführer waren groß an Zahl, vielfältig und meist erratisch. China und seine Nachbarländer beherbergten und beherbergen zahlreiche Träumer, von dem Kulturgegner Walter Spies bis hin zu den heutigen Easy-Ridern im Rising-Asia-Zug: Sie beschreiben vornehmlich ihre eigenen Phantasien von persönlicher Macht und sozialem Status, ihren Wunsch, sich der scheinbar universalisierenden und homogenisierenden westlichen Geschichte anzuschließen oder daraus auszutreten.
Selbst intellektuell anspruchsvollere Reiseschriftsteller sind unfähig, ihre zufällig erworbenen Vorurteile hinter sich zu lassen. Ob nun im Blick auf Yoga, den Islam oder die Japaner – sowohl V.S. Naipaul als auch Arthur Koestler behaupteten mit wechselnder literarischer Kraft, dass der Westen am besten sei. Und Claude Lévi-Strauss, der solche naiven westlichen Vorstellungen selbstbewusst zurückwies, erschrak in Traurige Tropen vor dem angeblich Malthusianischen Schicksal Asiens, einer »Vision unserer eigenen Zukunft, die dort bereits Wirklichkeit geworden ist«, und erlag dann in seinen späteren Jahren einer simplen Japanophilie. Der im Blick auf Japan äußerst scharfsinnige Roland Barthes brachte im Blick auf China nur Banalitäten zustande. Rabindranath Tagore, Amitav Ghosh und Rahul Sankrityayan, die eine sehr schwache indische Tradition des Schreibens über Ost- und Südostasien wettmachen, sind da weitaus anregender. Nach Jahrzehnten der Beschränkungen und einer strammen Verbreitung abgestandener Klischees aus dem Kalten Krieg erlebt der ausländische Journalismus in China nun ein Goldenes Zeitalter. Donald Richie, Ian Buruma und Pico Iyer haben Japans »Andersartigkeit« geschickt entschlüsselt. Ost- und Südostasien sind auch die Region, in der Giganten der modernen Geisteswissenschaften wie Jonathan Spence, Benedict Anderson, Clifford Geertz und James C. Scott sich umgesehen haben. Dennoch taugen breite Übersichtsdarstellungen und grobkörnige Geschichten durch Außenstehende allenfalls zu einer ersten Orientierung.
Es bedarf anderer Anstrengungen, um das innere Leben einer Gesellschaft zu erspüren – dazu gehören Zufallsgespräche und Zufallslektüren wie auch strukturiertes Reisen. Wie sich zeigt, ist kaum etwas wichtiger, als bei den Debatten – und Streitigkeiten – über Politik und Kultur zuzuhören, die nicht für ausländische Ohren bestimmt sind. Die Schriften indonesischer Denker und Schriftsteller wie Soedjatmoko und Goenawan Mohamad, des Chinesen Wang Hui oder der Japaner Takeuchi Yoshimi und Karatani Kojin eröffneten Perspektiven, die sich in den Darstellungen von Ausländern nicht finden lassen. Und in der Literatur wie auch im Film Ostasiens erwarteten mich gleichfalls anregende Offenbarungen.
Im größten Teil meines Erwachsenenlebens bin ich darin ausgebildet worden, das eigene Ich und die Welt durch eine vornehmlich westliche und südasiatische Brille wahrzunehmen. Durch die Romane von Kenzaburō Ōe oder die Filme von Hou Hsiao-hsien entdeckte ich neue Zusammenhänge und Ähnlichkeiten. Die Erfahrung der Orientierungslosigkeit in der neuen Welt, die Japan machte, als es sich schon früh und mit mancherlei Verwirrung in der Zielsetzung modernisierte, gab vielen asiatischen Schriftstellern, Künstlern und Denkern das Muster vor. Mir wurde klar, dass die Verwirrungen und Dilemmata der entwurzelten jungen Männer und Frauen bei R.K. Narayan in Natsume Sosekis Romanen Sanshiro und Kokoro präziser vorweggenommen worden waren als in irgendeinem Text von Italo Svevo und Thomas Mann; dass Naruse Mikios Film Wenn eine Frau die Treppe hinaufsteigt die Dilemmata indischer Mittelschichtfrauen aus meinem Bekanntenkreis ebenso direkt ansprach wie Satyajit Rays Mahanagar; und dass Kalkutta mehr mit dem halbkolonialen Shanghai und Tokio der 1920er und 1930er Jahre gemeinsam hatte als mit Dublin.
Diese Entdeckung neuer Symmetriebeziehungen half mir, die Vertrautheit mit dem Land aufzubrechen, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens gelebt und über das ich das meiste geschrieben hatte. Wenn wir uns fremden Ländern aussetzen, bewirkt das eine Entfremdung vom Alltag; es relativiert, was wir an uns selbst für einzigartig halten – die politischen Prozesse, die kulturellen Normen. Dennoch war ich überrascht, wie dramatisch meine Reisen den Bezugsrahmen erweiterten, auf den sich mein Denken über Indien lange Zeit beschränkt hatte. Die folgenden Texte über einige entscheidende Phasen in der zeitgenössischen Geschichte Ostasiens sind vor allem ein Versuch, die Dinge bifokal zu sehen: eine Studie über China und seine Nachbarn, deren Ausgangs- und Endpunkt unvermeidlich Indien darstellt.
Deshalb enthält dieses Buch mehr ungewöhnliche Gegenüberstellungen und Kontraste als farbige Darstellungen und Aufzählungen exotischer Fakten. Zugleich bemüht es sich um eine sorgfältige Distanz zu dem instrumentellen Weltbild, das man bei außenpolitischen Fachleuten, Sicherheitsexperten und Finanzanalysten findet. Schließlich beschreibt es eine Welt, in der großartige unilineare Visionen – wonach Verbesserungen der Technologie, der Bildung, des Unternehmertums und der Produktivität uns alle zu einer Konvergenz mit Wohlstand und Stabilität westlichen Stils führen werden – immer fadenscheiniger wirken. Wahlen bedeuten noch keine funktionierende Demokratie oder gar politische Stabilität, freie Märkte haben nicht zu größerer Freiheit, bessere Bildungschancen und Kommunikationsmöglichkeiten nicht zu mehr Toleranz und Menschenrechten geführt. Stattdessen erleben wir politisches Chaos, gierige Unternehmen, eine Verschlechterung des Klimas, fremdenfeindlichen Nationalismus und Völkermord in großem Maßstab. Die angeblich universellen Gesetze des Fortschritts, wie sie in jüngster Zeit von aalglatten Davos-Leuten verbreitet werden, haben sich wieder einmal als Schein erwiesen.
Aber das Leben geht weiter, wie es immer weitergegangen ist, trotz der fehlgeleiteten Rationalität der Wissenschaft, der Märkte und des Staates – und das auf unerwartete Weise. Das zeigt sich auf unterschiedliche Art bei den Japanern mit ihrer »Post-Wachstums-Ökonomie«, bei den Tibetern mit ihrer Abwendung von der »Entwicklung« und ihrer erneuten Hinwendung zum Glauben an ihren wiedergeborenen spirituellen Führer und bei den Indonesiern mit ihrer Präferenz für eine Regierung »von unten nach oben«. Jeder Versuch, das neue Asien zu verstehen, muss solche tiefverwurzelten Unterschiede anerkennen, die unterhalb der oberflächlichen Einheit liegen, wie sie von Verfechtern des Nationalismus oder der Globalisierung behauptet wird. Über dem Zusammenstoß unmenschlicher Ideologien mit dem gewöhnlichen menschlichen Leben lauert das Phantom alternativer Geschichten, die nicht sind, aber sein könnten, und alternativer Lebens- und Denkweisen, die möglicherweise eine Zukunft haben. Das jedenfalls waren die Verlockungen des Ostens – die sagenhaft vielgestaltigen Arten des Menschseins und die Entschlossenheit vieler Menschen, sie zu bewahren –, als ich mich auf den Weg machte, um mein privates Tibbat zu finden.
Erster TeilEin Trommelwirbel für die Moderne
Eine Erziehung der Gefühle in Shanghai
1.
Am 24. April 1924 traf Rabindranath Tagore zu einer Vortragsreise durch China in Shanghai ein. Kurz nachdem er 1923 den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte, war er zu einer internationalen Berühmtheit auf dem Gebiet der Literatur geworden und hielt vor vollen Häusern Vorträge in aller Welt, von Argentinien bis nach Japan. Seine Botschaft – wonach die auf dem Kult des Geldes und der Macht basierende moderne Zivilisation zutiefst destruktiv sei und der Mäßigung durch die spirituelle Weisheit des Ostens bedürfe – fand Anklang bei vielen Menschen im Westen, die der Erste Weltkrieg gezwungen hatte, ihren Glauben an Wissenschaft und Fortschritt in Frage zu stellen. Aber als er auf seinen Reisen durch den Osten die Asiaten ermahnte, ihre traditionelle Kultur nicht aufzugeben, wurde er oft durch Zwischenrufe gestört und ausgebuht.
Auch in Japan wurde Tagores Warnung vor der »besonderen Begeisterung für Fortschritt und Kraft des Westens« 1916 meist verächtlich zurückgewiesen. Doch in China traf sein Lob der spirituellen Traditionen Asiens auf den heftigsten Widerstand. Der Dichter Qu Qiubai, der Buddhismus studiert hatte, bevor er sich dem Kommunismus zuwandte, fasste den allgemeinen Tenor der Aufnahme Tagores in China mit den Worten zusammen: »Vielen Dank, Herr Tagore, aber wir hatten schon zu viele Konfuziusse und Menziusse in China.« Nach wiederholten Angriffen durch aggressive Fragen war Tagore gezwungen, seine Vortragsreise abzubrechen.
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war China eines der größten und schwächsten Länder der Erde. In den vorangegangenen Jahrzehnten hatten westliche Mächte und ein im Aufstieg begriffenes Japan dem Land mehrfach ungleiche Verträge und hohe Entschädigungszahlungen aufgezwungen. Doch wie Qu Qiubai forderten führende Intellektuelle wie Chen Duxiu, Herausgeber der radikalen Zeitung Neue Jugend und Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas, eine vollständige Abkehr von der chinesischen Tradition. Sie wollten, dass China durch den Einsatz westlicher Methoden zu einer starken, durchsetzungsfähigen Nation wurde, und bewunderten Besucher wie Bertrand Russell und John Dewey, deren Glaube an Wissenschaft und Demokratie den Weg zu Chinas Rettung zu weisen schien.
Dieser intellektuelle Konsens war schon früh in der modernen Geschichte Chinas entstanden. In einem Umfeld nationaler Erniedrigung und Schande aufgewachsen, war die erste Generation der reformorientierten Intellektuellen, zu der auch Kang Youwei (1858–1927) und Liang Qichao (1873–1929) gehörten, einhellig der Auffassung, dass China einer Modernisierung bedurfte, und dies mit oder ohne Beteiligung der Mandschu-Kaiser. Nach dem verheerenden Boxeraufstand von 1898 bis 1900, als westliche Mächte und Japan einen Volksaufstand gegen die äußere Einmischung in chinesische Angelegenheiten niederschlugen, bemühten sich selbst die wankelmütigen Mandschus um Reformen nach westlichem Vorbild. Sie schafften die traditionellen Prüfungen für den Beamtenstand ab, gründeten moderne Schulen und schickten chinesische Studenten ins Ausland. Tausende junger Chinesen kamen erstmals mit Naturwissenschaften, Technik, Medizin, Rechtswesen, Wirtschaft, Erziehung und militärischen Fertigkeiten des modernen Westens in Berührung, und sowohl in China als auch in der chinesischen Diaspora schossen Vereinigungen aus dem Boden, die sich der Modernisierung Chinas verschrieben.
Der Zusammenbruch der Mandschu-Herrschaft 1911 und die Gründung der Republik China erweckten den Anschein, als könnte dies den politischen und wirtschaftlichen Wandel Chinas beschleunigen, doch an die Stelle der Mandschu-Herrscher traten Warlords, die weite Teile des Landes in Gewalt und Chaos stürzten. Japan erhob weiterhin meist unsinnige Ansprüche auf chinesisches Territorium, und am 4. Mai 1919 kam es in Beijing zu gewalttätigen Protesten von Studenten, nachdem die alliierten Mächte den Japanern auf der Pariser Friedenskonferenz die vormals von den Deutschen gehaltenen Territorialrechte in Kiautschou zugesprochen hatten.
Die Proteste waren der Anfang der »Bewegung des 4. Mai«, einer Explosion intellektueller Energie in China, in der sich eine Überzeugung herauskristallisierte, die zahlreiche Chinesen teilten und die heute noch Politik und Kultur des Landes prägt: dass China die Fesseln der Tradition abstreifen und sich dringend modernisieren müsse, um eine starke, selbstbewusste Nation zu werden. Für die Generation des 4. Mai waren die egalitären Ideale der Französischen und Russischen Revolution und der wissenschaftliche Geist, der die Grundlage der industriellen Macht des Westens bildete, ganz selbstverständlich einer verknöcherten chinesischen Kultur überlegen, die Tradition über Innovation stellte und China in Rückständigkeit und Schwäche festhielt. 1924 war kaum jemand von ihnen bereit, einem scheinbar jenseitigen Dichter aus Indien zuzuhören, der sich über die Probleme der modernen westlichen Zivilisation und die Tugenden des alten Asien ausließ.
2.
In den 1920er und 1930er Jahren lebten die meisten modernen chinesischen Intellektuellen und Schriftsteller in Shanghai, der am stärksten verwestlichten Stadt Chinas, deren Buchhandlungen Zeitschriften wie Harper’s, The Dial und Vanity Fair neben Übersetzungen von Joyce und Woolf und anderen modernen Autoren anboten. Obgleich die Stadt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts von westlichen Geschäftsleuten dominiert wurde, schienen ihre Theater, Tanzpaläste, Cafés, Rennbahnen, importierten Autos und Buchhandlungen jungen Chinesen zahlreiche Chancen zu bieten, sich selbst zu erfinden. Der junge Held des klassischen Romans Die umzingelte Festung von Qian Zhongshu, der 1937 nach ein paar Jahren in Europa nach China zurückkehrt, bemerkt sarkastisch: »Shanghai ist auf kulturellem Gebiet ganz sicher Avantgarde. Dass Schülerinnen sich ihr Gesicht anmalen und zukleistern, um Männer anzuziehen, findet man selbst im Ausland nur selten.«
Dennoch war es sicher nicht leicht, ein westlich orientierter Intellektueller in einer Stadt wie Shanghai zu sein, wo Chinesen in den sogenannten Internationalen Konzessionen gezwungen waren, getrennte Aufzüge zu benutzen, in ausländischen Clubs nur als Gäste geduldet wurden und zu den meisten modernen Krankenhäusern keinen Zugang hatten. Die große japanische Präsenz in der Stadt dürfte eine noch größere Qual gewesen sein. Viele chinesische Intellektuelle sahen in Japan ein Beispiel dafür, wie ein asiatisches Land stark oder sogar unangreifbar werden konnte, wenn es im industriellen Wachstum und den militärischen Fähigkeiten mit dem Westen gleichzog. Die in China erhältliche westliche Literatur war größtenteils aus dem Japanischen ins Chinesische übersetzt worden, und viele führende Schriftsteller und Aktivisten wie Lu Xun und Sun Yat-sen hatten lange in Japan gelebt. Zugleich aber waren die chinesischen Autoren täglich konfrontiert mit ständig zunehmenden Beweisen für die bösen Absichten Japans gegenüber China.
Die Chinesen, die auf eine persönliche Befreiung durch den Westen oder Japan hofften, konnten den politischen und wirtschaftlichen Verfall ihres Landes unmöglich übersehen. Aber wie der Literaturkritiker Shumei Shih darlegt, vermieden es Romanschriftsteller in den 1920er und 1930er Jahren lieber, die demütigenden Aspekte einer ausländischen Präsenz in China zu behandeln, für die Shanghai mit seinen rassistischen und ausbeuterischen Geschäftsleuten, Opiumhändlern und Missionaren das herausragende Beispiel darstellte. Da viele chinesische Intellektuelle inzwischen den Ehrgeiz entwickelt hatten, als den westlichen Intellektuellen ebenbürtig angesehen zu werden, empfanden sie außerdem Verachtung für ihre entschieden rückwärtsgewandten und von Armut heimgesuchten Kollegen. C.T. Hsia, der erste große Englisch schreibende Kritiker der modernen chinesischen Literatur, meinte dazu:
Vielleicht waren sie in jüngeren Jahren stolz auf China gewesen, aber dieser Stolz hatte sich in eine offen masochistische Anerkennung ihrer, wie sie meinten, auf allen Gebieten anzutreffenden Unterlegenheit verwandelt. Angewidert von Zöpfen, gebundenen Füßen und Opium – den greifbaren Symbolen für die Rückständigkeit Chinas –, schämten sie sich gleichfalls für ihre Kunst, ihre Literatur, ihre Philosophie und ihr Volkstum.
Da kann es kaum überraschen, dass Lu Xun, ein leidenschaftlicher Kritiker der traditionellen chinesischen Kultur, sich angesichts solcher inneren Konflikte wie viele andere chinesische Autoren dem Marxismus zuwandte. Andere wie Shao Xunmei, ein Dichter, der die Gedichte und Zeichnungen Aubrey Beardsleys herausgegeben hatte und kurze Zeit der Geliebte der für den New Yorker schreibenden Schriftstellerin Emily Hahn gewesen war, scheinen ihre ambivalente Einstellung durch ein kosmopolitisches Dandytum kompensiert zu haben.
Auch heute, viele Jahrzehnte später, ist die Frage, wie China modern werden sollte, immer noch ungelöst – trotz oder vielleicht sogar wegen der langen Jahre der Isolation vom Westen, die Mao Zedong dem Land auferlegte. Die beliebte dokumentarische TV-Serie Fluss-Elegie (1988), die die chinesische Tradition als dem Untergang geweiht darstellte und China in wenig schmeichelhafter Weise mit dem Westen verglich, brachte die Empfindungen vieler gebildeter Chinesen zum Ausdruck. In weiten Teilen der 1980er und 1990er Jahre waren chinesische Intellektuelle, die sich gerade erst von den Exzessen der Kulturrevolution erholten, einhellig der Auffassung, dass eine rasche politische und kulturelle Verwestlichung China von seiner feudalen Vergangenheit befreien könne – ein Konsens, der durch die Ermordung unbewaffneter Demonstranten 1989 auf dem Tiananmen-Platz zwar erschüttert, aber nicht gebrochen werden konnte.
Seit einigen Jahren jedoch beklagen junge konservative Nationalisten eine in ihren Augen unkritische chinesische Übernahme einer dekadenten westlichen Konsumorientierung. Im Wissen um ihr ideologisches Vakuum versuchte das kommunistische Regime in den 1990er Jahren, Konfuzius als Quelle von Werten wiederzubeleben. Und in jüngster Zeit verweisen Schriftsteller und Wissenschaftler, die einer »neuen Linken« zugeordnet werden, auf die gewaltigen Kosten der lange hinausgezögerten Integration Chinas in die moderne Weltwirtschaft – wachsende soziale Ungleichheit, soziale Unruhen und Umweltschäden.
Chinas Romanze mit der modernen Welt schien bereits sehr bitter geworden zu sein, als Qian Zhongshu Anfang der 1940er Jahre in seinem Roman Die umzingelte Festung (Fortress Besieged), der weithin als eines der Meisterwerke der chinesischen Literatur des 20. Jahrhunderts gilt, über den wirkungslosen verwestlichten Intellektuellen schrieb. Die brutale japanische Invasion 1937 – die Bombardierung Shanghais und der Überfall auf Nanjing – und die offensichtliche Gleichgültigkeit des Westens gegenüber dem Leid der Chinesen hatten das Bild der kulturellen und politischen Vorbilder Chinas getrübt. Die Desillusionierung hinsichtlich der zerstrittenen Führer des republikanischen China – des Nationalisten Chiang Kai-shek, der Warlords und der Kommunisten – war gleichfalls gewachsen. Die »Bewegung Neues Leben«, eine Kampagne, die Chiang Kai-shek 1934 begonnen hatte, um China durch die Verpflichtung der Massen auf die vier traditionellen Tugenden – Höflichkeit, Integrität, Selbstachtung und Rechtschaffenheit – moralisch zu erneuern, schien angesichts der offenkundigen Brutalität und Korruptheit des nationalistischen Regimes nicht mehr als leere Rhetorik zu sein.
Der Drang der Bewegung des 4. Mai, vom Westen zu lernen, verkam zu einem leeren Ritual. Qians Protagonist, der siebenundzwanzigjährige Fang Hung-chien, sagt dazu:
Weißt du, heutzutage ist ein Auslandsstudium wie ein Titel in den kaiserlichen Examina. […] Ebenso will man mit einem Auslandsstudium nicht seine Bildung vertiefen, sondern seine Komplexe loswerden.
So strengt sich denn auch Fang als Student in Europa möglichst wenig an und kauft einen falschen Doktortitel von einer nichtexistenten amerikanischen Universität namens Clayton, um seiner Familie zu gefallen. Zu Beginn des Romans kehrt Fang nach China zurück, nachdem er ein paar Jahre auf Kosten seiner Verwandten untätig im Ausland verbracht hat, und in dem Jahr, in dem wir ihm nun durch China folgen, scheint er bestens ausgerüstet, um die eigene Unaufrichtigkeit und Anmaßung wie auch die anderer verwestlichter Chinesen zu beobachten.
Da er nicht weiß, was er will, gelingt es ihm, die beiden modernen Frauen, denen er den Hof macht, zu verprellen. In Shanghai begegnet er einem Dichter, der in Cambridge studiert hat und dessen mit zahlreichen Anmerkungen versehenes modernistisches Gedicht »Sündiger Salat« Anspielungen auf Werke von T.S. Eliot, Leopardi, Franz Werfel und anderen enthält. Fang begegnet auch einem selbsternannten Philosophen, der schmeichlerische Briefe an berühmte westliche Denker schreibt und von sich behauptet, mit »Bertie« Bertrand Russell persönlich befreundet zu sein:
»Kennen Sie Russell gut?«
»Wir sind gewissermaßen Freunde, er respektiert mich und hat mich gebeten, ihm bei der Lösung gewisser Fragen zu helfen.« Der Himmel war Zeuge, daß Chu Shenming dabei nicht aufschnitt. Russell hatte sich tatsächlich bei ihm erkundigt, seit wann er in England sei, welche Pläne er habe, wieviel Stück Zucker er in den Tee nähme und ähnliche Fragen, die nur er selbst beantworten konnte.
Ein wohlhabender chinesischer Manager einer amerikanischen Firma, der in Fang einen potentiellen Ehemann für seine Tochter erblickt, garniert seine Rede mit, wie er meint, amerikanischen Ausdrücken, während er dem Gast seine Porzellansammlung zeigt:
»Sure, sehr wertvoll, plenty of dough. […] Wenn ich manchmal ausländische friends einlade, nehme ich diese große Kangxi-Platte mit farbiger Unterglasur als salad dish. Die Gäste finden das sehr romantisch, und auch das Essen schmeckt ein bißchen old-time.«
Die tieferen Leidenschaften hinter den Sehnsüchten der Neureichen zeigten sich indessen im Bücherschrank der Tochter des Geschäftsmanns, wo Fang neben Heften von Reader’s Digest und dem Filmbuch zu Vom Winde verweht auch ein Buch mit dem Titel How to Gain a Husband and Keep Him entdeckt. Bei einer anderen jungen Frau, die sich für Fang interessiert, wird klar, dass eines ihrer Gedichte das Plagiat eines alten deutschen Volkslieds darstellt.
Fang empfindet Shanghais moderne Fassade als falsch, doch in seiner Heimatstadt ist er sogar in noch höherem Maße ein Außenseiter. Seine Familie umschmeichelt ihn, aber er versucht sich ihrer Bemühungen zu erwehren, eine Ehe für ihn zu arrangieren:
Er hatte immer die »modernen« Kleinstadtmädchen gehaßt, mit ihrem veralteten Schick und ihrer unbeholfenen Verstädterung. Sie glichen aufs Haar dem ersten europäischen Anzug, den ein chinesischer Schneider nach einem abgetragenen, ausländischen Modell angefertigt und bei dem er sogar die Flicken auf Hose und Ärmel mitkopiert hatte.
Am Ort verehrt man ihn wegen seines Studiums in Europa und bittet ihn, einen Vortrag über das Thema »Der Einfluß der westlichen Kultur in der chinesischen Geschichte und deren kritische Wertung« zu halten. Sein altmodischer Vater drängt ihm zur Vorbereitung dieses Vortrags ein paar chinesische Bücher auf, in denen unter anderem behauptet wird, die Chinesen »hätten einen ›viereckigen‹, aufrichtigen Charakter, daher hielten sie die Erde für ein Viereck; die Ausländer dagegen besäßen einen ›runden‹, hinterlistigen Charakter, daher behaupteten sie, die Erde sei rund«. Und Fang scheint mehr als nur ein persönliches Gefühl der Bedeutungslosigkeit und des Scheiterns zum Ausdruck zu bringen, wenn er seinem verwunderten Kleinstadtpublikum erklärt: »Trotz jahrhundertelangen Austauschs mit dem Ausland werden nur zwei westliche Errungenschaften im chinesischen Volk ewigen Bestand haben: Opium und Syphilis.«
Die japanische Besetzung Shanghais setzt seiner Trägheit vorübergehend ein Ende und zwingt ihn, das Stellenangebot einer im Hinterland geschaffenen Universität anzunehmen. In klapprigen Bussen und auf Booten unternehmen Fang und seine Begleiter eine, wie sich zeigt, epische Reise durch Provinzen, in denen das Chaos des Kriegs und der Flüchtlingsströme herrscht. Ihre Kämpfe mit niederen Beamten, Prostituierten und Gastwirten inspirieren den Autor zu einigen der komischsten Szenen des Romans. Hier sitzen sie in einer typischen Absteige und überlegen, ob sie das Fleisch essen sollen, das ihnen als geräucherter Schinken angeboten wird:
Der Kellner nahm zu ihrer Erbauung ein rabenschwarzes, fetttriefendes Ding vom Haken und murmelte unentwegt: »Eine Delikatesse!« Dabei lief ihm das Wasser im Mund zusammen, und er schien Angst zu haben, der fette Brocken könnte unter den lüsternen Gästeblicken zusammenschrumpfen. Eine Made erwachte aus ihrem fetten Schlummer und begann sich zu räkeln. Herr Li erkannte sie sofort und war angeekelt. Mit gespitzten Lippen gab er der Made von weitem ein Zeichen seines Mißfallens und rief: »Frechheit!« Der Kellner tippte zart auf die weißlich-weiche fette Masse, wobei sein Finger auf der das Fleisch bedeckenden Staubschicht eine schwarzglänzende Spur hinterließ – wie eine nagelneue Asphaltstraße. »Es ist nichts!« behauptete er.
Der erboste Gu fragte ihn ununterbrochen: »Denkst du, wir sind blind?«
»Das ist die Höhe«, riefen alle im Chor […], was den Wirt auf den Plan brachte. Inzwischen hatten zwei weitere Maden den Lärm gehört und streckten wißbegierig die Köpfe raus. Der Kellner, dem es nicht länger möglich war, »die Leiche zu vernichten und die Spuren zu tilgen«, wiederholte nur stereotyp: »Wenn ihr es nicht eßt, essen es andere … ich zum Beispiel, ich zeige es euch …«
Der Wirt nahm die Pfeife aus dem Mund und dozierte: »Das sind keine Maden, das hat nichts zu sagen. Das sind Fleischsprossen – Fleischsprossen.«
Die moderne Satire benötigt eigentlich als Hintergrund eine relativ stabile Gesellschaft mit klaren Verhaltensregeln. Die Gesellschaftskomödien von Evelyn Waugh, die Qian bewunderte, verdanken ihre Kraft den geordneten Konventionen des edwardianischen England. Das China, das Qian kannte, war dagegen von Gewalt und Unordnung geprägt und erschwerte dem Romancier die Arbeit.
Der 1910, ein Jahr vor dem Zusammenbruch der Mandschu-Dynastie, geborene Qian studierte an der angesehenen Tsinghua-Universität in Beijing und anschließend in Oxford. Er war nicht nur ein großer Kenner der klassischen chinesischen, sondern auch der griechischen, lateinischen, englischen, deutschen, französischen, spanischen und italienischen Literatur. Seine Bildung bewahrte ihn in den vielen schwierigen Zeiten seines Lebens vor der Verzweiflung.
Als er 1937 aus Europa mitten in den Krieg nach China zurückkehrte, musste er wie sein Protagonist Fang und tatsächlich wie Millionen von Menschen aus den von Japan angegriffenen oder besetzten Küstengebieten tief ins chinesische Landesinnere flüchten. Er lehrte an einer improvisierten Universität in Kunming, der Hauptstadt der in Südwestchina gelegenen Provinz Yunnan, bevor er 1941 nach Shanghai zurückkehrte, wo damals ein mit den Japanern kollaborierendes Regime herrschte. Dort lehrte er und schrieb bis zum Ende des Kriegs – unter anderem einen großen Teil des Romans Die umzingelte Festung.
Qian misst seine Figuren an einem persönlichen ästhetischen Maßstab, da alle übrigen Normen zusammengebrochen sind. In seiner eleganten und scharfsinnigen Art bezeichnet Jonathan Spence im Vorwort zur Neuausgabe von Fortress Besieged Flauberts Erziehung der Gefühle als möglichen Einfluss. Gewiss findet sich bei Qian unter seiner überschießend komödiantischen Ader etwas von Flauberts melancholischem Verständnis des Lebens als einer Abfolge verpasster Chancen auf Glück.
Er teilt auch Flauberts scharfen Blick für bourgeoisen Betrug und Selbstbetrug wie auch dessen Verachtung für Plattitüden über menschlichen Fortschritt. So bemerkt Fang einmal:
»Die Ungebildeten werden betrogen, weil sie nicht lesen können, und die Gebildeten, weil sie lesen können. Man betrügt sie mit Druckerzeugnissen wie deiner Propagandazeitung oder dem Lehrmaterial, mit dem du dein Beamtenkorps heranbildest.«
In einer halbgebildeten Gesellschaft, die intellektuelle Leistung an akademischen Graden misst, florieren Betrüger und Betrug. Fang entdeckt, dass der Direktor seines Fachbereichs an der Universität ebenfalls einen Doktor der nichtexistenten Universität Clayton besitzt. Der Mann behauptet auch, Aufsätze in der Saturday Review of Literature veröffentlicht zu haben, aber in Wirklichkeit hatte er lediglich im Anzeigenteil der Zeitschrift eine Kleinanzeige geschaltet. (»Junger Chinese, Hochschulbildung, möchte Chinaforschern assistieren, geringes Honorar.«)
Niemand war indessen sicherer im Umgang mit Floskeln als der Rektor der Universität, der »das gesamte Wissen der drei Fakultäten und zehn Fachrichtungen ›durchforscht‹« hatte, »wobei das ›durch‹ sich auf die ›Durchfahrt‹ eines Schnellzuges bzw. auf ›Durchfall‹ bezog, d.h. einige Floskeln fanden den direkten ›Durchgang‹ von seinem Ohr zu seinem Mund, ohne den lästigen Aufenthalt im Gehirn«. Bei einer Feier der »Literatur-Gesellschaft« rief er seine Zuhörer dazu auf, sie sollten
werden wie »Indiens Tagore, Englands Shakespeare, Frankreichs … äh … Frankreichs Russell (er sprach es wie Rüssel aus und meinte Rousseau), Deutschlands Goethe, Amerikas … die Zahl der amerikanischen Schriftsteller ist Legion.« Ging er am dritten Tag zur Begrüßung neuer Mitglieder in den Physikclub, beschränkte er sich mangels einer Atombombe darauf, das Wort »Relativitätstheorie« mehrfach in den Saal zu donnern, so daß Einstein am anderen Ende des Ozeans bestimmt die Ohren klangen und er niesen mußte. Im Gespräch mit dem Militärtrainer dagegen benutzte er das eine oder andere Mal auch das Wort »Scheiße«.
Fang beschließt, eine »Kapazität« zu werden, nachdem er entdeckt hat: »Während man beim Doktorgrad seine Lehrer beschwindelt, beschwindelt man im Unterricht seine Studenten.« Er beteiligt sich an diversen Intrigen in seinem Fachbereich, doch es gelingt ihm nicht, seine Stellung zu sichern. Bevor er die Universität verlässt und nach Shanghai geht, treibt er in eine Verlobung mit einer jener neurotischen modernen Frauen, denen er im Roman immer wieder begegnet. Er liebt sie nicht, aber offenbar bedarf es zur Heirat keiner sonderlich großen Liebe.
Einander nicht zu verachten reichte als Grundlage für eine Ehe. […] In dem dumpfen Zustand, in dem er sich gerade befand, bildeten seine Gefühle keine Belastung für seinen Verstand, und das war ihm recht.
Diese schon mit so geringen Aussichten begonnene Verbindung ist vollends dem Untergang geweiht, als sie in Shanghai der Boshaftigkeit der Verwandten von Fang und seiner Frau ausgesetzt ist. Nun beginnt Fang in der Ehe eine belagerte Festung zu sehen: Die draußen sind, wollen hinein, und die drinnen sind, wollen hinaus.
Qians Erzählung besitzt eine Stendhal’sche Frische, die es ihr ermöglicht, rasch vom Humorvollen zum Intellektuellen und Emotionalen überzugehen. Man erkennt deutlich die Stufen, über die ein schwacher, aber guter Mensch wie Fang seine Überzeugungen verliert und in Unaufrichtigkeit und Falschheit abrutscht. Bemerkenswert für einen komischen, pikaresken Roman enthält Die umzingelte Festung viel Psychologie, vor allem im letzten Teil, den Jonathan Spence zu Recht »eine der besten Beschreibungen des Zerfalls einer Ehe« nennt, »die jemals in irgendeiner Sprache geschrieben worden ist«.
So heißt es dort, als Fang nach einem Streit mit seiner Frau das Haus verlässt:
In seinem Kopf wirbelten die Gedanken wie Schneeflocken im Nordwind. Er ging ohne Ziel, seine Schatten wurden von den unermüdlichen Straßenlaternen weitergereicht. Ein anderes Selbst schien zu sagen: »Es ist alles aus«, worauf seine wirren Gedanken sich plötzlich auf einen Punkt konzentrierten und ihn Traurigkeit überfiel. Auf einmal schmerzte seine linke Backe und fühlte sich feucht und klebrig an – er hielt es für Blut. Obwohl der Schreck ihm weiche Knie verursachte, beruhigte es ihn auch irgendwie. Doch als er unter einer Laterne an seinen Fingern keine Blutspuren feststellte, merkte er, daß er weinte.
Manche Leser könnten jedoch enttäuscht sein von einem langen Roman, dessen Hauptfigur es zu gar nichts bringt. Diesen Lesern sei gesagt, was einst die Shanghaier Schriftstellerin Eileen Chang auf die Kritik Fu Leis, eines wichtigen Literaturkritikers der 1940er Jahre, antwortete, wonach ihre Erzählungen und Romane die nationalistisch und politisch engagierten Ideale der früheren Literatur der Bewegung des 4. Mai vermissen ließen:
Meine Erzählungen und Romane […] sind mit zweideutigen Gestalten bevölkert. Sie sind keine Helden, aber sie gehören der Mehrheit der Menschen an, die tatsächlich die Last der Zeit zu tragen haben. So zweideutig sie auch sein mögen, nehmen sie ihr Leben doch ernst. Es mangelt ihnen an Tragik; sie haben nur Verzweiflung. […] Obwohl sie nur schwache und gewöhnliche, zu Heldentaten unfähige Menschen sind, können doch gerade solche gewöhnlichen Menschen besser als Helden den Maßstab der Zeiten bilden.
Das Schrumpfen der Wahlmöglichkeiten, das Gefühl persönlichen Scheiterns und der Zwang zu Kompromissen, die Qian im Leben seiner Figuren wahrnahm, waren zum Teil auch sein eigenes Schicksal – und das von Millionen Chinesen. Qian entschied sich, im kommunistischen China zu bleiben, und obwohl er Mao in einer Anthologie klassischer chinesischer Dichtung zitierte, die er 1958 herausgab, behaupteten seine Kritiker, er wäre nicht marxistisch genug. Während der Kulturrevolution schickte man ihn und seine Frau zur Landarbeit in eine Kommune. Vom Deng-Regime »rehabilitiert«, erhielt Qian die Erlaubnis zu Auslandsreisen und veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten, aber keinen weiteren Roman mehr. Er starb 1998.
Der Roman Die umzingelte Festung wurde in China 1980 erneut aufgelegt und diente angesichts seiner Beliebtheit 1990 als Grundlage für eine Fernsehserie. Der Grund für seinen fortdauernden Erfolg ist leicht nachzuvollziehen. Die Erinnerung an das vorkommunistische China und vor allem an die halbkoloniale Welt Shanghais wird in Literatur und Film unserer Zeit ausgiebig wachgehalten, so auch in der chinesischen Fernsehfassung des Romans, die das Phantasiebild eines verlorenen Arkadiens zeichnet.
Viele chinesische Leser des Romans finden dessen Figuren und Themen jedoch auch im heutigen China wieder. Während das immer noch in weiten Teilen arme Land unter einem dem Namen nach kommunistischen Regime voranstürmt in Richtung eines Kapitalismus und einer Konsumorientierung westlicher Prägung, zwingt es seiner Bevölkerung nicht nur viele psychische Konflikte und Spannungen auf, sondern bringt auch eine ungewöhnlich große Zahl an Spießbürgern, Plagiatoren und Profitmachern hervor.
Der Drang gebildeter Chinesen nach Geld und Ruhm mag einem Außenstehenden jämmerlich erscheinen. Doch Qian lehnte es ab, seine Figuren zu verurteilen, und behandelte sie sogar mit Sympathie. Auch Fang erweckt beim Leser den Eindruck ernsthaften moralischen Strebens. Sein Scheitern hat etwas Edles und Bewegendes.
Vielleicht ist er ein frühes Beispiel eines Typs, den wir auch aus anderen Werken der Literatur des 20. Jahrhunderts kennen. Thomas Mann, Italo Svevo, Saul Bellow und andere haben zu beschreiben versucht, wie der moderne westliche Intellektuelle, Produkt einer reichen bürgerlichen Gesellschaft, darum kämpfte, die Lehren seiner umfassenden Bildung auf sein privates Leben anzuwenden. Doch Fangs moralische Verwirrung scheint ihre Ursache weniger in seinen persönlichen Unzulänglichkeiten oder einem Übermaß an Hedonismus und Materialismus zu haben als im amorphen Charakter seiner Gesellschaft. Darin ähnelt er eher den ziellosen Kleinstadtfiguren in den Romanen von R.K. Narayan oder dem gelangweilten Beamten in Upamanyu Chatterjees English, August: An Indian Story (1988) als den Helden der Romane und Erzählungen von Italo Svevo oder Philip Roth.
Seine Dilemmata sind alles andere als privat und gehören zu einer größeren Welt, in der schwierige politische, ökonomische und moralische Fragen erst noch gelöst werden müssen. Chinas chaotische jüngere Geschichte sorgt dafür, dass diese Fragen dem Land auch weiterhin nachgehen. Als ein eigenständiges, aufschlussreiches und unterhaltsames Werk der Literatur findet der Roman Die umzingelte Festung Resonanz aufgrund seines weiten und bedeutsamen Hintergrunds, den das im Übergang befindliche China bildet – ein Übergang, der immer noch nicht abgeschlossen zu sein und noch ungewisser zu werden scheint, während gebildete Chinesen, endlich von der Tradition befreit, mit dem zweideutigen Versprechen der modernen Welt kämpfen.
Die Hungerjahre
Von 1876 bis 1879 starben in Nordchina dreizehn Millionen Menschen während der »Unglaublichen Hungersnot«, wie man sie später nannte. Es war eine von vielen schlimmen Katastrophen, die in diesem Jahrzehnt auf der ganzen Erde durch extreme Wetterbedingungen ausgelöst wurden. Nach Ansicht des in britischem Besitz befindlichen North China Herald, einem einflussreichen Sprachrohr der in Shanghai versammelten westlichen Geschäftsleute und Unternehmer, war die Hungersnot jedoch ein Beweis für die Torheit des Big Government – in diesem Fall der Staatsverwaltung des Qing-Reichs. Eine fatale Gleichgültigkeit der Chinesen gegenüber Wissenschaft, der Eisenbahn und vor allem gegenüber der Laissez-faire-Ökonomie trage die Schuld an der Katastrophe. Die Hungersnot und die zahllosen Toten in China seien indessen nicht »vergebens« gewesen, hieß es im Leitartikel des Herald, wenn sie die chinesische Regierung veranlassten, ihre paternalistischen Eingriffe in die Gesetze des »privaten Unternehmertums« aufzugeben.
Vergessen war die Tatsache, dass während der Hungersnot in Madras 1877 mehr als zwölf Millionen Menschen gestorben waren, obwohl Indien von seinen britischen Herrschern mit Eisenbahnen und einem freien Getreidemarkt ausgestattet worden war, oder dass Irland während der Großen Hungersnot dreißig Jahre zuvor unter der britischen Herzlosigkeit gelitten hatte, die noch von der Ideologie des Laissez-faire verstärkt wurde. Der Herald beklagte die »antiquierte Bildung« der Chinesen und beschrieb die heroische Gestalt, die China aus seiner Not erretten könne: »Der Mann, den China heute wie in seiner Frühzeit braucht, ist ein patriotischer Ingenieur …, unbeirrbar und energisch …, mit gebieterischer Kraft und Entschlossenheit«. Es dauerte nicht lange, da bekam China solch einen in großen Linien denkenden, unbeirrbaren »patriotischen Ingenieur«. Sein Name war Mao Zedong, und seine ahnungslose Schwärmerei für die Zeichen und Symbole des modernen Fortschritts – gigantische Projekte und ökonomische Statistiken – verursachte eine Hungersnot, die selbst die Unglaubliche Hungersnot in den Schatten stellte. Die Große Hungersnot von 1958–1962 soll mehr als dreißig und möglicherweise sogar fünfundvierzig Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Zwei neue Bücher beschreiben auf der Grundlage bislang ungenutzter Quellen die hartnäckigen Täuschungen und Grausamkeiten des Mannes, der unter anderem glaubte, wenn Hunderte Millionen von Chinesen in ihren Hinterhof-Schmelzöfen Stahl erzeugten, könnte China die industrielle Produktion der westlichen Länder übertreffen. Grabstein (2012) von dem chinesischen Journalisten Yang Jisheng ist die erste große chinesische Darstellung der Ursachen und Folgen dieser Hungersnot. Mao: die Biographie (2014), von Alexander V. Pantsov und Steven I. Levine, zeigt aufgrund von Quellen aus russischen Archiven sehr viel deutlicher als bisher, dass diese scheinbar beispiellose Geschichte grausamer Torheit im 20. Jahrhundert, dem Zeitalter ideologischer Auswüchse, nicht ohne Vorläufer war.
Die Sowjetunion gehörte zu den ersten »unterentwickelten« Ländern, in denen nationale Führer mit pseudowissenschaftlichen Visionen sozialer und wirtschaftlicher Ingenieurskunst unermessliches Leid über ihre Gesellschaften brachten. In den frühen 1920er Jahren gingen die Bolschewiken als stärkste Kraft aus einem verheerenden Bürgerkrieg und einer Invasion westlicher Mächte hervor und drängten entschlossen auf eine Industrialisierung ihres Landes als ersten Schritt auf dem Weg zum Kommunismus. Mangels ausländischer Investitionen kam es darauf an, für die Industrialisierung ausreichend Kapital aus landwirtschaftlichen Überschüssen zu gewinnen, und anfangs experimentierten die Bolschewiken, teilweise erfolgreich, mit einem freien Markt im Bereich der Landwirtschaft und mit Privateigentum. Doch 1929 beschloss Stalin, den erhofften Aufstieg der Sowjetunion zu einer Industriemacht durch eine Zwangskollektivierung der Landwirtschaft zu beschleunigen. Bauern, die Widerstand leisteten – zum Beispiel indem sie ihr Vieh schlachteten oder sich weigerten, die Felder zu bestellen –, wurden rücksichtslos vernichtet. Der Zoll an menschlichem Leid war gewaltig – Millionen von Bauern, davon viele in der Ukraine, wurden ermordet oder verhungerten. Mitte der 1930er Jahre hatte der Stalinismus gesiegt. Die kollektivierte Landwirtschaft war nun fester Bestandteil des sowjetischen Lebens, und die Sowjetunion wurde zu einem industrialisierten Land. Ihre scheinbar unbegrenzten Fähigkeiten, die militärische Hardware zu produzieren, die erforderlich war, um ihren fürchterlichen Krieg gegen Nazideutschland zu führen – und zu gewinnen –, waren ein Beweis für ihren Erfolg.
In China beobachteten in den 1920er und 1930er Jahren nur wenige Stalins brutale, aber wirkungsvolle Ingenieurleistungen so intensiv wie Mao Zedong, damals ein ruheloser junger Mann, der sich gerade zum Kommunismus bekehrt hatte. Wie viele Chinesen, die ihren Weg durch die Ruinen des Qing-Reichs suchten, war Mao der Überzeugung, dass China wie zuvor die Sowjetunion zu einem mächtigen Nationalstaat werden müsse, um die Anfeindungen des imperialistisch-kapitalistischen Westens zu überleben. Bei diesem Projekt war die Sowjetunion für China ganz unverzichtbar – zunächst als brüderlicher Vorreiter und dann als ideologisches Gegenstück. Pantsovs und Levines Quellensuche in sowjetischen Archiven ergab, dass die Kommunistische Partei Chinas seit ihrer Gründung 1921 dringend auf die Bereitstellung von Geld, Expertise und ideologischer Führung durch die Sowjetunion angewiesen war. Sie zeigte auch in überwältigender Detailfülle, dass Maos katastrophales »Konzept eines besonderen chinesischen Entwicklungswegs«, wie Pantsov und Levine schreiben, nur im »nachstalinistischen Klima entstehen« konnte.