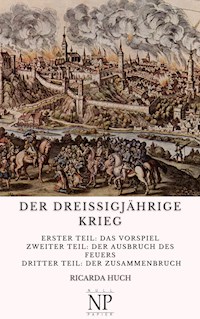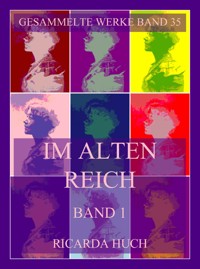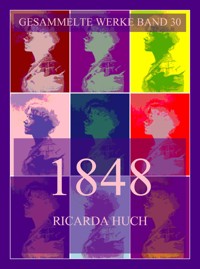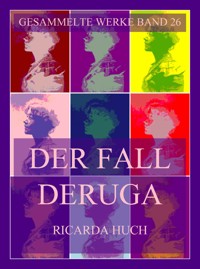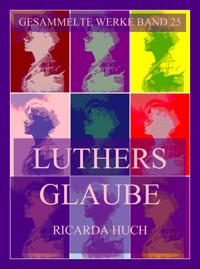2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ricarda Huch Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Ricarda Huchs " Triumphgasse" ist ein unsauberes italienisches Gässchen voller Schmutz und Gestank, nicht nur in seinen Rinnsteinen, sondern auch in seinen Menschen. Es häufen sich Verbrechen aller Art. Was nur immer Armut und Verwahrlosung in wildem Verein zustande bringen können, hier geschieht es. Zola kann nicht mehr Schreckliches auf ein paar hundert Seiten erzählen. Und doch liegen Welten zwischen ihm und Ricarda Huch, die sich außer im rein Stofflichen nirgends berühren. Schon dass aus dem Sumpf der Triumphgasse immer wieder Kinder mit reinen Zügen auftauchen, zeigt eine ganz andere Welt- und Menschenbetrachtung. "Das bloße Darstellen von Menschen, von Leidenschaften und Handlungen macht es wahrlich nicht aus, so wenig wie die künstlichen Formen, und wenn ihr den alten Kram auch Millionen Mal durcheinander würfelt und übereinander wälzt," sagt Friedrich Schlegel. Dies trifft auf den romantischen Roman: "Aus der Triumphgasse" zu. Das Symbol eines Ichs, sagt die Verfasserin, ist dieser Roman. Und noch eins ist an ihm durchaus romantisch. "Alles Poetische muss märchenhaft sein", meinte Novalis einmal. Ricarda Huch selbst legt das so aus: "Wenn man sich vornimmt, die Lebensläufe verschiedener, beliebiger Menschen nach Märchenart zu erzählen, indem man sie liebevoll genau betrachtet, die kleinen, seltsamen Zufälligkeiten und Verknüpfungen sich nicht entgehen lässt und alles als bedeutend ansieht, so wird man finden, dass jedes, auch das ärmste Leben, so wunderbar wie irgendein Märchen ist." Nun, so hat die Dichterin die Menschen ihrer Gasse gesehen. Aber zugleich ist auch der Realismus nicht spurlos an ihr vorüber gegangen. Das zeigt einmal die Form ihres Buchs, die im Gegensatz zu der der Romantiker von damals es nicht ein Chaos bleiben lässt, sondern es zu einem Kosmos ordnet und rundet, ihm Geschlossenheit und Einheitlichkeit verleiht. Das zeigt ferner die scharf umrissene Charakteristik der Menschen, namentlich der Mädchen und Frauen, sowie die ganz unsentimentale Art, mit der fast grausam deutlich und grausam oft die Beobachtung gestaltet wird, dass der Mann das Schicksal aller Mädchen und Frauen aus dem Volk ist, dem sie wie die Motten zu flattern, um an ihm zu Grunde zu gehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus der Triumphgasse
RICARDA HUCH
Aus der Triumphgasse, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681638
Der Text folgt der Ausgabe von 1920, erschienen im Diederichs Verlag Düsseldorf, abrufbar unter https://books.google.de/books?id=8KcCAAAAMAAJ.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II.10
III.19
IV.. 28
V.. 34
VI.45
VII.51
VIII.59
IX.69
X.80
XI.88
XII.97
XIII.104
XIV.109
XV.118
XVI.123
XVII.128
XVIII.137
XIX.142
XX.151
I
Im Traum habe ich die Triumphgasse wiedergesehen.in Wirklichkeit so oft begangen habe, ohne wie damals vor dem Hause des heiligen Antonius haltzumachen; erst als ich oben, am Ende der Gasse angelangt war, blieb ich stehen und drehte mich um. Die Laterne am Eckhause brannte, denn es war Nacht; das wohlbekannte schmutzig-rote Flämmchen hinter dem staubigen, auf einer Seite zerbrochenen Glase, das die abschüssige Gasse kaum zur Hälfte beleuchtete. Der Himmel war dunkel und sternenlos, nur am Horizonte zog sich ein grellweißer Streifen hin, unter dem ich den Ausschnitt des Meeres, der von hier aus wahrzunehmen ist, sehen konnte. Jetzt erst fiel es mir auf, dass es totenstill in der Gasse war. Wie spät war es denn? Die Laterne brannte ja noch, und überdies pflegte das Leben erst lange nach Mitternacht im Triumphgässlein einzuschlummern, ja, verworrenen Lärm aus den nächsten Schenken hörte man bis gegen den Morgen. Kein Lachen, kein Singen, kein Zirpen der Mandoline, nicht einmal das Geflüster des Brunnens hörte ich. Einmal war es mir, als schlüge Riccardos Krücke in dem ihr eigenen Takt auf die Steine, und ich wollte rufen: Riccardo, wo bist du? wo warst du so lange? aber ich brachte den Laut nicht aus der Kehle. Während ich mich mühte, zu sprechen, erlosch plötzlich die Laterne neben mir und ein unheimliches Gefühl überlief mich; denn es war kein Nachtwächter, überhaupt niemand an mir vorübergegangen. Als ich suchend die nun ganz verdunkelte Gasse hinunterblickte, bemerkte ich etwas dicht über der Erde sich Bewegendes, schleichend, kriechend, furchterregend, noch eh' ich es genau erkannt hatte. Immer deutlicher traten pantherartige Geschöpfe aus dem Dunkel hervor, mit langsam nach beiden Seiten fegendem Schwanze, und grünlich glühende Punkte, die näher schwebten, wurden gierige, grausame Raubtieraugen. Trotz der Gefahr, in der ich mich befand, und der Angst, die ich fühlte, wunderte ich mich, dass ich die Bestien nicht brüllen hörte: denn sie öffneten den Rachen weit, so dass ich die spitzen Zähne darin erkennen konnte. Da ertönte ein schriller, entsetzlicher Schrei aus den Häusern hervor, die bisher so ausgestorben stumm gestanden hatten. Da hinein mussten die Untiere, die ich nun auch nirgends mehr sah, geschlichen sein und die Bewohner in ihren Betten angefallen haben. Die Fenster und Türen waren alle geschlossen, aber wie ich angestrengt hinblickte, schien es mir, als ob aus den Ritzen des Gemäuers Blut hervorrieselte. Ja, es war kein Zweifel, in dicken, dunklen Tropfen quoll es zwischen den Steinen hervor, immer schneller und stärker, und floss die Mauern hinunter auf das Pflaster. In diesem Augenblicke ertönte noch einmal ein gellender Schrei, der mich zugleich weckte: es war in Wirklichkeit Geschrei auf der Straße, wenn auch nicht so laut und fürchterlich, wie es mir im Traum geklungen hatte.
Ich war schon zehn Jahre Eigentümer des Hauses zum heiligen Antonius, als ich es zum ersten Mal sah; mein Vater hatte es gekauft, und nach seinem Tode war es in meinen Besitz übergegangen, wurde aber nach wie vor von demselben Manne verwaltet, so dass ich nicht nötig fand, mich darum zu bekümmern. Nach der Überlieferung war dieses Haus im frühen Mittelalter von Hugo von Belwatsch, dem ersten unserer Vorfahren, der sich in dieser Gegend niederließ, erbaut worden, weshalb mein Vater, der Familienerinnerungen gern pflegte und auch mich, seinen einzigen Sohn, nach diesem Ahnen benannt hatte, das seitdem ziemlich wertlos gewordene Haus erwarb und einen Teil seines Vermögens unvorteilhaft darin anlegte. Dass ich dies gedenkreiche Haus niemals in Augenschein genommen hatte, ist erstens daraus zu erklären, dass ich mich zu der erwähnten Neigung meines Vaters gleichgültig verhielt, ferner wird die Römerstadt, als der älteste, engste und verfallenste Stadtteil, nur vom niedrigen Volke bewohnt und von den Wohlhabenden gemieden, die sich nicht gern dem Anblick des Elends und dem Almosensturm zerlumpter Kinder aussetzen, übrigens auch da nichts zu suchen haben. Zwar gibt es auf diesem von vielen Völkern und Geschlechtern heimgesuchten Boden zahlreiche Altertümer aus heidnischer und christlicher Zeit, für die ich in der Fremde wohl Sinn hatte, die ich aber, wie es zu gehen pflegt, zu Hause nicht achtete. Da ich außerdem viel auf Reisen war und sonst in dem regelmäßigen Trott dahinlebte, der mich immer dieselben Wege von meiner Wohnung in das Kontor oder Kaffeehaus führte, blieb mir die Altstadt fremder als Mekka und Jerusalem, von denen ich doch durch Bilder eine ziemlich deutliche Vorstellung hatte.
Da meldete mir an einem Frühlingstag der Verwalter meines Hauses, es sei ihm unmöglich gewesen, den Zins, der allwöchentlich bezahlt wurde, einzutreiben; die Mietsleute, die sonst nicht unpünktlich gewesen wären, verweigerten jetzt die Zahlung einmütig, dass es einer Revolution gliche; ich müsste durchaus selbst hingehen und ihnen mit unbeugsamem Ernst androhen, dass ich sie bei dauernder Widerspenstigkeit samt und sonders auf die Straße werfen würde. Dieser widerwärtigen Aufgabe mich zu unterziehen, hatte ich keine Lust, und gab dem Verwalter anheim, lieber den Leuten einen Monat Frist zu lassen oder ihnen in Gottes Namen einen Teil der schuldigen Summe zu erlassen. Das wies er aber entrüstet von der Hand. Er hatte den Namen eines gutmütigen Mannes und war es auch, von grenzenloser Ergebenheit gegen solche, die über ihm standen, ohne kriechend oder berechnend zu sein, von Kopf bis zu Füßen rechtlich. Gegen die Armen konnte er grob und hart sein, weniger aus Neigung und Anlage, als weil er es für seine Pflicht und die richtige Art hielt, mit ihnen umzugehen. Selbst aus dem Volke hervorgegangen, beobachtete er es nicht viel, noch dachte er selbständig, sondern ging davon aus, dass mit den armen und elenden Leuten irgendetwas nicht richtig sein, irgendein Verschulden vorhanden sein müsse und jedenfalls kein Grund vorliege, sie zu bemitleiden oder gar etwas Erhebliches für sie zu tun. Bei jeder Gelegenheit stellte er sich auf die Seite der Besitzenden und brachte auch jetzt eine Menge Beispiele bei von der Faulheit, Falschheit und Niedertracht dieser Leute, die meine Güte nur benutzen würden, um mich zu hintergehen und auszubeuten. Da sei namentlich die alte Farfalla, die Rädelsführerin in allen Dingen, so keck und ausgepicht, dass sie es scheinbar ganz unschuldig, mit ein wenig Witz und Gelächter, über den lieben Gott sowohl wie über den Teufel, davontragen würde. Kurz, wenn ich ihn loswerden wollte, blieb mir nichts übrig als zu versprechen, dass ich hingehen und die Sache selbst untersuchen wollte. Seine Begleitung, die er mir antrug, da er mir offenbar das bluttriefende Tyrannenwesen, das seiner Meinung nach erforderlich war, nicht recht zutraute, schlug ich aus; denn ich wollte nicht wie Kaiser Wenzel oder Johann von Leyden auftreten mit dem Henker Knipperdolling zu meiner Rechten.
Am Nachmittag des folgenden Tages machte ich mich auf und stieg die Anhöhe zur Römerstadt hinan, anfänglich übler Laune in Anbetracht des unliebsamen Geschäftes, das ich vorhatte, aber bald fühlte ich mich, mir selber zum Trotz, auf wunderbare Weise erheitert, so angenehm wurden alle meine Sinne gereizt. Während unten über der Stadt ein qualmiger Druck brütete, unter dem die Seele sich krümmte, war hier, je höher man kam, ein wenig säuselnde Bewegung in der reineren Luft, und der süße Geruch der Ölweiden, die hier und da in Gärten blühten, kam und ging, als atmete sie ihn aus und ein. Als nun plötzlich der Anblick des Meeres sich auftat, das, wie es an Gewittertagen zu sein pflegt, schwärzlich-grün und steif wie ein schlafendes Riesentier dalag, dem nur zuweilen im Traume die Haut schaudert, war es mir, als tauchte das ewige Jenseits siegreich über unserer armen Welt aus bemalter Pappe empor, und ich blieb unwillkürlich stehen, um tief zu atmen. An dieser Stelle hatte vielleicht vor Jahrhunderten der erobernde Römer den Speer in den wildbewachsenen Boden gerannt und blitzenden Auges Umschau gehalten über Berge und Täler; wahrsagende Adler waren aufgerauscht und unvergängliche Mauern waren aufgetürmt worden, auf die heute noch der Betteljunge mit rotem Ziegel seine Fratzen malt. Da ich gerade an der neuen Kastellmauer entlang schritt, von der einzelne Teile aus der Römerzeit herrühren sollen, erblickte ich wirklich mit wenigen Strichen nach Kinderart gezeichnet ein rundes Jungengesicht mit ausgestreckter Zunge und folgendes Verslein darunter geschrieben:
Drei Dinge sind wahr:
Ich heiße Berengar,
Ich geh ins zehnte Jahr,
Und wer dies liest, der ist ein Narr.
Ich musste darüber lachen, gerade weil durchaus nichts Besonderes oder gar Geistreiches daran war, sondern Bild und Spruch nur eben das Straßenbubengenie ausdrückten, wie es immer war und wohl immer sein wird. Unbemerkt war ich in eine enge, von hohen Mauern eingeschlossene Straße gelangt, wo sich ein ärmliches Leichenbegängnis langsam den sanft ansteigenden Weg hinan bewegte. Jetzt erst kam mir zum Bewusstsein, dass schon seit einiger Zeit das Geläute der Heidenkirche in Bewegung war, wohin die Leiche augenscheinlich geführt wurde. Der Sarg war mit den geschmacklosen Zeug- und Wachskränzen bedeckt, wie das Volk sie liebt, und aus den Leidtragenden, die dürftig, zum Teil sogar lumpig gekleidet waren, konnte man schließen, dass der Verstorbene zu den Allerärmsten gehört hatte. Voran ging dem Zuge der Pfarrer der Römerstadt, ein noch junger Mann von so auffallendem Äußeren, dass ich die Augen nicht von ihm abwenden konnte; während die Mehrzahl der Geistlichen in den kleinen Kirchspielen durch eine gewisse Rohheit der Körperbildung und Stumpfheit der Bewegungen ihre bäuerliche Herkunft verraten, zeigte das schöne, feine Antlitz dieses Menschen, sein schlanker, erhabener Gang, selbst der Wurf seines schwarzen Gewandes natürlichen Adel und gebildeten Sinn, und seine ganze Erscheinung umgab ein unerklärliches Etwas von Auserlesenheit, Absonderung vom Gewöhnlichen oder wie ich es nennen soll, was vielleicht in alten Zeiten das phantasievolle Volk als Heiligenschein zu sehen sich eingebildet haben mag. Die kerzentragenden Chorknaben und die kümmerlichen Menschen, die folgten, sahen aus wie ein Ehrengeleit, das in bescheidener Verehrung mit ihm trauerte. Ich begleitete den Trauerzug bis zum Dom, den ich, ich muss es gestehen, noch niemals einer eingehenden Betrachtung unterzogen hatte. Dies uralte, etwas ungefüge, aber ausdrucksvolle Münster wurde allgemein die Heidenkirche genannt, weil es über einem römischen Venustempel erbaut worden war; einzelne Trümmer desselben waren wahllos in die Mauern der Christenkirche eingefügt, was ihr ein merkwürdiges, malerisches Ansehen gab. Insbesondere zog eine korinthische Marmorsäule meinen Blick immer wieder auf sich, die, wie eine Gefangene in den gewaltigen viereckigen Turm eingeschlossen, mit reizender Wehmut aus den grauen Steinen hervorsah. Während nun der Sarg vom Wagen gehoben wurde, blickte ich in das tiefe, niedrige Innere der Basilika und unterschied in der schwachen Beleuchtung das schwarz verhängte Gerüst, worauf der Sarg während der Feierlichkeit stehen sollte. In dem Augenblick, als er, von einigen Männern getragen, über der Schwelle schwebte, verstummte das Geläute und anstatt dessen erhob sich mit dumpfem Zittern die Stimme der Orgel.
Ich blieb an der offenen Türe stehen, um den hübschen Pfarrer sprechen zu hören. Aus seinen Worten ergab sich, dass der Verstorbene ein armer braver Handwerker war, den irgendein anderer niedergestochen hatte, und er sprach von dem Ermordeten, der nicht zu beklagen, weil er von Gott in einen höheren Stand hinübergenommen sei, von der Witwe, die mit einem Kinde zurückbleibe und ein zweites eben jetzt erwarte, schließlich von dem Mörder, der von allen der Unglückseligste sei, weil er seine Seele mit Blut befleckt habe, so dass er hienieden schon in einer Verdammnis lebe, aus der nur Gottes Allmacht und die Fürbitte der Menschen ihn retten könnten. Alles war weitaus gemeinplätziger, als ich mir von einem so fein und eigenartig aussehenden Manne versprochen hatte; doch sein Äußeres gewann im Sprechen noch, indem er seine Worte mit einem wehmütigen Lächeln begleitete, das er ihnen wie eine Liebkosung mitgab, um sie in die Herzen der Hörer einzuschmeicheln.
Oberhalb des Domplatzes beginnt die eigentliche Altstadt, ein hässliches Labyrinth enger und schwarzer Gassen, die einen anmuten wie eine Höhle oder ein unterirdischer Keller, den man von fröhlichen Sonnenhügeln her betritt. Als ich, auf einem kleinen Platze angelangt, mich nach den Namen der Straßen umsah, die hier einmünden, entdeckte ich zwischen ein paar kleine bucklige Häuser eingeklemmt die geraden strengen Linien eines römischen Siegestores; es machte den Eindruck, als klammerten sich die Häuser daran und hätten es schon ein gutes Stück in den Erdboden hinuntergezogen. Der Triumphbogen war im ganzen wohlerhalten, nur wenig angeschwärzt und verbröckelt sahen die dicken, pomphaften Fruchtgehänge aus, die sich am Fries hinzogen; ein feinblätteriges Schlinggewächs, das oben aus den Ritzen hervorwuchs und jetzt im ersten lachenden Frühlingsgrün prangte, fiel üppig und zierlich zugleich über die steinernen Symbole herab. Um den einen Pfeiler herum, der stark aus der Mauer des Hauses heraustrat, während der andere ganz in das gegenüberliegende hineingepresst schien, spielten ein paar winzige Kinder mit wackelndem Gange Haschen oder Verstecken. Durch dieses Tor hindurch kroch das Triumphgässlein mühselig bergan.
Weiter oben, etwa in der Mitte der Straße, fand ich mein Haus, schmal und hoch, dunkel von Schmutz und Alter, dem immerhin die Dicke der Mauern und die steinerne, mit zwei mächtigen Steinbällen verzierte Treppe, die zur Haustür führte, als Wahrzeichen vornehmen Ursprungs diente. Nachdem ich vergeblich an mehrere Türen geklopft hatte, fand ich im dritten Stock eine geöffnet, durch die mich eine schwache, sehr wohlklingende Stimme anrief, wer ich sei und was ich wolle. Ich betrat die Wohnung der Farfalla, auf die mich der Verwalter als auf eine gefährliche Person aufmerksam gemacht hatte, fand sie selbst aber nicht zu Hause; die Stimme, die ich gehört hatte, kam von ihrem jüngsten Sohn Riccardo. Er lag halb angekleidet auf einer breiten Bettstatt und deutete zur Entschuldigung, dass er mir nicht entgegenging, auf eine Krücke, die am Kopfende des Bettes lehnte. "Manchmal gehe ich so leicht, dass man mir die Krücke kaum anmerkt, aber heute habe ich keinen guten Tag", sagte er, indem er mir das blasse, magere Gesicht zuwendete, aus dem mich ein paar dunkle, außerordentlich lebensvolle Augen ansahen. Diese strahlenden Augen in dem abgezehrten Gesicht hatten etwas von Edelsteinen, die man in die Augenhöhlen einer Mumie eingesetzt hat: sie schienen nicht mitgelitten zu haben, unsterblich in dem gebrechlichen, knöchernen Gehäuse zu schweben und ihres unantastbaren Daseins ruhig und zuversichtlich zu genießen; in ihrem Blick lag eine reine Sicherheit, als entginge ihnen nichts und als irrten sie niemals. Auch mich musste Riccardo schnell überschaut und einigermaßen eingeteilt haben, wenigstens war er, als ich meinen Namen nannte, nicht überrascht, sondern, als hätte er mich erwartet und kenne mich schon lange, sagte er freundlich, es wäre gut, dass ich einmal anstatt des Verwalters käme, ich würde mich bald überzeugen, dass ich durch ein wenig Gelindigkeit eher gewinnen als verlieren würde. Was denn im Werk sei, fragte ich, dass meine bisher so pünktlichen Mieter auf einmal nicht zahlen wollten? Seine Mutter nebst vielen anderen Bewohnern des Hauses und der Straße, antwortete er, hätten beschlossen, eine Wallfahrt auf den heiligen Berg zu unternehmen, was mit beträchtlichen Kosten verbunden sei. Da nämlich auf einem nicht allzu weit entlegenen Berge die gnadenreiche Mutter Gottes verehrt wird, der Mai aber der Marienmonat ist, in welchem die Himmlische sich tiefer als sonst zur Erde neigt, um das Flehen der Menschenkinder zu vernehmen, ist es altes Herkommen, sich ihr in diesem Monat zu verloben und etwa mit dem täglichen Absingen eines Gesanges in der Kirche oder mit einer Wallfahrt sich die Gewährung eines bestimmten Wunsches als billige Gegenleistung zu verdienen. Das Haus stehe leer, erzählte mir Riccardo, weil alle zum Begräbnis des Benvenuto gegangen wären, eines jungen Arbeiters, den alle wegen seiner Herzensgüte, Aufrichtigkeit und Pflichttreue liebgehabt und geachtet hätten, und der von einem betrunkenen Taugenichts mit dem Messer niedergestochen sei. Mich fesselte dabei am meisten Riccardo selbst und seine Art, zu erzählen: Gesicht und Hände wirkten dabei so lebhaft mit, dass ich meinte, man müsse ihn aus Mienen und Gebärden allein verstehen können. Ich glaubte, den armen Benvenuto mit den Augen, die immer lächelten, und dem großen Munde, der nicht nein sagen konnte, vor mir zu sehen; den Mörder aber mit seinem Adlergesicht, schielend, verwildert, entsetzlich, und die Szene des Mordes so deutlich, dass ich verwundert fragte, ob er denn dabei gewesen sei. Er sah mich ebenso erstaunt an wie ich ihn, und erst nach einer Pause erklärte er mir, es sei überhaupt niemand dabei gewesen, und man wisse gar nicht, wer der Mörder sei; es sei spät in der Nacht geschehen, und man hätte nur streitende Stimmen gehört und eine männliche Gestalt entfliehen sehen, aber nicht erkannt. Dann schwieg er und fügte nach einer Weile wie erläuternd hinzu: "Wenn ich nachts nicht schlafen kann, kommen die Bilder von allem, was ich am Tage gesehen oder auch nur gedacht habe, so deutlich vor meine Augen, wie man im Traume sieht, nur dass ich wach bin; deshalb ist es mir manchmal, als hätte ich etwas wirklich gesehen, was ich mir nur vorgestellt habe." Und wie er währenddessen seine Augen still auf mir ruhen ließ, hatte ich das unheimliche Gefühl, als löste er eine unsichtbare Hülle von mir ab, um sie vielleicht auch in Gottweißwas für unerhörten, verhängnisvollen Szenen an sich vorüberziehen zu lassen.
Bald darauf wurden Stimmen im Hause laut, und die Farfalla trat ins Zimmer, einen großen Totenkranz aus Zypressen und Rosen in der Hand, den sie Riccardo aufs Bett legte. Sie sagte: "Den hat Anetta mir für dich gegeben, weil er dir Freude machen würde, dem armen Benvenuto aber nicht mehr." Wirklich schien das Geschenk Riccardo nicht grauenhaft, sondern sehr willkommen zu sein, denn er brach in einen Ruf des Entzückens aus und beschäftigte sich mit den Blumen, als ob es lebendige kleine Kinder wären, während seine Mutter mich begrüßte. Ich sah in ihr zunächst nichts anderes als ein altes, hässliches, in etwas verlotterter Kleidung einhergehendes Weib mit starker Nase und klugem, aber nicht eben warmem Gesichtsausdruck, an der mir nur der helle Blick gefiel, mit dem sie mich ansah, und die unbefangene Art, in der sie mit mir verkehrte. Sie bedauerte, dass ich habe warten müssen, meinte aber, Riccardo würde mir die Zeit schon gut vertrieben haben; denn sein Geist und seine Zunge liefen fünfmal um die Erde, während er mit seinen Beinen einmal durchs Zimmer hinkte. Ich ging sogleich auf die Hauptsache los und sagte, dass ich geneigt wäre, wegen des Zinses einen beliebigen Aufschub zu gewähren, knüpfte aber, denn die Worte des Verwalters hatten doch in mir nachgewirkt, die Ermahnung daran, sie möchten deshalb nicht auf meine Gutmütigkeit oder gar Torheit pochen, sondern sich hernach der alten Ordnung befleißigen, da es sonst mit meiner Nachsicht bald ein Ende haben würde. Die Farfalla dankte mir im Namen aller herzlich, aber durchaus ohne Überschwang; übrigens, sagte sie, wüssten alle, dass das Zinszahlen ein Verhängnis sei, dem man nicht entrinnen könne, und noch ehe das tägliche Essen gekauft sei, pflegten sie die betreffenden Kreuzer für die Miete zurückzulegen. Ich fragte, warum denn die Wallfahrt so kostspielig sei, worauf sie mir verschiedenes aufzählte, als Hauptsache aber das Almosen, das jeder der Kapelle hinterlassen müsse; "denn", sagte sie", in der Kirche ist alles Geschäft und ein einträgliches dazu."
"Warum geht ihr denn", fragte ich", wenn ihr diese Meinung von der Kirche habt?"
"Ja", sagte sie", einen Sinn hat es im Grunde nicht. Aber wenn man im Elend ist, streckt man die Arme aus und fleht aufs Geratewohl in den Himmel hinein, wie auch Ertrinkende um Hilfe schreien und die Arme ausstrecken, selbst wenn weit und breit niemand zu sehen ist, der retten könnte." Weniger die Feinheit dieser Bemerkung war es, die mich stutzig machte, als die Art und Weise, wie die Farfalla sie hinwarf, und das Lächeln, mit dem sie sie begleitete. Es klang nicht, als wäre sie diese Elende, die verzweifelt nach Hilfe jammerte, sondern als hätte sie die Beobachtung an anderen gemacht, ohne mehr als einen kühlen, menschlichen Anteil daran zu nehmen. Ich betrachtete mit etwas mehr Aufmerksamkeit als vorher diese Augen, die so frei, so überlegen auf der eigenen Not ruhten: sie waren denen ihres Sohnes sehr ähnlich, obwohl sie heller und kälter waren und nicht die eindringende, ich möchte sagen, krankhaft seherische Kraft des Blickes besaßen. Sie sprach gewandt und augenscheinlich gern, wenn auch ohne Aufdringlichkeit, und so kurzweilig, dass ich mich von Minute zu Minute, fast gegen meinen Willen, dadurch aufhalten ließ.
Ich wünschte etwas über den jungen Pfarrer zu erfahren, der mir durch seine Schönheit aufgefallen war, und sie erzählte mir, dass er als Findling von armen Leuten auferzogen und wahrscheinlich das Kind von sehr vornehmen und hochstehenden Leuten sei. "Dass er hübsch ist", sagte sie", finden die Weiber in der Römerstadt auch; nicht eine, alt oder jung, die nicht in ihn verliebt wäre, sogar die Männer gingen für ihn durchs Feuer." Auf meine Frage, ob er diese Zärtlichkeit der Frauen erwidere, sagte sie gleichmütig, das könne man nicht wissen, jedenfalls habe er für jede ein Scherzwort und ein Lächeln bereit. Sogar die Gradella, ein altes, widerliches und hassenswürdiges Weib, grüßte er mit einem Blick, der nach der Meinung der Mädchen süßer sei als ein Kuss von anderen Männern. Die Gradella lieh Geld auf Wucherzinsen aus, hielt damit viele Bewohner der Altstadt in der Hand und hatte manch einen ins Verderben gebracht, war aber nicht nur mitleidslos, sondern sogar voll Schadenfreude, und pflegte zu sagen, es gehe jedem, nach dem er's verdiene; sie selbst sei arm, führe aber einen frommen Wandel, und deshalb schlüge ihr ein Krümlein Brot besser an als einem gottlosen Geldsack sein Spanferkel und seine Mastgans. Sie selbst war steinreich, staffierte sich aber, um nicht angebettelt zu werden, ärmlich aus und erzählte gern, wie wunderbar Gott sie mit einem Nichts speise und erhalte. Eine Mittagspause ausgenommen, saß sie vom Morgen bis zum Abend mit einem Strickstrumpf in der Kirche, nicht nur aus Frömmigkeit, sondern auch aus schwärmerischer Liebe für den Pfarrer Jurewitsch, was sie weder ihm noch anderen verhehlte. Einige Leute waren der Ansicht, er wisse, dass sie ihm ihre Truhen voll Geld vermachen wolle, und dass das die Ursache seines lieblichen Betragens gegen die ausgepichte Sünderin sei. Die Farfalla verteidigte ihn in diesem Punkte, denn habgierig sei er nicht, er könne nur, wie alle Männer, ein Weib nicht böse ansehen, das ihm schmeichele.
"Mir schien es vielmehr", sagte ich", als ob seine Gedanken überhaupt nicht bei irdischen Dingen verweilten, entweder weil er melancholisch von Natur ist oder weil ein unheilbarer Kummer ihn beschäftigt." Das wäre richtig, sagte die Farfalla, und eben diese Traurigkeit mache die Weiber vollends toll. Als den Grund seines Kummers, der allgemein bekannt sei, erzählte sie mir folgendes: Als der Jurewitsch zum ersten Mal in der Heidenkirche predigte, hielt er am Schlusse des allgemeinen Gebetes einen Augenblick inne und sagte dann leise, aber vernehmlich die merkwürdigen Worte: "Freunde, betet mir zuliebe für zwei Seelen, an die ich denke." Er war dabei so schön, wie er erst die Augen niederschlug, sie dann wieder öffnete und mit bittendem Ausdruck, schüchtern und doch würdevoll, auf die Gemeinde richtete, dass von da an ihm alle Herzen ergeben waren. Anfänglich glaubte man, er hätte bei jener Aufforderung, die er an jedem Sonntag ebenso wiederholte, an seine unbekannten Eltern oder an seine verstorbenen Pflegeeltern gedacht; allmählich aber wurde es klar, dass es sich um Lebende handelte, nämlich um seine missratenen Pflegeschwestern, Galanta und Torquato, die er wegen ihrer Verdorbenheit mehr als Tote betrauerte. Ihr Vater war ein Trunkenbold gewesen, Galanta war eine Dirne und Torquato alles Nichtswürdige, was man sein kann. "Der Jurewitsch ist", sagte die Farfalla", wie eine Lilie mitten aus einem Kehrichthaufen herausgeblüht, während seine Geschwister einheimische Mistgewächse sind und bleiben müssen. Es ist zwar vielen zur Gewohnheit geworden, ein Gebet für die beiden Seelen des Pfarrers Jurewitsch zu murmeln; aber was kann das helfen, da sie einmal als stinkendes Unkraut gewachsen sind und sich nur im Unrat wohl fühlen. Überhaupt ist Beten bei weitem nicht so wirksam wie Fluchen. Kein Fluch fällt zur Erde, und wer von vielen verflucht wird, den schlägt Gott nieder, und wäre er Kaiser oder Papst, dagegen die Fürbitte hört er nicht, vielleicht weil sie gemeinhin leiser ausgesprochen wird als ein Fluch."
Ich hatte mit Anteil zugehört, aber doch meinen Widerwillen gegen die dumpfe Armseligkeit der Umgebung nicht überwinden können. Ich dachte, was für ein Mann war Hugo von Belwatsch, mein Ahn, dass er in solcher Höhle hausen mochte, und atmete hoch auf in stolzer Zufriedenheit, dass ich ich war und heute lebte. Die Farfalla und ihr Sohn dauerten mich zwar, aber zugleich war ich ungeduldig, sie abzuschütteln und aus diesen Winkeln herauszukommen. Ein hoher, teppichschwerer Raum, von einer verhüllten Ampel nur so viel erhellt, dass man die warme Dunkelheit darin sehen konnte, stellte sich mir vor, wo an diesem Abend noch eine blonde Frau mit vollen Wangen und rosigem Lächeln mich erwartete. Wie einen durchnässten und verschmutzten Anzug, der eine Weile lästig und ekelhaft an einem geklebt hat, wollte ich diese Armut um mich her abstreifen und wegwerfen. Auch war es inzwischen dunkel geworden, und das Unwetter, das sich tagsüber angesammelt hatte, war dicht vor dem Ausbruch. Ich verabschiedete mich kurz und eilte so schnell wie möglich das holprige Gässlein hinunter. Einzelne dicke Regentropfen waren in der Luft, und ganz in der Ferne glaubte ich das halblaute, gurgelnde Heulen des kommenden Sturmes zu hören. Wie, dachte ich, nicht ohne ein vernehmliches Gefühl des Unbehagens, wenn aus diesen schwarzen Torwegen vermummte Gestalten spähten, die mir auflauerten? Konnten diese Kinder des Elends, die Verstoßenen, nicht gewittert haben, dass einer aus der Lichtwelt in ihre Finsternis geraten sei? Und wäre es zu verwundern, wenn sie sich verbündet hätten, um mir das Gold, mit dem sie mich natürlicherweise auswattiert glaubten, abzunehmen und die Lücken ihres schlotterigen Daseins damit zu stopfen? Ich atmete auf, als ich den Heidenturm sah, dessen nackte, plumpe Gestalt sich drohend gegen den Himmel stemmte, der sich wie eine schwarze, zum Bersten schwere Lawine langsam herunterließ. In dem Augenblick, als ich in die enge, ummauerte Gasse einbog, fuhr der Sturm los, als hätte er sich an dieser Ecke verborgen gehalten, um mich zu überfallen. Nun sauste er wie ein furchtbarer Vogel Rock dicht über mir mit gedämpftem Brüllen, zuweilen mit zottiger Klaue meine Haare oder meine Schulter streifend. Erst als ich ganz unten in der Stadt war, blieb das Untier zurück, als dürfe es den geweihten Ring, der mich nun aufnahm, nicht berühren; aber bis an den Morgen hörte man von oben her das unheilvolle Gebrüll und die zornigen Flügelschläge, vor denen die Luft sich stöhnend zwischen den Häusern verkroch.
II.
In dieser Sturmnacht verhalf die Farfalla, der es eigentümlich war, alles zu können, was der Augenblick gerade erforderte, dem vaterlosen Kinde der Anetta ans Licht und stellte mit Genugtuung fest, dass es zwar nicht tot, aber doch dem Tode näher als dem Leben war, was sie für ein außerordentliches Glück sowohl für das Kleine selbst, wie auch für die Mutter ansah. Bei dem bedenklichen Zustande des elenden Wurmes musste es ohne Verzug getauft werden, und am liebsten hätte die Farfalla es selbst über die Taufe gehalten, doch seit sie im Elend war, konnte sie ihren Bekannten diesen kostspieligen Dienst nicht mehr leisten. An Rat fehlte es ihr aber nicht: sobald der Morgen graute, lief sie zum Fleischhauer Toni, der nie nein sagte, wenn es sich darum handelte, Pate zu sein; er hatte etwa zwei Dutzend Patenkinder in der Römerstadt, alle blutarm, weil gerade die ganz verlassenen und notleidenden Eltern zu ihm ihre Zuflucht nahmen. Unter lauten Kundgebungen freudiger Überraschung und die kümmerliche Beschaffenheit des Neugeborenen missbilligend, sagte er denn auchsogleich zu, und da die Sache Eile hatte, trocknete er sich rasch die Hände ab und folgte, ohne nur die blutige Schürze abzubinden, der Farfalla in die Kirche. Dort wurde der kleine Menschenwurm unter häufigem betrübten Kopfschütteln des Toni schleunig getauft, und es fehlte nicht an einem reichlichen Patengeschenk, obgleich sein Ableben jeden Augenblick erwartet wurde. Der Toni war keineswegs reich, wenn es ihm auch etwas besser ging als den meisten Bewohnern der Altstadt; aber er hatte ein Söhnchen, das er sehr liebte und um welches er, als einziges, in beständigem Fürchten und Bangen war. Deshalb hatte er angefangen, sich armer kleiner Kinder werktätig anzunehmen, damit Gott, wie er, der Toni, für Gottes Schützlinge, die Armen, sorgte, hinwiederum sein Kind, den kleinen Berengar, in Schutz nähme. Diese Erklärung gab der Toni den Leuten und namentlich seiner Frau, die nicht immer mit der Freigebigkeit ihres Mannes einverstanden war; aber die Farfalla sagte, die Hauptsache sei vielmehr, dass er die Kinder liebte und ein goldenes Herz hätte. Er war auch der Einzige, der sich aufrichtig freute, als das neue Patenkind sich, allen Prophezeiungen zum Trotz, zum Leben zu entschließen schien; denn die kleine Anetta war zu sehr in ihren Kummer versunken, um Notiz davon zu nehmen. Die Farfalla war ihr tröstend, aber ungerührt zur Seite und meinte, so leidenschaftlich Anetta jetzt auch zu sterben und zu ihrem Manne zu gehen verlangte, würde sie doch in kurzem wieder guter Dinge sein." Sie ist jung und gesund", sagte sie", arbeitet gern und lacht gern, so kann sie ein großes Stück Elend verschlucken, ohne sich den Magen zu verderben."
Anetta, armes, liebes, törichtes Geschöpf! Ohne Charakter, ohne Grundsatz, ohne Größe, ohne Stolz und Einsicht und Treue, was hatte sie, was war sie, dass ich nie an sie denken konnte, ohne dass mein Herz warm und traurig wurde? Sie galt für leichtsinnig und war es auch, wenn man diese kindische Liebe zum Leben so nennen wollte, diese kindische Sucht nach Fröhlichkeit und Freude, die sie immer aus der Geborgenheit in Gefahr und Schmerzen lockte. Man hätte sie hundertmal retten und in einen netten, bequemen Käfig setzen können, sie wäre immer wieder neugierig und sehnsüchtig ins Freie geflogen, ohne daran zu denken, dass sie sich draußen tothungern oder von der Katze gefressen werden würde. In der maßlosen Traurigkeit um ihren Mann, der sie einstweilen hingegeben war, war sie ohne Falsch, dennoch konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, als litte sie unter dem Traurigseinmüssen ebenso sehr wie unter dem Verlust des guten Benvenuto. Sicherlich vermisste sie sein liebes Gesicht und seine Sorgfalt, aber nicht minder die Fröhlichkeit und das Lachen, das früher trotz der Armut bei ihr zu Hause gewesen war. Sie trug die Traurigkeit wie ein Kleid, das ihr nicht passte und die kleine, schmächtige Person noch rührender machte, die ebenso hilflos aussah wie der zweijährige Junge, der sich erschrocken an sie drückte, und das festgewickelte staunende Kind in der Wiege. Ihre äußere Lage war indessen eher besser als früher, denn abgesehen von dem Fleischhauer Toni, der als Gevatter für sie tat, was er konnte, fand sich ihr noch ein unvermuteter Beschützer im Pfarrer Jurewitsch.
Ungeachtet meines gegenteiligen Entschlusses und innerlichen Widerwillens stieg ich schon am folgenden Tage nach meinem ersten Besuche wieder in die Altstadt hinauf, sei es, dass Mitleid für die kleine Anetta oder der Wunsch, den schönen Pfarrer kennenzulernen, die treibende Ursache war. Er erschien mir übrigens in seinem Zimmer, als er von einem Stuhle aufstand und mir entgegenkam, weniger schön, weniger erhaben und auch weniger jung, dagegen kindlicher und liebenswürdiger, so dass ich, was mangelte, nicht eben vermisste. Sein Liebreiz hatte etwas Mädchenhaftes auch insofern, als er wohl davon Bescheid zu wissen schien und sich dessen freute. Aus seinen Augen sprach bescheiden und doch dringlich die Bitte, man möchte ihn hübsch finden und ihm gut sein, was denn wohl auch kaum jemand hätte unterlassen können, wenigstens ich fand nichts Gefallsüchtiges oder gar Geckenhaftes in seiner Eitelkeit, die sich unbefangen zeigte und die sein Lächeln leiser Wehmut selbst töricht hieß. Immerhin konnte ich mir nun vorstellen, dass er auch der garstigen Gradella für ihre Bewunderung dankbar war und nicht umhin konnte, sie mit offener Grundsatzlosigkeit mit süßen Augen anzusehen. Vor allen Dingen war er in Gesicht und Gestalt, Art und Wesen von solcher Feinheit, dass die nackte Dürftigkeit des Zimmers, in dem er sich befand, einen halb lächerlichen, halb abstoßenden Eindruck in seiner Unangemessenheit machte. Was man von seiner vornehmen Geburt sagte, war sicherlich kein Märchen: bis auf die stark ausgeprägten und dabei schlaffen Züge, auf die Geistesenge und den fein verschwiegenen Hochmut glich er dem Abkömmling eines hochgeborenen Geschlechtes, das sich nie durch heißes Blut aus dem Volke erfrischt hat.
Als ich auf die Sache zu sprechen kam, die mich zu ihm führte und ihm ein kleines Sümmchen für die Anetta einhändigte mit der Bitte, es ihr zuzuwenden, wurde er verlegen und es schien fast, als ob er mein Geld am liebsten zurückgewiesen hätte; über den Fall zu sprechen, war ihm augenscheinlich unlieb. Mir gingen allerlei Gedanken durch den Kopf: nützte er doch vielleicht die Verliebtheit der Weiber aus? legte er es etwa gar darauf an? dachte er daran, diese nun ledige Anetta, die für lustig und leichtsinnig galt, für sich zu gewinnen? besaß er sie vielleicht schon? wenn nun etwa das arme neugeborene Kind sein eigenes wäre? Ich betrachtete sein hübsches Gesicht forschend; aber die Feinheit und Bildung seiner Atmosphäre war so mächtig, dass sie einen zwang, alles Verletzende zu umgehen und jeder Verlegenheit im Gespräch schnell vorzubeugen. Diesem Einfluss nachgebend, ging ich auf etwas anderes über und erkundigte mich nach den Lebensverhältnissen seiner armen Gemeinde, musste aber zu meiner Verwunderung bemerken, dass er hier nicht sonderlich Bescheid wusste. Er kam wohl seinen seelsorgerischen Verpflichtungen nach, aber ohne dabei das Wesentliche ins Auge zu fassen, und die Leiden der Armut machten keinen Eindruck auf ihn, entweder weil er selbst dazwischen aufgewachsen war oder weil er sich als den Adligen fühlte, der es für selbstverständlich ansieht, dass die Armen arm sind und entbehren. Allmählich sah ich klar, dass dies letztere der Fall war: im Grunde verachtete er sie alle, die er beständig durch seinen Liebreiz an sich lockte und von denen er sich so willig anbeten ließ. Um Anetta bekümmerte er sich nur, weil er wusste oder ahnte, dass sein Bruder es war, der ihren Mann getötet hatte, verlieben hätte er sich in eine Frau aus dem Volke nicht können. Er hatte keine Liebe zu seiner Gemeinde, überhaupt gar keine Menschenliebe. Aber geliebt zu werden sehnte er sich über alle Maßen, und nicht das kleinste Genügen gab ihm das Anschmachten und die Verehrung und die Anbetung der Männer und Weiber in der Altstadt. Sein vornehmes Wesen, die Ahnung seiner hohen Geburt und schließlich seine Priesterwürde hatte sein Leben lang solche Zuneigung, deren er bedurfte, in dem Kreise, wo er sich bewegte, von ihm ferngehalten: eine rücksichtslos zugreifende, herrisch über seine Person verfügende Liebe, die ihn wie ein warmer Sturm umschlungen und mitgerissen hätte, der hätte er sich hingeben und sich darin verlieren mögen. Dies äußerte er nie, noch deutete er es an, aber ich fühlte bald heraus, dass es der eigentlichste tiefste Schmerz seines Lebens war, und es rührte mich, wie schon mein warmes, aber von jeder Scheu und Ehrerbietung freies, handfestes, freundschaftliches Entgegenkommen und die Art, wie ich mich seines Vertrauens bemächtigt, ihm wohltat, und wie gern er sich bei mir gehen ließ.
Einmal gegen Abend traf ich ihn auf einem Platz, wo Musik spielte und die elegante Gesellschaft vor den Kaffeehäusern saß und plauderte. Ich fragte ihn, ob er die Musik liebe, aber er verneinte es und schien sie nicht einmal bemerkt zu haben. Er grübelte über einer theologischen Frage, die er schriftstellerisch bearbeiten wollte und die mir nach seiner Erklärung uninteressant und unwichtig vorkam. Wir waren kaum einige Minuten nebeneinander hergegangen, als uns an der Seite eines Soldaten ein Mädchen entgegenkam, die schon von weitem meine Blicke fesselte, nicht nur durch ihre zigeunerhaft auffallende Kleidung, sondern weil ich eine solche Erscheinung noch niemals gesehen hatte. Als ich ihrer ansichtig wurde, lachte sie, wodurch ihr Gesicht kinderhafter erschien, als sie war; ein schlankes, schmales, strahlendes Kindergesicht, in dessen Lachen man einstimmen, das man hätte küssen mögen aus Freude an seinem Glück und seiner Unschuld. Das Wunderbarste daran war aber die goldbraune Farbe von einer Wärme und einem Schmelz, wie ich keine ähnliche in der Natur je gesehen habe. Gewachsen war sie schlank und gerade wie ein Schilf und ebenso biegsam; es sah aus, als ob der Wind sie uns entgegenwehe. Dazu war in ihrer Haltung ein leidenschaftlicher Stolz wie von einer Person, die sich nie unter einer Regel der Gesellschaft gebeugt und immer in wilder, aber nicht unedler Freiheit gelebt hat. Ich wollte eben eine Bemerkung über das wundervolle Mädchen machen, als ich sah, dass sie den Pfarrer an meiner Seite erblickt hatte und dass sich der Ausdruck ihres Gesichtes gleichzeitig in überraschender Weise verwandelte. Mit dem Blick überlegenen, kränkenden Hohnes, den sie absichtlich starr auf ihn heftete, sah sie viel weniger reizend und kindlich aus, ja es war unleugbar etwas Rohes in der Art und Weise, wie sie ihm mit ihrem Blick förmlich ins Gesicht schlug, indem sie mit dem Soldaten dicht an uns vorbeiging. Der Jurewitsch, den ich erstaunt und erschrocken von der Seite ansah, war bleich wie eine Wand geworden und sagte, wobei ihm der Mund ein wenig zitterte, erklärend zu mir: "Das war meine Schwester Galanta." Ich hatte nicht geglaubt, dass ihn etwas so erschüttern könnte: im Gefühl, dass seine Knie wankten, dass ich irgendetwas für ihn tun müsste, zog ich ihn mit mir auf eine Bank, die in den Anlagen ein wenig versteckt stand. Ich sagte: "Lieber Freund, dies ist schrecklich, schrecklich traurig, nicht nur, dass Sie eine solche Schwester haben, sondern dass sie so reizend, so strahlend und ich möchte sagen, so unschuldsvoll ist und so, wie sie ist, im Schlamm untergehen soll; wenn das geschieht, ist es wirklich ein Sieg des Teufels über Gott gewesen." Die Entschlossenheit, mit der ich sein Vertrauen als etwas mir Gebührendes in Anspruch nahm, gewann ihn mir, und ich glaube, dass er in diesem Augenblick so offen von sich sprach, wie er überhaupt konnte.
Er war, wie ich schon von Farfalla wusste, ein Findelkind, auf dessen vornehme Geburt man daraus geschlossen hatte, dass das Tuch, worin das Kleine eingewickelt war, eine Krone über dem Buchstaben zeigte. Die Leute, die es auflasen, ein Briefträger und seine Frau, glaubten nach Art des Volkes bereitwillig an eine märchenhafte Lösung des Rätsels, durch die sich ihre Guttat einst belohnen würde; doch geschah es auch aus warmer, mitleidiger Gesinnung und von Seiten der Frau aus frommem Glauben an die Vorsehung, dass sie das verlassene Kind zu sich nahmen und behielten. Sie waren zu der Zeit noch kinderlos und hatten ihr leidliches Auskommen, und der kleine Findling, den sie für einen heimlichen Prinzen ansahen, wurde liebevoll, sogar mit Ehrfurcht behandelt. Allmählich verschlechterten sich die Verhältnisse durch die Schuld des Mannes, der ein schöner, leidenschaftlicher, aber zügelloser Mensch war, im Allgemeinen zuverlässig und fleißig, sich aber hier und da durch unbegreifliche Versäumnisse und Nachlässigkeiten verfehlte. Als er einmal wegen einer groben Unpünktlichkeit seines Dienstes auf eine Zeitlang enthoben wurde, hatte das nicht etwa die Folge, dass er sich besserte, sondern er verbitterte sich, warf sich auf das Trinken und wurde in der verborgenen Unzufriedenheit mit sich selbst launenhaft und herrschsüchtig gegen seine Umgebung.
In dieser Zeit wurde Galanta geboren, und in den fünf Jahren, die bis zur Geburt Torquatos verliefen, kam die Familie immer mehr herunter und schließlich in große Armut. Der Mann verlor seinen Posten und damit die bisherige Einnahme, gelangte zu keinem regelmäßigen Erwerb mehr und drückte durch Gereiztheit, tyrannische Laune und Wutanfälle auf die Frau und die Kinder. Die Frau, die sich mit frommer Ergebung in alles fügte, hörte nicht auf, eine wunderbare Rettung durch das Erscheinen der Eltern ihres Findlings zu erhoffen, erzog ihn selbst in dieser Aussicht und prägte ihm eine Art von andächtiger Ehrfurcht vor seiner vornehmen Abkunft und eigentlich vor sich selber ein.
Trotzdem er durch Rohheit und Hässlichkeit in seiner Umgebung unbeschreiblich gelitten hatte, was er nicht sagte, was sich aber leicht verstehen ließ, liebte er doch seine Pflegeeltern. Besonders der unglückliche Mann, reich veranlagt, warm und gut von Natur, mit der verhängnisvollen Heftigkeit seiner Triebe, hatte einen Eindruck in seinem Herzen gemacht, den auch die abscheulichste Verwilderung der späteren Zeit nicht ganz verwischen konnte. Aber seine Liebe war immer von oben herabgekommen und stets war er sich bewusst, dass es eine göttliche Regung in ihm war, so niedrigen Leuten Zuneigung zu schenken. Er fühlte sich, das sprach mich vornehmlich aus seiner Erzählung an, als der rechtmäßige König, der, etwa von Feinden oder Empörern vertrieben, bei armen Holzhauern im Walde Versteck und Schutz gefunden hat. Dass er diese liebhatte, während ihn das übrige Volk in der Altstadt im Grunde anwiderte, war zum großen Teil Herablassung, wenn er sich auch keine Rechenschaft davon gab, weil sie sich durch die Treue zu ihm geadelt hatten. Er war es doch eigentlich, von dem ein Licht auf sie fiel und sie auszeichnete, und es war der wesentliche Inhalt aller seiner Träume, dass durch ihn zeitliches und ewiges Glück über sie kommen sollte. Wenn er sich den Hoffnungen seiner Pflegemutter, die sie in Bezug auf ihn hegte, hingab, war es hauptsächlich, weil er wünschte, diese Armen, die ihn bei sich aufgenommen hatten, königlich belohnen, überschütten zu können. Nichts hätte er durch sie leiden können, was das Gefühl der Dankbarkeit in ihm aufgehoben hätte; denn er war nicht nur von Herzen dankbar, sondern hielt das auch für die vornehmste Pflicht, die sein Adel ihm auferlegte. Wie er sich jetzt des wenigen, das er hatte, beraubte, um seinen Geschwistern etwas zukommen zu lassen, wie er Laufbahn und Zukunft ihnen geopfert hätte, so hätte er als Kind, obwohl zart und furchtsam, ohne Besinnen sein Leben in ihrer Verteidigung hingegeben. Freilich hatte er damals auch die kleinen Geschwister geliebt, das einzige Mal in seinem Leben mit einer Liebe, die in seinem Blut saß, in seiner Natur festwurzelte, nicht wie jede spätere Neigung willkürlich und lose in seinem Herzen steckte. Sie war das einzige Feuer, an dem sich seine nackte, frierende Seele einmal ganz durchwärmt hatte, und sie flatterte noch immer dahin zurück, um sich aufzutauen und sich lebendig zu fühlen.
Seine Pflegemutter hatte ihm, wenn sie arbeiten ging, die Geschwister anvertraut und sein hochmütiges Pflichtgefühl noch dadurch angespornt, dass sie betonte, wie nun nicht nur die beiden kleinen Körper, sondern auch die Seelen in seiner Hand lägen. Dies Gefühl, nicht nur der Höherstehende, sondern tatsächlich der Herr über die arglosen kleinen Wesen zu sein, die alles von ihm zu erwarten hatten, öffnete sein Herz gegen sie, die übrigens auch völlig dazu angetan waren, sich durch allerlei kindlichen Reiz beliebt zu machen.