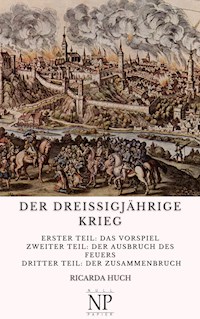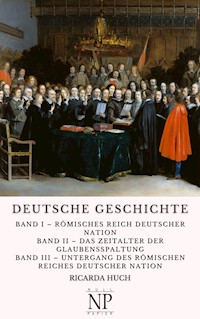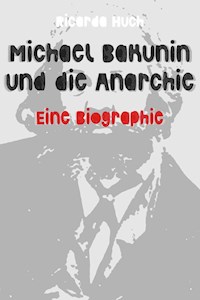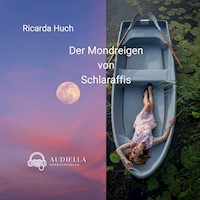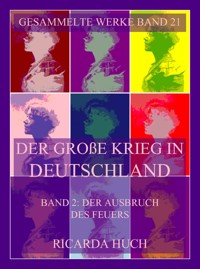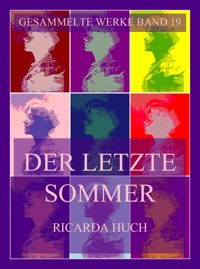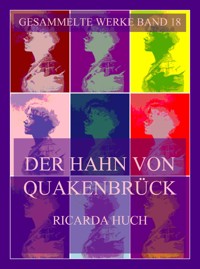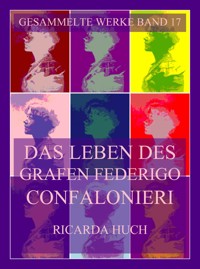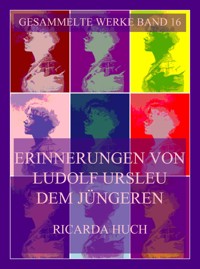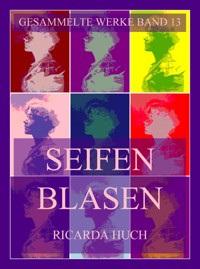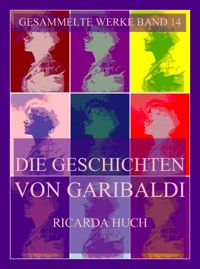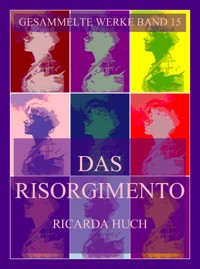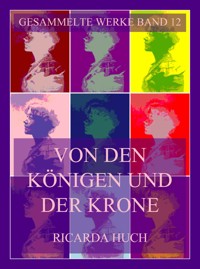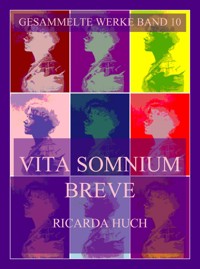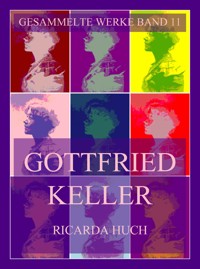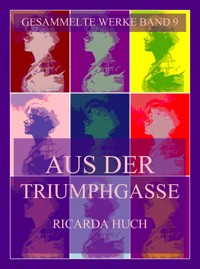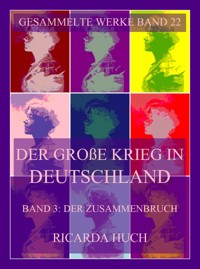
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ricarda Huch Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
"Der große Krieg in Deutschland", eines der umfangreichsten Prosawerke Ricarda Huchs, erschien in den nun wieder vorliegenden drei Bänden zwischen 1912 und 1914 im Leipziger Insel-Verlag. Als "Der Dreißigjährige Krieg" wurde es ab 1929 in stark gestraffter Fassung erneut aufgelegt. Auf über 1000 Seiten der drei "neuen" Bände handelt Huch rund sieben Jahrzehnte vor und während des Dreißigjährigen Krieges ab. Dieser dritte Band "Der Zusammenbruch" beleuchtet die Zeit zwischen 1633 und 1650 im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Die Handlung schildert das durch den Krieg völlig zermürbte, verarmte und ausgeblutete Deutschland und endet zwei Jahre nach dem Westfälischen Frieden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der große Krieg in Deutschland
Band 3: Der Zusammenbruch (1633 – 1650)
RICARDA HUCH
Der große Krieg in Deutschland 3, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681966
Quelle: https://archive.org/details/dergrossekriegin01huch/page/n7/mode/2up
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II7
III11
IV.. 15
V.. 22
VI26
VII32
VIII39
IX.. 43
X.. 45
XI52
XII57
XIII62
XIV.. 65
XV.. 68
XVI75
XVII82
XVIII86
XIX.. 92
XX.. 96
XXI98
XXII101
XXIII104
XXIV.. 106
XXV.. 109
XXVI112
XXVII118
XXVIII120
XXIX.. 123
XXX.. 127
XXXI131
XXXII136
XXXIII140
XXXIV.. 144
XXXV.. 148
XXXVI152
XXXVII156
XXXVIII160
XXXIX.. 162
XL.. 166
XLI171
XLII177
XLIII181
XLIV.. 187
XLV.. 190
XLVI192
XLVII195
XLVIII200
XLIX.. 203
L.. 208
LI212
LII216
LIII218
LIV.. 222
LV.. 229
LVI233
LVII237
LVIII240
LIX.. 243
LX.. 246
LXI251
LXII254
LXIII258
LXIV.. 263
LXV.. 265
LXVI270
LXVII274
LXVIII277
LXIX.. 279
LXX.. 282
LXXI287
LXXII290
LXXIII293
LXXIV.. 296
LXXV.. 299
LXXVI303
LXXVII307
LXXVIII311
LXXIX.. 314
LXXX.. 317
LXXXI321
LXXXII325
LXXXIII330
LXXXIV.. 334
LXXXV.. 340
LXXXVI342
LXXXVII345
LXXXVIII348
LXXXIX.. 352
XC.. 356
XCI361
XCII364
XCIII367
XCIV.. 372
I
Der Kurfürst von Sachsen wurde durch die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft Oxenstiernas in Dresden in üble Laune versetzt; er habe gedacht, sagte er, die schwedische Wirtschaft sei mit dem Tode des Königs zu Ende, nun gehe es wieder los; er wolle einmal nichts damit zu tun haben. Herr von Taube und die anderen Räte suchten ihn zu beschwichtigen und schlugen vor, den Kanzler wie den König selbst zu empfangen, damit womöglich alles glimpflich geordnet würde; er betone ja seine Friedensliebe, vielleicht könne man einen guten Frieden erlangen. Solange Oxenstierna sich bescheiden aufführe, entschied der Kurfürst, solle er nach Gebühr traktiert werden; ließe er sich aber einfallen, den Herrn zu spielen, so wolle er als ein vornehmer deutscher Kur- und Reichsfürst ihn Mores lehren. Besonders der Oberhofprediger Hoe redete dem Kurfürsten zu, das schwedische Bündnis zu halten; Gott habe die schwedischen Waffen gesegnet und werde es ferner tun, Abfall und Untreue ständen einem christlichen Fürsten nicht an. Man könne auch nicht wissen, wie Gott das getreue Ausharren des Kurfürsten noch lohnen werde. Als ihn die Böhmen im Jahre 1618 zum Könige hätten wählen wollen, habe er die große Zukunft dem Kaiser aufgeopfert; vielleicht kröne ihn dafür jetzt der Himmel freiwillig mit dieser uralten und reichen Krone. Es gehe ja alles kopfüber kopfunter in Böhmen, die liebe Religion liege in den letzten Zügen, Mensch und Vieh kämpften miteinander um den letzten Grashalm, und das wisse ja jeder, wie die frommen böhmischen Exulanten auf den Kurfürsten als auf ihren Messias blickten. Der Kurfürst brummte, er wolle nichts, als was ihm mit Fug zustehe, und der hartköpfige böhmische Adel müsse sich noch viel tiefer bücken, bevor er sich mit ihm einließe; aber das Projekt rumorte doch in seinem Kopfe.
Ernstlicher gingen die Kurfürstin und ihre Söhne mit dem Gedanken an Böhmen um; die jungen Prinzen wären glücklich gewesen, wenn sie der väterlichen Tyrannei hätten entrinnen und außer Landes einen ansehnlichen fürstlichen Hof hätten einrichten können.
Ach, sagte der schwedische Resident Nikolai, Tränen im Auge, zu Oxenstierna, als er ihn in Dresden begrüßte, er sei ja so froh, den Kanzler zu sehen; es sei ihm fast, als hafte noch ein Stückchen von des Königs Seele an ihm.
Das möge wohl so sein, nickte Oxenstierna; denn er fühle sich zuweilen zu Handlungen und Plänen getrieben, die er früher missbilligt hätte, und die er jetzt gleichsam zu des Königs Gedächtnis und wider seinen Willen tun müsse. Früher sei er mit des Königs Herumstürmen im Reich nicht jederzeit einverstanden gewesen, habe gemeint, es führe ihn zu weit ab von Schweden, und er habe ihm oft geraten, sich mit einem guten Beutel voll Geld aus dem Knäuel zu ziehen, solange es noch mit Ehren möglich sei. Jetzt steckten sie vollends wie die heiligen Märtyrer in einem Löwenzwinger, umringt von heimlichen und offenen Feinden, losgetrennt von der Heimat, ein verschlagenes Häuflein, nur der eigenen Fäuste und des eigenen Kopfes mächtig.
Des Kanzlers Kopf zähle aber auch für viele, sagte Nikolai, und er sei insoweit der alten neunköpfigen Hydra zu vergleichen.
Oxenstierna lachte und sagte, er sei mit diesem Instrument zufrieden, brauche es aber auch. Die gesamten evangelischen Stände des Reichs, eigenmächtige und verschlagene Leute, samt Frankreich unter einen Hut zu bringen, dazu müsse man ein nüchternes Gehirn und einen festen Schlaf haben. Bis jetzt habe sich der Herkules noch nicht gezeigt, der ihm das kostbare Hauptbüschel vom Halse schlüge, sicher sei es der Kurfürst von Sachsen nicht.
Nikolai schüttelte bedenklich den Kopf. Es würden mehr Stämme durch wucherndes Unkraut umgebracht als durch den Blitz gefällt, sagte er. Oxenstierna möge ihm gestatten, dass er, Nikolai, ihm mit seiner Erfahrung diene, und möge sich seine Warnungen, mehr als der hochselige König getan hätte, zu Gemüte ziehen. Er sei jetzt in Dresden zu Hause, kenne sich aus mit sächsischer Falschheit und Hinterlist. Der Kurfürst sei niemals aufrichtig schwedisch gewesen und werde es nie sein, ebenso wenig sei dem Arnim und dem Lauenburger zu trauen, wie sie sich auch anstellen möchten. Ein redlich schwedisches Gemüt habe nur der alte Graf Mathes Thurn, freilich sei er nicht tief, werde leicht betrogen, und könne schlecht dissimulieren. Überhaupt meine es niemand so treu mit den Schweden wie die böhmischen Emigranten, weil das mit ihrem Partikularinteresse Zusammenhänge.
Freilich, ohne Köder fange man keine Fische, lachte Oxenstierna; der sächsische zappele ja schon an der böhmischen Krone, und dem brandenburgischen habe er auch einen ausgeworfen, nämlich die schwedische Heirat des Kurprinzen Friedrich Wilhelm. Das Würmlein komme ihnen zu Berlin fett genug vor, und mittels Brandenburg hätte er Sachsen ohnehin, da sich Sachsen kaum von Brandenburg trennen würde.
Bevor Nikolai sich verabschiedete, schlug er Oxenstierna vor, ihn mit dem Grafen Kinsky bekanntzumachen. Der sei kein Heißsporn wie der alte Thurn, sondern vorsichtig und gelinde. Arnim habe ihn im Jahre 1631 kriegsgefangen aus Prag gebracht, seitdem lebe er in Dresden und genieße das Wohlwollen des Kurfürsten, weil er Anno 1618 nicht dem Pfälzer, sondern ihm, dem Kurfürsten, seine Stimme gegeben habe.
So, so, sagte Oxenstierna, er denke das wohl jetzt noch zu effektuieren?
Nikolai zuckte die Schultern. Dass Kinsky, als ein eifriger Protestant, sein Vaterland wieder in den vorigen Freiheits- und Blütenstand setzen möchte, sei gewiss; aber er kenne den Sachsen zu wohl, um von ihm allein viel zu erwarten. Er wisse, dass Böhmen das Heil nur von den Schweden kommen könne. Vor allen Dingen könne er dadurch nützlich werden, dass er vermittelst seiner Frau, die eine Terzka sei, in genauer Verbindung mit Wallenstein stehe; er unterhalte auch mehrere Kundschafter bei dem General und sei von allem, was dort vorgehe, aufs Beste unterrichtet.
Die Verhandlungen Oxenstiernas mit den kurfürstlichen Räten wollten indessen zu keinem Ziele führen, wie scharf er sie auch anhielt, bei der Sache zu bleiben. Ihre Versicherungen, dass der Kurfürst des geopferten königlichen Blutes eingedenk sei und von den Glaubensgenossen nicht weichen wolle, unterbrach er bald mit der Forderung, diese löblichen Absichten in Tat umgesetzt zu sehen; namentlich sollten sie sich erklären, in welcher Weise die Kräfte der Evangelischen künftig zusammengefasst und vertragsmäßig konstituiert werden könnten.
Der Kurfürst sei gesonnen, sagten die Räte, seine Liebe zu der verstorbenen schwedischen Majestät auf den Kanzler zu übertragen und sich nicht von ihm zu separieren; das Weitere würden Zeit und Gelegenheit geben. Sachsen sei ja vom Feind gesäubert, der Kurfürst wolle sich aber damit nicht begnügen, sondern seine Waffen mit schwedischer Hilfe in Böhmen hineintragen und dem flüchtigen Feind gänzlich den Garaus machen.
Oxenstierna lehnte sich in den Sessel zurück und spielte mit seiner Feder. So weit wären sie noch nicht, sagte er ablehnend, es sei nicht ratsam, das Kriegstheater weiter auszudehnen, bevor noch eine Basis für den Krieg geschaffen sei. Man müsse zuerst wissen, wie die Mittel für den Krieg aufzubringen wären, und wer künftig das Wesen zu dirigieren hätte, damit der Brei nicht versalzen würde, wie es bei allzu vielen Häuptern zu geschehen pflege.
Dass dem Kurfürsten, als der vornehmsten evangelischen Säule des Reichs, der gebührende Respekt zuteilwerde, antworteten die Räte, verstehe sich wohl von selbst. Ob Oxenstierna Ursache habe, dem Kurfürsten zu misstrauen?
Dies höflich verneinend, machte Oxenstierna die Herren darauf aufmerksam, dass er viele Geschäfte zu erledigen hätte und deshalb den Sachen gerade auf den Leib ziehen müsse. Er habe sich ausgerechnet, dass das evangelische Kriegswesen auf dreierlei Weise könnte geordnet werden: Erstens könnten wie bisher alle Glieder zu einem Corpus formiert werden, das unter schwedischer Direktion stehe; oder aber es könnten zwei getrennte Corpora gemacht werden, von denen eins Schweden, das andere den Kurfürsten von Sachsen zum Haupte hätte; drittens könnte, falls die Deutschen der schwedischen Hilfe nicht mehr zu benötigen meinten, diese Krone durch eine billige Entschädigung befriedigt werden, worauf sie sich gänzlich aus dem Kriege zurückziehen würde. Die Räte möchten diese drei Punkte dem Kurfürsten vorlegen und einen schleunigen Entschluss zuwege bringen.
Johann Georg hörte den Bericht der bestürzten Herren entrüstet an. Das fehle noch, sagte er, dass er sich von einem schwedischen Adligen an die Wand drücken ließe! Man müsse doch Zeit zum Besinnen und Überlegen haben, auf ein Entweder - Oder ließe er sich überhaupt nicht stellen.
Es sei nicht zu leugnen, meinten jene, dass der Kanzlersehr gereizt und empfindlich zu sein scheine; man müsse sich wohl oder übel entschließen, über die vorgeschlagenen drei Punkte zu beraten.
Dazu brauche er keinen Rat, schalt der Kurfürst, um zu wissen, dass er sich nicht unter einen schwedischen Edelmann stellen wolle; einen solchen Schimpf könne er sich nicht selbst antun.
Das erwarte Oxenstierna wohl auch nicht, sagten die Räte; und der erste Punkt sei also von selbst hinfällig. Der zweite Punkt sei aber auch heikel, weil Sachsen dadurch ganz isoliert werden würde.
Den erbosten Einwurf ihres Herrn, warum denn nicht davon die Rede sei, dass er, der Kurfürst, das ganze Wesen dirigiere, was doch dem Leipziger Schlüsse gemäß sei, schoben die Räte mit der Bemerkung zurück, bei der exorbitanten Meinung, die Oxenstierna von seiner Krone habe, könnten sie sich nicht wohl getrauen, einen solchen Vorschlag einzubringen. Der verstorbene König habe ja mit dem König von Frankreich stets Anstände darüber gehabt, dass er mit diesem auf gleichem Fuße habe traktiert sein wollen. Da nun die Entschädigung vollends zu schwer falle, wüssten sie nichts anderes, als einen Modus zu ersinnen, wie man sich jeder bestimmten Antwort überhaupt entschlüge.
Bald jedoch meldeten die Räte, der schwedische Kanzler habe einen solchen Humor, dass verständige Leute nicht mit ihm auskommen könnten. Er habe ihre wohlgemeinten Insinuationen rotunde von sich gewiesen und in einem fast imperiosischen Tone gesagt, er wolle auf seine deutliche Frage eine kategorische Resolution haben.
Nun habe er es satt, rief der Kurfürst aus. Die phantastische Einbildung dieses Menschen sei durch den königlichen Empfang, den er ihm wider Willen und bessere Einsicht bereitet hätte, völlig ins Närrische ausgeschlagen. Er solle sich die Resolution aus seinen Fingern saugen und damit abfahren; ihm dürfe von nun an keiner mehr mit dem schwedischen Bündnis kommen.
Während diese Verhandlungen sich hinschleppten, trafen an einem der letzten Dezembertage Oxenstierna und Graf Kinsky bei Nikolai zusammen. Es war nach Kinskys Wunsch eine späte Abendstunde gewählt worden, damit der Besuch womöglich geheim bliebe, und beim Eintreten hafteten seine Blicke scheu in den düsteren Winkeln des niedrigen holzvertäfelten Zimmers. Während Nikolai ihm half, sich seines Pelzmantels zu entledigen, sagte er erklärend, die Herren kennten ja die wunderliche Gemütsbeschaffenheit des Kurfürsten, wie er bald mit diesem, bald mit jenem unzufrieden sei, und dass er ihm, Kinsky, Späher nachzuschicken pflege, die ihm alle seine Schritte hinterbrächten. Er würde sogleich etwas Verräterisches dahinter wittern, wenn er mit Oxenstierna zusammenträfe, obgleich er doch der Herren Schweden Bundesfreund wäre.
Ihm, einem alten Diplomaten, sagte Oxenstierna beruhigend, könne Kinsky Vorsichtigkeit und Verschwiegenheit zutrauen. Übrigens habe er nicht im Sinne, diesen Abend Staatssachen zu traktieren, wolle sich im Gegenteil davon erholen. Er freue sich, die Bekanntschaft eines so hochgelehrten, weitberühmten Mannes zu machen, wie Kinsky sei; es ständen viel böhmische Exulanten als Offiziere im schwedischen Heer, der verstorbene König habe sie wohl zu schätzen gewusst, und es sei sein Wunsch gewesen, den armen Märtyrern zu helfen und sie in ihr Vaterland zurückzuführen. Ihm, Oxenstierna, wären des Königs Wünsche billig, und wenn er es vermöchte, würde er die böhmischen Herren in den Frieden einschließen, sofern es einmal dazu käme.
Sofern es einmal dazu käme, wiederholte Kinsky, indem er seine traurigen schwarzen, ein wenig starren Augen auf den Kanzler heftete. Es eröffne sich ja nirgend eine Aussicht. Und so wie es in Böhmen jetzt stehe, verlange es ihn auch gar nicht heim; es sei nichts als Untreue und Unfrieden da zu finden.
Ihm komme es seltsam vor, sagte Nikolai, dass die böhmischen Herren sich so still unter dem österreichischen Joch verhielten. So kluge, mächtige und stolze Herren! Man sollte meinen, es hänge nur von ihrem Willen ab, ob sie wieder frei würden.
„Sie sind stark zur Ader gelassen," sagte Kinsky, „das Blut von 1621 ist noch nicht ersetzt."
„Und noch nicht gerächt," fügte Nikolai hinzu.
Er wolle die Gerichteten von 1621, denen Gott gnädig sei, nicht verteidigen, sagte Kinsky; sie hätten keine ganz reine Sache gehabt, und er hätte sich deshalb in ihre Rebellion nicht eingelassen. Man müsse nicht unsinnig auf die eigene Kraft pochen, sondern auch den Gegner recht einschätzen, und nie einen Fuß heben, bevor man wisse, wo man ihn wieder aufsetzen könne.
Der Graf fuhr zusammen, als in diesem Augenblick dröhnend an die Haustür geschlagen wurde, und er wandte sein gelbes Gesicht ängstlich horchend nach dem Fenster, an dem große Schneeflocken, lautlos aus dem Dunkel ins Dunkel tauchend, vorüberglitten. Das sei nichts Besorgliches, sagte Nikolai gutmütig, vielleicht sei es ein Bote mit Briefschaften für ihn. Es könnten aber auch Kinder sein, die das alte Jahr austreiben wollten.
Kinsky erklärte, er sei schreckhaft, weil er krank sei, laboriere schon seit Jahren an Magenschwäche. Es lägen ihm auch zu Hause zwei Kinder krank, so sei er immer auf eine Hiobspost gefasst.
„Ja, ja," sagte Nikolai, „die Pest ist es, die jetzt gefährlich herumgeht, vom Kriege ist dermalen weniger zu befürchten."
Kinsky war aufgestanden und blickte auf die Straße hinunter, wo ein paar Knaben standen und mit dünner Stimme ein Lied absangen, zog ein Geldstück aus der Tasche und warf es heraus, das Fenster behutsam ein wenig öffnend. Dann sagte er, an Nikolais Worte anknüpfend, die kaiserliche Armee unter Wallenstein sei allerdings zurzeit nicht formidabel. Dazu stecke sie so voll Protestanten, dass gar kein Mut zum Kriege gegen die Glaubensgenossen darin herrschen könne. Auch sei Wallenstein selbst krank und liege meistenteils zu Bette. Einer seiner Leibärzte habe gesagt, wenn er das Jahr überlebe, so sei es nur eine Gnadenfrist, die Gott ihm bewillige.
Er habe auch dergleichen gehört, sagte Oxenstierna, es aber für Geschwätz gehalten. Das Podagra hätten andere auch, das bringe einen Fünfzigjährigen nicht ins Grab.
Das sei je nachdem, sagte Kinsky, von den Ärzten werde er für einen Mann des Todes ausgegeben.
„So hätten wir freilich einen mächtigen Bundesgenossen," sagte Oxenstierna.
Kinsky wiegte den Kopf und sagte zögernd, es sei die Frage, ob die Schweden nicht mehr Ursache hätten, Wallensteins Leben als seinen Tod zu wünschen. Viele wollten wissen, dass der General keine Lust mehr zum Kriege habe und den Evangelischen eher wohl als übel wolle.
„Ja, wer hätte denn noch Lust zum Kriege!" rief Oxenstierna aufseufzend. Übrigens wisse er von seinem seligen Könige, dass Wallenstein ein Wasser ohne Grund sei, in dem sich kein Schiff verankern könnte. Es seien da allerlei Knoten geschürzt gewesen, aber niemals zugezogen. Auf Traktate mit Wallenstein könne man keinen Wert legen, ja nicht einmal auf seine Taten. Er mache es wie gewisse Leute beim Brettspiel, die jeder Zug gereute, den sie eben getan hätten. Nach seiner Ansicht sei ein offener Feind besser als ein zweideutiger Freund, deren er leider ohnehin genug hätte.
Oxenstiernas Ablehnung schien Kinsky ein wenig zu reizen; soviel er wisse, sagte er, habe es das eine Mal an Gustav Adolf gelegen, dass das Projekt nicht zustande gekommen sei. Wallenstein sei dazumal sehr empfindlich und der alte Thurn ganz desperat gewesen. Freilich, setzte er hinzu, wären das subtile Sachen, von denen schwer zu reden wäre.
Als die Herren sich trennten, hatte Kinsky den Eindruck, dass Oxenstiernas Misstrauen gegen Wallenstein schwer zu überwinden sei, und dass er sicherlich dem kaiserlichen General nicht entgegenkommen werde. Da aber Wallenstein, wie er nun einmal war, den ersten Schritt nicht tun würde, müsse man, so dachte er, mehr Samen ausstreuen; vielleicht dass auf einem anderen Acker etwas aufginge.
II
Nach der Schlacht bei Lützen stieß Herzog Georg von Lüneburg zum schwedischen Heer und vertrieb mit Bernhard von Weimar die kaiserlichen Besatzungen aus Sachsen, worauf sie bei Altenburg Quartiere bezogen. Sie erwarteten ungeduldig die Ankunft Oxenstiernas, um mit schwedischem Beistande ihre Eroberungen vollenden zu können, Georg nach Norden, Bernhard nach Süden strebend. In der Reisekutsche, die den Kanzler von Berlin nach Sachsen führte, bereitete er sich auf das bevorstehende diplomatische Gefecht mit den beiden Herzogen vor, von denen er voraussah, dass sie durch des Königs Tod doppelt ausgelassen geworden sein würden und von neuem gebändigt werden müssten. Gott sei Dank hatte er einen festen Blick und eine geschickte Hand, und an Besonnenheit und Selbstbeherrschung glaubte er seinem verstorbenen Freunde sogar überlegen zu sein. Wäre der Augenblick geeignet gewesen, eine ansehnliche Entschädigung zu erpressen, so hätte er den Krieg am liebsten abgebrochen; da das nicht der Fall war, wollte er so operieren, dass er sich nicht in weitaussehende Pläne verwickelte, sondern das Nächstliegende und Erreichbare verfolgte. Es wäre wünschbar gewesen, ein starkes Heer mit einem starken Feldherrn aufzustellen; aber da sich einem schwedischen die deutschen nicht unterwerfen würden, ein deutscher sich aber gegen ihn, den Kanzler, auflehnen könnte, beschloss er zu tun, was er an und für sich missbilligt hätte, nämlich das Heer zu teilen. Am liebsten hätte er gesehen, wenn Herzog Wilhelm von Weimar Generalleutnant der Armee geblieben wäre, wie Gustav Adolf vorsorglich angeordnet hatte; aber Bernhard hatte dem älteren Bruder den Oberbefehl bereits aus der Hand gewunden, und Oxenstierna hielt es für unklug, das rechtmäßige Verhältnis wieder herstellen zu wollen, da er bei Bernhards trotzigem Charakter so viel zu erzwingen nicht hoffen konnte. Lieber wollte er von vornherein anerkennen, was er nicht ändern konnte, damit es von ihm auszugehen schien, und womöglich keine Befehle erlassen, denen der Gehorsam nicht sicher wäre. Dagegen wollte er, wo er seinen Willen durchsetzen könnte, standhaft dabeibleiben und mit Drohungen und Grobheiten nicht sparen; das würde bei den deutschen Fürsten bessere Wirkung tun, als wenn er suaviter und caute vorginge. In Berlin hatte er schon guten Erfolg gehabt; vielleicht, dachte er, würde er mit Fuchsschritten weiterkommen, als der selige König mit seinen Rosssprüngen. Seine Augen wurden feucht, wie er an die tote Majestät dachte: mit was für weiten Nüstern hatte der die Lebenslust verschlungen, was für Funken hatte sein Ritt aus den Kieseln geschlagen! Es war festlicher und kurzweiliger gewesen an seiner Seite, und außerdem dass eine Anregung fehlte, drückte auch noch die schwerere Last der Verantwortung.
Als Oxenstierna den schwedischen Feldmarschällen Horn und Banör auseinandersetzte, warum er das Heer zu teilen beabsichtige, und dass er sie ausersehen habe, die deutschen Häupter, namentlich Herzog Georg und Herzog Bernhard, zu beobachten und zu zügeln, sah Horn missvergnügt vor sich nieder und Banör lachte geradeheraus. Die Rolle passe nicht für ihn, sagte er, er habe nicht das Zeug zu einem Jesuiten und Spion. Es sei bekannt, wie er mit seiner Meinung herauszufahren pflege, er würde alles verderben. Er glaube nicht, unverträglich zu sein, aber einen Kameraden am Oberbefehl könne er nicht leiden, der Kanzler solle ihn allein schalten lassen, so werde es recht, zu zweit sei er nicht zu brauchen.
Horn, Oxenstiernas Schwiegersohn, erklärte, er sei bereit, sich zu fügen, gehorche ja überhaupt in diesem Kriegs-wesen mehr der Notwendigkeit, als dass er Lust dazu habe; aber es sei eine undankbare Aufgabe, die Eule oder Kassandra zu spielen, er habe auch vom verstorbenen König wenig Dank für seine wohlgemeinten Warnungen geerntet. Das habe er jedoch hingehen lassen, weil es sein König gewesen sei; von einem Deutschen und jungen, unerfahrenen Draufgänger wie Herzog Bernhard Widerspruch und Widerstand zu ertragen, sei härter.
Oxenstierna versprach, ihn getreulich zu flankieren und nicht im Stich zu lassen. Er leiste dem Vaterlande einen wichtigen Dienst; denn da man die beiden Herzoge einmal nicht aus der Welt schaffen könne, müsse man sehen, sich ihrer zu möglichst großem Vorteil und möglichst geringem Schaden zu bedienen. Sie hätten ja auch schon mancherlei genützt und wären durch ihr Interesse mit der Krone Schweden verknüpft, man dürfe die wenigen Freunde, die man im Reich hätte, nicht verscherzen. Der Lüneburger sei fast gefährlicher als der Weimaraner; denn beide wären stolz und wollten hoch hinaus; aber Bernhard lasse sich durch Gemüt und Phantasie beeinflussen, Georg dagegen frage wenig nach Glauben und Ehre, desto mehr nach Gewinn und Vorteil, und mit dem Katechismus würden eher Reiche auf Erden errichtet.
Horn schlug vor, Oxenstierna solle womöglich Knyphausen die Aufsicht über Herzog Georg anvertrauen; Knyphausen habe dem verstorbenen König treu gedient, sei als ein niedersächsischer Ritter dem niedersächsischen Fürsten nicht sonderlich gewogen, werde nun auch alt und denke daran, sich zu versorgen, also werde er für einen Rekompens empfänglich sein.
Der Kanzler atmete auf, als er diese schwere Angelegenheit der Lösung nahe sah. So wolle er denn Banör, sagte er, allein ins Zentrum setzen, damit er das ganze Kriegstheater überblicken und je nachdem es sich notwendig erweise, hierhin und dahin eilen könnte. Vor allen Dingen müsse er mit dem Landgrafen Wilhelm von Hessen in steter Korrespondenz bleiben, ihm in der Not beispringen oder ihn, als den verlässlichsten Bundesgenossen, wenigstens mit guten Worten vertrösten. Banör, mit dieser Einrichtung zufrieden, war guter Dinge und hatte Lust zu feiern und zu bankettieren; aber weder Herzog Georg noch Herzog Bernhard stand der Sinn danach.
Aus Obersachsen sei der Feind vertrieben, sagte Georg, nun wolle er Niedersachsen säubern; es sei hohe Zeit, dass man sich in jenen Orten zeige, wo seit dem Tode des Königs Treulosigkeit und Abfall umginge. Der Herzog von Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich, dem der Krieg nie recht angestanden habe, wolle seinen, Georgs, Truppen kein Quartier mehr geben und erkenne sein Recht auf die Stadt Einbeck nicht an, die Gustav Adolf ihm, nebst mehreren Ämtern, angewiesen habe; habe sogar das Amt Uslar, das dazu gehöre, seinem eigenen Feldhauptmann, dem von Uslar, verschrieben. Nun sei es offenbar, dass ein Heer nicht in der Luft kampieren könne, und wenn der Soldat seine Notdurft nicht erhalte, habe man ausgekriegt; Oxenstierna möge dazu tun, dass Friedrich Ulrich bei der Pflicht erhalten werde.
Ja, er habe schon vernommen, erwiderte dieser, dass der Herzog von Wolfenbüttel sich widerwärtig anstelle und große Lust mit dem Kaiser zu traktieren spüren lasse. Er rüste heimlich und habe auch einen niedersächsischen Kreistag ausgeschrieben, wozu er doch nicht das mindeste Recht hätte, als welches dem Administrator von Magdeburg zukäme. Ob Herzog Georg wisse, wer das wäre? Er, Oxenstierna, sei jetzt Administrator von Magdeburg; wer außer ihm einen niedersächsischen Kreistag ausschreibe, maße es sich widerrechtlich an, und er werde einen solchen zu bestrafen wissen.
Oxenstierna hatte sich im Reden erhitzt und sah Georg herausfordernd an, der nur ein wenig stutzte und dann wieder ruhig die Daumen umeinander drehte. Er wolle es dem Kanzler danken, sagte er, wenn er Friedrich Ulrich, seinen Vetter, bei der Pflicht erhielte. Derselbe sei ein schwacher Mann, leider allzu leicht von dunstigen Einfällen und Schimären oder von falschen Räten zu regieren, und da er ohne Leibeserben sei, habe die Gesamtfamilie ein großes Interesse daran, ihn zu beaufsichtigen, damit er nicht durch liederliche Politik Land und Leute verzettele. Was ihn, Georg, betreffe, so sei er gesonnen, treu bei dem mit dem verstorbenen König abgeschlossenen Würzburger Traktat zu verbleiben und wünsche, dass die Krone Schweden denselben bestätige. Es sei Oxenstierna gewiss bekannt, wie der König von Frankreich goldene Schlingen nach den evangelischen Reichsfürsten auswerfe, ihm gefalle aber das französische Wesen nicht, und er werde sich nicht fangen lassen. Dagegen möge Oxenstierna bedenken, was er zugesetzt, wie er sein Amt Herzberg preisgegeben habe und kaum einen Stein am Wege, um seine Familie zu behausen, besitze. Ohne die rechten Mittel könne er als General nicht operieren und das gemeine evangelische Wohl nicht befördern. Hiernach wurde das monatliche Gehalt des Herzogs auf 18000 Reichstaler festgesetzt, worauf die Verhandlungen mit ihm vorläufig abgeschlossen waren.
Unverweilt brach Georg auf und eröffnete seinen Offizieren, er gedenke stracks die Weser zu überschreiten und mit der Wiedereroberung der Stadt Hameln zu beginnen. Die Offiziere betrachteten das als eine ungewöhnlich hitzige Expedition, und besonders Knyphausen erklärte sich rund heraus dagegen. Man sei jetzt im Anfang des Februars, sagte er, der Winter habe erst recht begonnen, da sei es wohlgegründeter Usus, die Truppen in gute Quartiere zu legen und zu verpflegen, damit sie im Frühjahr desto besser bei der Hand wären. Eine Belagerung im Winter verschlinge Zeit und Leute, im gefrorenen Boden richte man in Monaten nicht aus, womit man im Frühjahr in Tagen zustande käme.
Herzog Georg wendete dagegen ein, mit dem Stillliegen lasse man auch dem Feinde Zeit, sich zu stärken, und es sei allemal leichter, ein Heer bei der Arbeit im Stande und in der Disziplin zu erhalten, als in den Quartieren. Knyphausen solle aber immerhin mit den Unlustigen zurückbleiben, während er mit den Willigen und Gehorsamen ans Werk ginge.
Im Kreise vertrauter Freunde schimpfte Knyphausen auf die Habgier des Herzogs: da könne alles in Grund und Boden verderben, wenn er sich nur sein Fürstentum zusammenkratzte. Für den verstorbenen König habe er, Knyphausen, sein Gut und Blut darangesetzt und Ruhe und Gesundheit geopfert, der habe aber auch an andere gedacht und königlich zu belohnen gewusst. Dieser geizige Herzog jedoch ästimiere niemanden, um niemanden beschenken zu müssen, und obgleich er keinen Schwertstreich für das Reich oder die Kirche tun würde, halte er doch jedermann für schuldig, ihm auf seinen Raubzügen beizustehen. Trotzdem entschloss sich Knyphausen, dem Herzoge zu folgen, den er nach seinen Abmachungen mit Oxenstierna doch nicht wohl sich selbst überlassen durfte, und der ihn etwa noch vor der ganzen Welt um seine wohlerworbene Reputation gebracht hätte, indem er ihn für feige ausschrie. Also überschritt in den ersten Märztagen an einer seichten Stelle, wo im Sommer das Vieh durchzuwaten pflegte, das Heer die Weser, und die Kaiserlichen, die es hatten geschehen lassen, zogen sich fliehend auf Hameln zurück.
III
Vor dem Rathause der Prager Altstadt waren Gerüste und Galgen für die Exekution derjenigen Offiziere und Soldaten errichtet, die den in der Schlacht bei Lützen empfangenen Befehlen nicht gehorcht hatten oder fahnenflüchtig geworden waren.
Bei grauendem Morgen rasselten die Kutschen heran, in denen die Herren vom Kriegsgericht saßen; es sei so dunkel, sagte einer, dass man kaum zur festgesetzten Zeit würde beginnen können. Ei was, entgegnete Holk, der Vorsitzender der Kommission war, der Henker würde den Hals schon finden, bei solchen Gelegenheiten müsse man exakt sein. Die anderen schlossen sich der Meinung an, und Colloredo sagte, in diesem Falle sei es besonders hoch vonnöten; denn es würden sicher noch Pressuren zur Begnadigung ausgeübt, seine fürstliche Durchlaucht, der General, sei schon über Gebühr mit der Sache drangsaliert worden. Holk sagte, er sei mit der Gemütsmeinung des Herzogs bekannt und wette seinen Kopf, dass es nichts nütze. Auch hätten diese Leute den Tod reichlich verdient, es könne ehrliebenden Soldaten nicht zugemutet werden, mit Feiglingen zusammen zu dienen.
Ja, sagte Piccolomini, der Herzog habe den Grundsatz, Gnade gegen Schuldige sei Ungerechtigkeit gegen das Verdienst, und das passe freilich manchem nicht. Jedenfalls zögen sie sich durch diese Arbeit mancherlei Hass zu.
„Desto besser," sagte Holk; „Hass gebührt einem rechten Manne, und die Gnade des Herzogs ist eine gute Rüstung."
Während das Armesünderglöckchen läutete, bestiegen die Herren die für sie errichtete Bühne. Ein feiner eisiger Wind trieb ihnen die Nässe des Nebels oder Regens ins Gesicht, sie zogen die Mäntel fest um sich zusammen, und Colloredo bemerkte, mit einem gehässigen Blick auf Holk, davor schütze selbst der erwähnte Panzer nicht. Colloredo war nämlich erbittert darüber, dass Holk nach der Schlacht zum Feldmarschall, er dagegen, der ältere General und Graf, nur zum Feldzeugmeister befördert worden war. Holk beachtete weder diese Worte noch die Witterung; seine ganze Aufmerksamkeit war darauf gespannt, dass die Hinrichtung ungestört verliefe, er gab nach verschiedenen Seiten Winke und suchte mit scharfen, ungeduldigen Blicken zur Eile anzutreiben. Der kleine Platz war rings mit Soldaten umstellt, die das Gewehr auf der Schulter und die Hand am Schwerte hielten, hinter ihnen drängten sich die neugierigen Zuschauer. Unter denen, die mit dem Schwerte gerichtet wurden, war ein achtzehnjähriger Fähnrich, ein hübscher Mensch, der sich mit augenscheinlicher Sorgfalt herausgeputzt hatte und kecke Sorglosigkeit zur Schau trug. Wie das Schicksal ihm näher rückte, warf er verstohlene Blicke die Karlsgasse hinunter, ob nicht eine Gnadenbotschaft von der Kleinen Seite her käme, und auch der Zuschauer und der Soldaten, ja der Richter bemächtigte sich eine gewisse Unruhe. Da sich nichts zeigte, zuckte der kleine Fähnrich die Achseln, zupfte an seinem keimenden Schnurrbart und begann als letztes Mittel, um den verhassten Augenblick hinauszuzögern, eine Rede; allein Holk sprang auf, stampfte wütend mit den Füßen, winkte den Soldaten zu trommeln und dem Scharfrichter ein Ende zu machen.
Um Mittag bewegte sich die Sänfte des Grafen Slawata über den Marktplatz, wo an der Abtragung der Gerüste und Säuberung des Pflasters gearbeitet wurde; er war jetzt 60 Jahre alt, grauhaarig und gebückt, und klagte beständig über seine Gesundheit, die er seit dem Fenstersturze nicht wiedererlangt habe. Unweit des Rathauses ließ er halten, winkte ein paar Arbeitern und fragte einen, der herbeilief: „Du musst wohl die Spuren des edlen vergossenen katholischen Blutes tilgen?" ferner, wo die gemarterten Leichname geblieben wären. Der Mann gab Auskunft, sie wären ihren Familien ausgeliefert, soweit sie von Adel gewesen wären, und fügte hinzu', es wäre freilich ein erbärmliches Schauspiel gewesen, so vornehme Herren einen so schimpflichen Tod leiden zu sehen, auch hätten Männer und Frauen laut geschluchzt, zumal als das liebe junge Blut, der Fähnrich, den Kehraus hätte tanzen müssen. Da wäre jedem zumute gewesen, als würde sein eigenes Kind geschlachtet.
Slawata schüttelte sorgenvoll den Kopf und sagte, die armen Opfer hätten wohl ihre Pflicht verletzt, denn das Kriegsgericht könne keinen ungerechten Spruch gefällt haben; aber man wisse ja, wie es in einer Schlacht zugehe, in dem grauslichen Getümmel könne manches mit unterlaufen; sie wären deshalb doch gute katholische Christen und des Kaisers treue Diener gewesen.
Das hätten sie selbst auch gesagt, fiel der Arbeiter eifrig ein, alle hätten ihre Unschuld beteuert und auch klar begründet, nur habe der Holk sie nicht zu Worte kommen lassen. Der Fähnrich habe zu guter Letzt noch gerufen: warum er eigentlich sterben müsse? Er habe nichts verbrochen, als dass er mit seinem General davongelaufen sei. Man habe deutlich gesehen, wie der Holk grün und gelb über diesen Worten geworden sei.
Ja, sagte Slawata, der Holk sei ein Ketzer und manche wollten sogar wissen, dass er mit dem Teufel zu tun hätte. Dergleichen Leute wären leider an gewissem Orte wohl angesehen. Schließlich gab er den Arbeitern ein reichliches Almosen, indem er sie ermahnte, der frommen Märtyrer im Gebet zu gedenken.
Während des Mittagessens, das er bei seinem Freunde, dem Oberstburggrafen Martinitz einnahm, erzählte Slawata, was er soeben vernommen hatte. Der junge Fähnrich, sagte Martinitz, habe argloserweise ausgesprochen, was jeder ehrliche Mann hätte laut sagen sollen: Wallenstein habe die Schlacht verloren und mit dieser Exekution seine Schande maskieren wollen. Warum hätte er auch sonst Sachsen so eilfertig geräumt? In Prag begreife niemand, wieso der Kaiser seinen prahlerischen Kriegsberichten Glauben schenken könne.
Das sei nur ein Glied in der Kette, sagte Slawata, Martinitz könne sich nicht vorstellen, wie es in Wien her-gehe. Da sei keine rechte Regierung am Hofe, sondern ein paar Ambitiöse, die er wohl nicht zu nennen brauchte, tyrannisierten alles, um ihren Beutel zu füllen, wie die berüchtigten römischen Statthalter im Altertum. Es wäre vielleicht vermessen, einem so gnädigen, gottseligen Kaiser etwas aufmutzen zu wollen; aber das sei gewiss, sein himmlisches Gemüt tauge für die von der luziferischen Schlange begeiferte Erde nicht, weil er das Böse nicht merke. Er sei wie ein Kind, das sein Händlein ganz gutmütig in den aufgesperrten Löwenrachen tauche.
So sei es ja unter den hochseligen Kaisern Rudolf und Matthias auch gewesen, stimmte Martinitz ein, man hätte sie oft wider ihren Willen retten müssen. Das sei jetzt auch notwendig, wenn nicht der allgemeine Ruin um sich greifen sollte.
Ihm sei es geradezu unleidlich, fuhr Slawata fort, dass ein gottloser Bösewicht wie Holk gutes adliges katholisches Blut verströmen dürfte. Ihm sei es nicht anders, als habe das vergossene Blut seinen eigenen Ehrenschild bespritzt. An diesem Beispiel zeige sich deutlich, dass man in schmähliche Servitut geraten sei.
Nach dem Essen kamen noch mehrere Herren, darunter die Grafen Michna und Mitrowitz, die alle ihrer Entrüstung über die Exekution des Morgens Ausdruck gaben. Man müsse sich mit Wallensteins baldigem Ableben trösten, sagte Graf Mitrowitz. Er habe einige seiner Diener in Sold, von denen kürzlich einer berichtet habe, der General könne es nicht lange mehr machen, esse fast nichts mehr und stöhne des Nachts vor Schmerzen.
Das Stöhnen, meinte Slawata, könne auch eine Frucht des bösen Gewissens sein, vielleicht habe er einen Pakt mit dem Gottseibeiuns geschlossen, und seine Zeit laufe bald ab. Wenn es aber wirklich so weit sei, würde Wallenstein umso mehr eilen, seine bösen Projekte zur Ausführung zu bringen, würde den Exulanten die Tür öffnen und mit ihrer Hilfe der heiligen Religion den Todesstoß versetzen. Darauf habe ihn der Teufel vereidigt, oder er tue es als ein Atheist aus eigenem Belieben.
Es wurde beklagt, dass mehrere Familien in Böhmen geblieben wären, die mit den vertriebenen Rebellen zusammensteckten, namentlich die Terzkys. Ihm sei kürzlich, sagte Martinitz, von einem, der auf den Terzkyschen Gütern bedienstet sei, eine Warnung zugekommen, als wollten die Terzkys den Wallenstein zum König von Böhmen machen. Der alte Terzky habe des Friedländers Bild in seinem Gemach hängen, und seine Frau, ein Teufelsweib, sei vollends außer Rand und Band und halte es mit den Schweden.
Das sei bekannt, sagte Slawata, welcher selbst in der Jugend das Bekenntnis gewechselt hatte, dass der Glaube der Neubekehrten nur ein dünngewebtes Mäntelein zu sein pflege, durch welches die alte Ketzerei hässlich hervorscheine. Die Alte solle ja auch evangelischen Prädikanten, die billigerweise an den Galgen gehörten, Unterschlupf gewähren.
Ja, das Geschlecht lasse von der alten Bosheit nicht, sagte Martinitz. Dem Kinsky, der alten Terzka Schwiegersohn, habe der Kaiser die Gnade mit vollen Händen angeboten, die Gnade habe er freilich angenommen, das lutherische Gift aber doch nicht von sich geben wollen. Es verlaute, dass häufige Briefe zwischen ihnen hin und her gingen, sie würden wohl etwas miteinander auskochen. Der alte Erzverräter Thurn spiele auch seinen Part dabei, möchte wohl wieder Oberstburggraf werden.
Indem sie erwogen, was für eine Umwälzung entstehen würde, wenn die Emigranten ihre konfiszierten Güter wiederbekämen, sagte Martinitz, man könne doch kaum glauben, dass Wallenstein ein solches Spiel in Gang brächte, wobei er selbst das meiste verlöre; denn er hätte ja, wie jeder wisse, dazumal das meiste an sich gerissen.
Slawata kicherte und sagte, wer das Vieh hätte, könne leicht eine Fuhre Mist verschenken; da liege eben der klare, gültige Beweis, dass der Friedländer auf die böhmische Krone ausginge, er würde sonst die Prätensionen der Rebellen nicht unterstützen.
Und wie es denn in Wien stehe? erkundigten sich die anderen; ob man da auf der Hut sei?
Der Kaiser wolle noch nicht recht heran, sagte Slawata, hörte und sähe leider mit Eggenbergischen und Questenbergischen Ohren und Augen. Auch sei er schon recht abgelebt, Gott wolle ihn noch lange erhalten. Der Thronfolger dagegen, der König von Ungarn, würde lieber heute als morgen mit Wallenstein abfahren, er sei fest überzeugt, dass der General an allem schuld und gleichsam der auf das Haus Österreich gewälzte Leichenstein sei. In dem König von Ungarn blühe die wahre spanische Tugend und Größe des habsburgischen Hauses wieder auf. Unter den hohen Offizieren könne man sich auf Aldringen verlassen, schade sei es, dass Collalto so früh habe dahin müssen.
Ohne den Kaiser werde sich doch aber nichts ausrichten lassen, wendete Martinitz ein.
Slawata zwinkerte listig mit den Augen. Der Kurfürst von Bayern, sagte er, der habe doch noch mehr Macht über den Kaiser als Eggenberg oder irgendein anderer, schließlich werde der wieder voran und Bresche schießen müssen. Zwar werde der fromme Fürst sich ungern aussetzen; aber die fast in den letzten Zügen liegende Religion werde er doch nicht verkommen lassen.
IV
Oxenstierna fand den französischen Gesandten Feuquières tölpelhaft und das ironische Lächeln in seinem steifen Gesicht unausstehlich, weshalb er sein Benehmen zwar höflich und entgegenkommend gestaltete, aber Wendungen persönlicher Vertraulichkeit einstweilen unterließ. Indessen veranlasste ihn das störrische Verhalten der in Heilbronn anwesenden Fürsten, Herren und Deputierten und die wühlende Tätigkeit kursächsischer und kaiserlicher Agenten, Feuquières zu einer besonderen Anstrengung aufzufordern, damit der Bund nach ihrem beiderseitigen Wunsch zum Abschluss käme. Feuquières sagte, er habe im Sinn, an die versammelten Stände eine Ansprache zu halten über die wohlwollende Gesinnung seines Königs, über die Vorteile, die sie durch bereitwillige Annahme derselben erlangen, und den Schaden, den sie durch Zaudern oder gänzlichen Widerstand auf sich ziehen würden; ob Oxenstierna damit einverstanden sei?
Durchaus, erwiderte dieser; er setze großes Zutrauen in Feuquières Eloquenz. Feuquières verbeugte sich mit ernster Miene. Ob Oxenstierna inzwischen bedacht habe, wie er des Königs Wunsch wegen Besetzung einiger fester Plätze an der Rheingrenze beantworten wolle?
So schnell könne er nicht denken, sagte Oxenstierna, im nördlichen Klima brüteten die Vögel länger über ihren Eiern als im Süden.
Und ein Schwan, setzte Feuquières hinzu, brüte länger als eine gemeine Taube oder Schwalbe; er zweifle nicht, dass Oxenstierna fruchtbare und segensreiche Entschlüsse ausreifen werde.
Feuquières wisse wohl, sagte der Kanzler, dass seines Königs Wünsche gewisse eigensinnige Meinungen oder Vorurteile der deutschen Reichsstände gegen sich hätten, und noch sei seine, Oxenstiernas, Stellung im Bunde nicht so befestigt, dass er sie beeinflussen, geschweige denn zu einem Opfer überreden könnte, dem sie abgeneigt wären.
Es handle sich ja um kein Opfer, sagte Feuquières; denn wenn der König Benfeld, Breisach, Schlettstadt und etwa Philippsburg besetzte, so tue er es, um seinen Verbündeten besser beistehen zu können, also einzig zu ihrem Wohle. Zum Beweise seiner Uneigennützigkeit diene seine Absicht, die Plätze nach Abschluss des zu erhoffenden Friedens zurückzugeben. Er könne nicht genug versichern, dass der König sich in diese Verhältnisse nur einließe, um dem Heiligen Römischen Reich zur Erneuerung seiner vormaligen Blüte zu verhelfen. Dies namentlich wolle er den Ständen in einer ausführlichen Rede auseinandersetzen.
Am Tage, nachdem Feuquières die Ansprache gehalten hatte, besuchte ihn zuerst der Markgraf Friedrich von Baden, um ihm zu sagen, was für einen tiefen Eindruck die Rede auf ihn gemacht habe, und welche Dankbarkeit die Zuneigung des Königs für die Protestanten ihm einflöße. Nach seinem Dafürhalten liege die Sache so, dass nur die Hilfe des französischen Königs einen guten Frieden herbeiführen könne.
Feuquières sagte, dass es seines Königs Wunsch sei, den Platz des glorreich gefallenen Königs von Schweden einzunehmen. Huldvoll und uneigennützig biete er den versammelten Reichsständen die Hand, sie brauchten sie nur anzunehmen.
Er habe schon durch seinen Abgeordneten vernommen, sagte der Markgraf, dass der König ihm eine gewisse Summe zur Verfügung stellen wolle, falls die kriegerische Zeit seine Hilfsmittel verschlungen habe. Das sei leider an dem, ohne Geld lasse sich ja nicht Krieg führen, namentlich heutzutage. Wenn der König ihn zu seinem Schuldner machen wolle, so mache er ihn dadurch zugleich zu seinem ergebenen Diener und Freunde, der jede Gelegenheit suchen werde, diese Gesinnung zu betätigen.
Nichts werde dem König lieber sein, sagte Feuquières. Des Königs großmütiges Herz brenne vor Ungeduld, dem Markgrafen gefällig zu sein, dessen Verdienste er hochschätze.
Der König habe im Sinn, sagte der Markgraf, ihm eine jährliche Pension von 2000 Reichstalern auszusetzen. Ob der König ihm vielleicht außerdem noch eine Anleihe gewähren wolle?
Feuquières sagte, er wolle es dem König melden und hoffe, dem Markgrafen bald eine erwünschte Antwort geben zu können.
Nachdem der Markgraf von Baden sich entfernt hatte, kam Pfalzgraf Johann von Zweibrücken, den Feuquières mit Danksagungen für sein der französischen Sache gewidmetes Wohlwollen und Vertrauen empfing. Die Zuneigung zu Frankreich, sagte der Pfalzgraf, sei in seinem Hause erblich. Jedermann wisse, wie seine Vorfahren für König Heinrich IV. Blut und Leben gewagt hätten. Freilich habe sich seitdem vieles verändert.
Der Pfalzgraf war noch nicht 50 Jahre alt; aber sein Gesicht war verfallen, er hielt sich nur mit Mühe stramm und fiel leicht in einen Zustand von Müdigkeit und Zerstreutheit.
Dem großen Gemüte des Königs, erwiderte Feuquières, sei Glaubenshass fremd. Er, Feuquières, sei zwar für seine Person in den Schoß der Kirche zurückgekehrt, aber seine Frau sei Hugenottin und erziehe auch ihre und seine Kinder in ihrem Glauben; trotzdem genieße er die besondere Gnade des Königs. Er habe zwar kaum nötig das anzuführen, da ja die Zuneigung seines Königs für den glorreich gefallenen Schwedenkönig, die er jetzt auf die evangelischen Reichsstände übertragen habe, genugsam beweise, dass er kein Fanatiker sei.
Der Pfalzgraf sprach von dem Bestreben des Königs, die ans Frankfurt und Speier ausgewiesenen Kapuziner zurückzuführen. Der Nachdruck, mit dem Feuquières das Geschäft betreibe, mache böses Blut namentlich bei den Städten, die Einmischung in ihre Angelegenheiten überhaupt nicht liebten. Auch er könne Feuquières deswegen nicht so unterstützen, wie er sonst gern täte.
Die Offenheit des Pfalzgrafen, sagte Feuquières, sei hochzuschätzen; aber er solle sich in die Lage des Königs versetzen, dem das Los seiner Glaubensgenossen am Herzen liege, und der durch uralte Titel zum Schutze des katholischen Glaubens verpflichtet sei. Da er so viel für seine Freunde im Reich täte, wäre es unpassend, wenn sie ihrerseits ihm, wenn auch nicht durch Unterstützung, doch wenigstens durch Zurückhaltung gefällig wären, wo es seine persönlichen Wünsche anginge.
Er habe nicht unterlassen wollen, seine Ansicht auszusprechen, sagte der Pfalzgraf; übrigens könne er dem König nichts vorschreiben, dessen Beistand er ja in Anspruch nehmen müsse.
Ob er dem König mitteilen dürfe, fragte Feuquières, dass der Pfalzgraf ihm die Freude mache, die als Zeichen besonderer Zuneigung ihm angebotene Pension anzunehmen?
Er nehme sie dankend an, sagte der Pfalzgraf, wisse sich leider anders nicht zu helfen. Das Haus Österreich habe sein Haus von jeher mit Hass und Neid verfolgt; seit er sich dem Schwedenkönig angeschlossen habe, sei das Band vollends zerrissen. Versöhnung mit dem Kaiser sei unmöglich, so müsse er den Waffen und Gott vertrauen.
Und dem König von Frankreich! setzte Feuquières hinzu; der werde einen so alten Freund und Bundesgenossen nie verlassen. Wenn die Reichsstände nur nicht selbst den König der Mittel beraubten, sie zu schützen! Es sei unglaublich, wie viele Schwierigkeiten sie machten, ihm ein paar Plätze, wie Breisach und Philippsburg, abzutreten.
Der Pfalzgraf schwieg und sah starr vor sich nieder. Der König wolle sich ja zum offenen Krieg gegen den gemeinen Feind nicht entschließen, sagte er endlich. Also komme es dem Bunde zu, seine Festungen selbst zu behaupten.
Es sei nur zu befürchten, dass der Bund bei der Größe des Kriegstheaters es nicht vermöchte, entgegnete Feuquières; aber er beharrte für den Augenblick nicht bei dem Gegenstand.
Es erschien nun ein Abgeordneter der Stadt Nürnberg, ein großer, beleibter Mann, dem das Heraufsteigen der eng gewundenen Treppe ein wenig den Atem versetzt hatte. Er hatte ein ausgedehntes fleischiges Gesicht und eine gebieterische Nase und ließ den Blick mit verhaltenem Misstrauen und feindseligem Spott auf dem schmalen Franzosen ruhen. Feuquières habe eine verständige Rede gehalten, sagte er, indem er sich langsam in den angebotenen Sessel niederließ. Die Herren Nachbarn wären Muster von Beredsamkeit, das wisse man ja. Er billige, was Feuquières gesagt habe. Entschlossen das gesetzte Ziel zu verfolgen, das sei auch immer der Grundsatz der Nürnbergischen Regierung gewesen; jedermann sei ja bekannt, wie die verstorbene Majestät von Schweden sich hauptsächlich auf sie gestützt habe.
Ja, sagte Feuquières lächelnd, das wisse man. Die Stadt Nürnberg sei eine vielumworbene Schöne, unter deren Fenstern die Herren Ständchen brächten.
Der Abgeordnete lachte, dass die goldenen Troddeln an seiner Weste zitterten. Feuquières zweifle hoffentlich nicht, sagte er, dass die Schöne tugendhaft sei? Tugendhaft und sehr wählerisch, bestätigte Feuquières. Sein König selbst achte sich nicht zu hoch, ihr seine Verehrung zu bezeigen.
Er vernehme es gern und mit gebührendem Dank, sagte der Nürnberger Gesandte. Er wolle nun mit uralter deutscher Aufrichtigkeit frei heraussagen, dass er ein Geschäft mit Feuquières zu machen gesonnen sei. Die Geschäfte der Stadt Nürnberg bedeuteten seit alters, dass sie den Potentaten das liebe Geld ausliehe; aber seit der Krieg im Schwange sei, wären viele säumige Zahler darunter, und das Blättlein müsse sich einmal wenden, so dass sie aus Gläubigern zu Schuldnern würden. Da nun der König von Frankreich sein Füllhorn darbiete, so wären sie entschlossen, die Gnade aufzufangen; eine erkleckliche Summe müsse es aber sein, damit der leere Kasten voll würde.
Den Herren von Nürnberg Geld anzuvertrauen, sagte Feuquières, sei fast mehr Weisheit als Gnade; besser könne man es auf der ganzen Welt nicht anlegen. Der König werde sich freuen, zum Glanze der goldenen Säule des Reichs und der guten Sache etwas beitragen zu können.
Feuquières wisse es lieblich zu wenden, sagte der Nürnberger. Das verständen sie im Reich nicht so gut, sie könnten den alten Bärenpelz noch nicht ablegen; wollten es auch nicht, schämten sich ihrer altdeutschen Rauheit nicht, weil sie mit Redlichkeit gepaart sei. Er wisse nichts anderes, als dem König untertänigen Dank zu sagen.
Feuquières versprach es auszurichten und hob die Weisheit hervor, mit der die Herren von Nürnberg das Staatsschifflein bisher so sicher durch den Sturm gesteuert hätten. Sie hätten in dem letzten, großen Jahre viel erleiden müssen.
Ja, und noch mehr stehe bevor, sagte der Gesandte mit einem Seufzer. Sie sollten Kassierer für das ganze Reich sein, und dabei würden die Einnahmen immer geringer.
Wenn die Deutschen, sagte Feuquières, nur mehr Zutrauen zu seinem König haben wollten! Sie besännen sich so lange, des Königs billigen Wünschen entgegenzukommen. Sie hätten ja keinen uneigennützigeren, treueren Freund! Wollten sie sich ihm nur auch recht eng und fest anschließen!
„Wir Nürnberger", sagte der Gesandte, „sind gewöhnt, auf eigenen Füßen zu stehen, und dabei stets gut gefahren. Die Freiheit ist eine Jungfrau, lockert sie den Gürtel nur ein wenig, so büßt sie ihre Kraft ein."
Ach, sagte Feuquières, solche Grundsätze wären in diesem Falle nicht angebracht. Der König von Frankreich gehe auf ein rechtmäßiges, gottgefälliges Ehebündnis aus. Er freue sich nur, dass ihre Strenge die Herren nicht verhindere, die Sympathie des Königs und ihre äußeren Zeichen anzunehmen, und er sei überzeugt, die gegenseitige Freundschaft werde dadurch befestigt, nicht gelöst werden. Er, Feuquières, bedürfe der Freunde in der Versammlung sehr. Er habe nicht geglaubt, dass die Stände es dem König so schwer machen würden, ihnen beizustehen.
Man müsse sich doch erst kennen lernen und verständigen, sagte der Nürnberger mit Zurückhaltung. Übereilung bei politischen Geschäften sei vom Übel; nur die Bündnisse wären von Dauer, bei denen jeder Teilnehmer seinen Vorteil finde.
Graf Philipp Reinhard Solms, der den Nürnberger ablöste, trat mit der Miene eines vertrauten Freundes ein. Nun, sagte er, Feuquières die Hand bietend, er komme, ihn wegen seiner Rede zu beglückwünschen. Es sei ein großer Erfolg gewesen. Damit habe er das entscheidende Gewicht in die schwebende Wage geworfen.
Er habe geglaubt, einmal die Sporen gebrauchen zu müssen, damit sie vom Fleck kämen, sagte Feuquières.
Die deutsche Langsamkeit, sagte Solms, sei ein großer Jammer und könne einen schier an der ganzen Nation verzweifeln lassen. Feuquières solle aber nicht glauben, dass alle so wären. Es gebe auch solche, die rasch mit der Hand am Schwerte wären.
So kenne er ihn, den Grafen Solms, sagte Feuquières, und ebenso großes Zutrauen habe er zu dem jungen Herzog von Weimar. Es habe ihn aber stutzig gemacht, dass der Herzog die Pension zurückgewiesen habe, die der König ihm habe bewilligen wollen. Er habe geglaubt, mehr Entgegenkommen bei dem Herzog zu finden.
Graf Philipp Reinhard machte ein nachdenkliches Gesicht. Wieviel denn Feuquières ihm angeboten habe? fragte er.
Sechstausend Reichstaler, antwortete Feuquières; der König habe dem Herzog durch eine so große Summe seine Sympathie und Anerkennung ausdrücken wollen.
Nun ja, sagte der Graf, er, Solms, würde sie mit Dank und Freuden angenommen haben. Aber dem Herzog Bernhard habe es wohl zu wenig geschienen. Er sei außerordentlich stolz. Feuquières möge verzeihen, dass er seine Meinung so offen heraussage, er tue es im Interesse des Königs. Nach seiner Meinung sei die Ursache dieses Refüs nur darin zu suchen, dass die Summe zu gering gewesen sei.
Feuquières bedankte sich für den Wink; er schöpfe nun Hoffnung, den Herzog doch noch zu gewinnen. Dem König liege viel daran, da des Herzogs Kriegstüchtigkeit und gute Gesinnung allgemein gerühmt werde.
Er sei tüchtig, sagte Solms, und der König tue wohl, ihn an sich zu fesseln. Doch müsse er sagen, dass Herzog Wilhelm, sein älterer Bruder, und Landgraf Wilhelm von Hessen fast ebenso wichtig wären. Besonders der letztere sei unübertrefflich, standhaft und zuverlässig und opfere alles dem Glauben und der Freiheit.
Aber ob er auch glücklich im Kriege sei? fragte Feuquières.
Er sei unermüdlich, erwiderte Solms, und habe in Melander einen erfahrenen General, der sich schon Anno 1618 beim Weißen Berge hervorgetan habe; auch wären die Hessen gute Soldaten. Herzog Bernhard werde von vielen für hitzköpfig und unbedacht gehalten.
Ob Solms denn glaube, fragte Feuquières, dass der Landgraf französische Bestallung annehmen werde? Der König habe ihm einen Titel in der französischen Armee und 1200 Gulden Pension zugedacht.
Der Landgraf sei hoch verständig, antwortete Solms, und sein Land sei durch das räuberische Hausen der Kaiserlichen ganz verarmt; es sei ein gutes Werk, ihm beizuspringen. Wenn er, Solms, raten dürfe, so solle Feuquières hauptsächlich Kursachsen gegenüber nicht sparen. Nur durch Geld könne der Kurfürst aus seiner Unschlüssigkeit gerissen werden. Wenn ihn überhaupt etwas in Bewegung setzte, so wäre es das Geld. Feuquières solle nur tapfer bieten.
Ja, wenn Kursachsen ein anderes Haupt hätte! sagte Feuquières. Jetzt könne man fast sagen, es sei nur ein Rumpf und wackele hin und her wie eine geköpfte Wespe.
Davon könne er erzählen! seufzte Solms. Feuquières werde aber schon selbst seine Erfahrungen in Dresden machen. Er, Solms, schlüge sich noch lieber durch Dornen, als dass er sich auf dem Miste wälzte. Darum sei er auch fest entschlossen, sich an Frankreich zu halten.
Feuquières sagte, es sei ihm eine wahre Erquickung, in Solms einen Deutschen nach der guten alten Art kennen gelernt zu haben. Solms habe vorhin erwähnt, dass er ein gutgemeintes Geschenk seines Königs nicht ausschlagen würde. Ob er ihn beim Wort nehmen dürfe?
Er stehe zu allen seinen Worten, sagte Solms, insbesondere aber zu dem, dass er sich mit ganzem Herzen an Frankreich schließen wolle.
Als Feuquières am Abend dem Herrn de l'Isle, den er nach Straßburg und Württemberg schickte, einige Instruktionen gab, sagte er zu ihm, er habe jetzt ein Trompetensignal herausgefunden, dass die deutschen Pferde unfehlbar in die blutigste Schlacht brächte.
„Ich habe Sie immer für ein großes Genie gehalten," sagte de l'Isle, indem er sich gegen Feuquières verneigte; „was ist es?"
Feuquières griff in eine Seitentasche seines Überrocks und warf eine Handvoll Goldstücke über den Tisch, dass es klirrte.
De l'Isle brach in helles Gelächter aus. „Diese Tiere scheinen sehr musikalisch zu sein!" sagte er.
„Das ist eine deutsche Eigenschaft," sagte Feuquières ernsthaft, „vermittelst welcher es mir hoffentlich gelingen wird, die Bedürfnisse der Deutschen in Einklang mit den Wünschen unseres Königs zu bringen."
V
Der gelungene Übergang über die Weser und die beim Überfall der Kaiserlichen gemachte Beute hatte die Unzufriedenheit des niedersächsischen Heeres für den Augenblick gedämpft, als aber Herzog Georg zur Belagerung von Hameln Anstalten traf, erwachte der Unwille von neuem. Da Knyphausen erklärte, sich der Sache nicht mehr annehmen zu wollen, erlaubten sich die Offiziere Vorstellungen beim Herzog und hoben namentlich den Mangel an Belagerungsgeschütz, Pulver und Mundvorrat hervor, allein Georg entgegnete, wenn er sich nur ernstlich zur Belagerung anschickte, würden ihn seine Vettern, die Herzoge von Celle und Wolfenbüttel, nicht im Stiche lassen. Diese waren aber mit dem Umsichgreifen Georgs durchaus nicht einverstanden, teils, weil sie sich dem Kaiser gegenüber nicht kompromittieren wollten, andrerseits auch, weil sie merkten, dass es ihrem kriegerischen Verwandten nur auf die eigene Vergrößerung ankam. Besonders Friedrich Ulrich war böse, weil Georg verlangte, dass die von ihm, Friedrich Ulrich, geworbenen Truppen sich mit seinen vereinigten, indem nach dem mit Schweden abgeschlossenen Vertrage er, Georg, die Verfügung über alle in Niedersachsen stehenden Heeresteile hätte; ferner, weil Georg Auflagen an Brot, Kleidern und Geld von seinen Untertanen erhob und sich auch sonst Eigenmächtigkeiten erlaubte. Der Wolfenbüttelsche Kriegsrat von Mandelsloh, der wegen dieser Geschäfte zwischen Braunschweig und den Quartieren Georgs hin und her reiste, kam auch nach Ohre zu Knyphausen; denn da er von dessen schlechtem Einvernehmen mit dem Herzog zu Lüneburg gehört hatte, hoffte er sich seine Unterstützung verschaffen zu können.
Knyphausen empfing Mandelsloh in einem niedrigen Zimmer, das durch einen umfangreichen Kachelofen erhitzt war, und hörte, in seinen Bierkrug starrend, zu, was der Rat von Herzog Georgs Rücksichtslosigkeit erzählte; wie er sich gebärde, als sei er allein auf der Erde, während er doch nur ein jüngster Sohn ohne Fürstentum und zurzeit fast ohne Apanage sei. Dann, wie er den neuen hessischen General Melander im Quartier vor Hameln getroffen habe, einen grämlichen, unartigen Mann, der ihn, Mandelsloh, wie ein armes Schreiberlein habe herunterputzen wollen. Da gehe es zu wie im Lager der übermütigen Prätorianer zur Zeit der römischen Kaiser! Er habe seine ganze Dexterität gebrauchen müssen, um zwischen diesen soldatischen Herren das fürstliche Ansehen zu wahren.
Nun, sagte Knyphausen, er sei gewiss mit dem barschen Wesen des Herzogs von Lüneburg nicht einverstanden; aber Herzog Friedrich Ulrich sei auch selbst schuld. Er, Knyphausen, habe sich dermaßen ausgesetzt und verwickelt, um das billige Recht der Herzog von Celle und Wolfenbüttel Georg gegenüber zu schützen, habe auch manches erreicht, und es wäre gewiss noch ganz anders über das Cellische und Wolfenbüttelsche hergegangen, wenn er sich nicht dawider gesetzt hätte; aber er habe bis dato noch keine Belohnung von ihnen gesehen. Wenn sie so fortführen, würden sie sich bald die treuen Freunde verscherzt haben. Er habe nur 2000 Reichstaler vom Herzog von Celle verlangt, die er notwendig brauche, der habe sie ihm abgeschlagen; nun sei er es müde, sich umsonst Widerwärtigkeiten aufzuladen.
Mandelsloh suchte den Herzog damit zu entschuldigen, dass allerorten Mangel sei; Knyphausen solle den unsäglichen Schaden bedenken, den der Krieg verursacht habe, man könne nicht alle Löcher auf einmal stopfen.
Auf das Notwendige, sagte Knyphausen, müsse aber doch gedacht werden. Er lasse jetzt den Herzog von Celle fahren. Der Herzog von Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich, sei hoch in seiner Schuld, er habe es noch nicht aufgegeben, seine Gebühr von ihm zu erlangen, und wenn der Herzog ihn befriedige, so solle er sehen, dass seine Sachen in guten Händen lägen.
Wieso denn der Herzog Knyphausens Schuldner sei? erkundigte sich Mandelsloh.
Ach, sagte Knyphausen, Mandelsloh solle nicht den Einfältigen spielen. Er habe vor Jahren dem jüngeren Bruder des Herzogs, weiland Herzog Christian, 20000 Reichstaler geliehen, welche Schuld der auf Friedrich Ulrich übertragen habe; das stehe noch immer aus, er habe bisher Geduld gehabt, brauche es aber jetzt hochnötig und wolle davon abhängig machen, wie er sich inskünftig gegen den Herzog verhalte.
Ach Gott, rief Mandelsloh aus, es sei ja Knyphausen bekannt, dass Wolfenbüttel noch in den Händen der Kaiserlichen sei, und wie unfürstlich Friedrich Ulrich zu Braunschweig sein eigenes Geld verzehren müsse. Das liebe Geld sei ja zurzeit rarer als Diamanten. Auch sei es immerhin eine im Nebel schwebende Sache mit der Christianischen Schuld.
Dagegen verwahrte sich Knyphausen, die Schuld sei sonnenklar, verbrieft und versiegelt, er könne alles nachweisen. Übrigens wolle er sich nicht auf Geld steifen, der Herzog könne es ihm auf ein Gütlein anweisen, etwa auf das Amt Syke; es trage nicht viel, grenze aber an das Amt Meppen, das Oxenstierna ihm als Rekompens versprochen habe, so sei es ihm bequem, und wolle er damit vorliebnehmen.
Und was denn Knyphausen Handgreifliches für den Herzog tun wolle? fragte Mandelsloh.
Des Herzogs Recht bei Georg und bei Oxenstierna vertreten, sagte Knyphausen; Oxenstierna höre mehr auf ihn als auf Herzog Georg, ja, Oxenstierna sei bereits sehr unzufrieden mit dem Herzog.
Das sei doch aber nichts Gewisses, worauf er die Hand legen könnte, meinte Mandelsloh.
So wolle er denn Mandelsloh seinen Sinn rund heraus sagen, war Knyphausens Antwort. Es sei unzweifelhaft, dass Georg die Festung Hameln für sich einnehmen wolle, die doch Friedrich Ulrich zustehe, und auf die er auch wegen ihrer Wichtigkeit nicht verzichten könne. Wenn es nicht zu verhindern wäre, dass Georg Hameln erstürme, müsse es wenigstens mit Wolfenbüttelschen Truppen besetzt werden. Das würde zwar Mühe kosten, er werde es aber durchsetzen. Wahrscheinlich sei es aber, dass es gar nicht dazu käme, denn Oxenstierna beabsichtige, den Herzog im Reich zu verwenden und, wie er Mandelsloh im engsten Vertrauen mitteilen wolle, ihm, Knyphausen, den Oberbefehl über die niedersächsische Armee zu geben. Dann sei Herzog Friedrich Ulrichs Sache im Trocknen.
Mandelsloh kratzte sich hinter den Ohren, trank ein Schlückchen und schob den Bierkrug wieder zurück. Das sei wohl schön und tröstlich, sagte er; aber bei alledem habe der Herzog doch keine Sicherheit, die ihm Knyphausens gute Dienste verbürgte?
Das gehe ihm nicht ein. Was Mandelsloh damit meine? sagte Knyphausen. Er fing langsam zu sprechen an, wurde aber schnell hitziger. Ob etwa eines ehrlichen Ritters Wort nicht mehr genüge? Es habe ganz anderen Potentaten angestanden als Friedrich Ulrich sei. Ob Mandelsloh eine bessere Bürgschaft wisse als sein Ehrenwort? Plötzlich sprang er auf und ging mit gezogenem Säbel auf Mandelsloh los: Der Herr solle ihm die Antwort nur gleich mit dem Schwerte geben.
Mandelsloh blieb ruhig auf seinem Stuhle sitzen und schüttelte missbilligend den Kopf. „So kommen wir nicht weiter," sagte er, „und es können auch solche Eruptionen des Herrn Feldmarschalls Gesundheit nicht zuträglich sein."
„Das ist wahr," erwiderte Knyphausen, indem er den Säbel einsteckte, „man setzt Gesundheit und Verstand bei diesem Leben zu. Die Hitze hier im Zimmer ist mir zu Kopfe gestiegen."
„Ja," sagte Mandelsloh, „der Wind bläst aus Westen, und die Erde gibt einen fruchtbaren Geruch von sich. Das kommt dem Herzog von Lüneburg bei seiner Belagerung zugute."
Nun, schloss Knyphausen, Mandelsloh solle seinem Herrn klarmachen, dass die 20000 Taler bei ihm, Knyphausen, wohl angewandt wären. Das Beste würde sein, wenn Herzog Friedrich Ulrich selbst ins Lager käme, sie könnten dann gemeinsam mit desto besserem Nachdruck vorgehen.
Als die beiden Herren aus dem Hause traten und sich die weiche, unruhige Frühlingsluft um die heißen Köpfe wehen ließen, erregte ein heranrollender Wagen ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht eine Botschaft von Herzog Georg oder gar von Oxenstierna, meinte Knyphausen, und es kam Mandelsloh vor, als ob der Ritter ihn eilig loszuwerden suchte. Indem er behutsam über den schlammigen Boden stapfte, warf er einen Blick in die Kutsche und glaubte ein wohlbekanntes Gesicht zu sehen; jedenfalls beschloss er in der Nähe zu bleiben, bis er sich über den neuen Gast Gewissheit verschafft hätte. Mit geringem Aufwand brachte er so viel heraus, dass der Ankömmling der ehemalige Wolfenbüttelsche Rat Rauschenberg war, der im Dänischen Kriege seinen Herrn an Wallenstein verraten hatte, und dass Knyphausen wegen der vermeintlichen Schuld Herzog Christians mit ihm verhandelte.
Friedrich Ulrich nahm den Bericht seines Kriegsrates zunächst sehr unwillig auf. Nun und nimmermehr wolle er Knyphausen die 20000 Taler geben, sagte er. Knyphausen sei es ja gewesen, der seinen armen Bruder Christian zum Bösen verführt und dadurch alles Unglück angestiftet hätte, und nun solle er ihn noch dafür belohnen? Davon zu schweigen, ob er überhaupt ein Recht darauf hätte.
Nach Recht und Unrecht pflegten die Kriegsleute selten zu fragen, meinte Mandelsloh bedenklich. Auch sei jetzt der Erzschelm, der Rauschenberg, bei ihm, der habe sich nicht gescheut, Friedrich Ulrich an Wallenstein zu verraten, werde jetzt das Judasgeschäft weitertreiben. Schließlich könne leicht an der Christianischen Schuld etwas Wahres sein, und davon sei er überzeugt, dass Knyphausen es sonst redlich mit ihnen meine. Mit Herzog Georg und der Cellischen Linie sei er ganz überquer, wenn Friedrich Ulrich ihm den Beutel ordentlich füllte, würden sie einen nützlichen Beförderer an ihm haben. Knyphausen habe sogar den Wunsch ausgesprochen, dass Friedrich Ulrich persönlich ins Lager käme, was er, Mandelsloh, aber widerriete.
Warum denn das? fragte Friedrich Ulrich. Er könne sich nicht denken, was Mandelsloh dagegen haben sollte. Es sei doch ein altes wahres Sprichwort, dass eine Armee am meisten ausrichte, wenn der Fürst sie selbst anführe.
Nun ja, sagte Mandelsloh, aber mit dem Kriegswesen laufe es heutzutage wunderlich, eins, zwei, drei habe man eine Schlappe weg, dann falle der Schimpf auf den Fürsten anstatt auf den Feldhauptmann.
Mandelsloh wolle doch nicht etwa andeuten, fragte Friedrich Ulrich misstrauisch, dass es ihm an Tapferkeit oder sonst Feldherrngaben mangle?
Das wolle er beileibe nicht, versicherte Mandelsloh, erinnerte aber daran, wie empfindlich es etwa der Kaiser aufnehmen könnte, womit sich Friedrich Ulrich einstweilen beschwichtigen ließ. Hinsichtlich der Christianischen Schuld
machten sie aus, dass der Herzog dieselbe nicht anerkennen, aber Knyphausen die 20000 Taler als Belohnung versprechen und das Amt Syke pfandweise dafür einräumen sollte, wenn Knyphausen zuwege brächte, dass Hameln, falls Herzog Georg es eroberte, nicht in seinem, sondern in Friedrich Ulrichs Namen besetzt würde.
VI
„Vergesse der Herr Oberst nicht, dass er zu seinem General und einem deutschen Reichsfürsten spricht," sagte Herzog Bernhard zum Obersten Pfuel; „sonst zwingt er mich, anstatt der Hand des Kameraden, das Schwert des Herrn gegen ihn zu gebrauchen."
Der Oberst sah dem Erzürnten dreist in die Augen und sagte: „Ich vertraue auf meines Generals und eines tugendhaften Fürsten Gerechtigkeit. Wir kämpfen alle nicht umsonst, auch der Heilige rechnet auf einen Platz an Gottes Seite."
„Ich rede nicht von der Sache," sagte Bernhard; „aber den drohenden Ton sollt ihr mäßigen."
Stände Bernhard ihnen in der Sache bei, antwortete Pfuel, so wollten sie den Ton gern umstimmen; es sei in der Natur, dass man laut riefe, wenn man leise nicht gehört würde.
Er habe gehört, sagte Bernhard, und sich sehr verwundert, dass sie ihre Klagen in diesem Augenblick vorbrächten. Wenn Gelegenheit zu einer großen Aktion wäre, müsse ein rechter Offizier Essen, Trinken und Schlafen, ja das Atmen darüber vergessen; leben könne man wieder, wenn die Gelegenheit genützt sei. Wenn sie den Aldringen jetzt geworfen hätten, wäre Bayern ihnen offen gewesen. Er selbst gebe ihnen das Beispiel. Pfuel wisse wohl, was für große Projekte er wegen Regensburg gehabt hätte: er habe sie fahren lassen, um im Verein mit dem Feldmarschall Horn Schwaben zu schirmen. Davon, dass er auch vieles, und mehr als die Obersten, vom schwedischen Kanzler zu fordern hätte, wolle er nicht reden.
Und warum er nicht davon redete? fragte Pfuel. Nun, Bernhard sei ein großer Herr und Fürst und komme wohl immer noch zu dem Seinigen; sie, als arme Obersten und Privatleute, müssten sich beizeiten umtun. Je höher der Schuldner stehe, desto unsicherer sei er. Manch ein großer Kaufherr sei um des Kaisers willen zum Bettler geworden.
Herzog Bernhard stand still, bückte sich nach einem Löwenzahn, der am Wege blühte, starrte in den rötlichgelben Strahlenkelch und ließ die Blume wieder fallen.
Geld sei ja jetzt vorhanden, fuhr Pfuel fort, der französische Gesandte streue mit vollen Händen in Heilbronn aus; aber bis an die Donau fliege der goldene Samen nicht. Ja, wer habe denn eigentlich das Hauptverdienst um die großen, wundervollen Eroberungen, die gemacht worden wären? Etwa die schwedischen Edelleute, die Räte und Schreiber, die sich jetzt in Heilbronn gütlich täten und mit goldenen Ketten prunkten? Da müsste die Sonne vom Himmel stürzen, wenn es so auf Erden zuginge, dass die Müßiggänger gemästet würden, und die, welche Schweiß und Blut verackerten, leer ausgingen!
Er habe bereits erwidert, dass er ihre Sache führen wolle, sagte Herzog Bernhard; ob sie bei ihm nicht in guten Händen wäre?
Das wohl, versicherte Pfuel, sie vertrauten gänzlich auf ihn; aber sie unterständen sich, ihn zu erinnern, dass er den Augenblick am Schopfe fassen müsse. Jetzt habe Moses mit dem Stab an den Felsen geschlagen, jetzt müsse ein jeder sein Schälchen unter die Quelle halten.
Gut, sagte Bernhard, er wolle mit Horn reden und verbürge sich dafür, dass ihre Forderungen dem Kanzler eingereicht und von ihm unterstützt werden würden; dagegen solle Pfuel versprechen, die Armee zur Ruhe und zum Gehorsam zurückzubringen.
Lieber hätte Bernhard die Unterredung mit Horn hinausgeschoben; allein er war gewöhnt, sich der drückendsten Aufgaben am schnellsten zu entledigen und suchte den ungeliebten Mitfeldherrn sofort auf. Horn hörte Bernhards Vorschlag, sie wollten die Forderungen der Obersten bei Oxenstierna vertreten, missbilligend an; es wundere ihn und sei noch nie erlebt, sagte er, dass ein Feldherr sich meuternder Soldaten annähme, die von Rechts wegen an den Galgen gehörten.
Bernhard rügte den scharfen Ausdruck: wenn es Meuterer wären, würde er nicht für sie eintreten. Sie suchten ihr Recht, und das stehe freien Männern zu.
Jetzt gelte kein anderes Recht für sie als das Soldatenrecht, sagte Horn. Wohin käme man, wenn Soldaten wegen ausstehender Forderungen den Dienst verweigern dürften?
Würden berechtigte Forderungen dauernd übersehen, so verliere man den Kredit, entgegnete Bernhard, und werde zuletzt niemand mehr für einen arbeiten. Horn solle sich einmal von der Stimmung überzeugen, die unter den Soldaten herrsche.