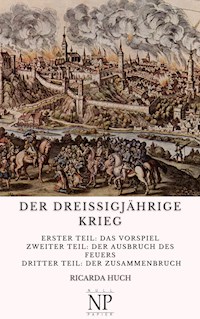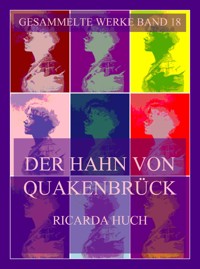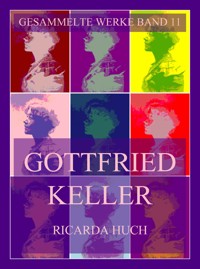0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ricarda Huch Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Werk trat die Huch in die erste Reihe der dichtenden Frauen überhaupt. Es ist ein Buch von Schönheit und Tod, das mit Staunen und Bewunderung erfüllt. Ludolf Ursleu, der letzte, etwas matte Spross eines norddeutschen Patrizierstammes, schreibt in der Zelle eines schweizerischen Klosters, in das er sich, müde des Weltgetriebes, zurückgezogen hat, die an Schicksalen überreiche Geschichte und den endlichen Untergang seiner Familie nieder. Es ist ein Buch von chronikartigem Charakter, durchströmt von einer Fülle äußeren Geschehens und von einer Flut komplizierter seelischer Bewegungen. Das Leben erscheint in einer feinen, romantischen Art stilisiert. Oft scheint es gelöst von aller irdischen Schwere und emporgehoben in ein klareres, aber auch kühleres Licht. Die Geschehnisse des Romans kristallisieren sich um ein liebendes Paar herum, das im Mittelpunkt steht: Galeide und Ezard. Eine große, starre, fast überirdische Liebe verknüpft sie; eine verbotene, wahnwitzige Liebe, denn Ezard ist durch die Ehe an eine andere Frau gebunden; eine Liebe voll dunkler Glut, die weder Rücksicht auf die Leiden anderer nimmt, noch ein Schuldbewusstsein in den Gefühlen der Liebenden aufkommen lässt. Und diese allmächtige Liebe bricht, das Schicksal will es, in sich zusammen wie ein morsches Gerüst, und das Mädchen mit ihren verwirrten Gefühlen findet darüber den Tod. Nicht was den Stoff betrifft, aber in sprachlicher und auch in technischer Hinsicht lässt der Roman erkennen, dass die Dichterin von Gottfried Keller gelernt hat. Der "Ludolf Ursleu" ist ein selbständiges und höchst persönliches Kunstwerk, das ist stark zu betonen, aber es führen Fäden zu Keller hinüber. Einzelne, in sich abgeschlossene Episoden von novellistischem Reiz schaukeln, gleich belebenden Kähnen, auf dem Strom der Handlung, nicht willkürlich, sondern weise verteilt. Die Dichterin liebt es, behagliche Perioden zusammenzuschweißen, Sätze mit starkem Gefühl für ihren Rhythmus ineinanderzuschachteln, wodurch mitunter eine beinahe wissenschaftlich solide Art der Darstellung erreicht wird. "Ludolf Ursleu" ist technisch von einer Meisterschaft, wie sie Keller in seinen großen Werken nicht erreicht hat. Die Komposition des Buches ist mit einer unheimlichen Sicherheit bewältigt, und jeder Teil des Ganzen zeigt die gleiche wundersame Gliederung. Keller ist behaglicher und krauser, die Huch jedoch klarer und kühler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren
RICARDA HUCH
Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681799
Der Text dieser Ausgabe folgt der Ausgabe "Gesammelte Werke, Erster Band" (1966). https://www.google.de/books/edition/Erinnerungen_von_Ludolf_Ursleu_dem_J%C3%BCng/dbMHAQAAIAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=erinnerungen+von+ludolf+ursleu&printsec=frontcover.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II2
III5
IV.. 8
V.. 12
VI15
VII19
VIII23
IX.. 27
X.. 32
XI35
XII40
XIII44
XIV.. 48
XV.. 54
XVI60
XVII64
XVIII67
XIX.. 74
XX.. 80
XXI84
XXII89
XXIII97
XXIV.. 103
XXV.. 108
XXVI113
XXVII120
XXVIII128
XXIX.. 135
XXX.. 140
XXXI146
XXXII152
XXXIII159
XXXIV.. 164
XXXV.. 170
XXXVI176
XXXVII183
XXXVIII188
XXXIX.. 192
I
Von Martin Luther, welcher die Anlagen hatte, ein großer Mensch zu werden, heißt es, dass er eines Tages habe zusehen müssen, wie ein im Gespräch neben ihm wandelnder Mann vom fallenden Blitz jäh erschlagen wurde. Dieses Erlebnis soll ihn im Gemüte so erschüttert haben, dass er sich von der Welt abkehrte, Mönch wurde und ins Kloster ging, worin er leider nicht verblieben ist. So ist es mir ergangen, wenn auch der Blitz, den ich blindlings niederfahren sah, nicht der äußerlichen Welt angehörte; aber er war nicht minder vernichtend.
Ich sah auf einmal, wie ich jetzt ausführlich beschreiben will, dass es nichts und gar nichts gibt, was im Leben einen festen Stand hat. Das Leben ist ein grundloses und ein uferloses Meer; ja, es hat wohl auch ein Ufer und geschützte Häfen, aber lebend gelangt man dahin nicht. Leben ist nur auf dem bewegten Meere, und wo das Meer aufhört, hört auch das Leben auf. Wie wenn eine Koralle aus dem Meere tritt, so erstirbt sie. Und wenn man die schönen, glasbunten Quallen aus dem Wasser nimmt, so hat man eine scheußliche Gallerte in der Hand. Nun, meine ich, ist es so mit den Menschen und dem Leben: man kann wohl Ruhe und Sicherheit erlangen, aber nur, wenn man auf das Leben mit seinem fröhlichen Wellenspiel, seinen wechselnden Farben, seinen tollen Stürmen verzichtet. Viele meinen, und besonders die jungen Leute und alte, die nichts erlebt haben, inmitten der unaufhaltbaren Bewegung, wo die erste Welle im Augenblick des Werdens schon mit der zweiten verschmilzt und so fort, und der vergangene und der nächste Augenblick so zwillingsmäßig miteinander verwachsen sind, dass sich kein kleinstes Stückchen mit Namen Jetzt oder Gegenwart dazwischen klemmen lässt, gäbe es so allerhand ewige Felsen. Damit meint man Liebe und Freundschaft und andere Empfindungen des Herzens; denn diese stimmen einen glücklich und darum gut, und darum hält man sie für heilig. Nun aber, was soll aus diesem kindischen Dinge, dem menschlichen Herzen, Ewiges kommen? dem Springinsfeld, der nie das Stillsitzen lernt in der Schule des Lebens? Das beständig hin und her zittert, als ob es auf allzu langem Stiele säße wie die Blätter der Espe? Es fährt als ein Kähnlein auf dem gewaltigen Lebensmeere umher, und bald schluckt es zu viel Wasser und sinkt und verzagt, bald tragen Wellen es in die Lüfte, dass es sich dem Himmel nähert, und dann jauchzt es voll Übermut und triumphiert. Aber es muss wieder hinunter, und wenn es unten ist, wieder hinauf. Es kann auch eine glatte Bahn durchlaufen oder in eine Meeresstille geraten, dass es still und bange daliegt wie vor dem Magnetberge. Aber wie es auch sei, den Hafen findet es nicht im Meere, Häfen sind am Ufer; das ist das Jenseits.
Mein Boot, welches eine leidlich unscheinbare Fahrt hatte, geriet in einen großen Sturm und Schiffbruch und wurde an den Strand geschleudert. Nicht gemächlich lief ich ein in die Bucht, ich ward ausgespie
n wie Robinson. Meine wüste Insel und mein Jenseits ist das Kloster Einsiedeln. Da hause ich nun, und das Leben liegt auf immer dahinten. Aber es ward mir so gut, dass ich, wenn ich auch nicht mehr lebe, doch nicht tot bin, sondern das weite Wasser, das ich durchfuhr, vom Strande aus betrachten und meine Reise bedenken kann. Ich habe immer gefunden, dass das Beschauen das Schönste im Leben sei. Wer in einem prächtigen Umzuge mitgeht, schluckt den Staub ein und schwitzt und würgt hinter seiner Maske; was hat er von seiner eigenen kostbaren Verkleidung und den übrigen Festbildern um sich her? Er sieht es alles nicht, nur etwa das allernächste, und das nicht vollkommen. Wer aber oben auf dem Balkon steht oder nur auf eine Gartentür geklettert ist oder sogar nur aus einer Dachrinne mühselig hervorlugt, der hat es alles vor seinen Augen, als wäre er der Herrgott, und es würde alles ihm vorgeführt eigens zu seiner Lust. - So macht es mir Vergnügen, die Tage meines verflossenen Lebens an mir vorübergehen zu lassen wie eine Prozession. Es wird seltsame Gestalten zu sehen geben, bunte Fahnen, Bilder, Symbole und Schaustücke. Ich kann sie schneller und langsamer gehen heißen je nach Geschmack, und die schönsten und seltsamsten kann ich zu mir heranrufen, um sie genauer zu betrachten und zu betasten. In diesem Sinne schreibe ich die Geschichte meiner Erlebnisse, verborgen vor jedermann; denn eine fromme Legende wird es nicht sein.
Ich will auch von meiner Kindheit und frühen Jugend einiges erzählen; denn wenn man das niedliche Küken nicht kennt, tut man dem Huhne im Urteil unrecht, und der edle Schwan ist einem weniger wert, wenn man nicht weiß, dass er einmal das hässliche junge Entlein gewesen ist. Wer mit einem aufgewachsen ist, sieht im Gesichte immer noch die zarten, guten Züge des Kindes, und wer einmal in einem Museum ein altes Wikingerschiff gesehen hat, der betrachtet unsere Dampfschiffe mit doppelter Neugier und reicheren Gedanken.
II
Ich bin in einer norddeutschen Hansestadt geboren, einer Stadt, deren ich niemals gedenken kann ohne Verwünschungen und niemals ohne Tränen. Mein Vater war ein begüterter Kaufmann; aus solchen setzt sich dort die angesehene Bevölkerung zusammen. Diese haben meist viele Länder und Völker gesehen und haben sich dadurch weltmännische Gewandtheit erwerben können. Da man sich in der Fremde weniger gehen lassen kann als zu Hause, haben sie sich eine feine Haltung und gefälliges Wesen angewöhnt, wie man es nicht in vielen Kreisen findet; damit machen sie Eindruck, und es erfüllt mich noch mit Behagen, mich im Geiste in eine Gesellschaft solcher Männer zurückzuversetzen. Wenn sie nun auch viele Sorgen haben, so geht doch alles im Großen zu, und solange sie überhaupt mitspielen im Leben, haben sie auch Geld und geben es reichlich aus. Eine wahrhaft gediegene Bildung geht ihnen zwar ab, und sie fragen auch nicht danach, obwohl sie um keinen Preis den Anschein derselben missen möchten. Es ging schön und herrlich zu in meiner Jugendzeit, wie bei den Phäaken. In unserm Hause herrschte diese Art zu leben auch, und doch war vieles anders als bei den anderen. Meine Familie von Vaters Seite war auch nicht von jeher einheimisch in dieser Hansastadt gewesen, erst mein Großvater war eingewandert. Meine Vorväter waren Pfarrherren gewesen, wovon zwar nichts mehr an den Nachkommen haften geblieben war als ein Hang zur Gelehrsamkeit und zu dem, was über diesem Irdischen ist.
Die Ursleuen der alten Zeit waren vielleicht religiöse Schwärmer; die, deren ich mich entsinne, hielten es nicht mehr mit der Religion, wie das denn jetzt dem Zeitgeiste weniger entsprechend ist. Sie beschäftigten sich mit der Poesie, den Künsten und Wissenschaften, nur obenhin zwar und nach der Weise von Laien, aber gerade darum so recht herzlich und voll Begeisterung und gar nicht wie die übrigen Phäaken, nur um es in den Gesellschaften wieder anwenden zu können. Denn wir lebten meist für uns, das will sagen innerhalb der Familie, die nun freilich groß genug war.
Mein Vater, Ludolf Ursleu der Ältere, musste seine herrlichen Kräfte leider in kaufmännischen Geschäften und Sorgen aufzehren. Aber aus Rücksicht für uns und aus einem gewissen Schönheitssinn ertrug er das alles heimlich für sich. Denn im Herzen hielt er seine Beschäftigung für ein notwendiges Übel zum Zwecke des Gelderwerbens und verachtete sie; man hielt in unserem Hause für die eigentliche Aufgabe des Menschen, das Leben wie ein schönes Gewand oder Schmuckstück zu tragen, das Haupt hochzuhalten und heiter zu sein. Mein Vater mochte das auch darum für das Allerwürdigste halten, weil meine Mutter zur Verwirklichung solcher Auffassung geschaffen schien.
Wie schön war sie! Wenn man sie ansah, dachte man zwar zuerst nicht an das Schöne, denn sie war vollkommen und deshalb weit weniger auffallend als eine, der noch irgendetwas gemangelt hätte. Aber man wurde heiter und froh diesem Antlitz gegenüber, und soviel ich weiß, kam es auch den Frauen nicht in den Sinn, sie um dieses Vorzuges willen zu beneiden. Sie machte niemals Staat mit ihrer Schönheit, obwohl sie großes Vergnügen an ihr hatte; denn sie war in der Art kindlich, wie man es von den wilden Völkern geschildert liest, und wie solche hätte sie sich mit bunten Glasperlen behängen und ihr Spiegelbild im Wasser anlachen können, ohne daran zu denken, dass sie es sei, die da so reizend hervorglänze. Alles, was sie sagte und tat war so lauter und urwüchsig wie ein Quell an der Stelle, wo er oben in prächtiger Waldwildnis aus der Erde herausspringt. Ich pflegte sie als Knabe öfters zu betrachten und darüber nachzusinnen, wie sie im Alter aussehen würde; das machte mich nachdenklich, denn ich konnte es mir in keiner Weise vorstellen, ebenso wenig wie man sich die Venus von Milo als eine alternde Frau denken kann. Sie schien in Wahrheit den leichtlebenden, unsterblichen Göttern anzugehören. Mein Vater war wohl auch ein starker und schöner Mann, aber Denken und Sorgen und die Jahre gingen doch nicht über ihn hin, ohne ihre Furchen einzugraben. Als ich den Mythus von der Göttin der Morgenröte und ihrem sterblichen Gatten kennen lernte, wie er in ihren rosigen Armen unaufhaltsam welkte, kamen mir immer meine Eltern in den Sinn, weniger wie sie gegenwärtig waren, als wie ich sie mir in der Zukunft dachte. Meiner Mutter selbst wäre ein solcher Vergleich niemals eingefallen, denn sie dachte überhaupt wenig über sich nach, und empfindsam war sie gar nicht. Nichts, weder Liebe noch Hass, hätte bei ihr eine Leidenschaft werden können. Ihre glückliche Natur stand gewissermaßen mit ihrer Schönheit im Bunde; was sie fühlte, war nie so heftig, dass es die letztere hätte verletzen können.
Ich, das älteste Kind, wurde nach meinem Vater benannt. Ich glich ihm aber wenig im Innern und Äußern, immerhin doch so viel, um anderen Leuten gegenüber die Gemeinschaft mit ihm stark zu empfinden. Ich hatte leichteres Blut als er. Das war die Ursache, dass ich eine wildere Jugendzeit durchlebte, als er sich je gewünscht oder gestattet hätte; hernach aber, dass meine Jugend rascher von mir abfiel als von ihm und ich ein griesgrämiger Greis wurde in einem Alter, wo er seinerzeit noch ein stattlicher Mann gewesen war.
Nach mir kam meine Schwester Galeide, von der ich auf diesen Blättern am allermeisten zu sprechen haben werde. Weil sie bei weitem nicht so schön war wie meine Mutter, kam ihr Äußeres bei uns nicht in Betracht. Doch war sie im Grunde ein wonnig Ding, weich und rund an allen Gliedern, bequem und wohlig auf dem Schoß zu haben wie eine junge Katze, still und zufrieden. Sie wurde deshalb gehätschelt und verzogen, was sie sich alles gleichmütig gefallen ließ und nur mit geringer Zärtlichkeit erwiderte. Ich muss aber sagen, dass sie auch sehr anhänglich und liebevoll sein konnte, wenn sie einmal eine Zuneigung gefasst hatte; böse war sie eigentlich mit niemandem. Sie hatte gern, dass man sie gewähren ließ, und war nicht ungern allein. Sie lag dann etwa in der Sonne und spielte Theater mit den Wolken, oder träumte auch nur und hatte meistens ein Kätzchen, ein Kaninchen oder ein anderes Tier bei sich, wie sie denn überhaupt die Tiere den Menschen vorzuziehen schien. Es war auffallend, wie auch die Tiere sie von jeher aufsuchten und ihr zahm wurden. Weil sie für gewöhnlich sanft und friedfertig war, hatte man sich in der Verwandtschaft angewöhnt, sie »das gute Kind« oder »die gute kleine Galeide« zu nennen. Diese Redensart machte ich nicht mit; denn ich sagte mir immer, gut ist sie eigentlich nicht, sie tut nur, was ihr behagt, und es trifft sich, dass das gerade mit dem Behagen der anderen übereinstimmt.
Gegen mich ist sie immer sehr liebreich gewesen und obwohl ich um mehrere Jahre älter war, oft in mütterlicher Weise. Überhaupt war es eigentümlich, wie sie zugleich so kindisch und so mütterlich sein konnte; das war sie beides, solange sie lebte, dazu freilich auch noch manches andere, wovon ich später reden will.
III
Wer meine Vaterstadt schön nennt, der liebt breite und gerade Straßen, große und reinliche Häuser und viereckige Plätze. Mir ist alles das zuwider. Es gibt da auch alte Quartiere, aber sie weisen sich als solche nur durch ihren Schmutz und ihre Enge und Dumpfheit aus, nicht durch ein würdiges Antlitz voll Erinnerung. Ja, in Schwaben sollte man leben, in den uralten Reichsstädten, in denen man einhergeht wie mitten in einem liebreichen Märchen der Vorzeit. In meiner Knabenzeit freilich verstand ich davon nichts, einesteils weil ich es nicht kannte, dann aber hätten mir auch die Kenntnisse und die Erfahrung dazu gefehlt.
Anders ist es mit der Natur; das Verständnis ihrer Sprache wird mit uns geboren. Ja, sie ist die älteste und treueste und echteste Freundin der Menschen. Einer, an dessen Wiege sie nicht steht, und dessen Jugend sie nicht behütet, auf dem liegt ein Fluch; seine Seele wird nie gelöst, sein Busen kann sich nie ganz eröffnen, er ist wie ein Keim, dem die Sonne fehlt. Ich wäre auch anders geworden, wenn ich in der Schweiz geboren wäre. Denn ich glaube, mein Genius war nicht übel geartet, und es fehlte nur wenig, dass ich etwas Rechtes geworden wäre. Aber wenig oder viel, fehlt überhaupt etwas, so ist es missraten und taugt nichts.
Als ich ein Knabe von dreizehn Jahren war, nahmen meine Eltern mich mit in die Schweiz. Damals war ich noch leidlich brav, fleißig und verständig. Als ich nun die Berge eine Zeitlang gesehen und mich an sie gewöhnt hatte, kam ein nie geahntes und wahrhaft himmlisches Glück über mich. Ich liebte den Wald und die weißen Bergköpfe mit stürmischer Zärtlichkeit, Demut und Angst. Ich kann mich noch wohl in meine unschuldigen und seligen Gefühle aus jener Zeit versetzen, und kann es nicht ohne Rührung. Ich meine das zutrauliche Bübchen zu sehen unter den gewaltigen guten Tannen und zwischen den Felsblöcken mit ihren verwitterten Gesichtern. Galeide war auch mit, und ohne großes Erstaunen von sich zu geben, rannte sie mit wilder Freude in diese schöne Natur hinein, als ob sie es nie anders gehabt hätte. Während ich mich gern in den schönen Wäldern im Tale erging, verlangte sie beständig auf die hohen Berge hinauf, zu deren Besteigung sie auch eine Kraft und ein Geschick zeigte, die an einem Kinde ihres Alters in Erstaunen setzten. Wenn wir auf einer Höhe ankamen, pflegte sie vorauszuspringen, ein bacchantisches Triumphgeschrei erschallen zu lassen und ihre Locken im Winde zu schütteln.
Dies ärgerte mich, da ich es für indianermäßig, unästhetisch und ganz unmädchenhaft ansah. Indem ich es mir jetzt vergegenwärtige, sage ich mir, dass es immerhin charakteristisch für meine Schwester Galeide war.
Sie bekam einmal, während wir im Gebirge waren, ein Murmeltier geschenkt, worüber sie eine unsinnige Freude hatte, die mich auch ärgerte. Noch mehr die närrische Art, in der sie sich mit dem Tiere gebärdete, als ob es viel vorzüglicher sei als alle Menschen. Später, als wir wieder zu Hause waren, passte das Bergestier nicht mehr in unsere städtischen Verhältnisse, und unsere Eltern nahmen es Galeide fort. Sowie sie das erfuhr, erzeugte der Kummer ein heftiges Fieber in ihr; ich sehe sie noch, in einen goldfarbigen Plüschsessel gekauert, mit halber Stimme seltsam singen in ihren Phantasien. Der Zustand war so beängstigend und keineswegs von ihr erkünstelt, dass man ihr das Tier wiedergeben musste. Das Merkwürdigste ist nun dies: als es starb, während sie gerade nicht zu Hause war, bemächtigte sich der ganzen Familie ernste Besorgnis vor Galeides wilden Schmerzensausbrüchen. Keiner mochte der Überbringer so grässlicher Nachricht sein (über die im Grunde jeder vernünftige und reinliche Hausbewohner von ganzem Herzen erfreute Loblieder anstimmte). Mit höchster Zartheit und Schonung wurde ihr endlich der Todesfall mitgeteilt, aber siehe da! nicht ein einziges Tränlein rötete ihre milden Augen. Sie streichelte den pelzigen kleinen Leichnam liebevoll und bemitleidete das Tierchen in den holdseligsten Ausdrücken, dass ihm sein lustiges Lebensfädlein so früh durchschnitten sei. Auch bewahrte sie ihm ein wahrhaft treues Andenken und erzählte stets gern Histörchen und Anekdoten aus Urselinos Leben (so hatte sie die unselige Kreatur benannt); wollte auch nie ein anderes haben. Aber ich hatte immer den Verdacht, als freue sie sich über das hübsche Bildchen, das als Zuwachs in ihren Gedächtnis- und Erinnerungskasten gekommen war.
Während meine jüngere Schwester solchergestalt noch mit ganz einfachen und kindlichen Leidenschaften wirtschaftete, entspann sich für mich das erste Liebesabenteuer. Ich kann nicht umhin, dieses artigen Geschichtchens hier zu gedenken; es verlief so unschuldig und sittig, wie es mir leider späterhin nicht mehr geraten ist. Hätte ich immer mit der Seele jenes dreizehnjährigen Bürschchens fürliebgenommen! So wäre manches nicht gewesen, was mich damals wenig beglückte, und dessen ich mich jetzt schäme.
Nun also: Wir waren an dem unsäglich schönen Wallensee, dem man tückische Wildheit nachsagt. Ich liebte ihn dafür umso mehr, dass er die Menschen befehdete, die ihn befuhren, und hegte daneben die Zuversicht, er werde wohl wissen, dass ich jenen nicht beizurechnen, sondern ein Mensch für sich sei, der ihn wohl verstehe und heilig halte. Außerdem hielt ich es für ein seliges Los, unter diesen grünen Wellenhügeln begraben zu sein und durch das bewegliche smaragdene Glas unbeweglich in den blauen Himmel darüber sehen zu können. Meine Eltern erlaubten mir aber niemals, allein auf den See zu gehen. Hierüber war ich anfangs schwer beleidigt und erschien mir für ewig geschändet, als mir der Schiffsmann einmal zur Begleitung sein Töchterlein mitgab, welches allem Anscheine nach jünger als ich war. Dies Ding, Kordula, ergriff behände die großen Ruder und setzte sie in Bewegung, und ich betrachtete voll Verwunderung die mageren, aber höchst zierlichen braunen Arme, wie sie wacker und unermüdlich arbeiteten. Ihre Haare waren ein wenig zottig, was ich aber bald, entgegen meiner sonstigen Geschmacksrichtung, sehr liebreizend fand; ihre dunklen Augen waren nicht groß, aber nicht ohne eine gutmütige Schlauheit im Ausdruck. Als sie anfing zu reden, entrüstete sich aber mein Schönheitsgefühl, und ich begann sie ärgerlich zu kritisieren wegen ihres heimatlichen Dialektes. Das ließ sie sich aber mitnichten gefallen, sondern sagte, das sei schön und vaterländisch, hingegen wir draußen im Reich müssten den Königen dienen, uns bücken wie Sklaven, kurz, wir seien nicht frei und könnten nicht tun, was wir wollten. Das reizte mich aufs höchste, und ich erinnerte mich mit Vergnügen, dass ich auch ein Republikaner war, was ich ihr aber nicht begreiflich machen konnte. Bald erlosch mein Übermut völlig und löste sich in Bewunderung des kühnen Schweizermädchens auf. Im Schatten der reckenhaften Churfirsten auf dem lauteren Wasser des Bergsees wurde es mir nicht schwer, mir mein Vaterland als schmachvoll geknechtet vorzustellen, und das kernigere Wesen der Schweizer, die Kraft und die Derbheit der Bergleute hielt ich alles für einen Ausfluss ihrer glücklichen Freiheitslage. In der Art verschmolz mir das braune Mädchen Kordula mit dem edelsten Gedanken, den der Mensch denken kann, mit der Freiheitsphantasie, und mein Herz bekam soviel Inhalt, dass ich ordentlich schwer daran zu tragen hatte; aber man lebt ja desto leichter, je voller das Herz ist.
Die Kordula hatte trotz ihrer gutgemeinten Vaterlandsprahlerei eine nicht geringe Ehrfurcht vor weithergekommenen Städtern mit ihren feineren Lebensgewohnheiten, so dass ihre Bewunderung meiner Person ungefähr ebenso groß war wie die meine der ihrigen, und das machte unsere Liebe zu einer so erfreulichen Erscheinung. Meine Eltern hielten sie für ein allerliebstes Idyll und behinderten uns gar nicht, verrieten auch nicht einmal das Vergnügen, das wir ihnen gewährten.
Einmal an einem Abend fuhren wir im Kahn, als die Sonne sich neigte. Ein Eisenbahnzug sauste schnaubend vorüber. Es wurde mir weich und wohl, als ich ihn dahinfahren sah, ohne mit ihm zu müssen, was doch einmal zu geschehen hatte; aber noch nicht. Als er vorbei war, erschien die Stille tiefer als vorher. Das Eisgrau der Bergspitzen nahm in der Sonnenbeleuchtung allmählich eine warme Veilchenfarbe an. Der See war ganz glatt und schien selbst atemlos das Wunder um sich her anzuschauen. Während ich unsagbar grenzenlose Empfindungen fühlte, gestaltete sich das in Kordulas Innern zu etwas ganz Bestimmtem, und sie fing plötzlich an, ein pathetisches Vaterlandsgedicht aufzusagen, welches sie in der Schule gelernt haben mochte.
Ich war über alle Maßen davon ergriffen. Eine heiße Verzweiflung erfasste mich, dass ich kein Schweizer war und diese Berge und das geliebte grüne Wasser nicht mein nennen konnte. Ich machte nun auch Verse, richtete sie alle an Kordula und gab sie ihr. Ob sie sie nun verstand oder nicht, sah sie doch, dass es Reime waren, und also war ich für sie ein Dichter; denn zwischen guten und schlechten unterscheiden konnte sie noch nicht. Sie sah mich seitdem mit vergrößerter Ehrfurcht an, und besonders gern betrachtete sie meine Augen. Einmal fragte ich, was sie denn da sehe; da antwortete sie mit einem recht lieblichen Bilde: ich sehe deine Gedanken darin herumschwimmen wie schwänzelnde Fischlein in einem See, viele, viele. Ich wurde rot und schämte mich und war doch so stolz und froh wie noch nie.
Zuletzt mussten wir dennoch Abschied voneinander nehmen; das war herzzerbrechend. Das Allerschlimmste aber kam erst, als wir wieder daheim waren. Auszugehen war mir verleidet, und auf dem Wege zur Schule schlug ich trotzig die Augen nieder, um die verhassten Steinhäuser und den ungeschmückten Horizont nicht sehen zu müssen. Am liebsten saß ich zu Hause und weinte und weinte in meinem untröstlichen Heimweh, und das Seligste, was ich mir auszudenken vermochte, war ein Grab im Wallensee unter den Zacken der Churfirsten. Es war ein großes Elend, und im Grunde hatte ich nicht so unrecht, zu weinen. Wenn man sich von der Natur entfernt, so entfernt man sich vom Guten und Schönen, und vor allem vom Glück. Ich hätte als Hirtenknabe auf einer Alp geboren werden sollen; dann säße ich wohl jetzt noch und jodelte und juchheite, anstatt dass ich hier im Kloster eine schleichende Träne erdrücke, wenn es von den Bergen herüber in mein kahles Gemach tönt.
IV
Ich habe noch nichts von meinem Urgroßvater gesagt. Wenn, wie ich später einsah, unsere ganze Familie nicht in dies Jahrhundert hineinpasste, so stand mein Urgroßvater, der Großvater meiner Mutter, Ferdinand Olethurm, dem jetztlebenden Geschlecht vollends ganz ferne; wie er ja tatsächlich einer anderen Zeit entsprossen war, da man noch nichts vom neuen Deutschland, Franzosenhass und sozialer Frage wusste. Sein vaterländisches Gefühl galt einzig seiner hansischen Vaterstadt, die er so im Herzen hegte, als habe er selbst Steine zu ihrem Aufbau herbeigetragen. Obwohl er insofern ein echter Patrizier nach der alten Weise war, so besaß er doch eine so merkwürdige Beweglichkeit des Geistes, dass ihm nichts Neues, mochte es auch noch so weit außerhalb des Gesichtskreises seiner Jugend und seines Mannesalters liegen, unverständlich oder gar gleichgültig war. Was an ihm so äußerst erfrischend und wohltuend für die Jungen war, war dieses, dass er nie ein Ereignis oder eine Idee zuerst vom moralischen Standpunkt aus betrachtete, wie das von einem so alten und ehrwürdigen Manne vielleicht manche erwarten würden. Wenn ihm ein Mensch gefiel, so hätte er sich füglich als ein Strauchdieb und Pirat entpuppen können, mein Urgroßvater hätte schon eine Erklärung dafür gefunden. So groß war seine Fühlung für das Leben des Herzens; denn was in der Welt geschieht, das ist ja doch auch im letzten Grunde erklärlich, ja notwendig. Ferdinand Olethurm hätte einer Erklärung aber auch andernfalls entraten können und hätte frisch zugeliebt und gehasst, wie es ihm ums Herz war. Dadurch machte er weniger den Eindruck abgeklärter Weisheit, als den unerschöpflicher Jugendkraft und unzerstörbarer Eigenart, und damit beherrschte er die Menschen und bannte sie unter seinen Einfluss.
Mich und Galeide liebte er über die Maßen, sie wohl noch etwas mehr als mich; einesteils vielleicht schon deshalb, weil sie ein Mädchen war, dann aber auch weil sie bei ihrer großen Weichheit zuweilen eiserne Härte und Festigkeit zeigen konnte, die ihm reizend erscheinen mochte wie eine Mandel im Grießpudding. Überhaupt galt sie für ein merkwürdiges Kind, obschon ich nicht zu sagen wüsste, woran das lag. Ebenso wenig wüsste ich zu sagen, warum jedermann in unserm Hause ein so unabweisbares Bedürfnis nach ihrer Gegenwart hatte, da es vorkam, dass man derselben gar nicht gewahr wurde, wenn sie auch eine Stunde lang mit einem im selben Raume war. Meine Eltern konnten sich nicht entschließen, sie, wie man es der Sitte gemäß mit den Töchtern macht, in eine Pension zu geben; anstatt dessen wollten sie, um sich doch etwas an die geläufigen Erziehungsgrundsätze ordentlicher Leute zu halten, eine Französin ins Haus nehmen, von der Galeide die scheu verehrte Sprache der übrigens verhassten Nachbarn erlernen sollte.
Unter den jungen Mädchen, die auf dieses Gesuch antworteten, war eine mit Namen Lucile Leroy aus der welschen Schweiz. Es war damals mehrere Jahre her, seit ich in der Schweiz gewesen war, aber das Bergland lag noch immer in meiner Erinnerung da schön und fleckenlos im Sonnenstrahlglanze, und es sagte mir ungemein zu, dass ein Mädchen aus jenen wunderbaren Gegenden in unseren traurigen Norden kommen sollte. Meine Eltern hatten stets Lust zu etwas Besonderem, und ein Schweizer war für uns etwas Rares wie dort oben unsere Austern oder eine pommersche Gänsebrust. Galeide sagte nicht viel dazu, obwohl es sie besonders anging; es schien ihr aber mehr leid als lieb zu sein. Es wurde nun ausgemacht, dass die Lucile zu uns kommen sollte; alles ging so einfach von statten, dass man nicht am allerkleinsten Anzeichen bemerken konnte, wie verhängnisvoll diese Wahl für uns werden sollte. Denn zugleich mit den zarten Mädchenfüßen setzte das Schicksal seine eherne Sohle auf unsere glatte Schwelle und trat verhüllt und furchtbar mitten in unser gemächliches Phäakentum. Nicht dass von Lucile selbst irgendein Unheil ausgegangen wäre, noch dass es sich überhaupt schon in nächster Zeit verkündet hätte. Sie wurde von meinen Eltern mit einer weitherzigen Liebenswürdigkeit empfangen, wie sie wohl nicht vielen Mädchen in solcher Stellung geboten wird. Man bemerkte aber bald an der Weise, wie sie es aufnahm, dass sie das wohl verdiente. Klug und tätig wie sie war, war es ihr ein leichtes, das zu leisten, was von ihr erwartet wurde, und in diesem Bewusstsein betrug sie sich im Übrigen wie ein willkommener Gast, machte niemanden durch erzwungene und augenfällige Demut unglücklich, sondern genoss die Freundschaft, die sie empfing, und vergalt sie durch glühende Liebe und Anhänglichkeit. Sie war lebhaft, wusste immer von anregenden Dingen zu sprechen und, was meinen Eltern das Erwünschteste war, sie besprach sie in einer uns fremden Weise und stellte sich meist auf solche Standpunkte, die wir zu übersehen pflegten. Denn sie war in ganz anderen Kreisen und Verhältnissen aufgewachsen. Was wir unbewusst in uns aufgenommen hatten, die vielfachen Bildungseinflüsse einer großen Stadt, danach strebte sie mit Hintansetzung und Unterschätzung der Natur in bewusster, planvoller Weise; einen reichgebildeten Geist achtete sie über alles und suchte sich einen solchen mit achtunggebietendem Eifer und Fleiß anzueignen. Alles, was sie bei uns fand, entzückte sie: die weiten hohen Räume unseres Hauses, die darin herrschende Anordnung, die mehr auf das Schöne als auf das Nützliche zielte, und unsere ganze Art zu leben, von der sich ungefähr dasselbe sagen ließ. Aber so sehr dies sie bezauberte, blieb sie doch dabei, mehr als sie wissen mochte, sie selbst und konnte den Zaun, der den wohlgepflegten Blumen-, Obst- und Gemüsegarten ihrer Seele einhegte, nie völlig durchbrechen. Infolgedessen missbilligte sie manches, was bei uns geschah und äußerte es mit einem Freimut, der meinen Eltern umso besser gefiel, als sie sich nicht danach zu richten brauchten. Sie hörten gern zu, wenn sie in beredter Predigt ihre Grundsätze entfaltete und fingen sogar an zu bedauern, dass Galeide eine solche Art zu reden und zu denken abgehe. Denn Galeide sprach wenig von Grundsätzen, hatte auch keine, oder wenn sie einmal äußerte, dass sie dies oder das gut oder schlecht fände, dies oder das tun oder nicht tun würde, sagte sie es kurz und derb, oft in unerhörten Ausdrücken, die sich freilich, von ihrer sanften Stimme getragen, weniger anstößig ausnahmen, als wenn ein anderes Mädchen sie gebraucht hätte. Immerhin gedieh mir diese Gewohnheit zum Ärger.
Trotzdem es Galeide mit Kummer empfand, wie sehr das interessante, fremdartige Wesen unseren Eltern einleuchtete, ließ sie doch Lucile die Eifersucht nicht entgelten; ich muss das als einen stolzen und würdigen Zug ihres Charakters anführen. Der Altersunterschied von fünf oder sechs Jahren machte sich zwischen den beiden Mädchen verhältnismäßig wenig bemerkbar. Ich erinnere mich, dass man überhaupt häufig dazu kam, mit meiner Schwester, die doch in mancher Hinsicht noch ein tolles und höchst unvernünftiges Kind war, wie mit einer reifen Person zu reden. Sie waren wie Schwestern miteinander, nein, weit inniger als solche gemeinhin zu sein pflegen. Galeide eiferte Lucilen sogar ein Unmerkliches nach und überhäufte die Fremde mit zarten, liebenswürdigen Zeichen ihrer Zuneigung. Lucile erwiderte diese Liebe nicht minder schwärmerisch, ja, sie übertraf Galeide vielleicht noch darin. Mir gegenüber äußerte sie das zuweilen, wenn ich Galeide einen zu geringen Willen zum Guten zur Last legte, den ich nebenbei gesagt nicht nur selbst nicht besaß, sondern damals sogar für etwas Verwerfliches hielt an einem Manne. »Sie mag ihn nicht haben,« sagte Lucile, »aber warum auch? Sie ist gut. Du weißt, dass es das Wesen des Genies bezeichnen soll, dass es nicht die bestehenden Gesetze befolgen muss, sondern in dem was es tut, selbst der Welt Gesetze gibt. Ein solches Wesen wird Galeide sein, und das ist auch das Geheimnis des unwiderstehlichen Zaubers, den sie ausübt.« Dies schien mir eine ungeheuerlich übertriebene Bemerkung zu sein.
Lucile und ich nannten einander du. Sie behandelte mich mitunter sehr als Knaben, was ich mir indessen nicht gefallen ließ. Und es glückte mir auch, mich auf eine höhere Staffel ihrer Achtung zu schwingen dank meiner Belesenheit und einer leidlichen Regsamkeit meines Geistes, wodurch es mir möglich wurde, ihr in den schöngeistigen Diskussionen, die sie liebte, ein willkommener Partner zu sein. Ehe sie da war, hatte ich mir eingebildet, sie müsse aussehen wie die Kordula vom Wallensee, obgleich das ein unbegreifliches Naturspiel gewesen wäre. Diese Vorstellung rührte mein Gemüt in angenehmer Weise, trotzdem ich in der Liebe bereits anfing, ganz andere und weniger erbauliche Wege zu gehen. Ich söhnte mich aber bald damit aus, dass Lucile nicht Kordula war; denn sie machte Eindruck auf mich, und es schmeichelte mir, dass sie sich nicht ungern mit mir beschäftigte. Ihre Gegenwart hielt mich in wohltätigen Schranken, wenigstens insofern, als ich die Folgen meines Leichtsinns zu unterdrücken trachtete. Wenn ich mit dem leisesten Anflug eines Rausches oder in der jämmerlichen Stimmung, wie sie den übertriebenen Schlemmereien junger Leute sich anschließt, zu Hause erschien, so zögerte sie nicht, mir ihre Missbilligung und Verachtung in scharfer Weise zu zeigen. Ich wies das zwar mit anmaßender und unliebenswürdiger Empfindlichkeit zurück, aber doch fürchtete ich solche Zwiste und gab mir Mühe, die Anlässe dazu zu vermeiden. Im Grunde besserte ich mich freilich nicht, dazu war ihr Einfluss nicht stark genug. Wie hätte das auch sein sollen? Ich gab jedem Anstoß nach, ob er zum Guten oder zum Bösen lockte, wenn er nur in einer Weise ausgeübt wurde, die mir zusagte. Ich wollte ein Weltmann sein und war ein Tor; einer der zu leben weiß, wollte ich sein und lernte nichts als frühzeitiges Absterben. Ich glich dem Hunde, der, nach dem Spiegelbilde seines Knochens schnappend, ihn selbst ins Wasser fallen lässt und nicht mehr findet.
V
Kaum kann ich es erwarten, und doch zage ich davor, den Schatten des Mannes im Zuge meiner Erinnerung heranschreiten zu sehen, an dem wie an keinem anderen meine Seele Anteil nahm. Ich spreche von meinem Vetter Ezard Ursleu, dem einzigen Menschen, der ich hätte sein mögen, da er mir besser gefiel als ich. Sein Vater, mein Onkel Harre, war ein namhafter Arzt in meiner Vaterstadt. Er übte aber, solange ich denken kann, die Praxis nicht mehr aus, ausgenommen in einigen befreundeten Familien, wo er seit Jahren der Hausarzt war. Im Übrigen suchte er fortwährend seine Wissenschaft zu ergründen und zu fördern, worin er auch von Erfolgen beglückt war, verfügte über ein ungemeines Wissen in seinem Fache, aber auch auf anderen Gebieten, denn nach der Art unserer Familie beschäftigte er sich mit vielen Dingen, die ihn von Rechts wegen nichts angingen. Es gibt zwar für einen ganzen Menschen nichts, das ihn nichts anginge, aber unsere irdischen Verhältnisse lassen solche nun einmal nicht werden: denn die Erde verschüttet unendlichen Überfluss, und die Schüssel, die wir zum Auffangen haben, ist flach und winzig. Harre Ursleu war indessen mehr als die meisten Menschen zu solcher Handlungsweise berechtigt, weil er mehr fasste als sie, und man durfte ihm nicht nachsagen, er wisse vieles anstatt viel. Seine gute Gesundheit und mäßige Lebensweise ermöglichten ihm stundenlanges Arbeiten und Denken. Er war aber kein Büchermensch, vielmehr stellte sich sein Geist mit soviel Glanz dar, dass man oft ungerechterweise an seiner Tiefe zweifelte, auch genoss er das Leben, und mehr als manchem Sittenrichter erlaubt schien. Aber so wenig er auf sie hörte, so aufmerksam gehorchte er seiner Natur und unternahm nie mehr, als er ohne sich zu schädigen ertragen konnte und hätte es für eine Schmach angesehen, eine wissenschaftliche Sitzung zu verfehlen oder irgend eine Arbeit hintanzusetzen um eines materiellen Vergnügens willen. So war er ein Mann von Bedeutung und der Jugend ein zusagendes Vorbild, da er beides in sich darstellte, was ihr erstrebenswert erscheint, einen in seinem Berufe rühmlich Ausgezeichneten und einen, der die Leckerbissen des Lebens zu würdigen und zu genießen weiß.
Sein Sohn, obwohl von ihm ganz verschieden, war sein vornehmster Stolz. Er sollte etwas Großes werden. Und wo waren dazu bessere Aussichten als in der alten Hansestadt? Er konnte als überseeischer Kaufmann in großartiger Weise den Strom des Goldes leiten zu eigenem und des Vaterlandes Gedeihen, oder als Mitglied unserer Regierung im kleinen Kreise das Ansehen eines Fürsten genießen. Es ist bekannt, dass die Herren einer aristokratisch regierten Republik sich oft mehr dünken als die Könige von Gottes Gnaden, wozu sie freilich auch berechtigt sein dürften; denn unsere jetzt lebenden Fürsten stammen alle nur von Vasallen ab, während sich von den Geschlechtern der alten Städte manche mit Fug Nachkommen der freien Leute unter den germanischen Eroberern nennen. Mein Onkel hielt es nach Erwägung und Verwerfung der anderen Pläne für das beste, seinen Sohn die Rechte studieren zu lassen, da er auf die Art am ehesten an die Spitze der Regierung gelangen konnte.
Ich war noch nicht zwanzig Jahre alt, als Ezard von den Universitäten zurückkehrte und ich zum ersten Male mit vollem Bewusstsein seine Bekanntschaft machte. Er kam gerade an dem Tage, als Galeide konfirmiert wurde und nahm an dem dazu veranstalteten Festessen teil. Die Aufmerksamkeit wandte sich von der eigentlichen Heldin des Tages, die in ihrem schwarzen Schleppenkleide sehr schlank, blass und betrübt aussah, bald gänzlich auf ihn. Tritt er nicht wie Odysseus unter die Phäaken? so dachte ich. Denn so hatte ich mir den göttlichen Dulder vorgestellt, nicht etwa die Spuren überstandener Leiden im Gesichte, sondern in seiner Erscheinung den Bekämpfer und Besieger des Schicksals verratend. Und es gibt keinen Gegner, gegen den sich erfolgreich gestemmt zu haben so mit Kraftgefühl und Befriedigung erfüllen kann, wie das Schicksal. Ja, mit dem Schritt und der Haltung eines Siegers schritt er einher. Man begann sich gesichert zu fühlen in seiner Nähe, weil man ihm zutraute, er vermöge alle Widerwärtigkeiten des Lebens zu überwinden. Worin das eigentlich lag? Er war als Mann nicht groß; schlank, ebenmäßig. Seine Schönheit war edel und maßvoll, aber höchst eindringlich dadurch, dass sie vollkommen mit dem seelischen Ausdruck verschmolz; man hätte glauben können, sein Gesicht sei nur durch den Adel des Ausdrucks schön, wiederum, es sei nur die äußere Harmonie der Züge, welche die Erscheinung des Seelenvollen hervorbringe.
Ich empfand dies alles damals, ohne es mir ganz einzugestehen; denn ich war in den Jahren der Anmaßung und überhaupt zu gut beanlagt und ausgestattet, um mich mit dem Bewundern und Trabantsein in der Welt zu begnügen und nicht selbst etwas vorstellen zu wollen. Mein Vetter Ezard besaß die Zierde angeborener, natürlicher Bescheidenheit, die man wohl eine Zwillingsschwester der Schönheit nennen kann; ich meine der Schönheit, die das feine Gemüt durchschimmern lässt, das sie erfüllt und belebt, einem venezianischen Glaskelch von grüner Farbe vergleichbar, der seinen wahren Sinn erst dartut, wenn das tiefe Gold edelsten Rheinweins ihn durchleuchtet. Es hatte wohl kaum jemals ein Mensch meinem Vetter Ezard Liebe und Anerkennung versagt; eitel zu sein hatte er also auch keine Ursache. Man sagt, dass die Schäfer eine besondere Art haben, ihre Tiere anzugreifen, so dass sie sich geduldig von ihnen scheren lassen. Solchen glücklichen Griff hatte Ezard in der Behandlung der Menschen, die ihm gegenüber stets das Beste ihres Innern hergaben, freilich ebenso viel zum eigenen Vorteile wie zu seinem.
Es zeigte sich bald, dass Ezard ein besonderes Wohlgefallen an Lucile fand. Nach der Art reich entwickelter Männer, welche zu den Vorzügen ihres Geschlechtes auch einige des weiblichen mitbesitzen, bewunderte er hauptsächlich solche Frauen, die durch Selbständigkeit, Eigenart und Tatkraft hervorragten. Lucile ihrerseits war mit einem Schlage von Ezard bezaubert. Aber sie verbarg es hinter einer anmutigen Sprödigkeit, widersprach keinem so viel wie ihm, wobei sie äußerst launig und anregend sein konnte, und baute gewissermaßen eine Festungsmauer um sich herum, die für seine Jugendkraft und Lust zu handeln und sich zu regen ein neuer Antrieb war, dies Mädchen zu erringen. Onkel Harre liebte es, sich im Gespräch mit ihr zu messen. Sie bewunderte ihn; die Rastlosigkeit seines Geistes, der wie ein Wasserfall dahinschoß, jeden darüber gleitenden Strahl in alle Regenbogenfarben zersplitterte und mit dem vielfarbigen Geschmeide spielte, blendete und entzückte sie. Ihn belustigte die gerüstete Unerschrockenheit, mit der sie ihn bald hierin bald darin angriff und tadelte. Häufig gab die Religion Anlass zu Streitigkeiten. Lucile war, der Tradition ihrer Familie folgend, Katholikin. Das veranlasste den Onkel, sie mit dem, was er für ungeheuerliche Auswüchse dieses Glaubens hielt, und was sich durch einen geschickten Redekünstler leicht als etwas Abenteuerliches und Widersinniges darstellen lässt, zu necken und zu reizen, was sie nicht ungern hatte, da es ihr Gelegenheit gab, ihren Glauben in beredten Auslassungen zu verteidigen. Galeide schämte sich bei solchen Gelegenheiten, dass sie sich zu keiner Partei mehr oder weniger hingezogen fühlte, und hätte gern ein heiliges Flämmchen der Gläubigkeit in ihrer unschuldigen Brust angezündet. Der Urgroßvater pflegte diejenige zu unterstützen, welche am schwächsten schien, oder er bildete für sich eine neue, indem er die buddhistischen oder meinetwegen parsischen Meinungen als die Fundgrube überirdischer Weisheit anpries. Onkel Harre begünstigte die Neigung seines Sohnes, solange er sie für eine Spielerei ansah, aber er betonte, dass er nie etwas Ernstliches daraus werden sehen wolle. Eine schweizerische Erzieherin zu heiraten, das war nicht, was er für Ezard erhofft hatte. Immerhin hätte dieses Vorurteil sich überwinden lassen; denn Harre Ursleu war kein gemeiner Jäger nach weltlichen Vorteilen und noch weniger ein barbarischer Vater, der dem Herzen seines Kindes nicht gegönnt hätte, sich auszuleben. Aber Lucile war die Frau nicht, die einen bedeutsamen Eindruck auf ihn ausüben konnte. »Sie hat Verstand, das kleine Ding,« sagte er von ihr. »Ihr Geist zuckt beständig wie ein Fixstern; aber ich ziehe das stille, stete Leuchten der großen Planeten vor. Ich frage auch, was für ein Modell könnte sie einem Bildhauer sein? Eine Hexe? Lächerlich! Eine Venus? Unmöglich! Eine Diana? Gott bewahre! Sie ist zu allem zu klein. Als Minerva könnte man sie sich am ehesten denken, wenn nicht wiederum die geringen Dimensionen störten. Ihr Körper ist zu klein, als dass sie ein herrliches Weib, und ihr Geist ist zu groß, als dass sie ein niedliches Püppchen sein könnte. Ich will wohl in Gesellschaft neben ihr sitzen, aber in meiner Familie will ich sie nicht haben.«
Ezard ließ sich durch die Meinung seines Vaters nicht im geringsten erschüttern. Ihm mochte manches an Lucile gefallen, was Onkel Harre selbst an sich hatte und darum an anderen nicht bemerkte oder nicht schätzte. Er umwarb sie, und sie war von dieser Neigung, wie von einer bengalischen Flamme beleuchtet, hübscher, feuriger, kräftiger als früher. Galeides liebevolle Aufmerksamkeiten setzten da ein, wo Ezard die seinigen einmal unterbrechen musste. Das Glück trug sie froh dahin wie eine große Welle ihr glitzerndes, stolzes Schaumkrönchen. Es war ein lustiges Leben damals im Hause der Ursleuen; es ging den Berg hinan, und jeder war sich noch eines solchen Vorrats von Kräften bewusst, dass er getrost davon verausgaben mochte.
VI
Ich habe das Wünschen ganz und völlig abgetan, denn wäre ich in dieses Kloster gegangen, wenn ich noch hätte wünschen mögen? Ich habe es oft mit angesehen und weiß es: wer wünscht ist wie einer, der sich Äpfel vom Baume schüttelt; die Erfüllung fällt ihm auf den Kopf und schlägt ihn blutig. Dennoch kann ich mich des einen Wunschgedankens nicht erwehren, dass die Studienzeit noch einmal wiederkäme, die Zeit, wo man sich den Stil auswählt, in dem man das Haus seines Lebens aufbauen will. Herr des Himmels, wie unreif und unberaten taumelte ich in diese Aufgabe hinein! Wollen und Streben hielt ich für Empfindeleien vergangener Zeitalter. Arbeiten, dachte ich, sei Knechtschaft und das Schicksal des Unfähigen wie die Kartoffel die Speise des Armen. Mir machten die Leute den größten Eindruck, die von den Spargeln nur die Köpfe, von den Austern nur die lose Gallerte aßen. So, fand ich, müsse man das Leben zu verzehren lernen, nur das Kostbarste davon nippen, dass man den Genuss und Geschmack, aber nicht die Last des Verdauens davon habe. Hätte ich nun diesen Grundsatz auf den wirklichen Vorgang angewendet, von dem ich das Bild entlehnte, so hätte ich aus dem Kampfe des Lebens wenigstens eine Trophäe davongetragen: einen guten Magen. Und dieses würde ich nicht gering anschlagen. Aber da war es mit Nippen und Abschäumen nicht getan, sondern ich beteiligte mich kräftig an allen Gelagen und wollte hier vor allem der erste sein; ein solcher Eifer war für einen Studenten der damaligen Zeit in keiner Richtung so schwer zu befriedigen wie in dieser. Auch ein guter Fechter wollte ich sein und brachte es mit vieler Übung ziemlich weit darin. Ich glaube, dass ich niemals so viel Fleiß und Ausdauer auf irgendetwas verwandt habe, wie auf den Gebrauch des Schlägers; und das tat ich nicht in dem Sinne wie die frommen Turnerknaben im Anfange des Jahrhunderts, um den Leib zu stählen, der für das Vaterland kämpfen sollte, sondern um ein Ansehen unter meinen Gefährten zu gewinnen, von denen kaum der zehnte den wahren Wert eines Menschen beurteilen konnte, geschweige denn selbst etwas davon in sich hatte.
Von dem was ich studierte dürfte ich billig schweigen, da es den allergeringsten Teil meiner Studienzeit in Anspruch nahm. Ich studierte nämlich die Rechte, hauptsächlich aus dem Grunde, weil Ezard es getan hatte, und weil ich die unverständige Einbildung hegte, freilich ohne mir selbst darüber klar zu sein, wenn ich nur so im gröbsten seine Handlungen nachahmte, würde ich ganz von selbst das werden und so werden wie er.
Liebschaften hatte ich auch. Es war aber nichts darunter, woran ich mich mit Lust erinnern dürfte. Nun, hie und da doch einiges, was der Aufzeichnung wert ist. Wiewohl ich mir vorgesetzt hatte, diese Pfade meines Lebens nicht noch einmal zu durchwandeln, verführt mich nun doch der eine oder andere mit anmutigem Schlängeln oder waldiger Vertiefung, ihn sinnend einzuschlagen. Wird man doch durch Verirrungen weise. Auch den heiligen Augustinus brannte das Feuer, ehe er geläutert daraus hervortrat. Wenn ich mir nun auch nicht anmaße ein Heiliger zu sein, so scheint es mir doch, dass meine Natur verwerfliche Vergnügungen nicht nur suchte, um sich zu vergnügen, sondern um sich durch Erfahrung vom Schlechteren zum Besseren zu erziehen. Dadurch unterscheidet sich ein wilder lasterhafter Jüngling vom stilleren, aber gemeineren Wüstling.
Es gab in einer Universitätsstadt, wo ich mich mehrere Semester lang aufhielt, in einem kleinen Häuschen eine Verkäuferin, die Süßigkeiten und allerlei Getränke feilhielt. Es galt unter den jungen Leuten für fein, die Gunst dieses Mädchens einmal besessen zu haben. Deshalb zeigten sich alle Studenten gern in dieser Bude, obschon sie die dort ausliegenden, abgestandenen Esswaren verschmähten. Sie bezahlten sie, ohne davon zu sich zu nehmen, und gerade deshalb war es umso feiner. Das Mädchen hieß Georgine, war von weißer Hautfarbe und durch rötliche Haare ausgezeichnet. Sie war von Natur und durch die Gewohnheit des Dasitzens in der Bude sehr träge, langsam von Bewegungen, welcher Umstand sie davor bewahrte, gemein zu erscheinen. Ich war über alle Maßen in sie verliebt, und ich muss sagen, dass sie eine Schönheit an sich hatte, der man sonst nur in Märchen oder Träumen begegnet. Wenn sie sich zu ihrer vollen Höhe aufrichtete, ihre schweren Augenlider ein wenig hob und die vollen Lippen lässig bewegte, erwartete man, dass sie etwa so sprechen würde: Ich bin die Meerkönigin und habe einen Palast von Perlmutter und Stühle von Korallen; schwöre mir Treue, so darfst du mit mir kommen. Sie trug ihre leuchtenden Haare wie eine Krone und jede geschliffene Glasperle darin wie einen unschätzbaren Diamanten. Ein jeder wusste, dass sie ihre Liebesgunst an den Meistbietenden verschleuderte, aber daran dachte der nicht, dem sie einen Kuss gewährte, als wäre er ein Bettler, und sie reichte ihm ein Almosen aus ihrem Überfluss. Sie war auch im Empfinden träge und hatte sich lieben lassen, wie ein Schoßhündchen sich von vielen Händen streicheln lässt. Sie war vorher und nachher dieselbe. Überhaupt hatte sie etwas von einem schönen Tier oder Halbmenschen an sich, von einer Nixe mit Fischschwanz. So viel Anteil an ihrer Gunst zu gewinnen, wie sie jedem gab, der ihr nicht gerade missfiel, war keine Kunst. Aber damit war mir denn doch nicht gedient. Es wurde mir klar, dass ich mir durch nichts ein so gewaltiges Ansehen erwerben könnte, wie wenn ich die Georgine ganz und ungeteilt für mich bekäme. Darauf ging nun mein Sinnen und Trachten. Ich darf zwar wohl sagen, dass ich es nicht nur aus Ehrgeiz erstrebte; mein Herz war damals noch frisch und unverdorben genug, um sich nicht mit Abfall abspeisen zu lassen. Ich wollte keine Katze im Sacke kaufen, ich wollte nicht nur einen Leib, sondern eine Seele dazu. Von der ich freilich mehr nicht verlangte, als dass sie mich lieben könnte. Eine solche hatte die Georgine wirklich aufzuweisen, wie nun an den Tag kam. Sie war wie das Blatt des Perückenbaumes, das nur duftet, wenn man es zerreibt; bisher hatte noch niemand versucht, die Würze herauszupressen.
Ich pflegte ihr zu erzählen von meinen Eltern und meiner Schwester und unserer Art zu leben. Davon verstand sie nicht viel, aber doch das, dass ich sie, wenn auch nicht in höherem Grade liebte als die übrigen, doch in würdigerer Weise. Und das war ohne Zweifel die Hauptursache davon, dass sie mir wiederum mehr gab als allen übrigen. Die Art eines Menschen zeigt sich nicht nur, wenn er große Taten verrichtet, sondern ebenso gut, wenn er ins Zimmer tritt und Gutenmorgen wünscht. Ein ungewöhnlicher Mensch küsst anders und lässt sich anders küssen als ein ganz gemeiner, und daran mochte es die Georgine bemerken, dass sie eine seltenere Beute am Schopfe hielt als sonst, eine, die sie nicht alle Tage wieder bekommen konnte. Nun fing sie an, mich mehr und mehr zu lieben, ängstlich und eifersüchtig zu werden. So sehr sind die meisten Geschöpfe bereit, sich höher hinaufzuschwingen, wenn man ihnen nur eine Leiter hinhält. Sie trat damit etwas aus ihrer Art heraus und verlor mit ihrer Ruhe auch von dem prächtigen Anstand einer orientalischen Haremskönigin; aber da ich einmal mitten in der Verliebtheit war, machte mich das nicht mehr irre, sondern verstärkte im Gegenteil die Gefühle.
Sie gab nun allen anderen um meinetwillen den Abschied und wurde unnahbar, weil ich es so haben wollte. Das verschaffte mir nun zwar das erhoffte Ansehen, aber nicht ohne Unliebsames auf der anderen Seite. Es war herkömmlich, dass die schöne Georgine in ihrem Stuhle lehnte, Limonade einschenkte und aus ihren grünen Augen wohlig lächelte. Wie sollten sich die jungen Leute nun zu dem schönen Weibe stellen? Sie hätten sich gern vor ihr auf den Knieen gewälzt; aber ein bisschen Achtung und Ehrfurcht vor einem Gemüte, das vom Schlechteren zum Besseren übergeht, wollten sie nicht haben. Vielmehr empfanden sie den Wechsel als eine arge Beleidigung. Aber Georgine kehrte sich nicht daran, sondern fuhr fort, mir als Liebesgabe blutende Männerherzen zu Füßen zu legen, wie ein Indianer seiner Geliebten die Skalpe erlegter Europäer überreicht. Es gefiel mir außerordentlich und ihr nicht minder. Sie behandelte die Verschmähten schnöder als nach allem Vergangenen billig und geraten war. So kam es dazu, dass ein niedriger Wicht eine höchst teuflische und unwürdige Rache an ihr nahm, indem er über ihr schönes, weißes Gesicht ätzende Schwefelsäure ausleerte und dies wunderbare Gebilde der Natur dadurch auf immer zerstörte. Es war ein Jammer, sie anzusehen. Die goldene Haarkrone thronte über dem elenden Antlitz wie die Sonne über einem wüsten, rauchenden Schlachtfelde. Sie war nicht nur nicht mehr schön, sie war scheußlich. Ich saß dabei und weinte, nicht anders wie ein Vater über den geschändeten Leib eines verlorenen Kindes. Die unselige Georgine war ganz und gar vernichtet. Sie löste mit zitternden Händen ihre Haare und presste sie vor ihre Augen. »O mein schönes Gesicht! mein schönes Gesicht!« stöhnte sie, und weiter hörte ich überhaupt kein Wort mehr von ihr. Sie rief diese Worte mit solcher Seelenangst und flehentlicher Klage, dass man im innersten Herzen erbebte, obwohl sie nur einem äußerlichen, vergänglichen Vorzuge galt. Aber man fühlte, dass sie recht hatte, wenn ihr Herz brach; denn sie war nun ganz verwaist, entblößt, geschändet und arm. Ich fürchtete mich in meiner Kläglichkeit, dass sie mich anflehen würde, sie wie bisher zu lieben. Aber das kam ihr nicht in den Sinn, vielmehr schickte sie mich heftig fort und wollte auch kein Geld von mir annehmen. Ich ließ mir das nicht zweimal sagen und unternahm einen weiten Ausflug, um mich meinen Gedanken zu überlassen, die mir sehr tief und bedeutend vorkamen.
Unterdessen ertränkte sich das verlorene Weib. Sie hatte auf einen Fetzen Papier in großen, schiefen Buchstaben ihre letzte Bitte niedergeschrieben, nämlich dass man, wenn sie im Sarge läge, ihr Gesicht mit ihren Haaren zudecken möge. Das geschah, und es nahm sich recht symbolisch aus; denn ungefähr wie der Goldmantel die Schmach ihres Antlitzes verbarg, so hatte, während sie lebte, ihre Schönheit über der armen entstellten Seele ihre göttlichen Schwingen ausgebreitet, dass man ihr gern verzieh um der hohen Fürbitterin willen. Ihr seltsames Unglück rührte auch alle Gemüter, so dass ihr beim Leichenbegängnis alle Ehre erwiesen wurde: man huldigte unbewusst der waltenden Natur, die ihr Füllhorn ausgießt, wo es sie gutdünkt, nach keinem anderen Plane als ihrer Laune; aber die Launen der Natur sind Gesetz.
Ich weiß nicht mehr, ob ich mir vorzuspiegeln suchte, ich sei der Held dieses traurigen Abenteuers. Jedenfalls trug ich eine tiefgehende Verstimmung davon und bildete mir ein, das Schicksal verkümmere mir meine wohlerworbenen Genüsse und zeige mir die schönsten Früchte nur, um sie meinen greifenden Händen tückisch zu entziehen wie dem Tantalus. In Wahrheit war es ganz anders und ich oder vielmehr die Mischung meiner Seelenkräfte war an allem schuld. Es gibt unter den Vögeln die hin und her segelnden Schwalben, die wirbelnden Lerchen, die Bachstelzen, die auf und ab trippeln und wippen, die wackelnden, patschenden Enten. Der stolze und gewisse Flug des Falken, der sich wie ein Pfeil in die Lüfte wirft und packt was ihm taugt, dann wiederum über der Erde steht, als hinge er an einem goldenen Faden vom Himmel herab, ist nicht jedem verliehen.
VII
Ich erzählte zu Hause von meinen Liebesabenteuern nur dem Urgroßvater, der mich selbst dazu ermunterte. Man darf sich aber nicht vorstellen, ihn habe eine hässliche Lüsternheit dazu bewogen; denn was ihn antrieb, lag ganz anderswo und ließe sich eher moralisch nennen. Er war überzeugt, dass das Gemüt aus jeder Liebesangelegenheit bereichert hervorgehe, wie sich der Körper im Turnen und jedem Gebrauch seiner Kräfte stählt. Da ich ihn wohl kannte, pflegte ich meine Geschichten romantisch auszuschmücken und vorzüglich mit allerhand Bemerkungen aus dem Gebiete der Seelenkunde zu verbrämen, als ob ich eigentlich mehr zum Behuf einer psychologischen Studie, als um des Vergnügens willen geliebt hätte. Ich erlog dies zwar nicht ganz, aber meine diesbezüglichen Beobachtungen kamen mir meist erst in dem Augenblick zum Bewusstsein, wo ich dem Urgroßvater gegenüber saß und erzählte. Er selbst besaß so viel natürliche Menschenkenntnis und Lebhaftigkeit, dass er über die in Frage kommenden Personen die zutreffendsten, feinsten Urteile fällen konnte, als hätte er jahrelang mit ihnen verkehrt.
Er schrieb mir auch, wenn ich fort war, über alles was zu Hause vorging, geistreiche und anmutige Briefe, in denen sein ganzes Wesen wie auf einer Photographie niedergelegt war, bis auf das allerjüngste Fältchen. Es belustigte mich besonders, wahrzunehmen, wie sich in jedem Briefe seine hauptsächliche Zu- und Abneigung verriet, nämlich die überschwängliche Liebe zu Galeide und die Feindseligkeit gegen Onkel Harre. Denn Onkel Harre hielt er für einen nicht gut konstruierten Menschen, etwa einem gotischen Dome der Spätzeit ähnlich, den der ungewissenhafte Baumeister mit Hintansetzung der Kunstregeln in zu kühnen Formen hat aufschießen lassen, als dass sie sich noch selbst zu tragen vermöchten. Mit solchen Aussprüchen suchte er seine Abneigung vor sich zu erklären und zu rechtfertigen.