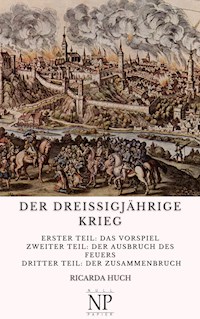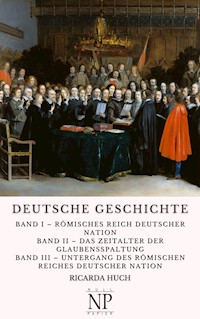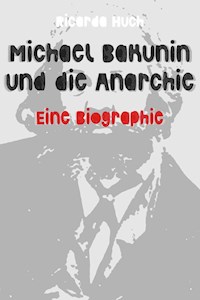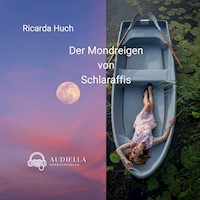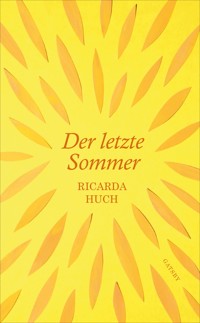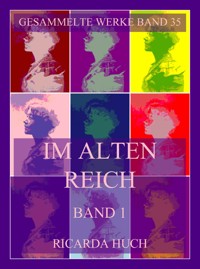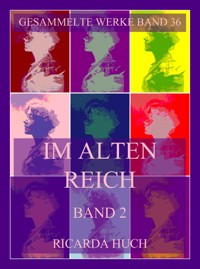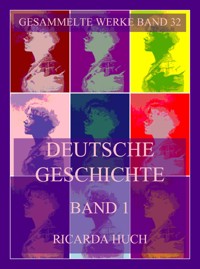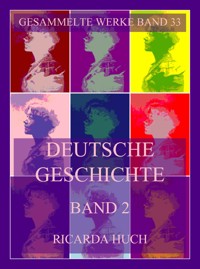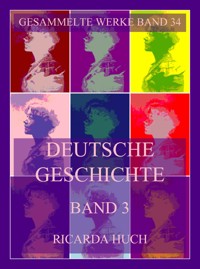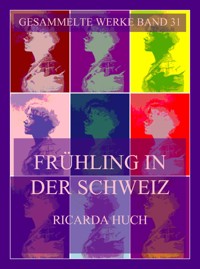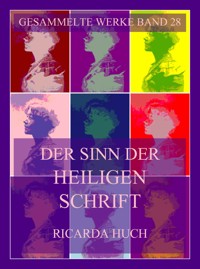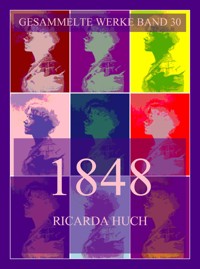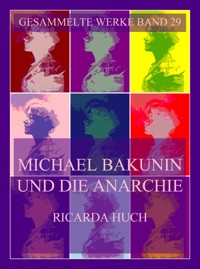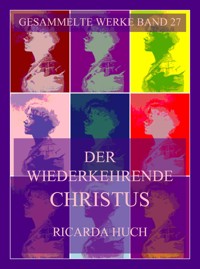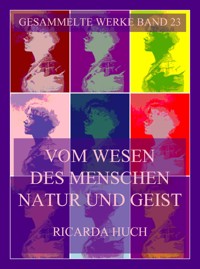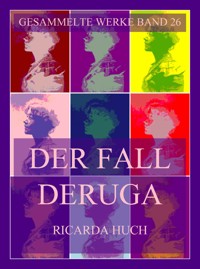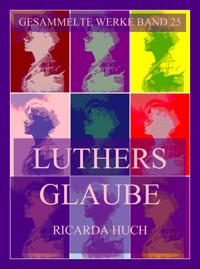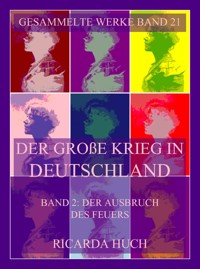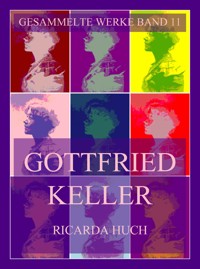
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ricarda Huch Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
So viel auch schon über Gottfried Keller geschrieben wurde, so treffend auch schon von manchem –– vor allem von Ferdinand Nürnberger –– seine Eigenart erfasst wurde, der geneigte Leser hatte doch lange Zeit das Gefühl, dass das Schönste noch nicht gesagt wurde. Ricarda Huchs Büchlein über den Dichter des "Grünen Heinrich" wirkt hingegen so wunderbar, als hätten bisher alle bloß aus dem trüben Wasser des mächtigen Stroms geschöpft und als hätte sie, die Erste, dessen eigentliche Quelle gefunden. Eine seltene Liebe durchzieht die Seiten, eine Liebe, wie sie aus einem langjährigen innigen Verkehr mit einem Menschen entsteht, dem man in die tiefste Seele hineingeschaut und dem man selbst das undeutliche Weben der Gedanken und Träume aufs klarste deuten kann. Es ist in diesem Büchlein so viel Herrliches ausgestreut, eine solche Helle des Bewusstseins umfließt es, dass man, nachdem man es einmal gelesen hat, immer wieder darin blättert, um den Glanz der einzelnen Perlen, die dieses literarische Kunststück ausfüllen, aufs Neue zu genießen und zu bewundern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gottfried Keller
RICARDA HUCH
Gottfried Keller, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681744
Der Text folgt der Ausgabe erschienen im Insel Verlag Leipzig, abrufbar unter https://www.gutenberg.org/cache/epub/31150/pg31150-images.html.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II9
III15
IV.. 21
V.. 30
I
Das von großen Mächten Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien wie ein Edelstein eingefasste Land Schweiz, zwischen unzugänglich hohe und mittlere Gebirge gelagert, die die Quellen starker Ströme bergen, wird von einem Volke bewohnt, das wie kein anderes mit dem Boden, aus dem es gewachsen ist, zusammenhängt und Herr in dem Hause ist, das es sich unter Kämpfen selbst gebaut hat. Von Fremden beneidet oder gehasst, ist es seiner teils natürlichen teils absichtlichen Zurückhaltung wegen wenig von ihnen gekannt und hat sich bis jetzt, obwohl beständig von Ausländern heimgesucht und selbst zum Zwecke des Erwerbs und der Ausbildung viel im Auslande sich aufhaltend, in seiner ausdrucksvollen Besonderheit erhalten.
Die Schweizer sind ein durchaus aristokratisches und konservatives Volk: vor allen Dingen die eigentlichen Aristokraten, Nachkommen der regierenden Geschlechter, aristokratischer als irgendwo, weil zugleich mit dem Bewusstsein der Überlegenheit durchdrungen und beseelt von dem Gefühl der Verpflichtung, den Tieferstehenden als Muster zu dienen; aber ebenso wohl die bürgerlichen Städter, deren Ahnen seit undenklicher Zeit jeder an seinem Teil an den allgemeinen und persönlichen Geschäften mitwirkten und eine wohlerworbene Stelle in der scharfen Freiheit des Gemeinwesens ausfüllten, wie schließlich die Landbewohner, die es überall sind, die allerdings in den städtischen Kantonen durch ihre vergleichsweise rechtlose, untergeordnete Lage auf die demokratische Linke gedrängt wurden.
Die Tugenden der Ausdauer, des Rechtsgefühls, der Sachlichkeit und der Selbstbeherrschung, die ihnen allein das Kleinod der Freiheit bewahrten in den Zeiten, wo es die Völker ringsumher sich entwenden oder entreißen ließen, haben sich immer mehr befestigt, so dass der Ausländer mit Staunen sehen kann, wie ein ganzes Volk trotz aller Abweichungen im Einzelnen, mit Vernunft und Besonnenheit handelt, den eigenen Vorteil, wie es sich gehört, im Auge behält, ohne unbillig gegen andre zu sein, mit sich selbst zufrieden, wie es die Art der Gesunden und Guten ist, doch geneigt von andern zu lernen. Elend und Verbrechen trüben das schöne Bild nicht so, wie es in anderen Ländern der Fall ist, weil die Beherrschung der Leidenschaften, die freilich in dem harten Lande auch nicht so hitzig sind wie anderswo, einen leidlichen allgemeinen Wohlstand ermöglicht. So geschieht es, dass der Schweizer häufig von Ausländern wegen seiner Ungeschliffenheit verlacht wird, während er doch mehr Kultur hat als jene, insofern als er durch Jahrhunderte sich nach einem bestimmten Ideal gebildet hat und nun im Besitze nicht blendender, aber humaner und erhaltender Eigenschaften ist.
Was nun die Nüchternheit betrifft, die dem Schweizer oft vorgeworfen wird, so ist diese allerdings vorhanden; aber man ist im Irrtum, wenn man glaubt, deswegen könne die Schweiz keine Künstler hervorbringen. Die Trockenheit des Schweizers ist die des kindlich oder bäuerlich verschlossenen Menschen, in dessen Innern die Phantasie oft umso kräftiger glüht, weil sie nicht beständig nach außen verschwendet wird. Besonders aber sollte man endlich wissen, was die Romantiker unter vielen Schmerzen an sich selbst erfuhren, dass künstlerisches Empfinden, Reizbarkeit und die Sehnsucht nach dem Schönen keineswegs den schaffenden Künstler machen, dass vielmehr, wie E. T. A. Hoffmann sagte, dem künstlerischen Feuer eine gute Dosis Phlegma beigemischt sein müsse, damit es nicht den Menschen verzehre, anstatt ihm in seiner heiligen Werkstatt zu dienen. Indem das Phlegma gegen den Einfluss fremder und eigener Reize festmacht, verleiht es dem, der es im rechten Maße besitzt, eine gewisse Überlegenheit, die sich beim Schweizer bescheidentlich als Humor äußert und ihn seine Eigenart unbefangen genießen lässt.
Dem Satze vom Künstlerfeuer und Phlegma, dessen negative Seite die Romantiker illustrieren, kann niemand so gut als positives Beispiel dienen wie Gottfried Keller. Er war in seiner Natur durch und durch Schweizer, wenn ihm auch die berüchtigte Schweizer Gewinnsucht und Geldliebe völlig abging, die er selbst oft bitter an seinen Landsleuten rügte. Seine Eltern stellten Gegensätze dar, wie sie bei den meisten Dichtereltern umgekehrt verteilt sind, wo die Mutter gegenüber dem strengen, charaktervollen Vater ein poetisch-religiöses Gefühlselement zu vertreten pflegt; womit aber nicht gesagt sein soll, dass es Kellers Vater an Ernst und Charakterstärke oder seiner Mutter an Empfindung gefehlt hätte. Der Drechslermeister Hans Rudolf Keller aus Glattfelden, 1791 geboren und schon 1822 dreiunddreißigjährig gestorben, und Elisabeth Scheuchzer, ebendaher, 1787-1864, also vier Jahre älter als ihr Mann und ihn um zweiundvierzig Jahre überlebend, waren beide tüchtige und rechtliche Menschen, er schwungvoll, das Neue, Poetische, über den Alltag Hinausgehende suchend, sie fleißig, ausdauernd, pflichtbewusst, nach außen trocken, mit einem sehr guten, gesunden Verstande und einer Neigung zu gutmütiger Ironie begabt. Für die liebenswürdige Erscheinung des frühverstorbenen Vaters bewahrte Keller lebenslang wehmütige Verehrung und vergaß das Erinnerungsbild nie, wie der schlanke junge Mann im grünen Anzug ihn, ein kleines Bübchen, unter schönen Reden über erhabene Dinge durch ein blühendes Kartoffelfeld trug. Mit der Mutter war er zusammengewachsen, und indem er sich als ein Stück von ihr fühlte, kam es ihm selbstverständlich vor, dass sie alle seine Leiden mit Leib und Seele mitleiden müsse, gerade so wie er sich im alten Grünen Heinrich ihr nachsterben lässt, als ob es nicht anders sein könne. Was uns oft wie unbegreifliche Grausamkeit erscheinen will, sein langes Fernbleiben und mehr noch sein langes, einmal jahrelanges Schweigen war in der Tat nur die allerinnigste Liebe, wie sie die beiden strengen Herzen fühlten. Die stille Heldenhaftigkeit der kleinen alten Frau, deren überschwängliche Liebe in den starren Kreis des unbeugsamen Pflichtbewusstseins gebannt erscheint, gibt seiner Kindheit und Jugend einen altertümlichen Hintergrund, wozu der alte Zürcher Stadtteil, in dem er aufwuchs, das enge Haus mit dem Fernblick auf die weißen Berge, die er vom Gewölk nicht unterschied, wohl stimmte.
Der kleine Gottfried war ein Bursche, wie es wohl manch einen in Zürich gibt: schweigsam und trotzig bei innerlicher Regsamkeit und Zärtlichkeit, lernbegierig trotz träumerischer Faulheit, zugleich ehrlich und listig, trocken und phantastisch, fest in seiner krausen Eigenart steckend. Über dieser drolligen Mischung herrschte ein mächtiger Intellekt, der sich langsam der Erscheinungen bemächtigte, die ihn umgaben, um schließlich die Welt zu umfassen. Gab es einen Riss in Gottfried Kellers Wesen, so bestand er in diesem Übermaß des Intellektes, dem ein gleich starker, auf das tätige Leben gerichteter Wille nicht entsprach, was sich in seinem Äußeren ausprägte durch das große Haupt mit der herrlichen Stirn und den schönen Augen auf dem kleinen kurzbeinigen Körper. Eine prächtige Blume und schwere Frucht an hohem, starkem Stamme würde uns als eine vollendete Naturerscheinung entzückt haben; nun, kurz und knorrig gestielt ist die Pflanze wohl etwas sonderlich ausgefallen, was aber eben Kellers Persönlichkeit ausmacht, die solche, die ihn lieben und verehren, sich nicht anders wünschen möchten.