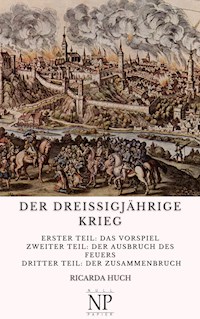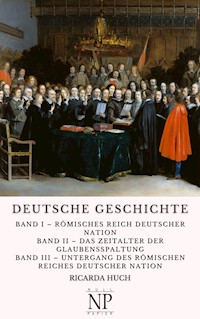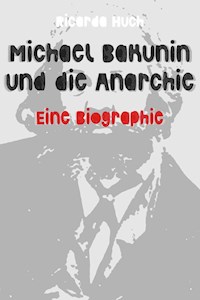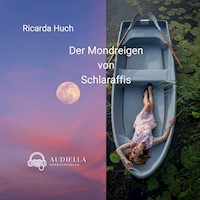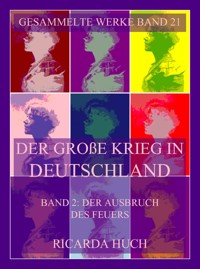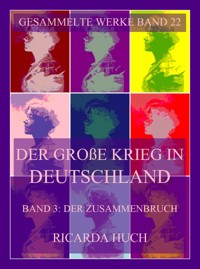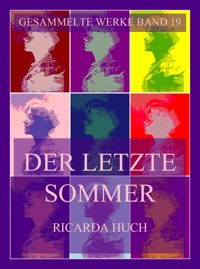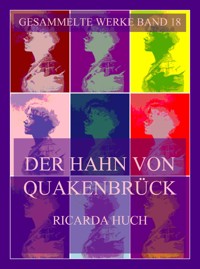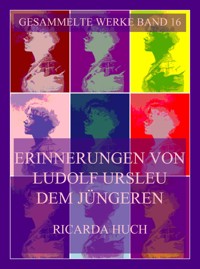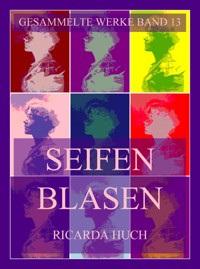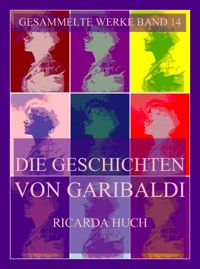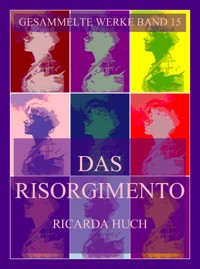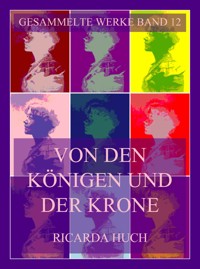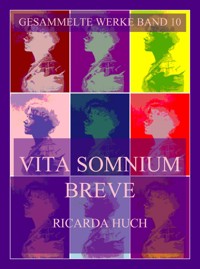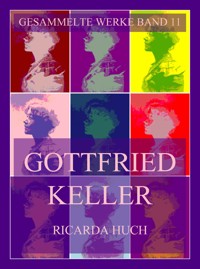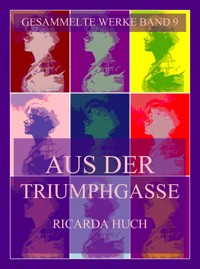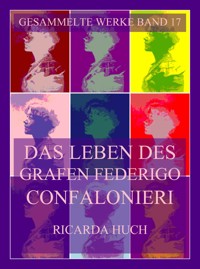
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ricarda Huch Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Aus den Vorfrühlingstagen der Einigung Italiens hat Ricarda Huch den Stoff für ihren Roman "Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri" geschöpft. Sie hatte schon früher eine Reihe bemerkenswerter Menschen und Schicksale aus dem Zeitalter des Risorgimento in ihren Büchern charakterisiert und erzählt. Nun haben sich die Sonderbilder zu einem Gesamtgemälde gerundet, das auf geschichtliche Treue Anspruch machen darf, aber weit darüber hinaus ins Bedeutende wächst. Gewiss packt uns der verfrühte Kampf des erwachenden italienischen Nationalgefühls gegen die österreichische Fremdherrschaft, gewiss sehen wir in dem mailändischen Grafen und seinen Genossen echte Lombarden, anders geartet als wir und unsersgleichen; aber das politische Lied wird von den tiefen Glockenstimmen menschlichen Leides übertönt, und der südländische Held aus edlem Geblüt, er wird einer der Unsrigen, wir werden heimisch in seiner Seele, und wenn die Tragödie seines Lebens in erhabener Feierlichkeit an uns vorüberzieht, so ist es uns, als wären wir vor etwa 200 Jahren denselben Weg mit ihm gegangen, als hätten wir den Confalonieri längst gekannt, als wären wir sein nächster Freund, vielleicht er selbst gewesen und hätten es nur vergessen gehabt. Dieses tief beseligende Gefühl einer erwachenden Erinnerung ist sehr natürlich, denn der Kern, der Wert von Confalonieris Leben ist unabhängig von Zeit und Ort die alte Weisheit, die jeder erfährt oder ahnt, dass auf den heißen Drang der Jugend ein kühler Abend folgt, und die tröstliche Zuversicht, dass ein warmes Gefühl, eine hohe Gesinnung, eine große Tat niemals verloren gehen, sondern heimlich fortwirken als Leben treibende Säfte im langsam blühenden Baum der Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri
RICARDA HUCH
Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681904
Der Text dieser Ausgabe folgt der Ausgabe 1922 Insel Verlag, zu finden unter https://www.google.de/books/edition/Das_Leben_des_Grafen_Federigo_Confalonie/Re8PAQAAIAAJ?hl=de&gbpv=0.
www.jazzybee-verlag.de
admin@jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II17
III30
IV.. 56
V.. 70
VI78
VII86
VIII93
IX.. 101
X.. 106
XI125
XII132
XIII139
XIV.. 147
XV.. 157
XVI163
XVII170
XVIII176
XIX.. 181
XX.. 189
XXI197
XXII207
XXIII216
XXIV.. 224
XXV.. 229
XXVI234
XXVII238
XXVIII247
XXIX.. 253
XXX.. 263
XXXI269
I
Wenn der junge Graf Federigo Confalonieri durch die Straßen Mailands ging, die eng, hoch und steil wie Felsschluchten waren, so glich er einem eingeschlossenen Pferde oder Hirsch, der mit entrüsteter Ungeduld die labyrinthischen Gänge seines Gefängnisses entlang schreitet und den Ausgang ins Freie sucht. Während er bei allen Vergnügungen, die die gute Gesellschaft pflegte, beim Fechten, Tanzen und Reiten, bei Rennen und Jagden, durch seine Gewandtheit und seinen Geschmack die Blicke auf sich zog, eilten seine Augen, deren schwarzblauer Glanz sie unvergleichlich machte, über die Umgebung hinweg, als ob sie nichts als ein Hindernis wäre, das ihn einengte.
Es war an einem Abend des ausgehenden Winters, als ihm dies Gefühl der Unruhe und des Ungenügens deutlicher und schmerzhafter als je zum Bewusstsein kam, nämlich auf einem Balle, den er ohne seine Frau besuchte, die ihrer ersten Entbindung entgegensah. Er fand die Gesellschaft, die sich im Palaste des alten Grafen Litta versammelte, in besonderer Erregung, weil Eugen Beauharnais, der Vizekönig von Italien, sein Erscheinen zugesagt hatte, worauf man umso mehr gespannt war, als seine junge Gemahlin ihn begleiten sollte, eine bayrische Prinzessin, von deren Schönheit, Liebenswürdigkeit und Tugend gesprochen wurde und die erst kürzlich in die Residenz eingezogen war. Federigo, dessen Familie Österreich anhing und der in der Abneigung gegen Napoleon aufgewachsen war, nahm die frohbewegte Stimmung mit Unwillen wahr; in jeder Gruppe, der er sich näherte, wurde von den hohen Eigenschaften des fürstlichen Paares gesprochen, und auch diejenigen, die über den neugebackenen König und Ehemann witzelten, verrieten, dass sie durch seine bevorstehende Gegenwart erregt waren.
Als Eugen, seine Frau am Arm, eintrat, hörte man zunächst nichts als das Kleiderrauschen der herabsinkenden Damen, bis die lebhafte Anrede des Prinzen den Herrn und die Herrin des Hauses, die Nächststehenden und allmählich die ganze Gesellschaft ermunterte. Federigo stand neben der Gräfin Frecavalli, einer Freundin seiner Frau, in einer Fensternische, von wo aus sie bequem zusehen konnten, ohne selbst beachtet zu werden. »Hübsch, aber plebejisch,« sagte sie mit Verachtung; »er sieht aus wie ein Unterleutnant, der etwa auch mit einem netten Kammermädchen zufrieden ist. Unsere Landsleute indessen scheinen mit Begeisterung die Untertanen dieses Karnevalkönigs zu spielen.« Dies sagte sie mit Bezug auf die Herren und Damen, die sich drängten, dem prinzlichen Paar vorgestellt zu werden. Die allgemeine Beflissenheit benutzte Federigo, um unbemerkt den Saal und das Haus zu verlassen; seine Laune war so geworden, dass es ihm unmöglich schien, in die gesellige Fröhlichkeit einzustimmen. Er machte sich eilig Weg durch die neugierigen Menschen, die noch immer am Tore des Palastes standen, bog in eine stillere Nebenstraße ein und überließ sich seiner Stimmung und seinen Gedanken.
Das Bild der hochmütigen Aristokraten, seiner Landsleute und Standesgenossen, wie sie dem jungen Franzosen huldigten, den die Willkür Napoleons ihnen als Fürsten aufgedrängt hatte, haftete, Zorn und Ekel erregend, in seinem Geiste. Er dachte, dass Napoleon kein Land mit solcher Nichtachtung behandelt hätte wie Italien, und indem er sich sagte, dass sie es durch ihr Betragen verdienten, empörte sich doch sein Gefühl dagegen, als gegen eine Vergewaltigung und Verhöhnung des edelsten unter allen Kulturvölkern. Mehr als je empfand er es mit Genugtuung, nicht zu diesen Menschen zu gehören, die ohne Würde und Größe nur auf den flachen Genuss des Augenblicks bedacht waren; zugleich aber bedrängte ihn die Frage, wodurch er sich denn anders als eben durch diese Verachtung von ihnen unterschiede. Dass sie ihn nicht für ihresgleichen hielten, ließen ihn die älteren Leute durch Abneigung, Tadel oder Spott merken, viele von den jüngeren dadurch, dass sie ihn anstaunten und ihm in Kleidung und Gewohnheiten nachzueifern suchten, sei es auch nur, um sich hervorzutun. Man hielt ihn für klug, scharfblickend und hochstrebend, seine Altersgenossen, junge Männer, Frauen und Mädchen hörten zu, wenn er sprach, wie wenn sein Urteil mehr als das anderer gälte; aber in diesem Augenblick schätzte er sie gerade deswegen gering. Er hatte nichts geleistet, nicht mehr gelernt als jeder junge Edelmann von Mailand: Reiten, Fechten, ein wenig Französisch und ein wenig Geschichte. Vielleicht gehörte eine gebietende Haltung und eine stolze Anmut zu seiner Person, die ihn vor anderen auszeichnete; aber auch wenn er alle anderen in der Ausbildung des Körpers übertroffen hätte, war er doch nicht so einfältig, bloßen Fertigkeiten höheren Wert beizulegen. Es hatte Männer in Mailand gegeben und gab noch solche, die Anspruch auf Ehrfurcht und Ruhm hatten: Beccaria, der die Rechtswissenschaft in eine neue Bahn gelenkt hatte, Verri, dessen Charakter ein Vorbild war, Monti, dessen Kunst auch die Verächter seiner Gesinnungslosigkeit bewundern mussten, und andere; wie er nun bedachte, dass ein unbestimmtes Selbstgefühl ihn von jeher über diese hinausgedrängt hatte, und dann, was er bisher geleistet hatte, mit ihren Taten verglich, ergriff ihn ein solches Schamgefühl, dass er für sich errötete.
Er ging schnell vorwärts, vom Ungestüm seiner Gedanken und Entschlüsse getrieben; denn indem er das schärfste Urteil über sich fällte, entschied er zugleich, dass es für die Zukunft aufgehoben sein sollte. Kenntnisse wollte er sich zuerst erwerben, damit er sich nicht länger durch die Lächerlichkeit entwürdigte, Meinungen und Einrichtungen zu verachten, ohne seinen Tadel begründen und vernünftige Vorschläge machen zu können. Wenn andere ihm darin nachahmten, dass er die herrschenden Gesinnungen und Verhältnisse angriff, so wollte er, dass sie zugleich ein Muster des Besseren in ihm finden könnten. Der Druck, der ihn während des ganzen Abends belastet hatte, wich dem Schwunge seiner belebten Willenskraft, die sich auf ein außerordentliches Ziel richtete; seine schlanke Gestalt richtete sich freier auf, und er durcheilte mehrere Straßen mit fliegenden Schritten, ohne darauf zu achten, wohin sie führten. Er beschloss ohne Zögern, morgen etwa, seine Lebensweise zu verändern und, anstatt die Zeit mit sinnlosen Vergnügungen und Zeremonien zu verlieren, seinen Geist durch gründliches Studium, namentlich der Staats- und Naturwissenschaften, der Geschichte und der Sprachen, zu bilden und zu erweitern. Plötzlich veranlasste ihn das Gefühl, sich an einem unbekannten Orte zu befinden, dass er stehenblieb und sich umsah: er fand heraus, dass er sich nicht weit von der Porta Comasina befand, in einer Gegend, wo hauptsächlich kleine Handwerker wohnten und die er selten besuchte.
Wie er stand und überlegte, welchen Weg er einschlagen müsste, um am schnellsten nach Hause zu kommen, denn er befand sich an einem Kreuzungspunkt, sah er tief im Hintergrunde einer langen dunklen Gasse etwas Unkenntliches sich langsam bewegen. Er bedachte schnell, dass er allein in dieser verlassenen Gegend war und keine Waffe bei sich hatte; doch blieb er mit etwas unruhiger klopfendem Herzen stehen, um das Verhüllte herankommen zu lassen. Ein schwaches Räderrollen und der klarer werdende Umriss überzeugten ihn, dass es ein Wagen war, der vielleicht einen Toten oder einen Kranken beförderte. Als er nahe genug bei ihm war, rief er dem Kutscher zu: »Fährst du einen Kranken? Hat es einen Unfall gegeben?« worauf der Wagenschlag sich öffnete und der Kopf eines Herrn zum Vorschein kam, der fragte, was es gebe. Mit Verwunderung erkannte Federigo den Grafen Melzi d’Eril, den ehemaligen Präsidenten der zisalpinischen Republik, den Napoleon zum Herzoge von Lodi gemacht hatte und der jetzt noch, obwohl ohne Amt, eine beratende und oft entscheidende Stimme in den Staatsgeschäften hatte. Auf Federigos Entschuldigung, er habe sich überzeugen wollen, ob der Wagen etwas Gespenstisches, etwas Verbrecherisches oder Hilfsbedürftiges verberge, lächelte Melzi und erklärte, dass er wegen eines Anfalls heftiger Gichtschmerzen seinem Kutscher befohlen habe, Schritt zu fahren; gleichzeitig forderte er ihn auf, einzusteigen und mitzufahren, wenn anders er nach Hause wolle, da die Schmerzen jetzt fast vorüber wären und er die Pferde wieder traben lassen könne. Als Federigo neben ihm saß, fügte er hinzu, dass er in einer sehr wichtigen Angelegenheit von seinem Landgut in die Stadt komme, nämlich um den Vizekönig von einer Entschließung abzuhalten, die er für unheilvoll halte. Er spreche davon, sagte er, weil Federigo in dem Rufe stehe, nicht nur gut reden, sondern auch klug schweigen zu können. »Da Ihr auf die eine meiner bescheidenen Gaben rechnet,« sagte Federigo, »gestattet Ihr mir vielleicht, von der anderen einen mäßigen Gebrauch zu machen.« Eigentlich sei es nur eine Frage, die er stellen wolle: ob Melzi es für ehrenhaft und ratsam halte, dass ein junger Mann sich und seine Arbeit einem Staate widme, dessen persönlicher Spitze er mit grundsätzlicher Abneigung gegenüberstehe. Melzi betrachtete Federigo mit Wohlwollen und sagte lachend: »Ich sehe, mein Lieber, dass Ihr auch ein wenig auf meine Verschwiegenheit rechnet.« Ernsthafter verbreitete er sich dann darüber, dass nach seiner Meinung jeder junge Mailänder, der durch Herkunft und Begabung eine Anwartschaft darauf habe, in den Staatsdienst eintreten solle. Er wisse, dass die Familie Confalonieri österreichisch gesinnt sei; ob nun aber Federigo diesen Traditionen folge oder nicht, so sollte er sich keinesfalls dadurch abhalten lassen, seine Arbeitskraft dem Staate zu widmen. Es komme weniger darauf an, wer der Maschine seinen Namen gebe, als von wem und in welchem Sinne sie gelenkt würde. Die französische Herrschaft sei in vieler Hinsicht ein Vorteil für die Lombardei gewesen, das öffentliche Leben habe sich reicher entfaltet; freilich, wenn die einheimischen Tüchtigen sich vom Staatsdienste zurückzögen, so müsste entweder Misswirtschaft oder Fremdherrschaft entstehen, die außerdem zur Folge hätte, dass der eingeborene Adel, der der Träger der Kultur und insbesondere des Staatswesens sein sollte, infolge der Untätigkeit träge, stumpf, weichlich und untauglich würde.
Da sie inzwischen vor dem Palaste des Herzogs angekommen waren, verabschiedete sich Federigo mit Dank, ohne den Wagen, den jener ihm anbot, weiter zu benutzen. Während er nach Hause ging, überdachte er Melzis Worte, die ihn durchaus nicht befriedigten. Wie konnte er sagen, dass es auf die Person des Herrschers nicht ankomme, wenn der Herrscher Napoleon war; denn Eugen Beauharnais war nur sein Geschöpf! Die in Mailand regierten und verwalteten, waren nur Vollzieher von Napoleons souveränem Willen; man war nicht in England. Je aufrichtiger er Melzi als einen hervorragenden Staatsmann von unanfechtbarer Redlichkeit bewundert hatte, desto mehr missfielen ihm die eben ausgesprochenen Grundsätze, auf die sich der Tross der gesinnungslosen Sklaven berufen konnte, die nach der Gunst des jeweils Mächtigsten haschen. Nicht die flüchtigste Neigung war in ihm, dem erhaltenen Rate gemäß zu handeln; vielmehr war sein Entschluss befestigt, keinerlei Amt, das Hof oder Regierung ihm anböte, anzunehmen, sondern sich zunächst ganz auf die Ausbildung seines Geistes zu beschränken.
Dessen ungeachtet gelang es Eugen Beauharnais, ihn mit dem Hofe zu verknüpfen, indem seine Frau Hofdame der Vizekönigin wurde, was Federigo auf den Wunsch der Familie Casati, der Teresa angehörte, zuließ. Teresa war zwar gewöhnt, sich dem Willen ihres Mannes zu fügen, der nicht selten von dem der Ihrigen abwich, freute sich aber der getroffenen Übereinkunft diesmal besonders, weil sowohl die wahrhaft liebenswerte Prinzessin wie der warmherzige, ritterliche Beauharnais ihr sympathisch waren. Ihre kindlich edle Erscheinung und ihr treuherzig schlichtes Wesen, das sie von den anderen Damen durchaus unterschied, machte bald Eindruck auf den Vizekönig, und seine Huldigungen wurden bemerkt, wie auch, dass Teresa sie gelassen annahm; denn da sie nicht gefallsüchtig war, dachte sie weder daran, die Männer zu reizen, noch sie gelegentlich zurückzustoßen, sondern freute sich arglos der Neigung, die sie erweckte. Federigo, der das Erscheinen seiner Frau bei Hofe immer ungern gesehen hatte, bekämpfte mühsam seinen Unwillen; wie nun aber der Vizekönig ihm das Amt eines Groß-Stallmeisters anbot und dadurch einer beleidigenden Verkennung seiner Persönlichkeit und seiner Talente oder einer Gedankenlosigkeit Ausdruck gab, die ebenso sehr der Zurechtweisung bedurfte, lehnte er nicht nur für seine Person ab, sondern ließ auch Teresa ihr Amt bei der Prinzessin niederlegen. Dass der kleine französische Edelmann, der Sohn einer Frau von zweifelhaftem Rufe, durch nichts als soldatische Tüchtigkeit und die galante und leichte Liebenswürdigkeit der französischen Offiziere ausgezeichnet, ihn zu seinem Stallmeister hatte machen wollen, fühlte er so sehr als Kränkung, dass er es bedauerte, sie nicht im Zweikampfe rächen zu können. Es verschärfte seinen Hass, dass die sonst immer nachgiebige Teresa zwar seinem Willen gehorchte, aber im Bewusstsein ihrer Schuldlosigkeit und der Harmlosigkeit von Eugens Leichtsinn, sein Verhalten ihr gegenüber in Schutz nahm und Federigos Eifersucht umso bestimmter zurückwies, als kein Liebesübermaß auf seiner Seite sie entschuldigen konnte. Eine Zeitlang war er geneigt, ihr nicht nur Mangel an weiblicher Würde, sondern auch an italienischer Gesinnung vorzuwerfen, eine Unbilligkeit, die ihre sich gleichbleibende Treue und Festigkeit allmählich stillschweigend widerlegte.
Mit dreißig Jahren war Federigo das Haupt einer Partei geworden, die sich die Italienische nannte, weil sie anstatt französischer oder österreichischer Herrschaft einen nationalen Staat als Ziel setzte, oder auch die Liberale, weil sie die alte, absolutistische Regierungsform durch eine Verfassung in moderner Art ersetzen wollte. Unerwartet schnell stellten die stürzenden Ereignisse sie vor die Notwendigkeit zu handeln, als Napoleon fiel. Die Möglichkeit, selbständig zu werden, war für Mailand jetzt durch raschen Anschluss an Eugen Beauharnais gegeben, der, an der Spitze eines geschulten Heeres stehend, Österreich abhalten und sich zu einem italienischen Könige machen konnte. Allein die Unabhängigkeitspartei konnte von diesem Franzosen und Geschöpf Napoleons den Begriff der Fremdherrschaft nicht trennen und richtete die ganze Kampfkraft gegen ihn, wodurch es den österreichisch Gesinnten leicht wurde, ihre Pläne durchzusetzen. Der wilde Flügelschlag dieser Zeit war für Federigo wechselweise belebend und entkräftend; er genoss in vollen Zügen, dass er handeln und vorwärtseilen konnte, aber das Bewusstsein nagte an ihm, dass teils Mangel an geeigneten Mitteln, teils die Gedankenlosigkeit und Selbstsucht seiner Anhänger wie seiner Gegner ihn verhindern würde, das erwünschte Ziel zu erreichen. Die größere Hälfte der Aristokratie mochte sich nicht schnell genug in Österreichs Arme werfen, das durch fast hundertjährige, heilsame Herrschaft sich heimisch in Mailand gemacht hatte, und mit derselben Ausschließlichkeit sahen die Franzosenfreunde die Rettung durch den Beauharnais verbürgt; es schien ihm, als ob keiner von allen, auch die von seiner Partei nicht, das Schicksal Italiens im Ganzen und seine Zukunft bedachte. Zuweilen war es ihm, als ob er allein sehend und wissend zwischen lauter Tieren sei, die ein unverstandener Instinkt zu einer an sich bedeutungslosen oder vielleicht unheilvollen Stelle risse, ein zugleich kläglicher und brutaler Anblick. In dem Gefühl, alleinstehend mit einer schweren Verantwortung belastet zu sein, dachte er an den Grafen Melzi als an den einzigen, dessen Ansehen so groß und allgemein war, dass er vielleicht die Vereinigung aller zu gemeinsamem Handeln erzwingen konnte.
Es war ein Frühlingsmorgen, als er sich entschloss, den Kanzler aufzusuchen und ihn zu bitten, in die Verwirrung der öffentlichen Angelegenheiten rettend einzugreifen. Melzi empfing ihn auf einem Diwan liegend, da ihn die Gicht seit einiger Zeit des Gebrauchs der Beine beraubte; sein Gesicht war schmäler und weißer geworden, die feine gebogene Nase schärfer, und die Lippen, um die ein höfliches Lächeln schwebte, dünn und blass. Seine dunklen Augen, die in früherer Zeit wohl einen Ausdruck jesuitischer List und Verborgenheit annehmen konnten, waren tiefer zurückgesunken und erschienen größer und ernster. Er äußerte Freude, Federigo zu sehen, an dessen Entwicklung er immer Anteil genommen habe und der einen Veilchengeruch von Ahnung und Hoffnung mit in sein Krankenzimmer bringe. Indessen zu dem, was Federigo nun vortrug, schüttelte er den Kopf. »Versucht nicht,« sagte er, »mich noch einmal in die Kämpfe des öffentlichen Lebens zu ziehen, die ich kaum aus der Ferne zu betrachten tauge. Ich habe jahrelang mit aller Kraft der einen Welt gedient, in der wir Sterbliche uns bewegen; nun wird es mir Zeit, mich in die unsichtbare einzuleben, der wir auch angehören. Wohl habe ich dem Kaiser nahe genug gestanden, um durch die Wendung seines Geschickes erschüttert zu werden; denkt indessen nicht, dass diese Anhänglichkeit mich etwa bewöge, mit dem sinkenden Sterne den Schauplatz zu verlassen. Aber wen lässt dies Ende nicht an das Ende aller menschlichen Dinge denken! Von dem Anblick der zahllosen geringeren Geschöpfe, die sich, von einem mächtigeren lange niedergehalten, nun tausendfüßig regen und täglich anmaßender ihr Teil von der freigewordenen Beute heischen, wendet mein Auge sich überdrüssig ab; geschweige denn, dass ich auf diesem Markte mitfeilschen möchte. Wir überschätzen die Wichtigkeit unserer irdischen Verhältnisse. Wie gleichgültig ist es, wessen Gier es davon trägt, was der oder jener besitzt, wem dies oder das angehört! Was ein jeder ist und tut, davon hängt das Wohl der Einzelnen und des Ganzen ab. In einem Staat von Ehrenmännern, die das Rechte tun, kann auch ein Schelm ohne Schaden regieren.«
Federigo hatte kaum mit der Achtung zuhören können, die das Alter und die Würde des Kanzlers erforderte. »Verzeiht mir,« entgegnete er lebhaft, »wenn ich Euch in die dünne Region solcher Anschauungen nicht folgen mag. Wie kann ein jeder das Rechte anders tun, als indem er die Pflichten seines Berufes erfüllt? Und habt Ihr nicht selbst gesagt, dass unser Beruf es ist, dem Staate zu dienen? Ich weiß nicht, welche Formen das Dasein im Reiche Gottes annehmen wird; wir müssen die Triebkräfte anerkennen und nützen, die uns irdische Menschen bewegen. Auf den Höhen Eurer Weisheit verkümmert der Wuchs der Taten; die aber sind das Skelett der Menschheit, und ihr Edelstes ist daran gebunden und darin ausgedrückt, bis wir erlöste Geister sind.«
Melzi, der aufmerksam und lächelnd zugehört hatte, sagte einlenkend, er freue sich, einen jungen Landsmann eine so kräftige Lebensauffassung äußern zu hören. Er habe sein Fernbleiben von den Welthändeln erklären, nicht ihn dazu überreden wollen. Wenn er seinen Rat wünsche, sei es der, nicht mehr erstreben zu wollen, als was vernünftigerweise erreichbar sei. Wenn Mailand jetzt zu Beauharnais halte, sei es möglich, dass dieser das lombardo-venezianische Königreich erhalte und eine einheimische Dynastie begründe; er habe dahinzielende Ratschläge bereits seit Wochen gegeben, allein die Mailänder Parteien hörten nicht auf, sich untereinander zu bekriegen, und Prinz Eugen sei zu zartfühlend oder zu kleinmütig, um die zum Zweck notwendigen Entschlüsse zu fassen.
Federigo warf mit einer unmutigen und verächtlichen Bewegung den Kopf zurück und sagte: »Wenn er es vorzieht, sich zu fügen, warum sollten wir den Fremden festhalten?« Der Kanzler kniff die Augen zusammen und betrachtete seinen Gast nachdenklich. »Gehorsam ist die höchste Weisheit, die der Mensch erlernen kann,« sagte er bedächtig und fuhr dann in einem sachlicheren Tone fort: »Ihr liebt den Vizekönig nicht und, wenn ich recht berichtet bin, die Erzherzoge ebenso wenig. Welcher klügere Plan ist es denn, mit dem Ihr meinen ausstechen wollt? Sollen wir dem General Pino die eiserne Krone anbieten?« Es war nämlich unter den unbedingten Italienern daran gedacht worden, diesen tüchtigen Anführer, der den russischen Feldzug rühmlich mitgemacht hatte, an Eugens Stelle zu setzen. Federigo machte eine hastig ablehnende Handbewegung, indem er sagte: »Wir haben genug von der Soldatenherrschaft!« und auf Melzis fragenden Blick setzte er vorsichtig zögernd hinzu: »Es gibt Millionen Italiener, und die Hälfte von ihnen sehnen sich nach einem freien und unabhängigen Vaterlande. Wenn sie alle ihre lokalen Eitelkeiten und Beschränktheiten diesem Ideal zuliebe ein wenig zurückstellten, wenn sie ihre Wünsche zu einem festen, dauerhaften Willen verdichteten, sollten wir zu diesem italienischen Volke nicht einen italienischen Fürsten finden können?« Melzi hatte mit kühlem Staunen zugehört und den Kopf nach dem geöffneten Fenster gedreht; am hellblauen Himmel hingen Girlanden von daunenweichen Wölkchen über den dunklen Palästen, die sein Gegenüber bildeten. »Wenn! wenn! Das sind Schimären!« sagte er zerstreut und spielte mit einem in karminrotes Leder gebundenen Buche, das an seinem Tischchen neben ihm lag, und in welchem er vorher gelesen haben mochte. Es sei die »Nachfolge Christi« von Thomas a Kempis, erklärte er, ein Buch, das Federigo wohl noch nicht gelesen hätte, das er aber gewiss später einmal schätzen würde. »Alle Geheimnisse der Welt löst dies Buch«, sagte er, »dem, der es versteht, wovon ich leider noch fern bin. Kennt Ihr den Spruch des alten Mystikers: ›In girum imus nocte et consumimur igni; wir irren nächtlich im Kreise und verzehren uns brennend?‹ Gönnt mir, mein Lieber, mich aus dem irdischen Labyrinth zu entwirren, bevor das selbstmörderische Feuer mich verzehrt hat.« In seinem Blicke lag beim Abschiede wohlwollende Nachsicht und ein leiser Spott, der Federigo das Blut in die Wangen trieb.
Die Enttäuschung, die er erfahren hatte, erbitterte ihn gegen den Mann, den er als den feinsten Geist und stärksten Charakter Mailands, ja Italiens bewundert hatte, und der sich nun seinem Vaterlande entzog, da es seiner am meisten bedurfte. So trübselig hatte ein Alter von kaum sechzig Jahren ihn verändert; er zürnte mit der gebrechlichen Menschennatur und mit dem Kanzler insbesondere, den er frei von den der Allgemeinheit anhaftenden Schwächen geglaubt hatte. Wäre er offen und wirksam für Eugen eingetreten, so hätte man ihn bekämpfen oder sich von ihm überwinden lassen können; aber unleidlich war ihm die Gleichgültigkeit oder Trägheit und vollends, dass er sie in eine Kutte der Frömmigkeit und Weisheit vermummte. Es schien ihm dasselbe zu sein, was er den meisten seiner Landsleute vorwarf und worin er den Grund der staatlichen Bedeutungslosigkeit sah, nämlich eine gewisse Weichlichkeit des Geistes, der sich am wohlsten fühlt, wenn er sich in Beschäftigungen verlieren kann, die kein wirksames Handeln erfordern und keine Verantwortung auferlegen, etwa Münzen oder alte Pergamente sammeln, ins Theater gehen oder Rosenkränze abbeten.
Auf sich selbst angewiesen, warf er sich mit hochgespannter Leidenschaft in die Ereignisse des Tages, zunächst mit dem Zweck, die Verlängerung der Franzosenherrschaft in der Person des Prinzen Eugen unmöglich zu machen. Die Volksrache, die man absichtlich gereizt hatte, griff aus der Reihe der Unbeliebten den Finanzminister Prina heraus und marterte den Wehrlosen mit den Händen und allerlei beliebig aufgerafften Werkzeugen zu Tode. Während so Mailand die Reste der napoleonischen Herrschaft zertrümmerte, verteilten die Alliierten Italien, und als eine Abordnung aus Mailand in Paris eintraf, um einem habsburgischen Prinzen die Krone eines selbständigen, nach liberaler Verfassung zu regierenden Reiches anzubieten, waren die Lombardei und Venetien bereits österreichische Provinzen geworden.
Federigo war ein Mitglied der durch die provisorische Regierung ernannten Deputation und reiste mit dem Bewusstsein ab, obwohl der jüngste unter seinen Gefährten, der einzige zu sein, der für eine möglichst weitgehende Selbständigkeit Mailands mit Nachdruck eintreten würde; denn die übrigen wollten nichts, als dem Kaiser ihre Ergebenheit versichern, oder verfolgten den Grundsatz, sich nicht auszusetzen. Nun aber zeigte sich sofort, dass der Abordnung keine andere Aufgabe blieb, als dem neuen Herrn zu huldigen, und während auf der einen Seite die wachsende Einsicht in die Aussichtslosigkeit aller seiner politischen Bestrebungen ihn erschütterte, erheiterte und berauschte ihn das Treiben der großen Stadt und die glänzende Geselligkeit, an der teilzunehmen seine Stellung ihn veranlasste. Wo er erschien, bewirkte der Zauber seiner Gestalt und Mienen, die seelenvolle Lebhaftigkeit und der Gehalt seiner Rede, dass man ihn auszeichnete; aber er konnte über der schmeichelnden Meinung der anderen nur auf Stunden die vergessen, die er selbst von sich hatte: dass er mit allen seinen Plänen und Hoffnungen gescheitert war und die hohle und lächerliche Rolle eines belanglosen Höflings spielte. Noch klammerte er sich an die Aussicht, dass die Vertreter Englands und Russlands Mailand in seinen Forderungen unterstützen würden; da er bei ihnen kein Gehör fand, blieb nur die Möglichkeit, dass der Kaiser selbst den Willen der Italiener achtete, wenn es gelang, ihn von dem Ernst und der Festigkeit desselben zu überzeugen.
Kaiser Franz empfing die Mailänder Herren in gemütlicher Stimmung, die sich unter dem Eindruck der absichtlichen Zurückhaltung, die Confalonieri beobachtete, zunächst nur desto umständlicher entfaltete. Während der ersten oberflächlichen Wechselreden betrachtete Confalonieri die hohe Person mit Spannung: Sein Körper, sein Gesicht und seine Haltung waren nicht hässlich, aber geistlos und unedel und standen in verletzendem Widerspruch zu der Stellung, die er einnahm, und zu der Selbstgefälligkeit, mit der er sich derselben bewusst zu sein schien. Nichts von Größe, Wahn oder Übermut lag in seiner Erscheinung unwillkürlich ausgesprochen, wohl aber ein eisernes Selbstgefühl, das nicht dem Stolz üppiger Natur und adligen Blutes entsprang, sondern einer Art habgieriger und missgünstiger Gesinnung, die sich von niemandem den Rang ablaufen lassen will. Dieser Eindruck, den er sich im Einzelnen nicht sofort klarmachte, erzeugte in Federigo ein Gefühl von Abneigung gegen ein Fremdartiges, seiner Seele nicht Eingehendes, das mit leiser Geringschätzung verbunden war.
Sowie eine Gelegenheit sich bot, sagte er etwa folgendes: »Die Wirbel der Vergangenheit haben in Mailand wertvolle Kleinodien zurückgelassen: ein eigenes Heer, das sich in blutigen Kriegen bewährt hat, Gesetze, die freilich bisher ungeachtet auf dem Papiere standen, Unternehmungen, die die Betriebsamkeit förderten und den Wohlstand hoben; darf Mailand von Eurer Majestät erleuchteter Einsicht und väterlicher Güte hoffen, dass Sie einen Besitz, den es mit vielen Opfern bezahlt hat, erhalten werden?«
Der Kaiser, dem die Bedeutung der Worte nicht entgangen war, sagte nachlässig, als ob es sich um ein paar förmliche Redensarten handle: »Ja ja, ich weiß wohl, die Mailänder haben in den Kriegsjahren viel gelitten. Nun, ich werde für alles sorgen; ihr seid meine Untertanen, und ich werde wie ein Vater euren billigen Wünschen und Bedürfnissen Rechnung tragen.« Das Wort Untertanen, das Franz in der Tat mit Bedacht gewählt hatte, klang Federigo wie eine Zurückweisung und Herausforderung; umso entschiedener brachte er die Bitte vor, der Kaiser möge die Lombardei durch Personalunion mit seinen übrigen Ländern verbinden, nicht zu einer österreichischen Provinz machen. »Ich bin nicht ehrgeizig,« sagte Franz, »von einem Königreich Italien will ich nichts wissen, weil ich nur auf die Provinzen Lombardei und Venetien ein Recht habe.« In seinem Tone lag jetzt die Bestimmtheit des Herrn, der das letzte Wort gesagt hat; doch würde er gern, fügte er herablassend hinzu, bei seinen Maßnahmen die Vorschläge der Abgeordneten in Überlegung ziehen. »Etwas anderes zu erbitten oder anzunehmen, als was wir gesagt haben, liegt nicht in unserem Auftrage,« sagte Federigo kalt. Franzens hellblaue, neugierige Augen glitten rasch mit spöttischem Missfallen über den jungen Grafen, der ihm dermaßen zu trotzen wagte. Das Urteil, das er im Innern über ihn ausfertigte, lautete, dass der junge Mann eitel, hochfahrend und phantastisch sei und gelegentlich gedemütigt werden müsse. Die anderen Mailänder Herren gefielen ihm freilich ebenso wenig, obwohl sie mit augenscheinlicher Beflissenheit darum warben; denn wenn er auch Unterwürfigkeit forderte, war er doch nur mit derjenigen zufrieden, die mit deutscher Einfalt und Biederkeit dargebracht werde, während ihre übertriebene und allzu glatte Äußerung ihm Misstrauen einflößte. Überhaupt hatten die Italiener nichts Trauliches für ihn; doch erachtete er sie für ungefährlich, sofern er sie nur scharf in Zucht hielte.
Federigos Herz war voll von Erbitterung gegen alle, die seiner Ansicht nach diesen Ausgang verschuldet hatten: gegen die mailändische Regierung, die sich nach dem Sturze Napoleons und Eugens gebildet hatte, gegen die österreichische Partei und gegen seine eigene, gegen den Grafen Melzi. Wenn alle diese anders gewesen wären, glaubte er, hätte sich etwas erreichen lassen; aber auch sich selbst warf er vor, dass er die Lage nicht beizeiten erkannt hatte. Er kam sich getäuscht und bloßgestellt vor, so, als könne er auf das Zutrauen seiner Mitbürger keinen Anspruch mehr erheben. Sein Widerwille, Mailand und sich in Mailand zu sehen, bewog ihn, von Paris nach London zu fahren, um die englischen Zustände gründlich kennenzulernen. Dorthin war ihm der Ruf seiner Persönlichkeit, Talente und Gesinnungen vorausgegangen und eröffnete ihm alle Kreise, in denen moderne Bildung und freisinnige Bestrebungen herrschten, und die nun seine schlanke Jugend, sein verschwenderischer Geist und sein beherrschtes Wesen vollends gewann. Als er nach Mailand zurückkehrte, begann sein Name in der liberalen Welt Europas Geltung zu haben.
Dort hatte inzwischen mit Gepränge und unter lauten Huldigungen der Einzug des neuen Monarchen stattgefunden. Im Hause des Grafen Vitaliano Confalonieri, des Vaters von Federigo, herrschte eine selbstzufriedene Stimmung, als wäre auf Grund eigener Verdienste nach langer Herrschaft des Unsinns nunmehr die Vernunft wiedereingesetzt. Der häufigste Gast im Hause des alten Grafen, die an Stelle seiner frühverstorbenen Gemahlin den Haushalt überwachte und der Geselligkeit vorstand, war seine Kusine Pompea, mit der er beständig im Streite lag, ohne sie jedoch entbehren zu können. Beide machten Federigo Vorwürfe, dass er gerade jetzt abwesend gewesen war, während er die Gelegenheit hätte ergreifen sollen, sich bei dem Kaiser in Gunst zu setzen; aber während Vitaliano verlangte, dass über alles, was den Hof anging, mit Ernst und Ehrerbietung gesprochen werde, nahm sich Pompea das Recht, über dies wie über alles andere ihre Meinung frei und ausgelassen zu äußern. Nach ihrem Gefühl waren die Rechte der Habsburger Dynastie über Italien unbestreitbar, hatte diese aber neben ihrer Unantastbarkeit als solcher auch eine menschliche Seite, die der allgemeinen und namentlich ihrer Kritik unterstand. Da Kaiser Franz in demselben Jahre wie sie selbst geboren war, betrachtete sie ihn nicht viel anders als wie einen Zwillingsbruder, der ein wenig missraten wäre und wohl daran täte, sich nach ihren Anweisungen zu richten. Sie erzählte Federigo, dass er während der Galaaufführung in der Scala ein sauertöpfisches Gesicht gemacht habe und überhaupt kein Kavalier sei, worauf Vitaliano entgegnete, er gebe das Beispiel lobenswerter Sparsamkeit, wovon freilich die Mailänder nichts wissen wollten. »Er ist ebenso geizig wie du,« sagte Pompea; »aber du kannst nicht leugnen, dass er wie ein Stück Seife aussieht. Ja, er hat etwas von einem langgezogenen Talglicht und ist kein Mann von Welt. Er plagt seine Frauen mit einer Gattenliebe, die ihm niemals ausgeht, wie einem Anstreicher seine Tünche, und es nimmt mich nicht wunder, dass sie sich hinlegen und sterben. Freilich hat er es nicht nötig, ein Kavalier zu sein, aber das hindert mich nicht, die Wahrheit auszusprechen.« Hingegen machte sie Federigos hingeworfene Bemerkung, Franz sei eben kein Italiener, sehr böse. Erstens, sagte sie, sei er in Florenz geboren, und zweitens taugten die Italiener nicht zum Regieren. Sie wären untereinander wie die Hunde und fingen an zu raufen, sowie mehr als einer da wäre. Indem sie Federigo mit ihrem Fächer auf den Arm schlug, sagte sie, er solle nicht das moderne Wesen annehmen und den Italiener spielen wollen; das sei pöbelhaft, und er würde seinen guten Ton und seine Eleganz dabei einbüßen. Er fange an, ein Sonderling zu werden, das sei aber eine grobe Geschmacklosigkeit, die er abtun müsse.
In einem Punkte war Vitaliano geneigt, Federigo zu entschuldigen, wo Pompea ihn angriff, nämlich, dass er seine Frau zu viel allein lasse, ohne sie auf Reisen gehe, überhaupt sie vernachlässige. Pompea, welche mit ihrem fünfundvierzigsten Jahre die Reihe ihrer galanten Abenteuer noch nicht abzuschließen gedachte, hatte eine Vorliebe für Teresa, die sie gerührt das gute Kind nannte, die nichts erlebt hatte und mit all ihrer Schönheit und Jugend in dem, was das Wesentliche war, gegen sie nicht aufkommen konnte. Zwar pflegte sie, wenn sie ihm Vorwürfe machte, ihn augenzwinkernd anzusehen und zu sagen: »Nicht wahr, sie ist langweilig, das gute Kind? Wie eine protestantische Kirche!«; aber sie beharrte darauf, dass die arme Kleine nichts dafür könne, und dass er sich ein wenig um sie bekümmern müsse. Vitaliano sagte dagegen, Frauen hätten das Haus und die Kinder, ohne sich dadurch irremachen zu lassen, dass Teresas einziges längst gestorben war, und könnten außerdem in die Kirche und in das Theater gehen; Männer gehörten zu Männern.
Nach kurzer Zeit erfuhr Federigo, dass man ihn allgemein für den Urheber des Volksaufstandes hielt, dem der Finanzminister Prina zum Opfer gefallen war; denn sein Hass Napoleons und des Prinzen Eugen waren bekannt, und seine Persönlichkeit trat so auffallend hervor, dass man ihm ohne weiteres die bedeutendste Rolle bei diesen Ereignissen zuschrieb. Besonders quälend war es, dass fast ein jeder annahm, es sei so, aber niemand es ihm ins Gesicht sagte, so dass er die Verachtung und den Abscheu zu spüren glaubte, die ein Anstifter zum Morde einflößt, ohne sich verteidigen zu können. Endlich entschloss er sich dazu, den Argwohn, der ihn lautlos umstrich, selbst auszusprechen und zugleich als verleumderisch zurückzuweisen. In der Schrift, die er zu diesem Zweck verfasste und verbreitete, machte er sowohl seine liberalen Überzeugungen bekannt wie seine Ansicht von dem Rechte Mailands auf Selbständigkeit und seine Trauer, dass es sie durch fremde Gewalt und eigene Schwäche verloren habe. Indem er sich einen Mann nannte, der niemals Sklave irgendeiner Regierung gewesen sei, noch es jemals sein werde, forderte er den Zorn des Kaisers heraus, der die Aristokratie seines Reiches als fügsame Diener zu betrachten gewohnt und gegen Federigos Person schon eingenommen war: Franz verbannte den Unbotmäßigen für eine gewisse Zeit auf eines seiner Güter.
Dies war eine erwünschte Genugtuung für Federigo, dem daran lag, zu zeigen, dass er nicht Gegner des Prinzen Eugen gewesen war, um sich beim Kaiser Franz beliebt zu machen, dass er vielmehr nach wie vor Freund einer nationalen Regierung in einer der neuen Zeit entsprechenden Form sei. Er atmete wieder freier und nahm den Zorn seines Vaters als willkommenen Tribut auf; denn es kränkte ihn nachträglich, dass er durch den väterlichen Einfluss in der Meinung aufgewachsen war, als wäre das Österreichische das allein Vornehme, Rechtmäßige und Vernünftige, und dass dieses Vorurteil ihn zu einer billigen Beurteilung des französischen Einflusses nicht hatte kommen lassen. Die Stellung, die er jetzt einnahm, glaubte er seinem Vater gegenüber ausdrücklich betonen zu müssen, obwohl ihm die Auftritte, die sich daran knüpften, peinlich waren. Widerwärtigkeiten der Art fielen nicht ins Gewicht gegenüber dem Aufschwung, den sein Geist nach Überwindung einer Zeit voll Qualen, Enttäuschung, Schmach, Bitterkeit gegen sich und andere wieder nahm. Die Feinde Österreichs, die sich rasch mehrten, sahen in ihm ihren Führer und eigneten sich dankbar seine Kampfesweise an, die darin bestand, dass er Bildung, Wohlstand und geistiges Leben in Mailand, den neuen Herren zum Trotze, zu verbreiten suchte, die ein dämpfendes und einengendes System befolgten.
In der Schar seiner Anhänger fehlten wenige von denen, die sich damals in Mailand durch Geist und idealen Antrieb auszeichneten. Die erste Stelle unter ihnen nahm Graf Luigi Porro Lambertenghi ein, etwas älter als Federigo, ebenso reich und ganz unabhängig, in seiner Unternehmungslust durch keinerlei Bedenken und Vorurteile gehemmt. Was neu und praktisch und der Ausgangspunkt eines großen Betriebes war, lockte ihn, sich irgendwie daran zu beteiligen. Er liebte die Ideen an sich, besonders wenn sie sich stracks verwirklichen ließen. Da ihm das Überlieferte als solches nicht heilig war, weder Kirche noch König noch Adel, so schienen ihm die kühnsten Umwälzungen leicht und einwandfrei. Die Gleichgültigkeit gegen seine Titel war nicht nur eine Redensart bei ihm und nicht einmal eine Überzeugung, sondern ihm angeboren, wie er denn oft, wenn er über die Unwissenheit der Aristokratie lachte, durchaus vergaß, dass er dazu gehörte; auch legte er keinen Wert auf seine äußere Erscheinung und den Eindruck, den er durch sie hervorrief. In allem diesen war er ganz von Federigo verschieden, der sich gewählt kleidete, der sich nicht leicht von den durch die Zeit geheiligten Mächten losmachte und sich nicht gründlich genug über eine Einrichtung oder Erfindung unterrichten konnte, bevor er mit seiner Person und seinen Mitteln dafür eintrat. Er hielt Porro für unreif und oberflächlich, Porro hingegen ihn für überbedenklich, herrschsüchtig und herzlos in Bezug auf Teresa, die er, der seit Jahren verwitwet war, verehrte, und die Federigo nach seiner Meinung unterschätzte und vernachlässigte. Trotzdem sie häufig aneinandergerieten, waren sie doch durch das gemeinsam Angreifende ihrer Richtungen, durch Porros Verehrung für Teresa und auch durch gegenseitige Anhänglichkeit dauerhaft verbunden. Es gehörten ferner zu diesem Kreise der Erzieher von Porros Söhnen, Silvio Pellico, ein junger, doch schon rühmlich genannter Dichter; der Arzt Rasori, ein hervorragender Mediziner und Bewunderer Napoleons, durch die Zügellosigkeit seines Privatlebens berüchtigt; Borsieri, ein origineller Kopf und beliebter Gesellschafter, von dem man viel erwartete; der junge Graf Arconati, ein gutmütiger, liebenswürdiger, aber von wechselnden Launen umgetriebener, seinem Reichtum nicht gewachsener Mensch; der Dichter Giovanni Berchet und viele andere; die Malerin Bianca Milesi, eine kräftige Natur, die immer Schützlinge hatte und für andere beschäftigt war, ohne empfindsam zu sein; die verwöhnte, feurige und reizbare Gräfin Frecavalli; die reizende, durch den Keim der Brustkrankheit zu frühem Tode bestimmte Gräfin Mathilde Dembrowsky, Freundinnen Teresas.
England hielt Federigo für das Urbild eines freien und glücklichen Staates. Nach dem Muster Londons suchten er und seine Freunde Mailand zu modernisieren; sie wollten die Beleuchtung der Straßen und Häuser durch Gas, auf den Flüssen die Dampfschifffahrt einführen, Zeitschriften gründen, in denen alles besprochen würde, was in Italien und im Auslande Bemerkenswertes geschähe, geleistet und gedacht würde, öffentliche Spielplätze und Bäder, Kaffeehäuser einrichten, in denen Zeitungen auflägen, und wo ein reger Verkehr interessanter Menschen sich entwickelte. Dass er die Wurzel dieses Gedeihens, die Tüchtigkeit eines sich selbst regierenden Volkes nicht so leicht nach Italien übertragen konnte, war ihm bewusst; dennoch regierte der Gedanke daran seine Handlungen und seine Lebensweise. Die unbestimmten Hoffnungen fingen an, sich zu gestalten, als das Gerücht laut wurde, der junge Thronfolger in Piemont, Karl Albert von Savoyen, sei liberalen und patriotischen Ideen zugänglich und ein Feind der Herrschaft und Bevormundung Österreichs. Wenn die Großherzigkeit dieses Prinzen so weit ging, dass er sein bequemes Erbe wagte, um die Hand nach der verhängnisvollen eisernen Krone auszustrecken, so war die Möglichkeit da, den ausländischen Fürsten einen einheimischen entgegenzustellen. Seitdem bereiste Federigo die Länder Italiens mit dem besonderen Zweck, die Stimmung und die Kräfte der Bevölkerung kennenzulernen und die gleichgesinnten Patrioten miteinander in Verbindung zu setzen. Überall war das Urteil der gediegensten Männer, dass die Zustände krank und faul, durch vereinzelte Reformen kaum heilbar seien; aber der größere Teil des Volkes, die auf dem Lande, waren in ihrer Armut stumpf und träge, ja sie zogen die Österreicher den einheimischen Bedrückern und Aussaugern vor, und auch der kleine Bürgerstand war nicht durch Vaterlandsgefühl oder andere ideale Triebfedern in Bewegung zu setzen.
Die Probefahrt des Dampfers, den Porro und Confalonieri auf eigene Kosten hatten herstellen lassen, auf dem Po gestaltete sich zu einem Feste, das mitzufeiern die beiden Unternehmer viele Freunde aus Mailand begleitet hatten. Der Abend versammelte alle im Hause eines Bekannten in Venedig. Federigo, der bei der Fahrt mit zugegriffen hatte, strahlte in heiterster Laune, Porro hingegen war verdrießlich und schalt auf Pellico, der sich von der Gesellschaft abgesondert hatte, um das Theater zu besuchen, wo die berühmte Schauspielerin Carlotta Marchionni spielte, in deren Kusine er verliebt war. Diese abgeschmackte Leidenschaft, sagte Porro, habe Pellico ganz untauglich gemacht, für ihn sei er gar nicht mehr da; sei auch sein Körper anwesend, so sei es doch sein Geist nicht. Das Mädchen liebe ihn nicht; abgesehen davon werde seine Familie eine solche Heirat nicht zugeben, auch hätten beide kein Geld, kurz, die Sache führe zu nichts Gutem.
Federigo zog Porro in einen kleinen Salon, der leer war, und fragte halblaut, ob es vielleicht nur dieser Liebeshandel sei, der Pellico fernhalte? Er habe bemerkt, dass sie beide, Porro und Pellico, allerlei Heimlichkeiten und zuweilen Umgang mit fragwürdigen Leuten hätten; hoffentlich dächten sie nicht daran, sich mit den Carbonari einzulassen?
Porro antwortete mit Empfindlichkeit, es sei unrecht, so wegwerfend von den Carbonari zu sprechen. Wenigstens wären dies Leute, die feste Ziele hätten und keine hindernden Vorurteile. Ein vergewaltigtes Volk könne seine Tyrannen nicht mit höflichen Redensarten aus dem Lande scharwenzeln. Wenn man etwas ausrichten wolle, dürfe man nicht heikel in der Wahl seiner Mittel sein. »Was haben sie denn ausgerichtet?« sagte Federigo. »Ich verdamme sie nicht; aber ihre Zeit ist vorüber, und du und ich, wir gehören nicht zu ihnen. Wir sind keine Knaben, denen das Herz beim Räuberspiele höher schlägt oder die Plutarch zu ehrgeizigen Träumen entflammt; wir sind keine Schwärmer, die, den Dolch in der Hand, die Gerechtigkeit auf der Erde herstellen wollen. Lasst euch vor Kindereien und Übereilungen warnen, die euch verderben können!«
Sie wurden durch einen Teil der übrigen Gesellschaft unterbrochen, die im lebhaften Gespräch über Karl Albert, den Erbprinzen von Savoyen, eintraten. Seit er eine Österreicherin zur Frau genommen, sagte die Frecavalli, könne man auf ihn nicht mehr rechnen. Wie ein freier Vogel durch ein Weibchen in den Käfig gelockt würde, so habe er um die verliebte Habsburgerin sein Schwert hingegeben. Er würde es nicht mehr führen, um Italien zu befreien, sondern höchstens um es für Österreich zu unterjochen. Was könne überhaupt von Piemont Gutes kommen, meinte Borsieri. Der junge Graf Arconati seufzte nach Napoleon; nur ein solcher Mann könne ein solches Werk vollbringen. »Ach, Napoleon!« rief die Frecavalli, »ein Tiger mit Menschengeist! So denke ich mir einen König von Italien!« Dabei richtete sie ihre dunklen Augen herausfordernd auf Federigo und lachte. Borsieri stellte sich vor ihn hin, als ob er ihn auf die Zulässigkeit dieses Gedankens hin mustern wollte. »Wahrhaftig, Federigo,« sagte er, »du bist ein göttlicher Mann! Mirabeau und Alexander in einer Person! Seht das feine Haupt! das stolze Lächeln, das den lieblichen Mund und die verschwiegenen Augen umspielt! Der diamantene Blick durchbohrt das Zukunftsgewölk, das die Krone verhüllt. Alle Nerven sind zur Tat gespannt und doch bemeistert von dem Willen, der den rechten Augenblick erwarten kann!« Federigo fasste den Redner lachend um die Schulter, schüttelte ihn ein wenig und sagte: »Jedem, was ihm gebührt. Ich bin ich, höher hinaus will ich nicht. Ich kann eher ein Gott werden als ein König.«
»Das verstehe ich nicht!« sagte Arconati. »Wenn man nur die Kraft hat! War Napoleon nicht Kaiser über alle geborenen Könige?« In Federigos Gesicht trat ein hochmütig ablehnender Ausdruck. »Solche Kraft«, sagte er, »hat nur ein Emporkömmling.« Borsieri ließ sich mit einem Seufzer der Erleichterung in einen Sessel fallen. »Gott sei Dank!« rief er aus. »Ich sah dich schon als einen zweiten Napoleon durch Europa, Asien und weiter fegen, mich hinterdrein. Ade Weib, Kind, Essen, Schlaf, Gemütsruhe, ade Welt und Leben!« Er wühlte mit beiden Händen in den Haaren und schien mit erschrockenen Augen die Katastrophe zu verfolgen, die nun glücklich vermieden war.
II
Es hätte noch lange so weitergehen können, wenn nicht die spanische Revolution im Frühjahr 1820 das Beispiel zu einer Erhebung in Neapel gegeben hätte, die glücklich verlief. Jetzt hielten die Freunde einer Verfassung im Königreich Sardinien den Zeitpunkt, zu handeln, für gekommen, wodurch denn auch die Verbündeten in der Lombardei zum Entschlusse gedrängt wurden. Die erste hoffnungsvolle Spannung, die sich aller Beteiligten bei diesem unverhofften Ausblick bemächtigte, wurde für Federigo bald zur quälenden Sorge. Weder die Kräfte der Revolution in Piemont noch in der Lombardei oder im übrigen Italien schienen einen glücklichen Ausgang zu gewährleisten; was bedeutete eine Handvoll freiheitliebender Männer, ein Haufe begeisterter Jugend und zweifelhafter Abenteurer gegen die festgegründete Macht Österreichs? Ob die Persönlichkeit des Erbprinzen für alles Fehlende aufkommen konnte, war ungewiss. Er hätte mithin seinen Anhängern raten müssen, für jetzt von jedem Befreiungsversuche abzusehen; aber dagegen erhob sich die Erwägung, dass immerhin der Umschwung in Piemont sich glücklich vollziehen könnte, worauf angesehene Männer dort rechneten, und dass man in diesem Falle ihn anklagen könne, er habe den richtigen Augenblick versäumt, wo Mailand im Anschluss an einen italienischen Fürsten Freiheit, Unabhängigkeit und die Grundlage künftiger Einheit hätte erringen können. Darum glaubte er dafür sorgen zu müssen, dass, im Falle Karl Albert dem in ihn gesetzten Vertrauen entspräche, die Rollen unter den Eingeweihten in Mailand verteilt wären und ohne Zeitverlust gehandelt werden könnte. Das Gelingen des Planes setzte eine Vorsicht und ein glattes Sichabrollen der Ereignisse voraus, wie es die Wirklichkeit selten zustande kommen lässt und worauf Federigo nicht rechnen konnte. Die andauernd und beständig sich steigernde Erregung, in der er lebte, und das Gefühl der Verantwortung für eine Tat, die das Leben so vieler Menschen gefährdete, überreizte seine Nerven umso mehr, als er sich aufs äußerste anstrengte, den hohen Grad seiner Unsicherheit und Sorge nicht merken zu lassen. Eine Krankheit ergriff ihn, die sofort mit Heftigkeit auftrat und ihn ans Bett fesselte, und die von den Ärzten als Herzkrankheit behandelt wurde. Trotz seines Fiebers und zeitweiliger Bewusstlosigkeit wurde von seinem Lager aus der Verkehr mit den Revolutionären in Piemont geleitet und die Genesung durch die fortwährende Aufregung hintangehalten.
Zu Beginn des Jahres 1821 war der Zustand des Kranken so besorgniserregend, dass Teresa eines Abends einen seiner Freunde, den Grafen Mompiani aus Brescia, glaubte abweisen zu müssen. Federigo jedoch, der die Stimme erkannt hatte, rief aus dem Nebenzimmer, Mompiani solle bleiben, er habe Wichtiges mit ihm zu reden. Sowie sie allein waren, sagte er ihm, die Vorsehung habe ihn gesandt, er müsse verhindern, dass Graf Bubna, der Gouverneur von Mailand, ermordet werde. Der Überfall sei von den Verschworenen auf diese Nacht festgesetzt. Der erschreckte Mompiani glaubte die Reden eines Fieberkranken zu hören, wofür auch Federigos Anblick sprach: seine Stirn flammte, seine blinkenden Augen irrten bald hastig an den Wänden entlang, bald stießen sie den bohrenden Blick in seine. Indessen sagte er, dass er nicht phantasiere, sondern seiner wohlbewusst sei. Pallavicino sei am Vormittage dagewesen und habe merken lassen, dass das Projekt in dieser Nacht ausgeführt werden solle; sein Einspruch verfange nicht mehr, seit seiner Krankheit sei der Einfluss anderer herrschend geworden. Es wurde Mompiani unheimlich zumute; als einem genügsamen und frommen Menschen war ihm die politische Tätigkeit seines Freundes, so sehr er ihn bewunderte und obwohl er die Abneigung gegen die österreichische Herrschaft teilte, von jeher bedenklich gewesen. Doch hielt er jetzt jede Bemerkung darüber zurück und meinte nur, ob es nicht genüge, wenn er Pallavicino oder einen der anderen aufsuchte und ihnen ihr Vorhaben ausredete, falls sie wirklich eine solche Untat im Sinne hätten. Das wäre nicht der rechte Weg, sagte Federigo, heftig den Kopf schüttelnd, vielleicht würde er sie weder zu Hause noch sonst irgendwo finden; keinesfalls würde es ihm gelingen, sie umzustimmen, er würde sich dadurch nur die Möglichkeit nehmen, ihnen entgegenzuwirken. Er müsse sich Einlass in Bubnas Palast verschaffen und ihn selbst warnen.
Das Rollen eines Wagens ließ Federigo zusammenfahren; Mompiani trat an das Fenster und versuchte durch die beschlagenen Scheiben auf die Straße zu sehen; aber nur die trüben Lichter aus den gegenüberliegenden Häusern drangen durch die dunstige Finsternis. Indem er zu Federigos Bett zurückkehrte, sagte er, ein solches Verbrechen müsse zweifellos verhindert werden, er danke Gott, wenn er als Werkzeug dazu erlesen sei, Federigo solle sich beruhigen und ihm die Sorge dafür vertrauen. Anstatt dessen wurde Federigo immer aufgeregter, trieb ihn zur Eile an und gab ihm Verhaltungsmaßregeln.
Es ging gegen den Morgen, als Mompiani zurückkam und dem fest schlafenden Freunde sagen ließ, es sei alles in Ordnung. Später teilte er ihm mit, er habe sich die ganze Nacht durch in der Umgebung des Palastes Bubna aufgehalten, aber nichts Verdächtiges bemerkt. Die Fenster seien bis lange nach Mitternacht erleuchtet gewesen; offenbar habe der Gouverneur Gesellschaft gehabt, und dieser Umstand habe die Verschworenen vielleicht irregemacht, oder sie wären aus eigenem Antrieb von ihrem frevelhaften Vorhaben zurückgekommen.
Aufregungen wie diese hoben die Heilwirkung der Arzneimittel und der unermüdlichen Pflege Teresas immer wieder auf. Erst der jähe und gänzliche Untergang der Revolution in Piemont, durch den Abfall Karl Alberts und die Zerfahrenheit der Anführer herbeigeführt, machte der gefährlichen Tätigkeit auch in der Lombardei ein Ende und gab dem Kranken eine gewisse Ruhe, die freilich immer noch voll Bitterkeit, Trauer und Sorge war. Einigen von den Häuptern der liberalen Partei in Piemont glückte die Flucht, andere wurden verhaftet, und es war vorauszusehen, dass die härtesten Strafen sie treffen würden. Dass die Fäden der Verschwörung bis in die Lombardei liefen, war Österreich nicht entgangen, und der Kaiser setzte eine Kommission in Mailand ein mit dem Auftrage, deren Zusammenhang auf die Spur zu kommen. Schon im Herbst des vergangenen Jahres waren Silvio Pellico und sein Freund Maroncelli, ein junger Musiker, der Carboneria angeklagt und befanden sich seitdem in Untersuchungshaft in Venedig. Man nahm indessen an, dass der Kaiser dadurch nur etwaige Unabhängigkeitsgelüste schrecken wollte.
Im Anfange des Mai war Federigos Gesundheit so weit hergestellt, dass er einige Stunden des Tages außer dem Bette bleiben und im offenen Wagen spazieren fahren konnte, um die schaffende Frühlingswärme auf sich wirken zu lassen. Auf den Rat des Arztes beabsichtigte er, den Sommer auf seinem Landgut am Comer See zuzubringen, wo er sich vollends erholen konnte und zugleich der Entfaltung von Siegerwürde und Untertanentreue aus dem Wege zu gehen, die nach der Niederwerfung der Revolution von Piemont und Neapel Mailand beherrschte.
An dem Tage, wo die Übersiedelung stattfinden sollte, brachte Teresa ihrem Manne zugleich mit dem Frühstück, das er noch im Bette nahm, ein Gedicht, das mit der Post eingetroffen war, und das einen Glückwunsch zur Genesung enthielt. Es lautete so:
Ihr schönen Augen überwölbt die Erde
Wie eine saphirblaue Himmelsnacht
Die fahler Schatten Schar in Fleischespracht
Aufsteh'n und atmen heißt mit Gottgebärde.
Euch schöne Augen sollte Tod verschließen,
Die ihr Vergang'nes hegt und Künft'ges denkt?
Verdorren sollte, die ihr eingesenkt,
Der edlen Hoffnungssaat verborgenes Sprießen?
Wenn ihr euch öffnet, feucht von jenem Tau,
Aus dem die silberfüß'gen Sterne steigen,
Rührt sich geheimnisvoll der träge Raum,
Es türmt sich marmorn hoch in euer Blau,
Es gürtet heiß sich unter eurem Schweigen – –
Erlöscht ihr, werden Träume wieder Traum.
Federigo und Teresa rieten vergeblich, wer der Dichter der Verse sein möchte; die Handschrift schien verstellt zu sein und verriet nichts. »Er hätte deine Augen besingen sollen«, sagte Federigo zu seiner Frau, »als den Himmel, der mich während meiner Krankheit behütete.« Sie schüttelte errötend den Kopf und sagte: »Das hätte vielleicht ein galanter Dichter getan; aber dies machte die Muse.«
Federigo fühlte sich durch das Gedicht angeregt und stand frischer und zuversichtlicher auf, als er seit vielen Tagen getan hatte. Er war noch nicht mit Ankleiden fertig, als ein Diener mehrere Herren meldete, die ihn zu sprechen wünschten. Er ließ ihnen sagen, dass er, von einer Krankheit kaum hergestellt, mit Geschäften nicht dürfe behelligt werden; sie indessen erwiderten, es sei eine dringende Sache, die für den Grafen von Wichtigkeit sei, sie kämen im Auftrage des Polizeiministers und würden warten, bis er angekleidet sei. Gleichzeitig kam Teresa; sie sah beunruhigt aus und sagte, die Herren wären ohne Zweifel Leute von der Polizei; wenn er einverstanden sei, wolle sie sie mit Vorstellungen von seiner Krankheit hinhalten, unterdessen könne er sich unbemerkt entfernen.
»Wozu? Wohin?« fragte er scharf. »Ich fürchte die österreichische Polizei nicht, ich fürchte mich nur vor mir, dass ich heftig werden könnte, wenn sie mich durch Dummheit oder Dreistigkeit reizen!« Er war im Begriff, an ihr vorüber aus der Tür zu gehen, als sie ihn bat, er möchte ihr erlauben mitzukommen. »Ich will nicht, dass sie dein angstvolles Gesicht sehen,« sagte er abweisend; »wenn die Unterredung länger dauert und du dich gesammelt hast, will ich dich nicht hindern dazuzukommen, wie wenn du glaubtest, dass es Bekannte wären.«
Inzwischen warteten in einem Vorzimmer die drei Beamten, von denen zwei Italiener waren, und unterhielten sich in bester Laune über ihren Auftrag. »In dieser Zeit wollte ich die Beute eines Raubzuges verstecken,« sagte der eine, »geschweige denn eine Handvoll Briefe; unsere Schuld ist es nicht, wenn er sich etwas abfangen lässt.« »Wo er verstecken kann, können wir auch suchen,« sagte der andere, ein junger Mann mit einem angenehmen Gesicht, aus dem ein paar lustige und schlaue Augen funkelten. »Übrigens habe ich ein Mittel, die Vögel zu überlisten, das mir nie fehlschlägt. Ich sage ihm, dass, wenn er etwas hätte, das er vor unbefugtem Einblick schützen möchte, ich bereit wäre, es an mich zu nehmen und ihm seinerzeit unangetastet zurückzuerstatten; ich weiß dabei eine solche Miene zu spielen, dass der ungläubige Thomas selber sich seines Misstrauens schämen würde.« Der Dritte, ein Österreicher, musste wider Willen lachen und sagte halb ärgerlich: »Wem würdest du einen Dienst damit leisten? Unser Auftrag geht dahin, den Grafen nicht zu überfallen, sondern ihn die Zeit, die er uns warten lässt, so klug wie möglich anwenden zu lassen.« Die beiden Italiener brachen in ein unbändiges Lachen aus: »O diese Deutschen, diese Deutschen!« rief der eine; »sie brauchen ein Jahr, um zu verstehen, was uns im Schlafe einfällt.«
Als der Graf eintrat, sah er ernste und achtungsvolle Gesichter; er grüßte kurz und sagte, sie hätten ihn zu sprechen gewünscht, er bäte sie, sich kurz zu fassen, da er beschäftigt sei. Einer der Italiener sagte geläufig und mit geflissentlicher Liebenswürdigkeit: »Sie werden wissen, Herr Graf, dass seit den piemontesischen Unruhen gegen hochangesehene Mailänder Herren bösartige Anklagen erhoben werden, als hätten sie in hochverräterischer Verbindung mit der Revolution gestanden. Es ist der Wunsch des Grafen Strassoldo, diese Anklagen als verleumderisch zu entkräften, besonders wo es sich um Sie, Herr Graf, handelt, den der Herr Graf vorzüglich schätzt. Er bittet Sie deshalb, uns zu erlauben, eine kleine Haussuchung vorzunehmen, deren Ergebnis die Nichtigkeit solcher Anschuldigungen ohne Zweifel dartun wird.«
»Der Graf Strassoldo«, sagte Federigo, »ist empfindlicher für meine Ehre als ich selbst; ich pflege verleumderische Verdächtigungen zu ignorieren.« Der Österreicher, der etwas verlegen geworden war, bat Confalonieri, er möge es ihnen nicht anrechnen, wenn sie einen erhaltenen Befehl ihrer Pflicht gemäß ausführten. »Sie sind frei von jedem Vorwurf,« sagte Federigo liebenswürdig; »wenn ich Sie unhöflich empfangen habe, bitte ich Sie, es den Nachwehen der Krankheit zuzuschreiben, die ich kaum überstanden habe, und die meine Nerven reizbar gemacht hat. Alle Räume meines Hauses stehen Ihnen offen; die Schränke, die Sie durchsuchen wollen, bitte ich Sie, sich von der Gräfin aufschließen zu lassen; es wird dem Grafen Strassoldo lieb sein, wenn er meine Ehre retten kann, ohne mein Mobiliar zu schädigen.« Teresa trat gerade ein und warf einen fragenden Blick auf die Fremden, worauf ihr Mann sie vorstellte und den Zweck ihres Besuches erklärte. Die offensichtliche Bewunderung, die ihre Erscheinung bei den drei Polizisten erregte, machte sie lachen, wodurch die Regelmäßigkeit ihres schönen Gesichtes reizend belebt wurde. Ohne daran zu denken, gaben der Österreicher und der eine Italiener, um Teresa bemüht, dem Dritten die erwünschte Gelegenheit, sich mit dem Grafen abzusondern. Er begann mit einleitenden Redensarten, dass er Italiener sei und den Grafen Confalonieri über alles verehre, und fuhr fort, dass, wenn der Graf Papiere oder Gegenstände habe, die er ungern in den Händen Unberufener sähe, er auf einen Wink bereit sei, dieselben an sich zu nehmen und als anvertrautes Heiligtum zu bewahren. Federigo betrachtete den jungen Mann zuerst mit ablehnendem Erstaunen, dann zeigte sich die Spur eines Lächelns in seinen Augenwinkeln, indem er sagte: »Wissen Sie denn schon, an wen Sie die Papiere verkaufen wollen, an mich oder an den Polizeiminister?« Der andere lachte, dass es ihn schüttelte, und sagte: »An den Meistbietenden, Herr Graf!« fügte aber treuherzig hinzu: »Herr Graf, ich schlage keinen von den Vorteilen aus, die mein Stand mir bietet, das leugne ich nicht. Ich bin ein armer Teufel und finde auf dem Theater des Lebens keine Rolle undankbarer als die des erhabenen Stoikers. Aber deshalb kann ich doch einem Landsmann, den ich bewundere, einen kleinen Dienst leisten, der mich nichts als ein wenig Geschicklichkeit kostet. Ich sehe indessen schon, dass Sie meiner Hilfe nicht bedürfen, und das ist umso besser.« Damit folgte er den anderen, die mit der Gräfin vorangegangen waren, während der Graf sich auf einen Diwan legte, der im Empfangszimmer stand; es fröstelte ihn vor Erschöpfung. Eine sonderbare Nation, meine Landsleute, dachte er. Was für ein sympathischer Bursche war dieser Gauner. Wahrscheinlich wusste er selbst noch nicht, ob und wen er betrügen sollte, und Gott oder ein Zufall würden im entscheidenden Augenblick einen opferwilligen Schwärmer oder einen käuflichen Verräter aus ihm machen. Er schloss die Augen und lag still, während allerlei Geräusche die Anwesenheit seiner Frau und der Beamten in seinem anstoßenden Arbeitszimmer anzeigten.
Plötzlich fiel ihm ein, dass in einem Fache seines Schreibtisches Briefe von einer Frau lagen, einer polnischen Fürstin, die er vor einigen Jahren in Neapel hatte kennen lernen, und mit der ihn leidenschaftliche Gefühle verknüpften. Er sah die duftenden Blätter vor sich, die eine zarte, biegsame, empfindungsvolle Handschrift flüchtig bedeckte, die zu verbrennen er sich niemals hatte entschließen können; denn jeder Buchstabe war ihm ein Abbild ihres berückenden, sich hingebenden und immer entschlüpfenden Wesens. Wie er sich vergegenwärtigte, dass die Polizisten jetzt vielleicht vor den Augen seiner Frau in diesen Briefen blätterten, wurde er sehr unruhig. Wenn Teresa auch wusste, dass sein Herz nicht ihr, sondern lange schon anderen Frauen gehörte, so wollte er doch nicht, dass sie die Kränkung erlitte, das Zeugnis seiner Treulosigkeit in Gegenwart anderer zu entdecken. Um dem Zweifel ein Ende zu machen, sprang er auf und ging schnell in sein Arbeitszimmer, aus dem die Männer sich eben entfernten. Teresa kam ihm lächelnd entgegen und sagte, sie hätten, offenbar nur, um der Form zu genügen, ein paar Schubfächer geöffnet, aber kaum einen Blick hineingeworfen; er könne nun selbst wieder zuschließen. Während er es tat, überlegte er, ob er nicht jetzt die anstößigen Briefe verbrennen sollte; aber wie sein Blick auf die schlanke, geschmeidige Schrift fiel, schien es ihm unmöglich, sich davon zu trennen, und er schob das Päckchen auf den alten Platz zurück. Da die Haussuchung ergebnislos verlaufen war, konnte er sich in dieser Beziehung umso sicherer fühlen, und von Teresa wusste er, dass sie ohne seinen Auftrag seine Sachen nicht berührte.
Als die Polizisten sich entfernt hatten, sagte Teresa, sie wollten nun sogleich nach ihrem Landgute fahren, nach diesem beunruhigenden Zwischenfall wäre Ruhe desto wünschenswerter.
»Im Gegenteil,« sagte Federigo, »ich habe beschlossen, nun überhaupt nicht fortzugehen. Sie sollen mich nicht mit billigen Schreckmitteln in die Flucht gejagt haben.« Teresa zog einen Stuhl an seinen Schreibtisch und setzte sich dicht neben ihren Mann. »Mein Gott, Federigo,« sagte sie, »es kann nicht dein Ernst sein. Die Ruhe und die gute Luft auf dem Lande sind dir notwendig, die Ärzte sagen es, und du selbst stimmtest ihnen zu. Du hattest selbst den heutigen Tag festgesetzt, um nicht in Mailand anwesend zu sein, wenn das Tedeum gefeiert würde.« Federigos Gesicht rötete sich, und seine Brauen fingen an zu zucken. »Du sprichst so oft von deiner Fügsamkeit in meinen Willen,« sagte er nicht ohne Schärfe, wenn er auch dabei lächelte; »im gegebenen Falle fehlt es dir nie an Gründen, um von deiner Richtschnur abzuweichen.« »Mir ist bange um dich, das ist alles,« sagte sie traurig. Er fasste ihre Hand und zog sie schnell an seine Lippen. »Ich weiß es, du bist gut und viel besser, als ich es verdiene,« sagte er. »Du wirst einsehen, dass ich nicht anders handeln kann. Wenn ich abwesend sein wollte zu der Zeit, wo das Tedeum abgehalten wird, war es nicht, weil es mir zu schmerzlich gewesen wäre, den feierlichen Triumph über die unglücklichen Piemontesen mit anzusehen. Ich kann kaum sagen, dass ich noch mit ihnen sympathisiere; denn ich liebe die Menschen und Völker nicht, die sich an Taten wagen, für die sie zu schwach sind. Aber ich wollte nicht mit denen verwechselt werden, die der österreichischen Regierung schmeicheln und sie wegen eines lächerlichen Sieges über eine Handvoll Verzweifelter und Willenloser feiern; wenn es von dem Sieger geschmacklos ist, Gott mit Lobgesängen zu danken, weil es ihm gelungen ist, einen Sklaven, der frei sein möchte, mit Waffenübermacht wieder ins Joch zu pressen, so ist es von den Mitsklaven gemein, dies zu tun. Ich hätte mich am schicklichsten davon zurückgehalten, wenn ich auf dem Lande gewesen wäre; nun, da man mich verdächtigt und an den Pranger stellt, halte ich es für angemessener, meine Gesinnung unmissverständlich zu zeigen, die die eines Mailänder Edelmannes von Ehre ist. Ich ertrage die fremde Herrschaft, solange ich muss; aber es soll keiner den Grafen Confalonieri sein italienisches Blut verleugnen sehen.« Teresa hatte, trotzdem sie seine Gesinnungen teilte, ihre eigenen Gedanken. »Was soll aus Mailand und Italien werden,« sagte sie, »wenn seine besten Söhne sich selbst ausliefern, anstatt sich zu bewahren? Kannst du die Tatsache ändern, dass wir zu viel gewagt und alles verloren haben?« In Federigos Gesicht trat ein starrer Zug. »Wir haben noch nichts gewagt,« sagte er mit nachdrücklicher Betonung. »Wir haben die Hand an das Schwert gelegt, es nicht gezückt; das kann ich verantworten.« Teresa gab es auf, zu widersprechen, und sagte nur betrübt: »Ich hatte mich darauf gefreut, Bäume flüstern zu hören und Wolken wandern zu sehen und darüber die Menschen zu vergessen.« Er antwortete tröstend, es sei nicht seine Absicht, den ganzen Sommer in der Stadt zu bleiben; er wolle sich eine Zeitlang in der Öffentlichkeit zeigen und schon am selben Abend das Theater besuchen. Im Schauspielhause, dem Theater Re, wurde Alfieris Antigone gegeben mit einem Schauspieler als Haemon namens Lombardi, der vor etwa zehn Jahren dadurch Aufsehen erregt hatte, dass er sich weigerte, vor Napoleon zu spielen, als derselbe zum ersten Male nach seiner Scheidung in Italien war.
Man hätte meinen können, dass die Aufführung der Antigone in dieser Zeit eine Kundgebung bedeutete, einmal des Stoffes wegen, und weil Alfieri ein Piemontese und bekannt war als italienischer Patriot und unbedingter herausfordernder Feind absolutistischer Fürstenherrschaft; indessen gab gerade die Stadt Mailand so laute Zeichen ihrer Anhänglichkeit an das österreichische Haus, dass solcherlei Beziehungen aufzuspüren fernlag. Der Ruf des Schauspielers Modena, der den Kreon spielte, und die Beliebtheit Lombardis hatten die Logen gefüllt; sogar der Vizekönig war mit seiner Frau anwesend. Modena, dessen besondere Gabe es war, mythische Tyrannen zu verkörpern, verlieh seiner Rolle mehr Würde, als der Dichter getan hatte; man sah in ihm den fleischgewordenen Willen, der, im ursprünglichen Machtgefühl sich Gott gleich achtend, abwechselnd als Erhabenheit und Wahn erscheint. Der Purpurmantel schien über einen Felsenleib geworfen, den zuweilen eine vulkanische Seele erschütterte. Das elementare Herrschenmüssen war so in ihm ausgedrückt, dass die Unterwerfung aller als natürlich, die Auflehnung gegen ihn als ein kindisches und gesetzloses Unterfangen aufgefasst wurde. Ihm gegenüber war die Antigone machtvoll genug: eine Flamme der Rache, die sich verzehrt, indem sie das Haus des Feindes zu Asche brennt. Die Liebe zu Haemon deutete sie kaum an; fast schien es ihr lästig zu sein, dass er sich mit seinen untergeordneten Gefühlen zwischen ihren und des Königs unaufhaltsamen Todeswettkampf drängt. Hätte nicht Lombardi ihn dargestellt, würden die Zuschauer diese Empfindung geteilt haben; Lombardi aber machte mit seinem Temperament aus dem unbestimmten, nur durch die Lage bestimmten Bühnenliebhaber einen ritterlichen, freien Charakter, dessen tragisches Los es ist, zwei eherne, in blinder Leidenschaft gegeneinander wütende Menschen zu lieben.
Trotzdem Federigo zum ersten Male nach seiner Krankheit sich im Theater zeigte, kamen außer den vertrauten Freunden keine Besucher in seine Loge. Porro war, wie er sagte, eigens wegen der Vorstellung vom Lande in die Stadt gekommen, entfernte sich aber trotzdem schon nach dem zweiten Akte. Er war zerstreut und sagte, dass er durch den Verlust Silvio Pellicos mit Geschäften überhäuft sei, dass er aber Ursache habe, zu glauben, sein armer Freund würde bald aus der Haft entlassen werden. Der junge Marchese Giorgio Pallavicino, einer der ergebensten Verehrer Federigos, und der seiner Natur nach dies Gefühl am heftigsten zur Schau trug, beglückwünschte ihn und Teresa zur Genesung und setzte sich, von ihm aufgefordert, neben den Grafen in den Hintergrund der Loge. »Es freut mich, dass ich dich sehe, Giorgio,« sagte dieser, »weil ich dir einen ernstlichen Rat zu geben habe. Ich weiß, dass die Kommission wegen der Unruhen in Piemont sehr tätig und wahrscheinlich von Spionen gut bedient ist. Setze dich sowohl deiner Mutter wie unserer Sache wegen nicht der Gefahr aus, verhaftet zu werden; reise in die Schweiz oder nach Frankreich, solange du es unauffällig tun kannst.« Pallavicino antwortete: »Ich sollte mich in Sicherheit bringen, wenn du hier bleibst? Warum denkst du mehr an mich als an dich? Es entspricht deinem Mut und deiner Großherzigkeit; aber das sind die einzigen Tugenden, in denen ich wagen kann, mit dir zu wetteifern.« »Es handelt sich nicht um Tugenden, sondern um Vernunft und Vorsicht,« sagte Federigo. »Wenn deine Reise nach Turin zu Karl Albert bekannt würde, hätte man Anlass, dich zu verhaften, und du tust klug, ja, du hast die Pflicht, dem vorzubeugen. Du weißt nicht, wie die Widerwärtigkeiten der Haft und der Untersuchung auf dich wirken würden, welche Mittel man etwa anwenden würde, um dir Geständnisse zu entreißen; auch wider deinen Willen könntest du mich und die Sache, die uns heilig ist, verraten.« Er sprach halblaut, aber mit solcher Unbefangenheit, dass das Gespräch auf Beobachter den Eindruck einer bedeutungslosen Plauderei machen musste. Auch den kleinen Marchese suchte er durch seinen Blick zu beherrschen und zu dämpfen; der aber pflegte die ganze Wucht seiner Meinung mit einem Überschuss wie ein ungeschickter Schauspieler in das Spiel seiner Mienen und Gebärden zu legen, so dass, wenn er nicht auffallen wollte, zu dem übrigen noch diese Absicht auffiel. Jetzt sprang er von seinem Sitz auf und rief, indem er mit der geballten Hand auf die Brust schlug: »Ich dich verraten! Giorgio Pallavicino dich, seinen angebeteten Freund, das Haupt und die Hoffnung Italiens! Kennst du mich so wenig, dass du nicht weißt, ich ließe mir eher die Zunge aus dem Munde reißen als ein Wort, das dich gefährdete?« Federigo zog ihn auf seinen Sitz zurück und legte ihm lachend einen Finger auf den Mund. »Es fehlte nicht viel,« sagte er, »dass du schon jetzt uns beide freiwillig verrietest.« Teresa wendete sich erschreckt und mahnend nach ihnen um. »Der Teufel hole mein Temperament!« sagte Giorgio ein wenig beschämt. »Ich will dir gehorchen und Mailand morgen verlassen; aber ich wünsche eine Gelegenheit herbei, um dir zu beweisen, dass ich im Falle der Not schweigen kann, und gelte es mein Leben.«
In der folgenden Pause trat ein Adjutant des Vizekönigs in die Loge und erkundigte sich nach dem Befinden des Grafen. Federigo errötete und dankte mit Ausdrücken der gewähltesten Ehrerbietung; er habe sich von dem Übel erholt, sagte er, und könne Gott sei Dank der Zukunft hoffend entgegensehen. Teresa fragte ihren Mann ängstlich, ob er nicht persönlich für die Aufmerksamkeit danken müsse, und Baron Trecchi, der gerade anwesend war, unterstützte sie; diese Höflichkeit würde er doch gegen jeden beobachten. Gegen jeden Gleichgestellten ja, antwortete Federigo ablehnend, bei Tiefer- und Höherstehenden ändere man das Maß, dort um nicht vertraulich, hier, um nicht zudringlich zu erscheinen.
Die Aufmerksamkeit des Vizekönigs hatte zur Folge, dass sich die Loge Confalonieris sofort mit vielen Besuchern, auch fernerstehenden Bekannten füllte; dass er Genugtuung darüber empfand, war ihm kaum, außer an einem erhöhten Glanze seiner Augen, anzumerken. Teresa fürchtete, das verlängerte Aufbleiben und viele Sprechen möchte ihm schaden, und drängte, das Theater vor dem letzten Akt zu verlassen; allein er erklärte, weder von der Dichtung noch von der vorzüglichen Darstellung etwas verlieren zu wollen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: