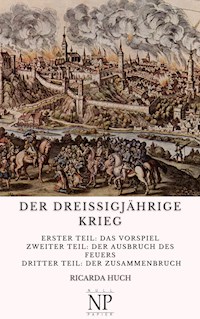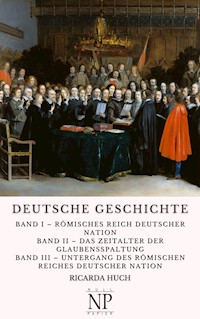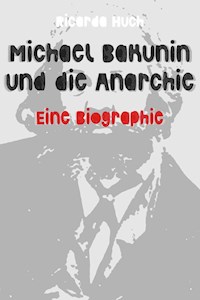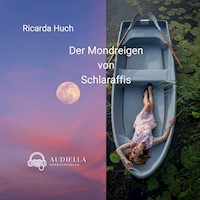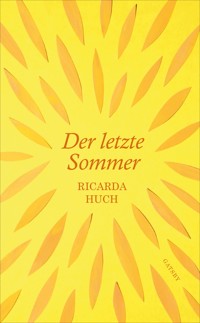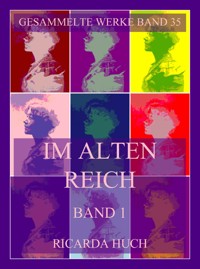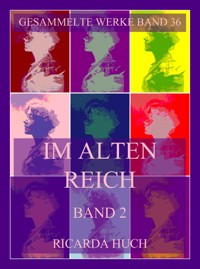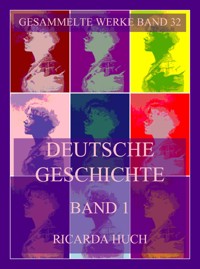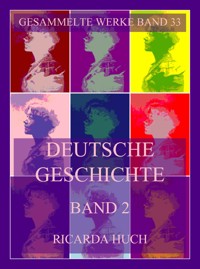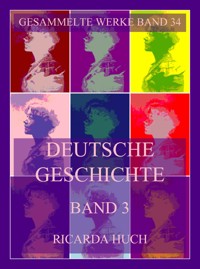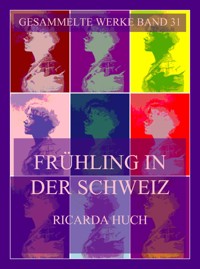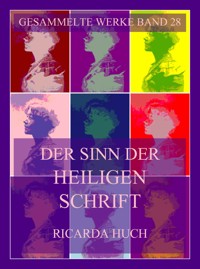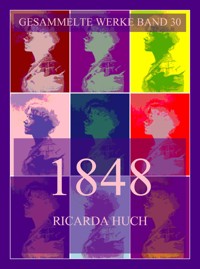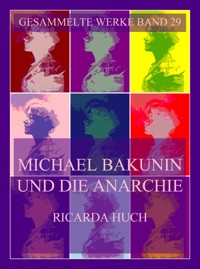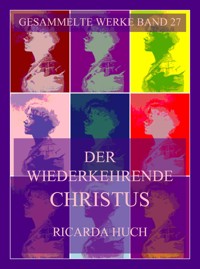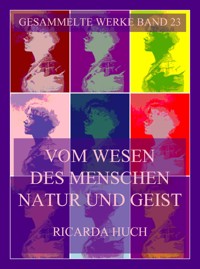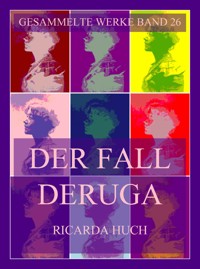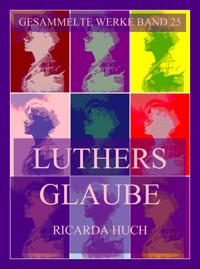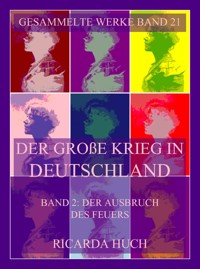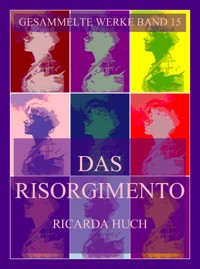
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ricarda Huch Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Es ist Ricarda Huch gut gelungen, in einer Anzahl von Charakteristiken die Anfänge der italienischen Freiheitsbewegung menschlich zu betrachten und den Leser zu einer fast empfindsamen Teilnahme an diesen Ereignissen anzuregen. Durch das langsame Vorbeiziehenlassen von sieben Erscheinungen, Spielern und Gegenspielern, die uns sämtlich den starken Eindruck des lebendigen Kontaktes aufzwingen und uns das Miterleben ihres Schicksals in einer fast zu strengen Hypnose befehlen, drängt sie uns die Sympathie für eine historische Epoche auf, deren Bedeutung wir bisher unterschätzten, sofern wir überhaupt von ihr etwas wussten. Allein Silvio Pellicos "I mici prigioni" hat ein bescheidenes Interesse für die Verschwörungen und Pläne erweckt, die ein Menschenalter vor Mazzini, Garibaldi und Cavour die Unabhängigkeit Italiens als konstitutionelle Monarchie anstrebten. Die "Gefangenen vom Spielberg", die Confalonieri, Pellico, Maroncelli, Pallavicino, Andryane erhielten ihren Ehrenplatz in der Geschichte Italiens erst, als die Sonne der Freiheit die Lombardei und Venetien überleuchtete. Die Romantik dieser Schicksale, eher noch die Verschiedenartigkeit der Bedingungen, unter denen die einzelnen sie aufnahmen (der Modus der Verteidigungen und der Anklage), die Bildung der gesonderten Charaktere, das Wallensteinische dieser Naturen musste Ricarda Huch anziehen und ihr dichterisches Mitgefühl so stark in Anspruch nehmen, dass sie, um nicht an Kraft zu verlieren, um nicht ein scheinbares Drama zu konstruieren, dem die Tragik gefehlt hätte, die Persönlichkeiten historisch zu nehmen beschloss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Risorgimento
RICARDA HUCH
Das Risorgimento, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681782
Der Text dieser Ausgabe folgt der Ausgabe von 1908, erschienen im Insel Verlag Leipzig, und ist abrufbar unter https://archive.org/details/dasrisorgimento00huch/page/n5/mode/2up?view=theater.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
EINLEITUNG.. 1
FEDERICO CONFALONIERI7
SILVIO PELLICO... 41
PIERO MARONCELLI67
ANTONIO SALVOTTI82
KAISER FRANZ.. 100
KARL ALBERT VON SAVOYEN... 111
GIORGIO PALLAVICINO.. 131
EINLEITUNG
UNS Lebende zieht Sehnsucht zu den Toten; hinweg von den Zahllosen, die uns umdrängen, die uns die warme Hand entgegenstrecken, in deren Augen wir lesen können, gehen wir einsamere Wege und beschwören die Gewesenen, die uns nicht Rede stehen. Wie Helden auf einer nächtlichen, vom Sturm umrauschten Bühne sehen wir sie mit flatternden Gewändern, mit starken Gebärden die Geschichte ihres Lebens spielen und werden nicht müde den tragischen und süßen Worten zu lauschen, die aus tiefer Vergangenheit abgerissen zu uns auftönen. Auch wenn wir Entsetzen und Abscheu empfinden, verlässt uns ein ehrfürchtiger Schauer vor den geistigen Wesen nicht ganz, die sich jenseits unserer Sinnlichkeit vollendet haben. Wie Halbgötter und Dämonen umgeben sie uns, von uns angerufen als Lehrer, als Beschützer, als Bürgen, unsere Kämpfe mit uns kämpfend, ihr goldenes Blut, das nie versiegende, immer von neuem vergießend.
Lebendiges Fleisch und Blut erregt unsere Sinne zu sehr in Leidenschaft, Ekel, Widerspruch; auch ist es uns zu nahe, so dass wir es im Ganzen nicht überblicken können, während wir das Einzelne zu groß, zu deutlich sehen. Die Namen der Toten, tun die her noch jene Kraft glänzt, die sie lebend ausstrahlten, sind wie flammende Siegel auf Geheimnissen und reizen uns übermächtig, sie zu durchdringen. Sie sind die Sternbilder, die den Himmel bedecken, Hieroglyphen, durch deren einzelne Leuchtpunkte wir silberne Linien ziehen, um sie zu schönen Gestalten zu verbinden. Es ist eine Glorie für ein Land, wenn sich viele dieser unsterblichen Zeichen darüber wölben.
Das italienische Risorgimento ist eine Fundgrube an tatenreichen Menschen und auffallenden Begebenheiten, wie für die meisten Völker ihre Wanderungen und Eroberungskriege in entlegener Vorzeit, wie etwa für Nordamerika die Geschichte der ersten Ansiedelungen und der Verdrängung der Indianer. Der lange Kampf in der bunt zusammengesetzten Halbinsel des Apennin hatte Entwicklungsabschnitte, die untereinander vom verschiedensten Charakter waren. Als die Idee des freien und unabhängigen Italien ein gewisses Alter und eine gewisse Kraft erlangt hatte, ergriff sie die Menge durch allgemeine Triebe: Auflehnung gegen die durch die ersten Empörungen veranlassten Vergewaltigungen, Rache, Begeisterung, Unternehmungslust, oder durch die Einsicht, dass dies die Wege der Zukunft seien; schließlich ist es etwas Selbstverständliches, dass auch Durchschnittsmenschen von einer Idee mitgerissen wurden, die, im Kampfe erstarkend, das Übergewicht erlangt hatte.
Etwas anderes ist es, wenn eine Idee noch neu ist, erst unbestimmte Umrisse hat, Gefahr damit verbunden ist, ihr anzuhängen, und unsicherer Ruhm, ja wenn sogar der zu erreichende Zweck nur undeutlich vorschwebt. Während der Herrschaft Napoleons hatten die verschiedenen Gebiete Italiens einen gewissen Grad von Selbstgefühl erreicht, sei es auch nur insofern als eine große Bewegung sie durchflutet hatte, und Bewegung Leben und Kraft bedeutet und Ideen erzeugt. Es war nicht so, dass das Volk einmütig nach nationaler Einheit und nach Freiheit verlangt hätte; aber die Gebildeten waren unwilliger als früher den Druck veralteter und fremdartiger Einrichtungen zu ertragen, und empfindlicher als früher gegen die Schmach der Fremdherrschaft. Beim Sturze Napoleons hatte in der Lombardei dessen Stiefsohn, der Vizekönig Eugen Beauharnais, eine Anzahl von Anhängern, die mit ihm eine Art von Selbständigkeit zu gewinnen hofften; die Konservativen und andere, denen der Despotismus der Franzosenherrschaft unleidlich gewesen war, neigten zu Österreich, beziehungsweise zu nationaler Selbständigkeit unter einem österreichischen Prinzen.
Inzwischen sprach der Wiener Kongress die Lombardei und Venezien dem Kaiser von Österreich zu, der sie, ohne sich um die neuen Wünsche der Italiener zu bekümmern, schlechthin als seine Untertanenländer betrachtete, wie es früher gewesen war. Das österreichische Regiment erwarb sich wenig Sympathien; das pedantische und rechthaberisch herrschsüchtige Wesen des Kaiser Franz verletzte fortwährend die Eigenart der Italiener. Die Jugend besonders, die in der liberalen Atmosphäre der Franzosenzeit aufgewachsen war, sehnte sich danach zurück; auf den Österreichern lastete bald das Odium der Langeweile, der Beschränktheit und Unkultur. Von einer solchen Stimmung zu offener Empörung ist es jedoch noch weit; es war nur ein kleiner Kreis von Menschen in Mailand, die sich geradezu in Gegensatz zur Regierung stellten, zunächst indem sie die Beförderung des industriellen, technischen und geistigen Fortschritts sich angelegen sein ließen und dadurch den österreichischen Grundsatz der Trägheit und Gebundenheit kritisierten und bekämpften. Der Widerstand, den der Kaiser diesen Bemühungen entgegenbrachte, verschärfte die Spannung, die sich dadurch zu entschiedenem Kampf zuspitzte, dass im benachbarten Savoyen ein Erbprinz aufwuchs, der als einheimischer Fürst mit modernen Ideen geeignet schien, der Fremdherrschaft berechtigterweise entgegenzutreten. Die Rolle des Befreierkönigs durchzuführen, zu der sein Charakter und die Umstände den jungen Karl Albert von Savoyen bestimmten, war es in jeder Hinsicht zu früh; er enttäuschte die Piemontesen und Lombarden, die auf ihn gerechnet hatten, und überließ sie der Rache der beleidigten Souveräne.
Diese im Keim erstickte Revolution war ein tragisches Vorspiel der großen, am Ende siegreichen Erhebung Italiens; in dem gewaltsam darüber aufgetürmten Grabhügel gärten Stürme und Blitze, die immer wieder hervorbrachen, den ungesühnten Kampf zu vollenden. Vorher hatten Ideen die Geister erregt, jetzt witterte die Rache frisches Blut. Die, welche gelitten hatten und untergegangen waren, schnell Verklärte, Strahlenbekränzte, lockten als Anführer wachsende Scharen.
Ein besonderes Interesse zieht uns zu den Gestalten, die in der Dämmerung den wirklichen Kampf ausfochten, ohne Beileid oder Beifall ihrer Landsleute.
Es scheint, dass der kräftige und gesunde, der harmonische Mensch im Allgemeinen konservativ ist; er verwendet seine Kraft darauf, mit den nächstliegenden Aufgaben fertig zu werden, unter schwereren Umständen sich doppelt anstrengend, zu erschütternden Veränderungen erst dann bereit, wenn ein Druck unerträglich wird und den Kern des Lebens angreift, und auch dann mehr auf Wiederherstellung des Gewesenen erpicht als auf Neuerungen. Überhaupt beherrscht das Gesetz der Trägheit die Menschen so sehr, dass das Leben zum großen Teil maschinenmäßig abläuft; neue Ansichten schon sind selten, vollends werden Handlungen, die das herkömmliche Geleise verlassen und Ausgangspunkte für Folgeketten werden, nur durch außergewöhnliche Umstände und Kräfte hervorgebracht. Die eigentlichen Neuerer sind oft nicht gerade sympathische Menschen: sie lieben es, sich hervorzutun, aufzufallen, das Naheliegende, Erforderliche gelingt ihnen nicht, wenigstens nicht so, dass sie sich darin auszeichnen könnten, oder sie haben gar nichts zu tun, wissen sich nicht zu beschäftigen und tasten planlos nach diesem und jenem. Der innerste Grund ist wohl, dass sie ungleichmäßig begabt sind: unproduktive Menschen finden sie in sich selbst nie Befriedigung und halten sich an das Äußere, dem sie mit überlegener Kritik, ungeduldig, aber ohne Tüchtigkeit gegenüberstehen. Dabei sind sie oft reich begabt und ihre Persönlichkeit ist reizend und blendend, vielleicht umso mehr, als ihre Kräfte sich nach außen wenden, anstatt innen zu bilden.
Beschäftigt man sich mit den Männern, die in der Lombardei zuerst als Bekämpfer der österreichischen Herrschaft der Größe Italiens hervortraten, so entdeckt man auch in vielen von ihnen etwas vom Normalen Abweichendes, Krankhaftes, da, wo man lauter Heroismus zu finden glaubte, Schwächen und Mängel. Indessen wären die ersten Opfer des Risorgimento ungenügend charakterisiert, wenn man sie schlechtweg als Neuerer auffasste; denn es handelte sich hier um große Dinge, in deren Natur es lag, die Mitspielenden mehr, als sie es vielleicht von vornherein beabsichtigten und ahnten, zu Kämpfern und Duldern, zuletzt des Lorbeers wert zumachen, weil andere Kränze in ihrem Namen nicht verliehen werden können. Was für Geschichten von Wagnis, Verrat und Gefahr, Flucht durch bewaffnete Häscher, über drohende Gebirge und empörte Flüsse: von Kerker, Todesangst und erhabenem Sterben; von Verbannung und Not, Liebesabenteuern, Glückswechsel, Untergang in Verzweiflung oder Aufschwung zu neuen Kämpfen! Es ist nicht möglich, sie ohne wechselndes Herzklopfen und Aufatmen zu lesen. Wenn die folgenden Geschlechter die Väter, die das Gedächtnis solcher Taten und Leiden zurückließen, schlechtweg als Helden feierten, so kann das nicht wundernehmen. Aber der Hass der gegnerischen, zuletzt besiegten Partei säumte nicht, die Fehler derer, die der Feind auf den Schild hob, ans Licht zu ziehen, und wo jene Vaterlandsliebe, Opfermut, Prophetenblick sahen, sprachen diese von Unglauben, Zerstörungswut und hohler Großmannssucht.
Das Künstliche dieser übertriebenen Figuren erkennend, sehnen wir uns nach der Wirklichkeit. Es genügt uns nicht, die gespenstischen Schauspieler in nächtliche Nebel eingehüllt vor uns ihr Glück und Unglück abhandeln zu sehen, wir möchten sie greifen, ansehen, irgendwie in ihrem Innersten lesen; aber wie wir es wagen uns zu nähern, zerrinnt der edle Umriss nach Geisterart, und ein kühler Hauch weht uns an, der uns frösteln macht. Wir sehen uns geängstigt um und zweifeln, ob etwas hier war außer uns, oder ob wir die ganze Zeit allein waren in gestaltloser Einsamkeit, die wir selbst mit erträumten Gesichten belebten.
Wir haben viele Bilder von Napoleon oder von Goethe; aber gleicht eins dem andern? An welches sollen wir uns halten? Entspricht nicht jedes der treuen Auffassung eines Künstlers, auf den der große Mann ebenso wirkte? Und wenn es überhaupt nicht zwei Menschen gibt, die einen andern ganz gleich auffassen, sollte sich dann je feststellen lassen, wie einer war? Ja, lässt sich eine Persönlichkeit überhaupt fest umschreiben? Wir haben unsere Väter und Mütter und andere Vorfahren täglich gesehen, ihr Wesen und Walten um uns erlebt, und wir haben ihren Schatten, nachdem sie gestorben waren, ebenso klar oder noch klarer erscheinen sehen als ihr Fleisch und Blut; aber wir finden vielleicht alte Briefe von ihrer Hand oder Zeugnisse ihrer Zeitgenossen, durch die wir mit Zügen und Taten bekannt werden, die sie uns entfremden, IC dass wir das Bild, an das wir bisher glaubten, betrügerisch schelten und durch ein anderes ersetzen müssen. So waren die Geister, zu denen wir aufblickten wie zu unantastbaren Sternen, nur Geschöpfe unserer Einbildungskraft, von uns verehrt, weil wir sie nach unserem Bedürfen ausstatteten? Vielleicht kommen wir dazu, weil wir von Minute zu Minute lebend uns selbst ausgeben, uns selbst zu verleugnen, wähnend, dass keine Form unser sei, als eine solche, die sich jeden Augenblick entstelle und vergehe, dass es also mit den Wellen der Zeit verfließende Seelen gebe, kein Ich, das alle die zerrinnenden Teile eines Lebens zusammenfasse und aus der Vergangenheit immer sich selbst gleich in die Zukunft blicke.
Indessen diese trostlosen Zweifel widerlegt ein Gefühl, das wir von uns selbst haben, wie auch von denen, die uns nahestehen, und vor allem von denen, die wir lieben. Wie die Gesichtszüge des Alten durch ein kaum zu bezeichnendes Etwas, das Siegel der Persönlichkeit, die des Kindes bestätigen, so ist auch die Eigenart des geistigen Wesens weder durch die Jahre noch durch Erlebnisse irgendwelcher Art ganz zu vertilgen. Dem Grundgefühl, das wir von einem Freunde haben, ordnen wir ohne zu schwanken alles unter, was andere, ja was wir selbst gegen ihn vorbringen könnten, überzeugt, dass alle Bruchstücke seines Lebens in den einen Grundriss eines Wesens sich müssen einfügen lassen, den wir im Herzen haben. Schließen wir nun auch, dass ein jeder eine bestimmte, kenntliche Wesensform haben müsse, so ist freilich damit nicht gesagt, dass diese sich immer enthüllen lasse, wenn es sich um längst Verstorbene handelt. Zwar auch sie hatten Freunde, die sie liebten und in denen sie sich spiegelten, und selbst Anklage und Verleumdung derer, die sie hassten, muss uns die verblichene Gestalt erleuchten helfen. Vorausgesetzt aber auch den günstigsten Fall, dass Aufzeichnungen anderer und hauptsächlich der fraglichen Personen selbst von ihnen zeugen, so bleibt das Wesentliche, das mehr noch in Stimme und Tonfall und Mienenspiel, als in den gesprochenen Worten liegt, dennoch im Dunkel. Wir wissen, dass Kolumbus Amerika entdeckte, und welches Maß von Genie und Willenskraft dadurch vorausgesetzt wird; doch haben wir nicht so viel Gefühl von seinem Wesen wie irgendein Schiffsjunge aus der Mannschaft, die ihn über Meer begleitete. Man hat darauf angewiesen, das letzte, was den einen einzig macht, zu ahnen mehr noch aus dem Duft, der über seinem Tun und den von ihm gebliebenen Worten schwebt, als aus seinem Tun selbst zu berechnen.
Man möchte vielleicht sagen, es komme nicht darauf an zu wissen, was für Menschen Nero und Kolumbus und andere gewesen seien, da nur wichtig sei, dass der Klang eines Namens einen Genius zu Schöpfungen verlocke, die, an sich wahr und groß, Bilder der Verehrung werden könnten. Ein Geschöpf des Geistes, an das Bedeutendes sich anknüpfen lasse, das Schönheit und Größe besitzt, sei ebenso wirklich und wertvoll wie ein Lebendiges, ja, sei vollendeter und dauernder. Der Mensch erschöpfe sich im Grunde in seinen Taten, überhaupt in seinem Leben, nach diesem bleibe nichts von ihm übrig, als sein Name und daran geknüpfte Berichte; wenn man ihn wiederholen wolle, müsse man ihn neu schaffen.
Allerdings kann wohl einmal die Schöpfung eines Dichters, etwa Schillers Wallenstein, den Toten verdrängen; im Allgemeinen aber hören wir nicht auf, die Schatten aus der Unterwelt zu beschwören, bis wir glauben, den unnachahmlichen und unvertilgbaren Persönlichkeitsgeruch zu spüren, der ihnen eigen war. So ist die Darstellung von Gewesenen eine Geisterbeschwörung. Zuweilen merken die Zuschauer, dass nur eine geschickte Spiegelung, irgendein gefälliges, vielleicht erstaunliches Kunststück ihnen vorgegaukelt wird; zuweilen haucht ihre Sinne das ahnungsvolle Aroma leibhaftiger Seelen an. Dann ist die Formel des Beschwörers in den Hades gedrungen und hat eine der flatternden Erscheinungen berührt und verdichtet.
Möchten die Angerufenen erscheinen und ihr verworrenes Schicksal enthüllend langsam an uns vorübergehen.
FEDERICO CONFALONIERI
WAS für ein Mensch! Was für ein Mensch!" sagte Gabrio Casati von seinem Schwager Federico Confalonieri. "Unter seinem Blick fühlt man sich von ihm gefesselt, aus der Ferne beneidet man ihn, ja liebt man ihn vielleicht nicht einmal!" So, schwankend zwischen Liebe und Abneigung, stand mancher dieser rätselhaften Erscheinung gegenüber, und tut man es noch jetzt, bald zweifelnd, bald wieder angezogen, obwohl der Zauber seines Anblicks, seiner Rede, seines Umganges nicht mehr wirksam sind.
Wenn es immer schwer ist, das Leben von Menschen, die etwa hundert Jahre vor uns wirkten, in seinen Einzelheiten und inneren Gründen zu erforschen, so ist es das des Grafen Frederico Confalonieri ganz besonders. über den schon seine Zeitgenossen ein unsicheres Urteil hatten, da es zuweilen in seiner Absicht, zuweilen nur in seiner Natur lag, vertrautem Einblick sich zu entziehen. Seine Wirksamkeit dauerte kaum ein Jahrzehnt lang und war den Verhältnissen entsprechend größtenteils verborgen, dann ging er in der Dunkelheit des Kerkers unter, um noch ein letztes Jahrzehnt verhärmt, ein unsteter Schatten, an Menschen und Dingen vorüber zu flüchten. So entzog ihn oft das Geschick, oft er selbst sich der Beobachtung. Was die Umstände offenbaren wollen, verhüllt er mit eigensinniger Verschlossenheit, so dass wir oft an den Ausspruch eines Priesters denken müssen, der ihn im Kerker besuchte: es gelinge niemandem, in seinem Herzen zu lesen.
Ein Jugendbildnis, das von ihm erhalten ist, zeigt uns ein schönes, insofern nicht regelmäßiges Profil, als das sehr anmutig geformte Kinn im Verhältnis zu Stirn und Nase zu klein ist. Mehr verrät das Bild, das aus der Zeit nach seiner Gefangenschaft stammt, wo er dem Beschauer das Gesicht zuwendet. Da sehen wir die auffallend breiten Lider, die das Auge wie ein Visier verhüllen zu sollen scheinen, unter denen der Blick hochmütig hervorgleitet, und die ungewöhnlich lange Oberlippe, wie sie Menschen zu haben pflegen, die schweigen können und beharrlich sind. Was vor allem diesem Bilde den Charakter verleiht, ist der Stolz, der wie eine vornehme Gebärde der Abwehr in jedem Gesichtszuge und in der Haltung des Kopfes ausgeprägt ist.
Seine Gestalt war groß und majestätisch und machte den Eindruck des Kraftvollen; wie denn der kleine zarte Silvio Pellico die unbesiegbar robuste Anlage des Freundes oft neidlos bewundernd hervorhob. Indessen täuschte das Aussehen, sei es auch nur, indem in einem ursprünglich vielleicht kräftig angelegten Organismus ein krankes Nervensystem arbeitete. In seinem 56. Jahre befiel Confalonieri eine schwere Herzkrankheit, der er fast erlegen wäre. Vieles deutete darauf, dass dieselbe nervöser Natur war, besonders der Umstand, dass in ihrem Gefolge epileptische Krämpfe auftraten. Doch fing er im Kerker an Rheumatismus zu leiden an, und seinen Tod führte Wassersucht herbei; er starb in seinem 61. Jahre, wurde also gerade so alt wie Silvio Pellico. Man kann vielleicht sagen: wie sein Körper eine unerschütterte Gesundheit vortäuschte, die er nicht besaß, so ließ sein Auftreten und Wesen, seine ganze Persönlichkeit ihn tatkräftiger, zielbewusster, sagen wir heldenhafter erscheinen, als er war. Was von einem süditalienischen Aristokraten gesagt wurde, der auch Jahre im Kerker zubrachte, er sei wie ein eiserner Stab mit Watte umwickelt, ließe sich dann auf Confalonieri umgekehrt anwenden, indem man ihn etwa einer ausgestopften Rüstung vergliche. Damit soll nicht gesagt sein, dass er schwach gewesen sei, nur weniger kraftvoll, als seine Erscheinung vermuten ließ.
Die Eigenschaften, die den Zeitgenossen zunächst an ihm auffielen, waren Willenskraft und Ausdauer, diejenigen, deren Mangel Gerio Capponi gelegentlich als verhängnisvoll für die Italiener hervorhebt, ferner Stolz und Verschlossenheit. Was die Willenskraft anbelangt, so erreichte er zwar mancherlei rühmlich, wenn er sich mäßige Aufgaben setzte; darüber hinaus aber ging ein leidenschaftliches, ruheloses Wollen, das seine eigentliche Seele war, dem aber die Sicherheit des Gelingens nicht innewohnte. Sein ganzes Wesen verlangte nach Tätigkeit, doch wäre es verkehrt, ihn für einen Mann der Tat zu halten; wenigstens war er es nur in den geringeren Angelegenheiten, die ihn nicht völlig befriedigten. In den wichtigsten Dingen wurde sein Wollen nicht von Entschlussfähigkeit unterstützt, zum Teil weil er sich nicht ganz klar über seine Ziele war. Es ist allerdings so, dass die schnell Handelnden selten ausdauernd sind, und dass ein gewisses Zögern, ein langsamer Gang, mit Willenskraft notwendig zusammenhängt; allein bei Confalonieri hatten die zurückhaltenden Hemmungen ein solches Übergewicht, dass sie ihn in Augenblicken, wo gehandelt werden musste, lähmten und ohnmächtig machten. Mit den Jahren und durch den Einfluss der langen Gefangenschaft nahm die Scheu vor dem Sichentscheiden so zu, dass er sich selbst eines Zuviel des Erwägens anklagte. Indes bestand sie in hohem Grade immer und beruhte auch mit auf seinem Stolz, der in der Tat das Bindende fürchtete, das ihr anhaftet, indem sie den Freien, der noch wählen kann, zum Unterworfenen macht, der die Folgen des Getanen annehmen muss. Überhaupt war Stolz eine wesentliche Linie seines Charakters, Stolz, der nicht durchaus mit Kraft verbunden war, dafür aber oft die Stelle der Kraft vertrat.
Es gibt Menschen, die zu stolz sind, um sich zu verbergen; Confalonieris Stolz verwehrte ihm, sich zu zeigen. Er konnte es nicht leiden, dass andere ihn durchschauten, wollte auch nicht zu einem Teil von anderen in Besitz genommen sein. Hatte die Natur ihn gleichsam gerüstet geschaffen, um eine gewisse Schwäche zu decken, so benützte er das, um sich überhaupt zu verbergen, das Visier nur vertrauten Freunden gegenüber vom Gesichte zurückzuschlagen, ja auch dann vergaß oder unterließ er es wohl. Der Priester Paulovich, dem die Seelsorge der Gefangenen auf dem Spielberge anvertraut war, warnte seinen Nachfolger vor ihm: er sei diplomatisch, versteckt, maskiert, sehr gefährlich und mehr als alle andern zu fürchten. Was er sage, ziele dahin, etwas aus dem andern herauszuziehen und niemals etwas vom seinigen zu geben, seine Worte hätten immer einen doppelten Zweck. Es scheint, dass ein unbewusstes Bestreben, sich unkenntlich zu machen, auch in seiner Schrift sich ausgedrückt habe; wenigstens kehrt in seinen Briefen häufig die Bitte wieder, seine undeutliche Schrift zu entschuldigen, die dem Empfänger das Lesen erschwere oder unmöglich mache. Er bildet den vollkommenen Gegensatz zu einem unter seinen Landsleuten häufigen Typus, die, gesellig mitteilsam, das sprudelnde Wort nicht von der Lippe zurückhalten können und sich bei erster flüchtiger Begegnung ganz geben; er sprach viel und sehr gut, ohne aber sein Innerstes auszusprechen.
Im Jahre 1814 lernte Confalonieri in Paris den Florentiner Filippo Buonarotti kennen, der als Emigrant dort lebte, ein Mann von antiker Denkweise, wie man es damals ausdrückte, eigentlich ein idealistischer Schwärmer, strenger Republikaner, der Federico liebgewann, während der ihn mit Neugier und Achtung betrachtete. Buonarotti, der Mitglied geheimer Gesellscharten war, die die Regeneration der Völker und den Sturz des Despotismus zum Zwecke hatten, suchte Federico zum Eintritt in dieselben zu bewegen. Diesen zogen der Widerstand gegen den Despotismus und die liberalen Ideen, der internationale Charakter und der brüderliche Geist gegenseitiger Hilfe, wie er es selbst nennt, zu den Gesellschaften hin; aber die kindischen Formen, mit denen sie sich umgaben, waren ihm lächerlich und verächtlich, an den Carbonari missfiel ihm das Irreligiöse und Demagogische, er tadelte die Neigung, das Altertum mit seinen Republiken in die Gegenwart versetzen zu wollen, und den Umstand, dass die Gesellschaften entweder nur wenig Mitglieder haben müssten, und dann machtlos wären, oder viele, und dann zum großen Teil aus schlechten, törichten, abenteuerlichen, unbedeutenden Menschen beständen. Da er aus diesen Gründen nicht Mitglied einer Gesellschaft werden wollte, lehrte Buonarotti ihn insgeheim die verschiedenen Grade verschiedener Gesellschaften mit ihren Geheimnissen kennen, ohne ihn zu verpflichten, so dass er mit den Eingeweihten Fühlung gewinnen konnte, wovon er auch auf seinen Reisen durch Italien Gebrauch machte.
In dieser seltsamen Geschichte zeigt sich Confalonieri ganz: die Macht, die er über die Menschen hatte, so dass er einen Mann von strengem, unbestechlichem Charakter wie Filippo Buonarotti dazu bewegen konnte, ihm eine so außergewöhnliche, eigentlich unerhörte Ausnahmestellung zu gewähren; seine Abneigung sich zu binden und in Verhältnisse einzutreten, wo er nur ein Glied in einer festgefügten Kette, zu Gehorsam oder doch zum Anschluss an von andern festgesetzte Grundsätze verpflichtet gewesen wäre; zugleich sein Drang, seinerseits diese Verhältnisse zu durchschauen und in sie eingreifen zu können, wie er denn wirklich, indem er die ihm bekannten Zeichen gab, Fremde veranlasste, ihn für einen Genossen, z. B. einen Carbonaro zu haken und ihm ihr Vertrauen zu schenken, das er zwar nie missbrauchte, aber keineswegs erwiderte.
Eine solche Stellung nahm er bis zu einem gewissen Grade auch seinen Freunden gegenüber ein, die sich ihm mitteilten, während sie sich über ihn täuschen konnten. Da er mit seiner Gabe, schön und überzeugend zu sprechen, die Fähigkeit vereinigte, sich in andere hineinzuversetzen und also mit ihnen zu denken und zu fühlen, so konnten sie leicht zu der Einbildung kommen, dass zwischen seinen und ihren Ansichten kein Unterschied sei. Übte er diese Kunst im Verkehr mit Freunden kaum mit Bewusstsein aus, jedenfalls nicht um sich einzuschmeicheln oder sie auszuholen, vielmehr um ihnen wohlzutun, so erreichte er doch damit, was in seiner Natur lag wollen zu müssen: dass er sie kannte und beherrschte, ohne sich selbst ganz hinzugeben. Er hatte aber die fürstliche Eigenschaft, diejenigen, die er beherrschte und die sich ihm ergeben hatten, ganz in seinen Schutz aufzunehmen und sich für sie verantwortlich zu fühlen. Er war der geliebteste, wie der hilfsbereiteste der Freunde. Seine auserlesene Fähigkeit, sich in die Lage anderer zu versetzen und ihre unausgesprochenen Schmerzen, der Bitte zuvorkommend, zu erleichtern, wird häufig hervorgehoben; liebevoll, stark und treu nennt ihn Silvio Pellico. Wenn er durch Geld unterstützen konnte, tat er es mit der Selbstverständlichkeit, die das Annehmen selbstverständlich macht. Auch durch seine bloße Nähe, ohne es zu beabsichtigen, vermöge der Kraft, die von seiner Persönlichkeit ausging, war er ein Spendender: "Deine Gegenwart in Mailand", schrieb ihm im Jahre 1812 einer seiner Freunde, "war also der Stützpunkt vieler Existenzen, wenn Du nicht da bist, fehlt es Jungen und Alten, Eheleuten und Junggesellen, kurz, Leuten jeder Klasse und Art an Leben". Von ihm hat man den Eindruck, dass er die meisten seiner Freunde hauptsächlich liebte, weil sie seiner bedurften, und dass sie ihm gerade so viel waren, wie sie ihm Gelegenheit gaben, ihnen etwas zu sein; manche vielleicht auch, namentlich die jüngeren, weil sie sein Gefolge bildeten; auch an wenigen, wie zum Beispiel an dem Florentiner Gino Capponi, scheint ihm um seinetwillen etwas gelegen gewesen zu sein.
Sein angeborener Hang, Menschen und Verhältnissen gegenüber der Beherrschende zu sein, ließ ihn diejenigen mit Kälte und Feindseligkeit zurückstoßen, die ihn beherrschen wollten. Mehr darin lag der natürliche Grund seiner evolutionären Stellung als im Temperament, das gelassen war; er ging so weit, die Begeisterung, so liebenswürdig und verehrungswürdig sie auch sei, als eine Störung im Gleichgewichte der Vernunft anzusehen. Für einen Jakobiner gehalten zu werden, wie man damals Umstürzler zu nennen pflegte, war ihm unleidlich; er war ein Aristokrat mit liberalen Ideen und einem leidenschaftlichen Drang nach Größe. Seine politische und soziale Richtung glich der, die vor der Revolution unter den französischen Denkern vorherrschend war: im Staate wünschte er die Macht der Regierenden nach englischem Muster durch eine angemessene Vertretung der Gebildeten beschränkt, die Freiheit durch vernünftige Gesetze gewährleistet zu sehen, die besitzende Klasse sollte sich verpflichtet fühlen das Volk zu bilden und seine Lage zu verbessern; im allgemeinen war er für Fortschritt auf allen Gebieten. Von den sehr partikularistischen Mailändern unterschied er sich dadurch, dass er als Italiener fühlte, für eine ideelle Vereinigung von ganz Italien arbeitete und auf eine faktische in der Zukunft hoffte. Die Toskana nannte er sein süßes Lieblingsland.
Übrigens hatte er nicht gerade eigene Ideen und Auffassungen. Man rühmte seine Klugheit, seinen Scharfblick, sein klares Urteil; einer seiner Bekannten fühlte sich durch die Lebhaftigkeit seines Geistes, durch sein allseitiges Umfassen der Verhältnisse, seine tiefen Einsichten in die Bedürfhisse der Zeit an die besten Seiten Mirabeaus erinnert; indessen wenn auch sein praktischer Verstand das durchschnittliche Maß überstiegen haben mag, so war er doch nicht durch seinen Geist hervorragend und wirksam. Der große Zauber, den er ausübte, insbesondere auf Frauen und Jünglinge, lag namentlich in der Intensität seiner Persönlichkeit und seines Lebensgefühls, wie auch in seinem Drange zu herrschen; denn die Menschen neigen sich im allgemeinen gern dahin, wo sie denselben spüren.
Federico Confalonieri ist am 6. Oktober 1785 geboren. Die Familie wurde erst am Ende des siebzehnten Jahrhunderts in den Grafenstand erhoben; im achtzehnten Jahrhundert nahm sie einen sehr angesehenen Platz in der mailändischen Aristokratie ein. Sein Vater hing Österreich an und gehörte überhaupt zu jenen "veralteten Personen", die das abgezirkelte, schläfrige Dasein, aus dem die napoleonischen Stürme Italien aufgerüttelt hatten, für das rechtmäßige und wünschenswerte hielt. Das Verhältnis zwischen beiden war gespannt. Federico war weder Österreichisch noch Französisch; er hasste Napoleon und soll mit dessen Stiefsohn, Eugène Beauharnais, dem Vizekönig von Italien, aus einem persönlichen Grunde, nämlich weil derselbe seiner Frau den Hof gemacht habe, verfeindet gewesen sein.
Im Jahre 1806, also sehr jung noch, hatte Federico sich mit einer um wenige Jahre jüngeren Frau verheiratet, Teresa aus dem gräflichen Hause Casati, deren Schönheit und Güte gerühmt wurde. Nach einem Profilbilde aus ihrer Jugend zu urteilen, waren ihre Züge regelmäßig; auffallend sind auf jenem Bilde ihre Augen, aus denen ein Triumph von Liebe und Wahrheit strahlt. Man verglich sie einmal mit einer römischen Matrone, deren Würde durch die Demut des christlichen Glaubens lieblich gemacht sei. Ihre Güte beweist am besten die Tatsache, dass sie von ihrer Dienerschaft angebetet wurde. Wenn es sich um Dinge handelte, die ihrem Herzen wichtig waren, konnte sie eine außerordentliche zielbewusste Tatkraft entfalten, aber nicht ohne sich dabei aufzuzehren. Es scheint, dass die Ehe, wenn sie überhaupt jemals glücklich war, sehr bald aufhörte es zu sein, was der Klatsch von Mailand dem herrischen und eifersüchtigen Wesen Federicos zuschrieb. Auch wurde behauptet, da ihr erstes und einziges Kind im zarten Alter starb, es sei das infolge seiner Rücksichtslosigkeit und Unvorsichtigkeit geschehen: er habe es nämlich gern in die Luft geworfen und wieder aufgefangen, wobei es gefallen sei und sich die Todesursache zugezogen habe, was ihn dann Teresa gänzlich entfremdet habe. Doch ist dies ebenso unverbürgt und noch unwahrscheinlicher als die Geschichte von der Neigung des Prinzen Beauharnais, die einen gewissen Eindruck auf Teresa gemacht habe. Gewiss ist, dass Teresa ohne Verschulden durch irgendeine Handlung war, er dagegen sich manches, hauptsächlich wohl Härte und Untreue, vorzuwerfen hatte. Ihr Charakter war edel und groß angelegt, vielleicht für seinen Geschmack zu vernünftig, zu klar, zu kühl und steif nach außen. Das Leidenschaftliche, Gefallsüchtige, Geheimnisvolle, Unnennbare, was oft mehr als Schönheit und Seelengröße zur Liebe reizt, scheint ihr gefehlt zu haben. Von dem Grad ihrer Liebe zu ihm mochte er keine richtige Vorstellung haben, oder es war die Art ihrer Liebe, die ihn nicht befriedigte. In die Bewunderung und ritterliche Verehrung, die die Freunde ihres Mannes ihr darbrachten, klingt zuweilen eine gewisse Parteinahme für sie und ein vorsichtiger Vorwurf gegen ihn an.
Wenn er weite Reisen ohne sie unternahm, suchte sie vergeblich ihre Schwermut vor ihren Bekannten zu verbergen: er füllte ihr ganzes Herz aus.
In ihrem Buch über Italien, das sie im Jahre 1820 verfasste, sagt die damals viel gelesene englische Schriftstellerin Lady Morgan, nachdem sie die geistlose Lebensführung der alten Generation in Mailand geschildert hat: "Es ist aber leicht möglich, dass in einem anderen Flügel des nämlichen Hauses der junge und regsame Erbe seinen Tag ganz auf englische Weise verlebt. Der Mann schreibt in seiner Bibliothek oder Kabinett an Vorsteher der Lancasterschulen, antwortet englischen Manufakturisten und Mechanikern, verschreibt ein Modell eines Dampfschiffs oder Einrichtung zur Gasbeleuchtung; dann besucht er seine (häufig englischen) Pferde, reitet spazieren, hütet sich, das Mittagsmahl im anderen Teil des Hauses nicht zu versäumen, wenn er nicht etwa um 5 Uhr bei einem Freunde zu Mittag isst, der des väterlichen Zwangs und alten Herkommens ledig wurde. Die Dame hat in der nächstgelegenen Kirche ihre Andacht verrichtet; dann übt sie im französischen Boudoir die Künste, welche sie in der Pension der Frau von Lor erlernte, besucht Freunde, die ihr empfohlen wurden. Nach dem Mittagessen macht sie einige Familienbesuche; nun kommt die Zeit zur Fahrt auf den Korso, dann die Oper, ihr eigentliches Reich, wo sie ihre Macht ausüben kann."
Es wäre nicht unmöglich, dass diese Schilderung auf das Haus Confalonieri ginge, auf welches der altmodische Vater einen Druck ausübte. Auch stimmt es insofern, dass Teresa in der Anhänglichkeit an die kirchlichen Gebräuche durchaus der alten Schule angehörte; aber, sei es aus Liebe zu Federico oder aus eigener Überzeugung, sie teilte sowohl seine politischen und sozialen Interessen und war in alle seine und seiner Freunde Pläne eingeweiht. Vielleicht war ihr Geist nicht glänzend, und jedenfalls drängte sie sich nicht vor; Verstand und Einsicht indessen fehlten ihr nicht. Aus ihres Mannes an sie gerichteten Briefen sieht man, dass, wenn kein leidenschaftliches, doch ein sehr gutes kameradschaftliches Verhältnis zwischen ihnen bestand; er wusste, dass sie Verständnis für alle seine Bestrebungen hatte, und dass seine Geschäfte von ihr mit derselben Umsicht und Zuverlässigkeit besorgt wurden, wie von ihm oder einem treuen Verwalter.
Der Sturz Napoleons eröffnete Confalonieri zum ersten Male eine öffentliche Wirksamkeit, die er nach seiner durchaus männlichen, auf Tätigkeit gerichteten Veranlagung suchen musste, in der er aber nicht vom Glück begleitet war; es zeigte sich, dass er auffiel, dass die öffentliche Meinung sofort ein anführendes, maßgebendes Haupt in ihm sah, weswegen man ihm am Schlimmen wie am Guten, was geschah, leicht einen bedeutenden Anteil zuschrieb, und dass er mehr Feinde als Freunde hatte. Er gehörte zu den Führern derjenigen Partei, die, sowohl der französischen wie der österreichischen entgegen, ein unabhängiges oberitalienisches Reich unter einem womöglich italienischen Fürsten wollte, ein Programm, das löblich klingt, aber den Fehler hatte, dass ein fürstlicher Kandidat zunächst nicht vorhanden war, dass dagegen der Vizekönig Eugène Beauharnais eine gewisse militärische Macht zur Verfügung hatte, die einzig die Lombardei in den Stand gesetzt hätte, den verbündeten Mächten gegenüber mit dem Anspruch auf Unabhängigkeit aufzutreten. Demnach konnte man dieser Partei Mangel an Logik vorwerfen, und sie zog sich vollends bitteren Tadel dadurch zu, dass in ihrem Namen ein wüster Racheakt geschah: es wurde nämlich durch eine zusammengerottete Volksmenge der bisherige Finanzminister Prina auf unmenschliche Weise ums Leben gebracht. Confalonieri nun wurde für den Anstifter dieses Mordes gehalten, so dass sein Name mit dem Makel wenn auch nicht einer erwiesenen Untat, so doch eines hässlichen Verdachtes behaftet blieb. Allerdings sprachen ihn Männer von Gewicht und Ehre von der Anklage frei, und er selbst verteidigte sich in einer Schrift, der man Glauben schenken muss, wenn man ihn nicht für einen abgefeimten Heuchler halten will; möglich wäre nur immerhin, dass er, ohne es zu beabsichtigen, durch sein Verhalten zu dem schrecklichen Akt anregte, dann, dass er ihn hätte verhindern können, wenn er gewollt hätte. Charakteristisch für ihn ist hauptsächlich, dass gleich sein erstes Auftreten etwas Unklares hatte, weil er Neider und Feinde hatte, besonders aber, weil er nicht ganz zielbewusst handelte, schließlich auch weil man ihm mehr Wichtigkeit beimaß, als ihm zukam.
Die Uneinigkeit der Mailänder ließ den Verbündeten freie Hand, die Geschicke Italiens nach ihrem Sinne zu ordnen. Von einer provisorischen Regierung mit mehreren andern nach Paris geschickt, um den dort versammelten und vertretenen Souveränen gegenüber die Sache seines Landes zu führen, tat Confalonieri, was in seiner Macht stand, um der Lombardei Unabhängigkeit und eine Verfassung zu sichern; aber Franz I. hatte im Geiste schon von Oberitalien Besitz ergriffen und behandelte die Gesandten, denen er mehrfach Audienz erteilte, ohne weiteres als seine Untertanen. Er hörte ihren Vortrag über verschiedene Maßregeln, die sie zugunsten ihres Vaterlandes von der neuen Regierung ergriffen wissen wollten, gnädig an, ohne etwas zu versprechen, wodurch er seiner Majestät etwas zu vergeben geglaubt hätte, außer dass er wie ein Vater für seine italienischen Untertanen sorgen wolle. Die Rolle, die Confalonieri in Paris gespielt, und vermutlich auch der Eindruck, den seine Persönlichkeit hervorgerufen hatte, machte ihn dem neuen Herrn sofort verdächtig.
Was er in Paris erlebt hatte, die Einsicht, dass von keiner fremden Macht etwas zu erhoffen war, dass nur selbständiges Handeln hätte helfen können, hatte Confalonieris Ansichten in mancher Hinsicht erschüttert, vielleicht seine ehemalige Haltung ihm in ungünstigem Lichte erscheinen lassen. Damals hätte er sich auch einen österreichischen Prinzen gefallen lassen, falls nur Mailand nicht abhängige Provinz eines außeritalienischen Reiches würde; erst jetzt fing er an, die Einmischung der Fremden überhaupt abzulehnen. Man kann sich denken, dass der stolze Aristokrat widerwillig war, sich vor einem Kaiser Franz zu beugen, dessen kleinliche Persönlichkeit seine maßlose Selbstgefälligkeit und Herrschsucht als empörende Anmaßung erscheinen ließen.
In diesem Falle gab sich der Graf nicht die Mühe, seine Gesinnungen zu verhehlen, und seine Abneigung gegen das aufgedrungene Regiment wurde bald bekannt. In dem schon erwähnten offenen Briefe, den er drucken ließ, um sich gegen die von der französischen Partei erhobene Anklage zu verteidigen, als habe er den Mord des Ministers Prina veranlasst, kam ein Satz vor, der lautete: "Ich war und werde niemals der Mann sein, der von Umständen oder von Regierungen abhängt;" diesen nahm der Kaiser zum Anlass, ihn für eine gewisse Zeit auf eines seiner Güter zu verbannen. Von der wegen ihres unwürdigen Spionierens verachteten Regierung gefürchtet zu werden, mag ihn weniger geschmerzt, als sein Selbstbewusstsein gesteigert haben; er ging seinen Weg, wie es ihm beliebte, ohne sich um die lauernde Feindseligkeit zu bekümmern, die ihm nichts anhaben konnte.
Federico war damals 30 Jahre alt: das Bedürfnis zu handeln, zu wirken, sein Leben mächtig, weithin sichtbar zu steigern, war auf seinem Höhepunkt und fügte einen durch seinen natürlichen Zustand bedingten Grund der Unzufriedenheit mit dem neuen Regimente zu dem im Bewusstsein liegenden. Den angenehmsten Ersatz der Tätigkeit verschaffte ihm das Reisen, wo es doch Bewegung, Geschehen, Erleben gab, und er zugleich den unwillig ertragenen Verhältnissen der Heimat entrückt war. Ähnlich wie ein unbestimmtes hohes Streben über dem, was er Naheliegendes unternahm, hinging, so waren seine Reisen in Italien, nach Frankreich und England für ihn gewissermaßen etwas Vorläufiges; denn er träumte von einer wundervollen Reise nach dem äußersten Indien. Indessen brachte ihm ein Aufenthalt in Neapel, wohin er Teresa mitgenommen hatte, ein Erlebnis, das seine gespannte Seele für eine Weile beschäftigte. Das Ehepaar trat dort in freundschaftlichen Umgang mit dem österreichischen Gesandten Jablonowsky und seiner Frau Carolina Woyna, einer Polin, die sich ihrerseits in ihrer Ehe nicht befriedigt fühlte und die zärtlichen Gefühle, die sie bald in Federico erregte, zu erwidern begann. Der Verkehr zwischen den beiden erinnert an die sentimentalen deutschen Liebesverhältnisse des achtzehnten Jahrhunderts: sie schrieben einander lange Briefe, in denen sie sich ihrer Zuneigung, er schwärmerischer, sie zurückhaltender, und des edlen Charakters derselben versicherten, sie mahnte ihn an die Vorzüge seiner Frau, er sie an die ihres Mannes. Seine Eigenart zeigte Federico darin, wie er ihr in Gesprächen und Briefen andeutete, dass er ihr umfassende Andeutungen über sich, seinen Charakter und sein Schicksal machen wolle, dadurch veranlasste, dass sie ihm Einblick in ihr Inneres gewährte, ihr aber das versprochene Vertrauen schuldig blieb, so dass sie ihm eindringliche Vorstellungen deswegen machte. Gewiss war es nicht seine Absicht, sie, die er liebte, auszuholen; es kam ihm wohl der Antrieb, sich einmal ganz mitzuteilen, und schließlich konnte er den Widerstand, der in seinem Innern dagegen war, doch nicht überwinden. Freilich muss man zweifeln, ob er die letzten Beweggründe seines Handelns, den tiefsten Grund seines Wesens überhaupt in Worte hätte fassen können. Was er wollte und was ihn quälte, das Ziel, das in der Ferne schwebend ihm keine Ruhe ließ, war nicht mit Namen zu bezeichnen, war das Unerreichbare an sich, wovon ihm vielleicht nur so viel zum Bewusstsein kam, dass er zögerte sich darüber klar zu werden und vollends auszusprechen.