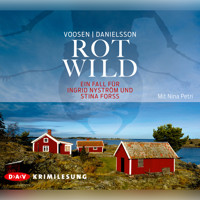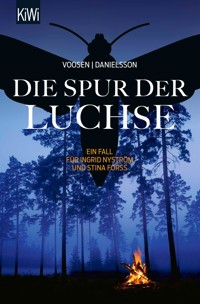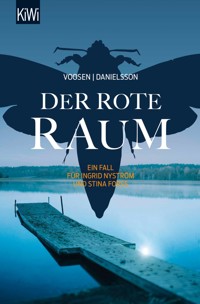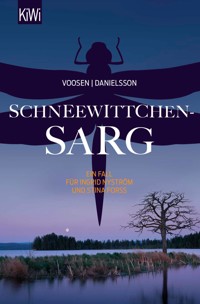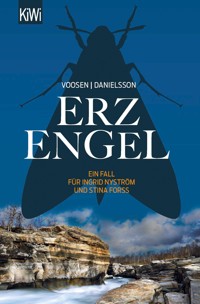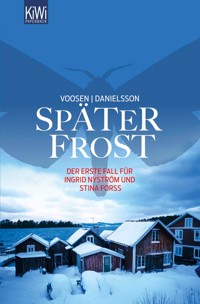Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kommissarinnen Nyström und Forss ermitteln
- Sprache: Deutsch
»Voosen und Danielsson gehören zu den großen Talenten im deutschsprachigen Kriminalroman.« Die Welt Schweden 1994: An einem kalten Herbstmorgen findet eine Frau in ihrem Garten ein verstörtes, sprachloses Kind in seinem Schlafanzug. Es ist der neunjährige Nachbarjunge. Seine Eltern sind über Nacht spurlos verschwunden. 20 Jahre später wird im småländischen Växjö bei Bauarbeiten eine Leiche entdeckt. Es scheint sich um einen seit Langem vermissten Osteuropäer zu handeln. Kommissarin Ingrid Nyström und ihre junge Kollegin, die Deutsch-Schwedin Stina Forss, nehmen die Ermittlungen auf. Die Spuren führen zunächst zu baltischen Schmugglerbanden, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Südschweden operierten. Als die Leiche plötzlich aus der Rechtsmedizin verschwindet, erkennen die Ermittlerinnen, dass der Fall noch längst nicht abgeschlossen ist. Während Nyström mit den Folgen einer Operation kämpft und Forss sich um ihren schwer kranken Vater kümmern muss, wird ein zweiter Toter gefunden. Auch hier führen die Ermittlungen in die Vergangenheit – zum Untergang der Estonia im Jahre 1994, dem schwersten Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Die beiden ungleichen Frauen stehen vor einer Mauer aus Lügen, politischer Intrige und wilden Verschwörungstheorien.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Aus eisiger Tiefe
Ein Fall für Ingrid Nyström und Stina Forss
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Roman Voosen, Jahrgang 1973, aufgewachsen in Papenburg, studierte und arbeitete in Bremen, Hamburg und Växjö.
Kerstin Signe Danielsson, Jahrgang 1983, geboren und aufgewachsen in Växjö, studierte und arbeitete in Deutschland und Schweden.
Sie leben und arbeiten gemeinsam im småländischen Växjö. Ihre Romane stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und werden auch in Schweden von der Presse gefeiert.
www.voosen-danielsson.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Schweden 1994: An einem kalten Herbstmorgen findet eine Frau in ihrem Garten ein verstörtes, sprachloses Kind im Schlafanzug. Es ist der neunjährige Nachbarsjunge. Seine Eltern sind über Nacht spurlos verschwunden. 20 Jahre später wird im småländischen Växjö bei Bauarbeiten eine Leiche entdeckt. Es scheint sich um einen seit Langem vermissten Osteuropäer zu handeln. Kommissarin Ingrid Nyström und ihre junge Kollegin, die Deutschschwedin Stina Forss, nehmen die Ermittlungen auf. Die Spuren führen zunächst zu baltischen Schmugglerbanden, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Südschweden operierten. Als die Leiche plötzlich aus der Rechtsmedizin verschwindet, erkennen die Ermittlerinnen, dass der Fall noch längst nicht abgeschlossen ist. Während Nyström mit den Folgen einer Operation kämpft und Forss sich um ihren schwer kranken Vater kümmern muss, wird ein zweiter Toter gefunden. Auch hier führen die Ermittlungen in die Vergangenheit – zum Untergang der Estonia im Jahre 1994, dem schwersten Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Die beiden ungleichen Frauen stehen vor einer Mauer aus Lügen, politischer Intrige und wilden Verschwörungstheorien.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Briljans
ISBN978-3-462-30847-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
Montag, 13. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Dienstag, 14. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Mittwoch, 15. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Donnerstag, 16. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Freitag, 17. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Samstag, 18. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Sonntag, 19. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Montag, 20. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Dienstag, 21. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Eine Woche später. Dienstag, 28. Oktober
Mittwoch, 29. Oktober
Mittwoch, 12. November
Montag, 18. November
Epilog
Leseprobe »Tode, die wir sterben«
Nur sein Auge sah alle die tausend Qualen der Menschen bei ihren Untergängen. Diesen Weltschmerz kann er nur aushalten durch den Anblick der Seligkeit …
Jean Paul: Selina oder Über die Unsterblichkeit der Seele
Come On Die Young
Mogwai
Prolog
Der Junge wachte auf. Er öffnete die Augen und blinzelte ins Zwielicht seines Kinderzimmers. Hatte ihn ein Geräusch geweckt? Er lauschte. Aber es war still in dem kleinen Raum, so still, dass er das Ticken des mechanischen Weckers auf seinem Nachttisch hören konnte. Die phosphoreszierenden Zeiger standen auf Viertel nach drei. Er wusste, was das bedeutete. Mit Zahlen kannte er sich aus und die Uhrzeit konnte er lesen, seit er vier Jahre alt war. Es war mitten in der Nacht. Der heftige Wind musste nachgelassen haben; kein Pfeifen mehr in den Zwischenwänden, kein Klappern der Dachschindeln, kein Ächzen der rostigen Regenrinne; selbst die Bäume aus dem Vorgarten, deren Schatten im Mondlicht wie Tigerstreifen auf die orangefarbenen Vorhänge fielen, standen vollkommen still. Der Junge konnte sich nicht erinnern, sein Zimmer schon einmal so gesehen zu haben. Der Raum hatte sich in eine Geisterwelt verwandelt. Dort, wo sonst sein Schreibtischstuhl stand, auf dem ihm seine Mutter immer die Kleidung für den nächsten Tag zurechtlegte, schien ein Gnom zu hocken und ihn mit glänzenden Augen zu beobachten. Über dem Kleiderschrank, wo eigentlich das Segelflugzeug an der Decke hing, das er im Sommer gemeinsam mit seinem Vater gebaut hatte und das tatsächlich einige Hundert Meter weit geflogen war und bei der Landung eine ganze Kuhherde in Aufruhr gebracht hatte, schwebte ein böse starrender Flugsaurier in der Luft und wartete nur darauf, auf ihn herabzustürzen und ihn mit seinem spitzen Schnabel zu stechen. Und auf dem Fußboden vor seinem Bett, wo er gestern Abend noch seine Holzeisenbahn aufgebaut hatte, wand sich nun eine meterlange Python, bereit, ihn mit Haut und Haaren zu verschlingen. Er tastete in der Ritze zwischen Matratze und Wand nach seiner Taschenlampe. Erst vergangene Woche hatte er herausgefunden, dass die Phosphorziffern seines Weckers heller leuchteten, wenn man sie vorher einer intensiven Lichtbehandlung mit der Stablampe unterzog. Er fand die Lampe und knipste sie an. Jetzt, mit seinem Lichtschwert ausgerüstet, fasste er genügend Mut, um sich im Bett aufzusetzen und den lauernden Kreaturen ins Auge zu sehen. Und tatsächlich: Unter dem Bannstrahl seiner Waffe schrumpfte der Gnom wieder zu einem Schreibtischstuhl mit Jeans, der Flugsaurier wurde zu einem Segelflieger aus Balsaholz und die Würgeschlange verwandelte sich zurück in seine Eisenbahnanlage. Er atmete durch, sein Puls beruhigte sich. Sein Mund war trocken. Er griff nach dem Wasserglas auf dem Nachttisch. Beinahe hätte er wirklich Angst bekommen, so viel Angst, dass er aus seinem Zimmer gerannt und zu seinen Eltern ins Bett gehüpft wäre. Und das wäre doch wohl ein bisschen peinlich gewesen, er war schließlich schon ein großer Junge, neun Jahre alt, und sein Vater hätte ihn am nächsten Morgen ganz bestimmt damit aufgezogen. Da war es doch gut, dass er seine Angst allein überwunden hatte. Er war sogar ein bisschen stolz auf sich. Was für eine machtvolle Waffe so eine Taschenlampe doch war! Wie ein Weltraumritter ließ er die Lichtklinge durch die Dunkelheit fahren und Wunden ins Zwielicht schneiden. Wie ein Jedi-Ritter. Er zeichnete mit ihr flüchtige Kringel an die Decke, dann komplizierte Muster und schließlich schrieb er voll Übermut seinen Namen an die Wand.
LUKE SKYWALKER, der Unbesiegbare, hatte für Ordnung gesorgt.
Als er das R mit einem ausladenden Schwung vollendet hatte, blieb der Lichtkegel der Lampe auf dem Regal über seinem Schreibtisch stehen und beleuchtete das Regal, auf dem er seine Modellschiffsammlung aufbewahrte. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis er begriff, dass überhaupt nichts in Ordnung war: Sein wichtigstes Schiff, die große Fähre, das Geburtstagsgeschenk von seinem Vater – es fehlte.
Es fehlte!
Wie konnte das sein?
Wie war das möglich?
Er war jetzt wach und sprang aus dem Bett. Mehr Licht, er brauchte mehr Licht! Fünf hastige Schritte brachten ihn zum Schalter neben der Tür, beinahe wäre er über die dumme Holzeisenbahn gestolpert, dann flammte die Deckenlampe auf. Zwei weitere Schritte und er stand vor dem Regal. Es blieb wahr.
Das Schiff, sein Lieblingsschiff, war weg, verschwunden. Gestern Abend war es noch da gewesen. Das wusste er genau, denn wie jeden Abend hatte er nach dem Spielen die Schiffe auf dem Regal in Position gerückt, alle vier, ordentlich nach Größe geordnet: die Fregatte, den Zerstörer, das Löschschiff und eben die Fähre. Nun war die Fähre fort. Unbehagen kroch ihm den Nacken hinauf. Einbrecher, durchfuhr es ihn, es mussten Einbrecher im Haus gewesen sein und sein Schiff gestohlen haben! Nun gab es kein Halten mehr.
»Papa!«, rief er, so laut er konnte. Schon durchquerte er den Flur. »Papa, Mama, aufwachen!«
Er riss die Tür des Elternschlafzimmers auf, seine Hand knallte auf den Lichtschalter.
Doch Mama und Papa waren nicht da! Das Bett war leer! Die Bettdecken lagen so glatt und straff, wie Mama sie morgens immer zurechtmachte. Die Wucht der Angst riss ihn fast von den Beinen. Sie war größer als sein Mut, größer als sein Herz, sie pochte in seiner engen Brust, so sehr, dass es wehtat. Gleichzeitig schrillte eine Alarmglocke in seinem Kopf. Unten, dachte er, sie müssen unten sein. Er raste die Treppe hinab, schlug auf die Lichtschalter, schrie nach seinen Eltern.
Doch die Küche war leer.
Das Wohnzimmer war leer.
Im Badezimmer war niemand.
Er schaute in den Abstellraum, riss Schranktüren auf, rannte in den Keller. Er sah in seiner kindlichen Verzweiflung sogar in der Garage und im Gartenhäuschen nach. Dann wusste er nicht mehr, wo er noch suchen sollte. Barfuß und im Schlafanzug stand er in der feuchten, mondkalten Nacht. Obwohl er erst neun Jahre alt war, begann er zu verstehen. Es war etwas ganz und gar Unlogisches passiert. Seine Eltern waren fort. Sie hatten ihn zurückgelassen. Er war nun vollkommen allein auf der Welt.
Montag, 13. Oktober
1
Eigentlich bin ich zu alt für diesen Mist, dachte Hanns Löfven, als er sich die schwere Pressluftflasche auf den Rücken wuchtete. Er schob das Mundstück am Schlauchende zwischen die Zähne und drehte das Ventil auf. Es war halb acht am Morgen, die digitale Temperaturanzeige in seinem Wagen hatte auf der Fahrt hinaus zum Golfplatz nach Araby sechs Grad angezeigt und vor ihm, gleich dort, wo das Green von Bahn Nummer sechs endete, klatschte der große, aufgewühlte Helgasee Wellen an die Uferböschung. Im Sommer mochte die Aussicht ja fantastisch sein, aber heute war definitiv kein guter Tag, um Golf zu spielen. Ein böiger, feuchter Wind riss an den Bäumen, schnitt ihm ins Gesicht und trieb die letzten Reste der nebligen Dämmerung aus den Senken und Sandbunkern. Löfven spürte die Schmerzen in seinen Kniegelenken und Ellenbogen und hinten im Kreuz, wo die Pressluftflasche drückte. Höchste Zeit abzutauchen, dachte er, denn je eher er den Job hinter sich brachte, desto früher würde er zu Hause in seinem Reihenhaus in Hässleholm unter einer heißen Dusche auftauen und sich entspannen können. Er ruckelte die Tauchermaske zurecht. Nicht, dass man da unten etwas würde sehen können. Die Wasserhindernisse auf südschwedischen Golfplätzen waren wie wahrscheinlich auch überall sonst auf der Welt die reinsten Schlammlöcher. Aber wenigstens bot die Maske den Augen Schutz vor dem dreckigen, eisigen Wasser. Löfven war alles andere als ein Golfballtaucher aus Leidenschaft. Angesichts seiner rheumatoiden Arthritis war sein Beruf im Grunde Selbstmord auf Raten. Sein Arzt riet ihm jedes Mal unmissverständlich und mit einem besorgten Kopfschütteln dazu, mit dem Tauchen in kalten Gewässern sofort und für immer aufzuhören.
Aber was hatte er schon für eine Wahl? Wo sollte er denn als siebenundfünfzigjähriger arbeitsloser Industriemechaniker noch einen einigermaßen gut bezahlten Job finden? Als der Betrieb in Höör, bei dem er sein Leben lang gearbeitet hatte, vor sieben Jahren in Konkurs gegangen war, war ihm die Idee seines Neffen Nils, gemeinsam eine Golfballtauchfirma zu gründen, gerade recht gekommen. Tauchen konnte er, seit er seinen Wehrdienst bei der Marine absolviert hatte, die Anfangsinvestitionen hielten sich in Grenzen und die Umsatzprognosen in Nils’ Businessplan klangen solide. Bei ihrem ersten Banktermin hatte sie die Frau aus der Kreditabteilung zwar noch skeptisch angesehen, aber nach zwei Jahren hatte die Firma bereits schwarze Zahlen geschrieben und mittlerweile war Skåne Lakeballs Marktführer für gebrauchte Golfbälle in ganz Südschweden. Dabei war das Geschäftsprinzip simpel: Landesweit boomte das Golfspielen und jedes Jahr landeten Hunderttausende von Golfbällen in Wassergräben, Tümpeln und Teichen, dabei kostete ein Markengolfball durchaus bis zu fünfzig Kronen das Stück. Hanns Löfven und sein Neffe Nils fuhren also die småländischen und schonischen Golfplätze ab, tauchten in den Wasserhindernissen nach dem weißen runden Gold, reinigten die erbeuteten Bälle in eigens dafür umgebauten Waschmaschinen, sortierten sie, katalogisierten sie und verkauften sie dann über das Internet. Die Golfclubs oder Platzeigner bezahlte man entweder mit einer kleinen Provision oder man überließ ihnen kostenlos die geborgenen billigen Übungsbälle. Pro Tauchgang brachten sie bis zu tausend Bälle ans Tageslicht. Sie waren Schatzsucher, die vom Ungeschick der vielen ambitionierten Hobbyspieler profitierten.
Löfven ließ sich vorsichtig in den lang gezogenen Wassergraben auf Bahn Nummer sieben gleiten. Trotz des Neoprenanzugs raubte ihm die Kälte wie jedes Mal fast den Atem. Eine einsam dahinpaddelnde Ente glotzte ihn erbost an, dann schwamm sie ans Ufer des Grabens und watschelte Richtung See davon. Löfven tauchte unter. Sofort übernahm sein Tastsinn die Orientierung. An der flachen Uferböschung war die Arbeit noch relativ leicht. Während er mit behandschuhten Fingern die Bälle ertastete und aus dem Schlick klaubte, musste er wie so oft unter Wasser an seine Kindheit in Östergötland denken, als er den Großeltern bei der Feldarbeit geholfen hatte. Sie ernteten gute, ehrliche Kartoffeln, die Früchte ihrer guten, ehrlichen Arbeit. Und was ernte ich? Golfbälle, verdammte Golfbälle. So weit war es mit Schweden also in den vergangenen fünfzig Jahren gekommen.
Bald hatte er das erste Netz an seinem Gürtel prall gefüllt. Er wandte sich den tieferen Regionen des Grabens zu. Hier war auch der Schlamm tiefer, morastiger. Der Platzwart hatte ihn vorgewarnt. In der letzten Woche hatte es in dem Wasserhindernis Ausbaggerungsarbeiten gegeben, da die Verschlickung überhandgenommen hatte, dabei waren allerdings die Schutzfolie und der Betonboden auf dem Grund des künstlichen Gewässers beschädigt worden und die Baggerarbeiten hatten abgebrochen werden müssen. Im Frühjahr würde man das ganze Wasser ablassen und den Graben umfangreich sanieren müssen. Löfven konnte das Maß der Zerstörung ertasten, das der unvorsichtige Baggerführer angerichtet hatte: herausgerissene Wasserpflanzen, Fetzen von dicker Teichfolie, vereinzelte Betonbrocken. Mittlerweile war ihm so kalt, dass er seine Gliedmaßen kaum noch spürte. Das zweite Netz mache ich noch voll, dachte er, dann ist hier unten Schluss. Tief stieß er seine tauben Arme in den weichen Schlamm. Plötzlich war da etwas, das da nicht hingehörte. Etwas Großes, Hartes, Rundliches.
Was war denn das?
Definitiv kein Golfball. Nein, dazu war es viel zu groß und außerdem hatte es merkwürdige Vertiefungen. Was konnte das sein? Vor Löfvens Augen war es vollkommen schwarz. Kein Lichtstrahl verirrte sich in das drei Meter tiefe Wasser. Er tastete, fühlte. Sein Zeigefinger glitt in ein Loch, sein Mittelfinger in ein weiteres und dann auch noch sein Daumen. Das Ding hatte drei Löcher! Er hob es an. Es hatte ein ordentliches Gewicht. Auf einmal ahnte er, was es sein könnte.
Eine Bowlingkugel?
Welcher Idiot wirft denn eine Bowlingkugel in einen Graben auf einem Golfplatz, fragte er sich. Man fand ja allerhand seltsame Sachen unter Wasser, einen Skistock hatte er schon geborgen, einen Schuh und einmal sogar einen Schuhlöffel, aber eine Bowlingkugel? Für einen Augenblick war er unsicher, was zu tun war. Sollte er das Ding einfach da unten liegen lassen? Nein, entschied er. Das entsprach nicht seinem Berufsethos. Schließlich gehörte eine Bowlingkugel nicht in einen Golfplatzgraben. Er zog die Kugel mit aller Kraft aus dem Schlamm und paddelte zum Ufer. Als er Grund unter seinen Flossen spürte, ging er in die Hocke, dann zog er das schwere Ding mit einem Ruck hoch und hob es auf die Grasnarbe neben sich. Mit der freien Hand zog er die beschlagene Taucherbrille vom Gesicht. Und dann sah er es.
Die Bowlingkugel war gar keine Bowlingkugel.
Bowlingkugeln haben keine Zähne. Er riss seine Hand aus dem Mund und den Augenhöhlen des schlammgefüllten Totenschädels und schrie so laut, dass seine Stimme weit über den See bis hinüber nach Öjaby hallte.
2
Von außen sah alles ganz normal aus. Von außen sah alles sogar richtig gut aus, wenn sie ehrlich war. Ihr Busen wirkte prall, symmetrisch und in der neuen Unterwäsche, die sie von ihren Töchtern zum Geburtstag bekommen hatte, sogar ein bisschen sexy. Ingrid Nyström zupfte zum wiederholten Mal an dem eleganten BH herum, glättete mit zwei Fingern behutsam die feine Spitzenbordüre und strich über den kühlen, bordeauxrot schimmernden Stoff. Dann drehte sie ihren Körper um neunzig Grad und prüfte mit einem Schulterblick in den Spiegel – eine Pose, die ihr beinahe keck vorkam –, wie sich ihre Linien im Profil ausmachten. Sie sah runde Schultern, volle Brüste, einen halbwegs flachen Bauch – zumindest wenn sie ihn wie jetzt einzog – und einen Po, der nach ihrem Geschmack in den vergangenen Jahren ein wenig zu groß geworden war. Aber andererseits: Was hieß schon zu groß? Sie war seit letzter Woche vierundfünfzig Jahre alt und in Anbetracht dieser Tatsache und vor allem angesichts dessen, was sie in den vergangenen anderthalb Jahren durchgemacht hatte, konnte sie mit ihrem äußeren Erscheinungsbild durchaus zufrieden sein.
Das Problem war, dass es innen drin ganz anders aussah.
Innen, in ihrer Seele.
Aber auch innen, in ihrem Körper.
Mochte ihr Busen vor dem Spiegel auch noch so gleichmäßig und gesund aussehen, er war es absolut nicht. Er teilte sich in zwei Hälften. Es gab die rechte, die gute Seite. Die warme Seite. Und es gab die andere Hälfte. Die kranke, kaputte Brust, aus der man ein großes Stück hatte entfernen müssen. Die Krebsbrust, in der nun ein kaltes Silikonkissen so tat, als gehöre es zu ihr. Die fremde, die linke Brust, direkt über ihrem Herzen, barg den eiskalten Keim der Angst. Dass das alles noch nicht vorbei war. Dass irgendwo in ihrem Körper tödliche Zellen überlebt haben könnten, jederzeit bereit, Metastasen zu bilden.
Es war siebzehn Monate her, dass sie die Diagnose bekommen hatte. Am Anfang war alles sehr schnell gegangen. Die Operation, in der das betroffene Gewebe und die Wächterlymphknoten in den Achselhöhlen entfernt worden waren. Der chirurgische Wiederaufbau der Brust. Die kräftezehrende Zeit der Bestrahlung und die fortlaufende antihormonelle Therapie. Dabei war im Grunde alles recht unproblematisch verlaufen. Sie erfüllte den Heilungsplan, wie ihre Ärzte sagten. Der Tumor war lokal begrenzt, ihr Körper vertrug die Strahlenbelastung und die Medikamente bemerkenswert gut und alle messbaren Werte waren bald wieder im grünen Bereich. Nach einem sechswöchigen Regenerationsaufenthalt in einer Klinik in Kalmar, in der sie Anders und die Mädchen beinahe täglich besucht hatten, war sie wieder nach Hause gekommen und drei Monate nach der OP hatte sie ihre Arbeit als Hauptkommissarin der Kriminalpolizei Växjö wieder aufgenommen. Zu Beginn hatten sie alle mit Samthandschuhen angefasst.
Kann ich dir etwas Arbeit abnehmen, Ingrid?
Möchtest du noch einen Tee, Ingrid?
Nimm dir doch einen freien Nachmittag, Ingrid!
Ingrid hier, Ingrid, da. Natürlich war das alles gut gemeint gewesen, aber es war ihr schon bald auf den Geist gegangen. Die Kollegen aus ihrer Abteilung hatten im ganzen Präsidium Geld gesammelt und ihr einen neuen, ergonomischen Schreibtischstuhl gekauft, ein richtig schickes Ungetüm auf sieben Rollen, mit diversen Hebeln, Knöpfen und Polsterungen. Das Ding hatte sogar eine eigene Gebrauchsanweisung auf einer beiliegenden DVD. Ein Stuhl mit einer digitalen Gebrauchsanweisung, das musste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! Man hatte sie auf Rosen gebettet, auf ergonomischen Polstern mit sieben Rollen und Ingrid Nyström war ein Mensch, den genau das gehörig nervte. Natürlich hatte sie verstanden, dass ihr berufliches Umfeld ebenso etwas kompensierte wie ihre Freunde und selbst ihre Familie: Sprachlosigkeit. Wie, um alles in der Welt, sollte man auch angemessen über Brustkrebs sprechen? Es ging ja schließlich nicht um eine Grippe oder einen Beinbruch. Selbst von einer Hüftoperation konnte man sachlich und halbwegs unverfänglich erzählen. Aber von ihrer Erkrankung?
Wie geht es deinem Brustkrebs, Ingrid?
Danke der Nachfrage. Man hat einen Teil meiner Brüste abgeschnitten, mich hochenergetisch bestrahlt und wird mich noch die nächsten Jahre mit Chemie vollstopfen. Vor jeder Nachuntersuchung habe ich Todesangst, dass der Tumor zurückkehrt. Mir geht es ganz ausgezeichnet!
Selbstverständlich wusste sie, dass ihr Sarkasmus nicht weiterhalf. Und sie hatte sich nach Leibeskräften bemüht, die ausgestreckten Hände, die man ihr entgegenhielt, zu greifen. Sie war freundlich, höflich und bemüht gewesen und trotzdem hatte sich zwischen ihr und ihrer Umwelt eine Mauer aufgebaut und es hatte nichts gegeben, was sie dagegen hatte tun können. Auf der einen Seite gab es sie, auf der anderen Seite die anderen, die Gesunden.
Dann, nach einigen Monaten, veränderte sich das Verhalten ihr gegenüber allmählich. Es war, als würden alle nach und nach vergessen, was mit ihr geschehen war. Alle taten so, als wäre sie wieder vollkommen gesund. Und offiziell, nach den Aussagen ihrer Ärzte war sie das ja auch. Nur – es fühlte sich überhaupt nicht so an.
Sie griff nach der Bluse, die sie zurechtgelegt hatte, eine schwarze, unter der man den dunklen BH nicht würde sehen können.
»Du siehst sehr schön aus.«
Die Stimme von Anders stand im Raum wie ein Angebot. Sie drehte sich zu ihrem Mann um.
»Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du schon wach bist.«
Anders lächelte.
»Schon eine ganze Weile.«
Er richtete sich auf.
»Und wie lange siehst du mir schon zu?«
Sein Lächeln wurde noch eine Spur breiter.
»Schon eine ganze Weile, schöne Frau.«
Jetzt musste auch sie lächeln.
»Flirtest du etwa mit mir?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht findest du es heraus, wenn du die Bluse da für einen Moment zur Seite legst und noch einmal zu mir ins Bett kommst?«
Sie sah ihn an. Für einen Augenblick schien es wirklich möglich. Da war der Glanz in seinen Augen, das Begehren. Und das Gefühl, dass er sie beobachtet hatte, ein gutes Gefühl. Und eine Sehnsucht in ihr. Eine starke, machtvolle Erinnerung. Doch dann war der Augenblick vorüber. Etwas in ihr krampfte sich zusammen, in ihrer linken Brust, etwas Kaltes.
»Anders, ich …«
Es war nicht nötig, dass sie weitersprach, ihr Zögern hatte längst für sie geantwortet. »Es ist schon gut«, sagte er und sie sah die Enttäuschung in seinem Blick.
Gar nichts war gut.
»Es tut mir so leid«, sagte sie.
Anders drehte seinen Körper, ließ seinen Kopf zurück ins Kissen sinken.
»Heute sind es fünfhundert Tage«, sagte er und sah an die Decke.
»Fünfhundert Tage?« Sie dachte nach. »Zählst du etwa die Tage seit der Diagnose?«, fragte sie.
Er ließ sich mit der Antwort Zeit.
»Nein«, sagte er schließlich. »Ich zähle die Tage, seit wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben.«
Ihr fiel die Bluse aus der Hand. Das Eis in ihrer Brust knackte. Ich erfriere, dachte sie. Ich erfriere von innen.
Dann klingelte ihr Handy.
3
Als ihr Handy klingelte, stand Kommissarin Stina Forss inmitten eines Chaos aus Reinigungsmitteln, Putzeimern, Besen und einem jaulenden Staubsauger. Mit einer Hand balancierte sie die auf maximale Länge ausgezogene Staubsaugerdüse in die Ecke der Zimmerdecke, die besonders von Spinnweben heimgesucht worden war, mit der anderen hielt sie eine wackelige Trittleiter fest, auf der ihre Nichte Tuva stand und versuchte, die Vorhänge von der Gardinenstange zu lösen, was sich schwieriger gestaltete, als sie zunächst gedacht hatten, da die Gardinenringe mit einem anachronistischen Mechanismus verschlossen waren, dessen haptische Komplexität Tuvas zappelige Teenagerhände an ihre Grenzen brachte. Forss hatte sich ein paar Tage frei genommen, da sich die Überstunden auf ihrem Arbeitszeitkonto in den vergangenen Monaten zu einer astronomischen Ziffer addiert hatten, während Tuva eigentlich krank war, Halsschmerzen – zumindest hatte sie das am Morgen so glaubhaft versichert, dass ihre Eltern es ihr abgenommen hatten, doch kaum waren Maj und Mathias und die jüngere Schwester Lea aus dem Haus gewesen, war eine spontane Besserung eingetreten und sie war die Treppe hinauf zur Dachwohnung ihrer Tante Stina gehuscht, wo allemal mehr los war als in ihrem eigenen, langweiligen Bett. Frühjahrsputz im Herbst, allemal besser, als in die Schule zu gehen.
Mit der leichten Erreichbarkeit ihrer Dachwohnung war das so eine Sache, dachte Forss oft. Als sie vor knapp zwei Jahren aus Berlin in ihre Heimat Schweden zurückgekehrt war, um näher bei ihrem kranken Vater zu sein, war die leerstehende Ferienwohnung im Dachgeschoss des Hauses ihrer Cousine Maj und ihrem Mann Mathias eine praktische Übergangslösung gewesen. Von der kleinen Ortschaft Moheda aus war es weder weit nach Växjö, wo sie an der Polizeihochschule und im Präsidium einen einjährigen EU-Anerkennungslehrgang absolviert hatte, damit ihre deutsche Kripoausbildung auch in Schweden Gültigkeit besaß, noch nach Ljungby, wo ihr Vater in einem Pflegeheim lebte. Im Laufe der Zeit war aus der Übergangslösung ganz unmerklich ein Dauerzustand geworden. Nach Ablauf des Anerkennungsjahres war sie als Kommissarin in den regulären Polizeidienst in Växjö übernommen worden, aber selbst mit der Perspektive, nun dauerhaft in Schweden zu bleiben, hatte sie irgendwie den Zeitpunkt des Absprungs aus der Wohnung verpasst. Ohne es wirklich zu wollen, war sie mehr oder weniger ein fester Bestandteil der Familie Lundin geworden. Ihre Nichten zweiten Grades, Tuva und Lea, beteten sie an, Mathias war ihr freundschaftlich verbunden und mit ihrer Cousine Maj hatte sie in ihrer Kindheit ganze Sommerferien im Sägewerk des Onkels verbracht; zwischen ihnen herrschte eine Offenheit und Herzlichkeit, die sich bis heute gehalten hatte. Sich allein eine Bleibe in der Stadt zu suchen, kam ihr überflüssig vor. Und mit einer wirklich schützenswerten Privatsphäre – in dem Sinne, dass sie eine Form von regelmäßiger Zweisamkeit beinhaltet hätte, die man vielleicht nicht unbedingt mit der Familie seiner Cousine teilen wollte – hatte Forss eh nicht aufzuwarten – aus Gründen, die so kompliziert waren, dass sie selten darüber nachdenken wollte.
Sicher, im Vergleich zu Berlin fühlte sich ihr neues, schwedisches Leben in der Provinz manchmal eng an. So eng, dass sie glaubte, keine Luft mehr zu bekommen und auf der Stelle zu ersticken. So gleichmäßig, ausgewogen, spießig und rational, dass sie Angst hatte, innerlich zu vertrocknen. Dann musste sie ganz schnell raus aus Moheda, aus Växjö und dem kleinen Småland, dann musste sie ganz schnell dahin, wo es laut war und groß, nach Kopenhagen zum Beispiel, oder Stockholm oder besser noch zurück nach Berlin, wo es nach Rausch schmeckte und nach Leben und manchmal vielleicht auch nach Schweiß auf nackter Haut.
Ihr Handy klingelte so ausdauernd und laut, dass es den brüllenden Staubsauger übertönte. Sie stellte das vorsintflutliche Gerät aus, half Tuva von der Leiter und nahm das Gespräch an.
Eine Minute später war der Plan vom Großreinemachen Geschichte.
»Ich muss zur Arbeit«, sagte Forss, nachdem sie das Telefonat beendet hatte.
»Und die Vorhänge?«, fragte Tuva.
»Die müssen wohl warten. Du kannst natürlich mit dem Wischen oder dem Staubsaugen weitermachen, wenn du willst, aber ich muss jetzt ganz schnell los.«
Forss zog sich ein altes Sweatshirt über den Kopf und strampelte die Jogginghose von den Beinen.
»Irgendwie tut mein Hals doch noch ganz schön weh«, krächzte Tuva. »Vielleicht sollte ich mich besser wieder ins Bett legen.«
»Das wird wohl das Beste sein«, lächelte Forss und griff nach ihrer Jeans.
Kurz darauf steuerte sie ihren VW Polo aus der Einfahrt, bog von der 126 links ab in den Slätthögsvägen, passierte die ehrwürdige Clogsfabrik, ließ den Ortskern hinter sich, fuhr am Furensee vorbei, dann an dem großen Bauernhof, der an warmen Sommersonntagen Antikmärkte veranstaltete, zu denen Tausende Schaulustige strömten, ordnete sich auf der L30 hinter einem Holzlaster ein und folgte dem Lkw in südlicher Richtung bis nach Växjö. Ein kräftiger Herbstwind trieb weiße Wolkenfetzen über den dunkelgrauen Himmel und zupfte an den Fichtenwipfeln zu beiden Seiten der Straße. Die Moderatorin des Lokalsenders, den Forss im Autoradio eingestellt hatte, bewies angesichts des unwirtlichen Herbstwetters Humor und spielte nur Songs, die irgendwie mit Sommer oder Sonne zu tun hatten. Forss ließ Chrissie Hynde und die ewigen Pretenders noch über sich ergehen, aber bei Sunshine Reggae war es allerhöchste Zeit, den Sender zu wechseln.
Auf dem Parkplatz des Golfclubs standen nicht mehr als ein Dutzend Fahrzeuge, darunter ein Streifenwagen. Sie erkannte den Kastenwagen der Spurensicherung, ein Einsatzfahrzeug der Wasserschutzpolizei und Ingrid Nyströms Toyota. An der Rezeption des Clubheims, ein ehemaliges Herrenhaus mit hohen Fenstern, traf sie einen aufgeregt wirkenden Angestellten mit Sonnenbrille im Haar. Der sollte vielleicht auch mal den Radiosender wechseln, dachte Forss. Nachdem sie ihren Dienstausweis gezeigt hatte, beschrieb ihr der junge Mann mithilfe eines Faltplans den Weg zu dem Wasserhindernis auf Bahn sieben. Die Strecke dorthin war weiter, als sie angenommen hatte. Ihr ging auf, dass die eigentliche körperliche Betätigung beim Golfen vielleicht eher aus dem dauernden Gehen bestand als aus dem Schlagen der Bälle. Trotz ihrer Vorurteile gegenüber dem Sport musste sie sich eingestehen, dass der Spaziergang über den weiten Platz anregend war. Der alte Laubbaumbestand, der gepflegte Rasen auf dem sanft gewellten Boden und im Hintergrund der mächtige Helgasee: eine idyllischere Umgebung für eine Freiluftaktivität konnte man sich kaum vorstellen; im Sommer musste es hier draußen wirklich toll sein.
Als sie eine dicht stehende Gruppe aus Eichen, Buchen und Ahorn umrundet hatte, sah sie ihre Kollegen in der Ferne stehen. Die Blätter der mächtigen Bäume hatten in dem diesigen Wetter jede Farbpracht verloren. Während Forss auf den Wassergraben zuging, versuchte sie sich an das Wenige zu erinnern, das Nyström ihr am Telefon gesagt hatte.
Eine Art Toter.
Menschliche Überreste.
Fortgeschrittener Grad der Verwesung.
Eine Art Toter – was sollte das überhaupt bedeuten? Entweder war man tot oder nicht, entweder gab es eine Leiche oder es gab eben keine. Ihre Chefin hatte sich nicht gerade präzise ausgedrückt. Trotzdem spürte sie nun, so nahe am Ort des Geschehens, eine vertraute Spannung in sich aufsteigen. Ein gutes, ein seltenes Gefühl. Sie beschleunigte ihre Schritte.
Sie begrüßte Ingrid Nyström, ihre Kollegen Hugo Delgado und Anette Hultin, die Rechtsmedizinerin Ann-Vivika Kimsel und Bo Örkenrud, den Chef der Spurensicherung. Den anderen Polizisten nickte sie zu, man kannte sich vom Sehen. Nyström führte sie zu einer Kunststoffplane, die auf dem Rasen ausgebreitet war.
»Das ist der Grund, warum wir hier sind.«
Nun verstand Forss, was eine Art Toter bedeuten sollte. Vor ihr, auf dem weißen Plastik, lagen ein Totenschädel und weitere menschliche Knochen: zwei Oberschenkel, das Becken, das sie entfernt an ein Elchgeweih erinnerte, ein Teil der Wirbelsäule, Elle und Speiche eines Unterarms. Die Knochenteile waren dunkelbraun, in manchen Bereichen schwarz angelaufen.
»Teile eines Toten«, murmelte Forss.
»So kann man es auch formulieren«, sagte Nyström. »Und es kommen laufend neue dazu. Gerade sind die Taucher von der Wasserschutzpolizei wieder unten. Wir können uns in den nächsten Stunden wohl auf ein Puzzlespiel gefasst machen. Bis jetzt ist auch noch völlig unklar, ob es sich um ein Skelett handelt oder ob da unten mehrere Tote liegen. Nur eins steht zweifelsfrei fest.«
»Und zwar?«
»Schau dir mal den Schädel genauer an.«
Forss kniete sich auf die Folie. Die obligatorischen Einweghandschuhe hatte sie längst übergestreift, ein Automatismus, dessen sie sich noch nicht einmal bewusst war. Sie nahm den Schädel in die Hand. Schlammreste und halb vermoderte Birkenblätter füllten den Totenkopf. Dann sah sie das Einschussloch in der rechten Schläfe und den Austrittskanal im linken Hinterkopf.
»Oh«, sagte sie.
Ihr Atem hinterließ kleine Wolken in der feuchten Luft, die bald vom Wind zerrissen wurden.
»Sein oder Nichtsein«, sagte Delgado, der neben sie getreten war, mit getragener Stimme.
»Was?«
»Du kniest da wie Hamlet.«
Forss legte den Schädel zurück auf die Plane und richtete sich wieder auf. »Vielleicht haben wir es hier ja mit einem Drama von shakespeareschem Ausmaß zu tun.«
»Vielleicht«, knurrte Delgado und schnipste den Stummel seiner selbst gedrehten Zigarette in den Wind, sodass sie einen Glutschweif hinter sich herzog. Er sprach jetzt wieder normal. »Vielleicht ist der Knochenmann aber auch schon genauso lange tot wie Shakespeare. Frisch sieht der jedenfalls nicht aus.«
»Ist ja klar, dass du wie selbstverständlich davon ausgehst, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt. Das ist mal wieder typisch südamerikanischer Macho«, sagte Anette Hultin.
»Moment! Meine Eltern kommen aus Chile, aber ich selbst bin schwedischer als jedes Dalarna-Pferdchen«, grinste Delgado. Dann schnalzte er mit der Zunge: »Hü-hott, mein Schatz, such nach heißen Spuren in der Umgebung. Vielleicht hat der Täter vor hundert Jahren ja seine DNA hinterlassen. Da vorne liegt sogar ein Zigarettenstummel. Na so was, der glimmt ja noch!«
»Ach, leck mich.«
Die verbalen Dauergefechte zwischen den beiden hatten ihren Ursprung in einer für Außenstehende schwer durchschaubaren On/Off-Beziehung und ihre gegenseitige Anziehung war angesichts ihrer offensichtlichen Unterschiedlichkeit wenig nachvollziehbar. Während die ehemalige Berufssoldatin und Leistungssportlerin Hultin überaus konservativ dachte, fühlte und lebte, sich selbst als Patriotin bezeichnete und bei den letzten Wahlen für die rechtspopulistische Partei der Schwedendemokraten gestimmt hatte, war der heitere Delgado, der seine Freizeit mit mittelalterlichen Online-Rollenspielen und als Fan des ortsansässigen Fußballclubs Östers IF verbrachte, seinen eigenen Worten zufolge ein linksliberales Musterkind der zweiten Einwanderergeneration und ein Paradebeispiel gelungener Integrationspolitik.
Ein Paar wie Feuer und Eis, hatte es Forss’ übergewichtiger Kollege Lars Knutsson, den alle meistens Lasse nannten, einmal zusammengefasst, bevor er hinter vorgehaltener Hand hinzugefügt hatte, dass da sexuell irgendwas Besonderes am Laufen sein müsse, anders könne er sich diese ungleiche Liaison nicht erklären. So genau hatte es Forss zwar gar nicht wissen wollen, aber im Grunde fand sie Knutssons These durchaus plausibel.
»Das mit dem shakespeareschen Alter bezweifele ich doch stark«, sagte die Pathologin Ann-Vivika Kimsel, die sich zu ihnen gestellt hatte. Mit einer Geste bat sie Delgado um Feuer für ihre Slim-Line-Zigarette. »Die Knochen sind alt, aber längst nicht so alt.«
»Wie alt schätzt du denn?«, fragte Nyström.
»Schwer zu sagen, in dem verschmutzten Zustand, in dem sie sind.« Sie zog an ihrer Zigarette. »Zehn bis zwanzig Jahre. Etwas genauer kann ich es dir wahrscheinlich heute Nachmittag sagen, nachdem ich die Funde in der Pathologie untersucht habe. Für einen endgültigen Befund müssen die Knochen allerdings ins kriminaltechnische Labor nach Linköping.«
Kimsel blies Rauch aus den Nasenlöchern. Im Gegensatz zur eher praktisch veranlagten Nyström, war die Ärztin auffällig elegant gekleidet, fand Forss.
»In der anderen Sache muss ich Hugo allerdings recht geben«, sagte sie. »Es handelt sich eindeutig um die sterblichen Überreste eines Mannes. Die Beckenknochen sprechen Bände. Bei einer Frau wären die Beckenschaufeln viel ausladender und das Hüftbeinloch dort hätte eine dreieckige Form. Dieses männliche Becken hier ist eher hoch, schmal und eng, wie ihr seht.« Kimsels glühende Zigarettenspitze zog die beschriebenen Formen nach. »Außerdem wäre bei einer Frau der Beckenausgang naturgemäß deutlich breiter und der Winkel der Schambeinfuge …«
»Schambeinfuge, so, so …« Delgado grinste.
»Du bist so ein Idiot!« Hultin schüttelte ihren Kopf.
»… wäre größer als 90 Grad.« Kimsel vervollständigte ihren Satz, bevor sie erneut an ihrer Zigarrette zog.
»Kommt mal her!«
Die kräftige Stimme von Bo Örkenrud hallte zu ihnen herüber. Der Chef der Spurensicherung hockte an der Uferkante des Wassergrabens und winkte die Ermittler zu sich. Vor ihm sah man die Oberkörper der Polizeitaucher aus dem Wasser ragen. Einer hatte etwas Helles in der Hand. Ein Turnschuh, aus dem ein Stück Knochen ragte. Forss pfiff durch die Zähne.
»Wow«, sagte sie, »Shakespeare trug Nike Airs.«
4
Neun Stunden später, es war mittlerweile dunkel geworden und der Wind drückte in Intervallen feinen Herbstregen gegen die Panoramascheibe des Konferenzzimmers, hatte Nyström das Team zu einer späten Lagebesprechung zusammengerufen. Irgendjemand hatte zwei Tüten Chips und einige Flaschen Cola besorgt und auf dem großen ovalen Tisch bereitgestellt. Dort saßen Hugo Delgado, Anette Hultin, der bärtige, beleibte Lars »Lasse« Knutsson, der junge Göran Lindholm, der erst seit einem knappen Jahr fertig ausgebildeter Polizist war und nun neben seiner halben Stelle einen Universitätskurs in Kriminologie besuchte, um seine Chancen auf eine feste Stelle in Växjö zu optimieren. Ann-Vivika Kimsel und Bo Örkenrud, der noch immer seinen rustikalen Arbeitsoverall aus Baumwolle trug; seine Gummistiefel mit Profilsohle hatten eine Spur aus Erd- und Matschkrümeln hinterlassen, die sich einmal quer durch den Raum zog. Ein starker modriger Geruch ging von ihm aus, was ihn aber nicht sonderlich zu stören schien. Und Stina Forss. Die kleine, zierliche Deutschschwedin zupfte wie so oft gedankenverloren in ihrem rotbraunen Lockenwust herum und nagte an ihrer Unterlippe. Trotz ihres leicht hängenden linken Augenlids, das ihrem Gesicht eine irritierende Asymmetrie verlieh, wirkte die junge Frau nicht unattraktiv. In Momenten wie diesen hatte sie beinahe etwas Elfenhaftes an sich. Ein friedliches, ein filigranes Fabelwesen. Doch Nyström wusste, wie sehr dieser Eindruck trog. Örkenruds Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
»Es hat mehr als fünf Stunden gedauert, diesen Wassergraben leer zu pumpen, trotz der Hilfe der Feuerwehr. Zum Glück ist ja der See gleich einige Meter weiter, sonst hätten wir gar nicht gewusst, wohin mit all dem Wasser. Aber die Plackerei hat sich gelohnt, wir konnten beinahe alle Teile des skelettierten Leichnams bergen, einschließlich der Kleidung, beziehungsweise dem, was davon übrig geblieben ist. Und noch ein besonderes Bonbon dazu.«
»Ein Bonbon?«, wunderte sich der junge Lindholm.
Örkenrud lächelte kurz – eine Kunstpause, dann legte er etwas auf den Tisch, etwas Kleines, Hartes.
»Das Projektil?«, fragte Nyström.
»Zumindest ein Projektil«, sagte er. »Wobei ich nicht glaube, dass es sich um die Kugel handelt, die für die Kopfverletzung verantwortlich war. Der Schädel hatte schließlich eine Austrittswunde, deshalb fürchte ich, dass das entsprechende Projektil für immer verschwunden ist – zumindest wenn wir davon ausgehen, dass unser Mister X nicht in dem Wasserhindernis erschossen wurde, wofür sehr vieles spricht, wie ich gleich ausführen werde. Nein, diese Kugel hier hat vermutlich im Körper des Toten gesteckt, bis sie die natürlichen Zersetzungs- und Verwesungsprozesse wieder ans Tageslicht gebracht haben. Milliarden Bakterien, Würmer und Kleinstlebewesen …«
»Mir wird gleich schlecht«, flüsterte Hultin.
»Tu dir keinen Zwang an«, stichelte Delgado und griff beherzt in die Chipstüte.
»Dazu würde die unnatürliche Absplitterung passen, die ich unter den verwesten Fleischresten an einem der Rippenbögen gefunden habe«, sagte Kimsel und blätterte in ihren Unterlagen.
Delgado ließ eine Handvoll Chips geräuschvoll im Mund zerknacken. Hultin wurde blasser.
»Zwei Projektile also, mindestens. Einen Kopfschuss und einen in den Oberkörper«, fasste Forss zusammen.
»Das klingt ja wie eine Hinrichtung«, brummte Lars Knutsson.
»Kannst du schon etwas zur Munition sagen?«, fragte Nyström.
»Yep«, machte Örkenrud und lehnte sich so weit in seinem Stuhl zurück, dass die Lehne unter dem Gewicht des ehemaligen Eishockeyverteidigers ächzte. »Und da wird es interessant. Dieses Bonbon hier auf dem Tisch ist 9.2 x 18- Millimeter-Munition, auch Makarow genannt, passend zur gleichnamigen Pistole. Das war die Standardwaffe der Sowjetarmee und ist heute noch in vielen Ländern Osteuropas weitverbreitet, als offizielle Polizeiwaffe und natürlich auch bei vielen Kriminellen dort drüben.«
»Etwa die Russenmafia?«, fragte Lindholm und fasste sich an seine modische, überdimensionierte Hornbrille.
»Zum Beispiel.«
»Klischee-Alarm!«, rief Delgado dazwischen. »Zehn Kronen in die Kaffeekasse, alle beide!«
»Was hat die Russenmafia auf unserem Golfplatz zu suchen?«, fragte Knutsson.
»Schon dreißig Kronen!«
»Das ist der nächste Punkt …« Örkenrud ignorierte Delgados Gequake.
»Moment«, warf Kimsel ein. »Wo du das gerade mit Osteuropa sagst – das würde zu der seltsamen Zahnsituation des Toten passen.«
»Was ist denn eine Zahnsituation?«, fragte Knutsson.
»Na ja, lass es mich so ausdrücken – der Kerl hatte eine regelrechte Batterie im Mund, so viele verschiedene Metalle waren da verbaut. Würde mich nicht wundern, wenn er mit offenem Mund Radioempfang gehabt hätte: Füllungen aus verschiedenen Amalgamen, Goldkronen, aber auch grauenhafte Stahlprothesen. Bei uns würde ein Zahnarzt für eine solche Arbeit ins Gefängnis wandern, im ehemaligen Ostblock waren solche Mischbehandlungen jedoch gang und gäbe. Und was das Alter des Mannes angeht: Vom Zustand der Zähne und der Knochen würde ich sagen, zwischen vierzig und fünfzig. Linköping kann uns mit Sicherheit Genaueres sagen, das wird allerdings erfahrungsgemäß eine ganze Weile dauern.«
»Ein Russe mittleren Alters auf dem Golfplatz«, sinnierte Knutsson. In seinem Bart hingen Chipskrümel.
»Er muss ja nicht unbedingt Russe gewesen sein. Möglicherweise war er auch Lette, Bulgare oder Tschetschene«, entgegnete Kimsel.
»Genau«, sagte Delgado. »Das sind dann noch mal zehn Kronen von dir, Lasse.«
»Außerdem war der Kerl selbst höchstwahrscheinlich gar nicht auf dem Golfplatz.«
Örkenrud nahm den verlorenen Faden wieder auf. »Lebendig, meine ich. Der ist dort unter dem Wasserhindernis begraben worden.«
»Unter dem Wasserhindernis? Du meinst im Wasserhindernis.«
»Nein. Unter. Das ist ja das Bemerkenswerte. Also: Vergangene Woche haben in dem Wassergraben Ausbaggerungen stattgefunden, um der Verschlickung Herr zu werden, dabei hat es der Baggerführer aber wohl übertrieben und zu tief gegraben, sodass der Grund des Grabens beschädigt wurde, eine dicke Teichfolie und eine Betonverschalung. Stand sogar in der Zeitung, das Malheur. Sachschaden 40.000 Kronen, schreibt Smålandsposten. Als wir das Wasser abgepumpt hatten, konnte man den Schaden ziemlich gut sehen. Der Leichnam hat unter der Folie und unter der Betonschale gelegen, und zwar eingewickelt in ein Tuch oder ein Laken oder so etwas Ähnliches. Sonst wäre er bestimmt auch schon früher gefunden worden, schließlich kommt dort zweimal im Jahr dieser Golfballtaucher vorbei, der heute morgen den Totenschädel ans Licht gebracht hat. Der arme Kerl! Jemand muss den Leichnam begraben haben, als sich das Wasserhindernis auf Bahn Nummer sieben im Bau befand.«
»Und wann war das?«, fragte Nyström.
Forss blätterte in ihren Notizen.
»Ziemlich genau vor zwanzig Jahren. Im Herbst 1994. Steht so in der Vereinschronik und der stellvertretende Vorsitzende des Clubs konnte das bestätigen.«
»Passt zu den Schuhen«, sagte Delgado. »Nike Air Max Classic BW heißt das Modell. Habe ich im Internet gefunden. Die wurden Anfang der Neunzigerjahre hergestellt, damals sehr teure Laufschuhe.«
»Der Rest der Kleidung ist auf den ersten Blick nicht besonders aussagekräftig«, merkte Örkenrud an. »Vermoderte Jeans, ein Sweatshirt, Baumwollunterwäsche. Die genauen Laborberichte stehen natürlich noch aus, mal abwarten, was da noch kommt.«
»Danke, Bo.«
Nyström räusperte sich und wartete, bis sie die Aufmerksamkeit aller hatte.
»Im Herbst 1994 wird ein vierzigbis fünfzigjähriger Mann, möglicherweise Osteuropäer, mit einer Waffe aus der Produktion der ehemaligen Sowjetunion erschossen und auf unserem Golfplatz begraben. Wem fällt dazu etwas Sinnvolles ein?«
»Sag ich doch, Russenmafia«, grunzte Knutsson und trank von seiner Cola.
»Rrring!« Delgado imitierte das Geräusch einer klingelnden Kasse.
»Du hast da was im Bart kleben, Lasse«, merkte Lindholm an.
»Organisierte Kriminalität, etwas Besseres fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein«, sagte Hultin.
»Rrring!«
»Wir hatten damals in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch des Ostblocks tatsächlich eine Menge Ärger hier«, sagte Nyström. »Alkoholschmuggel war natürlich ein Thema. Und ich erinnere mich an eine litauische Einbrecherbande. Aber ein Mord? Wir müssen auf jeden Fall die Archive aus dem Herbst 1994 sorgfältig durchgehen.«
»Wir sollten auch das Bauunternehmen überprüfen, die damals die Arbeiten an diesem Wasserhindernis auf dem Golfplatz gemacht haben, das Graben und das Ausgießen mit Beton, meine ich. Die Mitarbeiter waren ja wohl diejenigen, die am ehesten Zugang zu der Baustelle hatten«, merkte Forss an.
»Gute Idee«, sagte Nyström. »Aber dann müssten wir den Kreis noch größer ziehen: die damaligen Angestellten des Golfclubs, eigentlich sogar alle, die zu der Zeit Mitglieder waren.«
»Puh«, machte Knutsson. »Das sind ganz schön viele. Zum Glück war Golfen in den Neunzigern noch nicht so ein Volkssport wie heute. Erinnert ihr euch noch an den Ausdruck Moderathockey?«
»Moderathockey?«, fragte Forss.
»Ja«, lachte Knutsson, »weil es fast nur von den reichen Wählern der Moderat-Partei gespielt wurde.«
»Stimmt.« Nyström lächelte. »Natürlich können wir nicht mit allen sprechen. Aber es kann ja nicht schaden, wenn wir uns einen Überblick verschaffen und versuchen, eine Liste mit allen zu erstellen, die theoretisch von dieser Baustelle auf Bahn Nummer sieben wissen konnten und Zugang zu ihr hatten. Vielleicht taucht irgendwo ja ein osteuropäischer Name auf oder sonst etwas Verdächtiges«, sagte Nyström.
»Rrring! Das klingt jetzt fast ein bisschen rassistisch«, sagte Delgado.
»Quatsch mit Soße«, meinte Hultin. »Und hör mit diesem albernen Geklingel auf!«
»Das Gebiss des Toten«, sagte Forss. »Wir müssen die Abdrücke nach Stockholm und an Europol und Interpol weitergeben. Mit viel Glück sind seine kreativen Zahnfüllungen ja noch in irgendeiner Dentalklinik registriert. Ansonsten sehe ich wenig Ermittlungsspielraum, zwanzig Jahre sind einfach eine halbe Ewigkeit. Wenn wir keinen Zufallstreffer landen, können wir den Fall vermutlich bald zu den Akten legen.«
Nyström nickte.
»Ich fürchte, viel mehr können wir im Moment wirklich nicht tun.«
Örkenrud ließ seine gewaltige Eishockeyverteidigerhand auf die Tischplatte krachen.
»Das ist doch mal ein angemessenes Schlusswort für heute!«
Niemand widersprach ihm.
Es war 20.37 Uhr und der böige Regen wurde stärker.
5
Erst als Ingrid Nyström vor ihrer Haustür in der kleinen Ortschaft Ör stand und in ihrer Handtasche nach dem Schlüsselbund fischte, merkte sie, wie sehr sie sich dagegen sträubte nach Hause zu kommen. Natürlich wusste sie genau, woran das lag. Sie hatte Angst vor der Begegnung mit ihrem Mann. Den ganzen Tag über hatte sie die Gedanken an die morgendliche Situation, an die vergangenen anderthalb Jahre verdrängen können, aber nun, vor der Schwelle ihres Zuhauses traf sie die Wucht der Zahl, die Anders ihr genannt hatte.
Fünfhundert.
Sie führten ihre Ehe seit fünfhundert Tagen ohne Sex. Zuerst hatte sie das nicht geglaubt. Es kam ihr so absurd lange vor, dass es einfach nicht stimmen konnte. Anders musste sich vertan haben, er musste absichtlich übertrieben haben, um sie zu schockieren oder zu verletzen. Aber dann hatte sie versucht, sich zu erinnern. Sie hatte nachgerechnet und ja, es kam hin. Das letzte Mal, dass sie mit Anders intim gewesen war, musste kurz vor ihrer Diagnose gewesen sein, im Sommer vergangenen Jahres. Trotzdem war sie wütend auf ihn. Was fiel ihm ein, die Tage zu zählen wie ein Buchhalter? Eine Ehe war ja schließlich kein Bilanzbuch, in dem man Zärtlichkeiten miteinander verrechnete! Körperliche Liebe war etwas Spontanes, Natürliches, das sich von selbst entwickeln musste! Nur wusste sie selbst, dass das Empfinden ihres Körpers im Moment weder spontan noch natürlich war. Anders’ Zahl war kein Vorwurf, sondern ein Fakt, den sie verdrängte. Sie wollte so nicht sein. Sie wollte diese innere Kälte nicht. Sie wünschte sich ebenso wie ihr Mann eine sinnliche und zärtliche Partnerschaft, auch nach neunundzwanzig Ehejahren. Und sie begehrte Anders noch immer, sie fand ihn attraktiv und männlich. Das, was sie abhielt, das, was sie von innen erkalten ließ, war etwas anderes. Es war die Angst, dass der Krebs zurückkehrte. Es war die Angst vor dem Tod.
Sie schloss die Tür auf. In der Diele war kein Licht, in der Küche auch nicht. Jetzt fiel es ihr wieder ein. Anders war diese Woche auf einem Fortbildungsseminar für Pastoren. Sterbebegleitung. Ausgerechnet. Sie hatten sich am Morgen noch nicht einmal richtig verabschiedet. Nun war sie beinahe ein wenig enttäuscht, gern hätte sie mit Anders zu Abend gegessen und von dem Skelett im Golfgraben erzählt. Gleichzeitig fiel die Anspannung von ihr ab wie ein schwerer, nasser Lodenmantel, den man im Flur zu Boden sinken lässt.
Auf dem Anrufbeantworter waren zwei neue Mitteilungen. Ihre Mutter Gullan hatte angerufen und ihre älteste Tochter Marie. Seit die Krankheit ein Teil ihres Leben geworden war, hatte sie fast täglichen Kontakt mit ihrer Mutter. Oft wurde es ihr zu viel, aber gleichzeitig hatte sie das Bedürfnis, die Menschen in ihrer Umgebung zu beruhigen, zu sagen, ich bin noch hier, ihr habt mich noch nicht verloren. Auch wenn sie wusste, dass die vielen Anrufe ein Zeichen von Fürsorge und Liebe waren, verspürte sie dabei die Verpflichtung, ihr die Ängste zu nehmen, so als trüge sie die Verantwortung dafür, dass sich ihre Mutter Sorgen machte. Eigentlich verrückt, aber so waren sie wohl, die menschlichen Beziehungen, dachte sie.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass ihre Mutter bis morgen warten musste. Um halb zehn schlief sie meistens schon. Stattdessen hob Nyström den Hörer und wählte die Nummer ihrer Tochter. Bei ihr war die späte Uhrzeit eher ein Vorteil, da Marie keine Ruhe zum Reden hatte, bevor ihre drei Kinder im Bett waren. Heute schliefen die Kinder allerdings noch nicht, das konnte sie schon an der Stimme ihrer Tochter erkennen.
»Hier Marie«, es klang gehetzt.
»Hej, hier ist Mama.«
»Elise, lass das, habe ich gesagt!«, brüllte es durch den Hörer. Es folgte eine gedämpfte Schimpftirade. Dann war Maries Stimme wieder ganz nah. »Entschuldigung Mama, es ist hier gerade ziemlich chaotisch, die Kinder sind noch nicht im Bett und ich kann jetzt wirklich nicht telefonieren, ich muss aber dringend mit dir sprechen. Kannst du morgen vorbeikommen?«
Marie hatte drei Kinder, Marcus, der seit August in die Schule ging, und die beiden Zwillinge Elise und Thea, die zwei Jahre jünger waren. Der Vater, Maries Ehemann Leif, kümmerte sich wenig um seine Familie. Die meiste Zeit arbeitete er auf einer Bohrinsel in Norwegen und es schien Nyström, als sei ihm der große Abstand recht. Faktisch war Marie alleinerziehend, auch wenn es auf dem Papier anders aussah.
»Mal sehen, wie es morgen bei der Arbeit aussieht. Ich werde mein Bestes tun, okay?« Kaum hatte Nyström den Satz zu Ende ausgesprochen, bereute sie ihre Wortwahl. Die Arbeit vorzuschieben war eine Floskel geworden. Wer heutzutage Arbeit hatte, hatte immer viel zu tun. »Nein, Marie, ich komme definitiv, ich kann nur noch nicht sagen wann genau, aber ich komme.«
»Wir essen gegen sechs, bis dann also!«
»Gute Nacht«, sagte Nyström liebevoll, aber am anderen Ende hatte Marie den Hörer bereits aufgelegt.
6
Stina Forss stand auf dem Green neben der Fahne des siebten Lochs. Sie sah auf den See hinaus. Obwohl es dunkel war und bewölkt, lag auf dem bewegten Wasser ein silbriges Schillern. In der Ferne sah sie vereinzelt Lichter, wahrscheinlich die Häuser in Öjaby und auf Helgö. Ihr Gesicht war feucht vom Nieselregen, vielleicht war es aber auch die Gischt, die der Wind von den Wellenkämmen gepflückt hatte. Nach einer Weile drehte sie sich um und ging zurück zu dem ausgepumpten Wassergraben. Auf dem Grund über dem Grab des unbekannten Mannes stand immer noch der weiße Pavillon der Spurensicherung, auch wenn alle Ermittler längst zu Hause waren.
Wer warst du, fragte sich Forss, und was hast du Schlimmes getan, dass du dafür sterben musstest? Wer hat dich metertief unter Wasser und Beton begraben, auf dass du nie mehr gefunden werden solltest?
Ihr Mobiltelefon klingelte. Das Display zeigte an, dass es das Pflegeheim ihres Vaters in Ljungby war. Sie ahnte sofort, dass es etwas Ernstes sein musste, das Personal hatte sie noch nie zuvor angerufen, außerdem war es schon nach elf.
»Ja, Stina Forss hier.«
»Hej, hier ist Elin Einarsson. Ich arbeite im Krankenhaus in Ljungby. Es geht um Kjell Forss.«
Es war, als würde der Boden, als würde die Böschung des Wassergrabens unter ihr wegsacken.
»Das ist mein Vater.«
»Ja, deshalb rufen wir an. Es wäre gut, wenn du möglichst bald hierherkommen könntest.«
7
Er schwebte lautlos dahin. Weit und immer weiter. Die Luft hier oben war so klar und kalt, als wäre sie kein Gas, sondern eine Flüssigkeit, die er mit seiner Lunge trank. Pontus Palmgren träumte von dem großen Ballon. Dunkle chinesische Seide gefüllt mit Wasserstoff, ein schwarzer Tropfen mit zwanzig Metern Durchmesser und genügend Auftrieb, um drei tapfere Männer und ihre Expeditionsausrüstung über das ewige Eis zum Nordpol zu bringen. Alles war seit Monaten geplant, alles war exakt kalkuliert. Und doch ging es schief. Die Launen des Windes konnte man nicht berechnen. Der Ballon sank, stieß hart auf, kratzte über das schorfige Weiß, bis er schließlich schlaff in der Eiswüste zum Liegen kam. Leblose schwarze Seide auf kantigem Eis. Drei Männer verloren in ewiger Einsamkeit …
Er wachte vom Klingeln seines Weckers auf. Im Zimmer war es kalt. Es war Viertel nach vier am Morgen. Pontus Palmgren führte ein Leben wie ein Uhrwerk. Seit 30 Jahren, neun Monaten, sieben Tagen und zweieinhalb Stunden. Jede unfreiwillige Abweichung von seinem Tagesplan, jede Störung seines inneren und äußeren Rhythmus bedeutete für ihn Verunsicherung und Irritation, ja, sie konnte in den schlimmsten Fällen sogar zu einer regelrechten Panik und anhaltenden Angstzuständen führen. Er stieg aus dem Bett, machte seine zwanzig Kniebeugen und dreißig Liegestütze, verbrachte wie jeden Morgen exakt sieben Minuten im Bad, frühstückte zu den Halbfünf-Uhr-Nachrichten im Radio und schmierte sich, während der Seewetterbericht lief, seine Brote für die Mittagspause, zwei mit Käse, zwei mit Salami. Er schälte und entkernte einen Apfel, viertelte ihn und legte ihn in eine gelbe Kunststoffdose zu einem Marabou-Schokoriegel. Um Punkt 5.03 Uhr verließ er seine kleine Wohnung in der Sjögatan in voller Kapitänsmontur und ging zu Fuß zum Gränna-Fähranleger, ein Spaziergang, für den er elf Minuten benötigte, um dann pünktlich, wie es sein Dienstplan vorsah, um Viertel nach fünf das Deck der Ebba Brahe zu betreten. Gemeinsam mit den Bootsmännern benötigte er je nach Wetterlage 14 bis 16 Minuten, um die Fähre fahrbereit zu machen. Um 5.45 Uhr legte das Schiff zur ersten Tour des Tages über den Vätternsee zur Insel Visingsö ab, die Überfahrt dauerte in der Regel 25, manchmal auch 26 oder 27 Minuten. Seine Ebba Brahe war 41 Meter lang, fasste bis zu 297 Passagiere und 20 Autos, und machte bei den üblichen Windverhältnissen im Durchschnitt zehn Knoten. Als er um 14.10 Uhr auf der Brücke abgelöst wurde, war er siebenmal zwischen Gränna und Visingsö hin und her gependelt. Genau das war das innere Bild, das er von sich selbst hatte: Pontus Palmgren, das Metronom.
Das Pendel.
Palmgren war jung, er war Kapitän eines Fährschiffs und er hatte das Asperger-Syndrom. Was die Sache natürlich nicht gerade leichter machte. Als am Ende seiner Schulzeit von einem Arzt zum ersten Mal die Diagnose gestellt wurde, hatte er sogar eine gewisse Erleichterung gespürt, so als hätte allein die wissenschaftliche Bezeichnung Asperger seine Schwierigkeit, mit anderen Menschen umzugehen, erklärt und ihm das diffuse Gefühl genommen, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Mit seiner Diagnose als Schutzschild gegen die Außenwelt hatte er angefangen, sich selbst zu respektieren und zu mögen. In der Klasse wechselte seine Rolle vom merkwürdigen Einzelgänger zu unserem Aspi, der ja nichts dafür konnte, dass er manchmal etwas seltsam und abwesend wirkte. Er fand endlich Freunde und hatte in den naturwissenschaftlichen Fächern und vor allem in Mathematik gute Noten in seinem Abschlusszeugnis. Auf dem Abschlussball – nach drei Gläsern Sekt – tanzte er sogar mit einem Mädchen, zum ersten Mal in seinem Leben. Die guten Noten blieben bis zum Ende seiner Berufsausbildung konstant, er war einer der Besten seines Jahrgangs, bis die Verkehrsbehörde dahinterkam, dass ein Mann mit einem diagnostizierten Handicap bald das Kapitänspatent erhalten würde. Asperger-Patienten galten für die Schreibtischärzte im Amt immer noch als eine Art geistig Behinderte, als emotional verkrüppelte Autisten, als in sich gefangene Freaks mit seltsamen Spezialbegabungen à la Dustin Hoffman beim Black Jack in Rainman. Aber Pontus Palmgren war kein Genie wie der Rainman und Kartenspiele interessierten ihn einen feuchten Kehricht. Richtig war, dass er ein Faible für Zahlenmaterial hatte, besonders für Zeitpläne und Tabellen. Er verbrachte einen Teil seiner Freizeit damit, die Fahrpläne sämtlicher 200 Fährlinien Europas auswendig zu lernen. Noch erfüllender war es natürlich, selbst ein Teil dieses Fährfahrnetzes zu sein, selbst dazu beizutragen, dass alles reibungslos funktionierte. Dass alles im Takt blieb.
Ein Metronom zu sein, ein Pendel.
Richtig war allerdings auch, dass Palmgren gewisse Probleme im Umgang mit anderen Menschen hatte. Soziale Interaktion war für ihn immer ein unsicheres Terrain gewesen. Er hatte Schwierigkeiten damit, auf das Verhalten seiner Mitmenschen angemessen zu reagieren, ihre Gesichtsausdrücke, ihre Gestik richtig zu deuten, Small Talk zu halten oder gar seine eigenen Gefühle zu zeigen. Dabei mangelte es ihm weder an Empathie noch an anderen Emotionen, er drückte sie nur anders aus. Und genau darum ging es der Behörde: Wie sollte ein Mann mit solchen sogenannten Störungen adäquat auf Notsituationen reagieren, wie sie an Bord eines Passagierschiffes jederzeit auftreten konnten? Obwohl sich seine Lehrer und Ausbilder voll und ganz hinter ihn gestellt und führende Wissenschaftler es als lächerlich bezeichnet hatten, dass eine Asperger-Diagnose an sich ein Problem für den Kapitänsberuf darstellen könnte, blieb die Behörde stur. Doch mithilfe der Gewerkschaft, die einen guten Anwalt engagierte, hatte er für seinen Lebenstraum bei Gericht gekämpft und schließlich recht bekommen. Mit 30 Jahren – und neun Monaten, sieben Tagen und 23 Stunden – war er nun einer der jüngsten Kapitäne Schwedens und der einzige mit einem diagnostizierten Asperger-Syndrom.
Auch heute blieb das Pendel im Takt und übergab die Brücke der Ebba Brahe um Punkt 14.10 Uhr an die Kollegen aus der Spätschicht.
Den Nachmittag verbrachte er im Heimatmuseum und machte anschließend einen langen Spaziergang am Seeufer.
Trotzdem fand er am Abend nicht in seine weißen kalten Träume zurück, sondern lag lange wach. Das kam nicht oft vor, normalerweise schlief er so pünktlich ein, wie er morgens auch wieder aufwachte. Doch heute konnte ihn das Ticken des alten Weckers auf seinem Nachttisch nicht beruhigen. Es gab etwas, das ihn irritierte und er konnte noch nicht einmal sagen, was genau es war. Ein vages Gefühl, ein Zucken am Rande seines Bewusstseins, wie eine verschwommene Erinnerung an einen Traum. Nach einer Weile schlug er die Bettdecke zur Seite und stand wieder auf. Ohne das Licht anzuschalten, trat er ans Fenster und schob den Vorhang beiseite. Wenn er sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte er aus seinem Schlafzimmer, das im ersten Stock lag, über die Giebel der anderen Häuser bis auf den endlosen Vätternsee schauen. Ein See wie ein Meer. Der Anblick des schimmernden Gewässers in der Dunkelheit beruhigte ihn. Obwohl ein kräftiger Ostwind für starken Wellengang sorgte, ging vom See etwas Friedliches aus. Und dennoch war da dieses Gefühl, als wäre dort draußen etwas, was dort nicht hingehörte.
Etwas Lebendiges.
Etwas, das ihn beobachtete.
Augen in der Nacht.
Dienstag, 14. Oktober
1
Obwohl Stina Forss so schnell gefahren war, wie es ihr Polo hergegeben hatte, war es bereits nach Mitternacht, als sie das Krankenhaus in Ljungby erreichte, das direkt neben dem Pflegeheim lag, in dem ihr Vater lebte. Sie stellte den Wagen ab, stieg aus und eilte über den Parkplatz. Hinter den doppelten automatischen Schiebetüren traf sie der Geruch von Alter stärker als sonst: menschliche Ausscheidungen, Putzmittel, Fencheltee. Diese Doppeltüren sind wie eine Schleuse, dachte sie, draußen ist das Leben und hier drinnen wartet der Tod. Ihre Schritte verlangsamten sich, ihr Herz klopfte. Sie wollte sofort zu ihrem Vater und gleichzeitig wollte sie ganz weit weg sein.
»Ein heftiger Schlaganfall«, sagte der Arzt, ein müde wirkender, junger Mann. »Seine Situation ist nun stabil, allerdings ist er momentan halbseitig gelähmt, auch das Sprachzentrum ist betroffen. Selbstverständlich haben wir sofort alle nötigen Gegenmaßnahmen eingeleitet, er bekommt wie in solchen Fällen üblich Blutgerinnsel auflösende Mittel, aber wie erfolgreich seine Rekonvaleszenz sein wird, ist bei der massiven Vorerkrankung natürlich völlig offen.«
»Ich möchte zu ihm.«
»Gerade schläft er. Die Pflegerin kann dich trotzdem für einen Augenblick zu ihm lassen.«
Mit einem flüchtigen Händedruck verabschiedete sich der Arzt. Eine Krankenpflegerin führte sie den Flur hinab, in einen Gebäudeflügel, den sie von ihren vorherigen Besuchen nicht kannte.
»Ich gebe dir zwei Minuten«, sagte die Schwester. »Und versuche bitte, ihn nicht zu wecken. Er braucht nun jede Erholung, die er bekommen kann. Nimm dir dort bitte einen Kittel und einen Mundschutz.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: