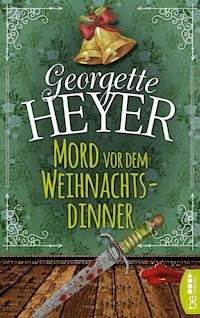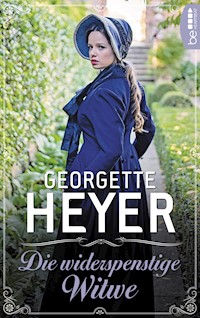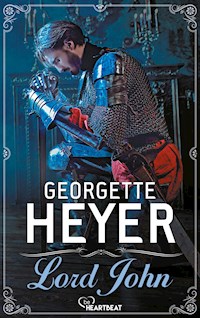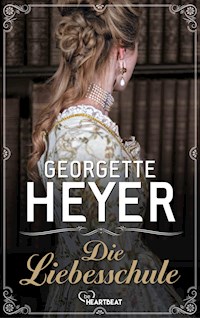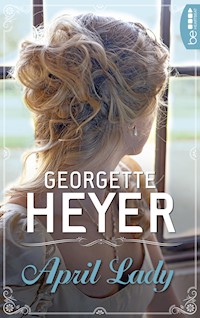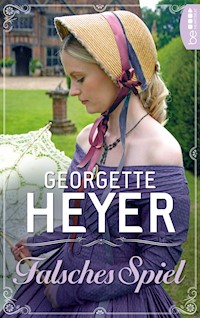6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1815. Die wunderschöne junge Witwe Lady Barbara hat einen schlechten Ruf in der feinen Brüsseler Gesellschaft - man munkelt sogar, dass sie sich die Zehnägel mit goldenem Lack verziert. Wirklich unerhört! Als die skandalumwitterte Lady dem attraktiven Oberst Charles Audley auf einem Ball begegnet, verlieben sich die beiden sofort ineinander. Und zum Entsetzen seiner Familie hält Charles um Lady Barbaras Hand an. Doch da kommt es zu der alles entscheidenden Schlacht von Waterloo ...
In ihrem historischen Roman "Barbara und die Schlacht von Waterloo" (im Original: "An Infamous Army") verwebt Georgette Heyer Salon-Welt, Romantik und Geschichte zu bester Unterhaltung. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Bibliographie
Über dieses Buch
Frühjahr 1815. Die wunderschöne junge Witwe Lady Barbara hat einen schlechten Ruf in der feinen Brüsseler Gesellschaft – man munkelt sogar, dass sie sich die Zehnägel mit goldenem Lack verziert. Wirklich unerhört! Als die skandalumwitterte Lady dem attraktiven Oberst Charles Audley auf einem Ball begegnet, verlieben sich die beiden sofort ineinander. Und zum Entsetzen seiner Familie hält Charles um Lady Barbaras Hand an. Doch da kommt es zu der alles entscheidenden Schlacht von Waterloo …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Barbara und die Schlacht von Waterloo
Aus dem Englischen von Emi Ehm
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2019
by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1937
Die Originalausgabe AN INFAMOUS ARMY erschien 1937 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1959.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-7327-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
»Ich habe eine klägliche Armee, sehr schwach und schlecht ausgerüstet, und einen sehr unerfahrenen Stab.«
Wellington an Gen.-Ltn. Lord Stewart, 8. Mai 1815
Vorwort
Mit diesem Roman habe ich ein Vorhaben verwirklicht, dem ich einfach nicht widerstehen konnte, sosehr ich fürchte, dass es als anmaßend empfunden wird. Von dem Epos abgesehen, das der Gegenstand an sich darstellt, muss der Geist Thackerays jeden verdunkeln, der sich an das Thema der Schlacht von Waterloo wagt. Er erlaubte mir die Feder erst anzusetzen, als ich ihn endlich mit der Überlegung verbannte, dass es schließlich auch niemandem einfiele, einen geringeren Poeten mit dem Maßstab Shakespearescher Größe zu messen. Ich sollte vielleicht hinzufügen, dass ich Vanity Fair schon vor vielen Jahren gelesen habe; und obzwar ich in Thackerays Gehege eingebrochen bin, habe ich doch zumindest nichts von ihm gestohlen.
Was die Bibliographie am Schluss dieses Buches betrifft, habe ich sie – um der Notwendigkeit auszuweichen, eine etwas langweilige Liste von Quellen anzuhängen – auf jene Werke beschränkt, die ich beim Schreiben eines Romans – nicht einer geschichtlichen Darstellung – höchst nützlich fand. Werke, die die rein taktischen Gesichtspunkte des Feldzuges behandelten, wurden weggelassen; ebenso viele weniger bedeutende Berichte; und gleichfalls ein Stoß von Biographien, Memoiren und Zeitschriften, die sich zwar nicht in erster Linie mit den Personen dieses Buches beschäftigten, jedoch da und dort verstreute Informationen über sie enthielten. Ferner wird man bemerken, dass mit Ausnahme Houssayes keine französische Quelle angeführt ist: der französische Standpunkt war für meine Zwecke unmaßgeblich. Andererseits führe ich jedoch bestimmte Arbeiten an, die – obwohl sie sich nicht mit der Schlacht von Waterloo beschäftigen – für mich unschätzbar waren wegen des Lichtes, das sie auf Wellingtons Charakter werfen, und auf die Gebräuche, die in seiner Armee herrschten.
Wann immer möglich, habe ich den Herzog für sich selbst sprechen lassen und mich dabei ausgiebig auf die zwölf Bände seiner Despatches gestützt. Falls man einwenden wollte, dass ich ihm 1815 in den Mund gelegt habe, was er 1808 schrieb oder viele Jahre nach Waterloo gesagt hatte, kann ich nur hoffen, dass mir die gelegentlichen chronologischen Ungenauigkeiten, die sich daraus ergaben, verziehen werden, da seine eigenen Worte, ob gesprochen oder geschrieben, allem, was ich ihm hätte in den Mund legen können, unendlich überlegen sind.
Georgette Heyer
Kapitel 1
Der junge Mann im scharlachroten Rock mit den blauen Aufschlägen und Goldtressen, der in der Fensternische des Salons von Lady Worth saß und müßig auf die Straße hinunterschaute, wandte einen Augenblick lang seine Aufmerksamkeit gänzlich von der Konversation ab, die im Gange war. Unter den Vorübergehenden hatte eine Brüsselerin in einer schwarzen Mantille seinen Blick gefesselt. Sie war wirklich so reizend, dass es der Mühe wert war, ihr die ganze Straße entlang mit den Augen zu folgen. Außerdem war das Gespräch im Salon sehr langweilig: genau dasselbe, was in Brüssel überall erörtert wurde.
»Ich gebe zu, dass man sich wohler fühlt, seit Lord Hill hier ist; aber ich wünschte trotzdem, der Herzog käme!«
Die Brüsselerin hatte im Vorübergehen einen spitzbübischen Blick aus dunklen Augen zum Fenster heraufgeworfen; dem jungen Mann in Scharlach war die Bemerkung gänzlich entgangen; die Lady Worth so ängstlich vorgebracht hatte, dass ihre Vormittagsbesucher eine Minute lang sehr ernst dreinsahen.
Der Earl of Worth sagte trocken: »Zweifellos, meine Liebe: das wünschten wir alle.«
Georgiana Lennox, die auf dem Sofa saß, die Hände über ihrem Muff gefaltet, unterstrich die Gefühle ihrer Gastgeberin mit einem Seufzer, lächelte aber bei den Worten des Earls und erinnerte ihn daran, dass es zumindest eine Person in Brüssel gab, die die Ankunft des Herzogs nicht ersehnte. »Mein Verehrtester, der Prinz ist ein ganz grässlicher Hitzkopf! Es gibt kein anderes Wort für ihn! Stellen Sie sich nur vor: er schalt mich aus, weil ich möchte, dass sich der Herzog beeilt – als sei es ausgeschlossen, dass ich nicht ihm zutraute, mit Bonaparte fertig zu werden – man denke!«
»Wie peinlich für Sie!«, sagte Lady Worth. »Was haben Sie gesagt?«
»O, ich kann Ihnen versichern, ich sagte nichts, was nicht wahr wäre. Der Prinz gefällt mir sehr gut, aber es geht denn doch etwas zu weit, wenn man annehmen soll, dass ein bloßer Knabe imstande wäre, sich gegen Bonaparte zu behaupten. Was hat er schließlich schon an Erfahrungen? Ebenso gut könnte ich meinen Bruder March für einen fähigen Oberbefehlshaber halten. Ja, er war sogar länger im Stab des Herzogs als der Prinz.«
»Stimmt es, dass zwischen dem Prinzen und seinem Vater Unstimmigkeiten herrschen?«, fragte Sir Peregrine Taverner, ein blonder junger Mann in einem blauen Rock mit sehr großen Silberknöpfen. »Ich hörte –«
Ein rundlicher Herr mit einem heiteren, neugierigen Gesichtsausdruck mischte sich mit dem Gehabe einer unverbesserlichen Klatschbase ins Gespräch. »Und ob es stimmt! Der Prinz steht natürlich ganz und gar auf Seiten der Engländer, und das passt dem Frosch aber schon gar nicht. ‹Frosch› nenne ich nämlich den König. Ich glaube, es ist Tatsache, dass dem Prinzen Englisch oder Französisch leichter fällt als Holländisch. Ich hörte, unlängst gab’s einen Riesenkrach, der damit endete, dass der Prinz dem Frosch unmissverständlich sagte: Hätte er nicht gewünscht, dass er sich seine Freunde unter den Engländern suche, würde er ihn nicht in England erziehen lassen oder ihn nicht nach Spanien geschickt haben, um dort das Soldatenhandwerk zu erlernen. Draußen war er und ließ Papa und Bruder Fritz wortlos stehen und erzählte natürlich Colborne brühwarm die ganze Geschichte. Ich bin überzeugt, Colborne ist es ganz gleichgültig, wie bald er zu seinem Regiment zurückgeht. Ich möchte ja um nichts in der Welt Oraniens militärischer Sekretär sein!«
Die Brüsselerin war dem Gesichtskreis Lord Hays entschwunden; es blieb für ihn nichts zu sehen als die spitzen Giebel und die chinagelbe Front eines Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Lord Hay hatte die letzte Bemerkung gehört, wandte den Kopf und fragte unschuldig: »O, hat Ihnen das Sir John gesagt, Mister Creevey?«
Unwillkürlich huschte ein Lächeln um die Lippen Judith Worths, die gekräuselten Straußenfedern auf Lady Georgianas Hut wippten; sie hob den Muff vors Gesicht. Einen Augenblick lang durfte sich die versammelte Gesellschaft in ihrer Phantasie das Schauspiel ausmalen, wie die mehr als sechs Fuß hohe Schweigsamkeit, personifiziert in der hübschen Gestalt des Sir John Colborne, Oberst des 52. Fighting Regiment, ihre Seele Mr. Creevey gegenüber erleichterte.
Mr. Creevey war nicht im Geringsten aus der Fassung gebracht. Er drohte dem jungen Gardeoffizier mit dem Finger und antwortete mit wissender Miene: »O, glauben Sie ja nicht, dass ich alle meine Informationsquellen preisgebe, Lord Hay!«
»Ich habe den Prinzen von Oranien gern«, erklärte Hay. »Er ist ein phantastisch guter Kerl.«
»O, was das betrifft –!«
Lady Worth war überzeugt, dass Mr. Creeveys Meinung über den Prinzen Lord Hay wohl kaum passen würde, und schaltete sich mit der Bemerkung ein, dass sein Bruder, Prinz Friedrich, ein ausgezeichneter junger Mann zu sein schien.
»Steif wie ein Besenstiel«, sagte Hay. »Preußischer Stil. Sie nennen ihn den ‹Stabskapitän›.«
»Er sieht aber sehr nett aus«, räumte Lady Georgiana ein und nestelte an den Falten ihres olivbraunen Umhanges. »Aber er ist erst achtzehn und zählt noch nicht.«
»Aber, Georgy!«, protestierte Hay.
Sie lachte. »Nun, du zählst ja auch noch nicht, Hay: das weißt du sehr gut. Du bist nur ein Knabe.«
»Warte nur, bis wir ins Feld ziehen!«
»Aber gewiss ja! Du wirst Wunder vollbringen und in den Depeschen erwähnt werden – daran zweifle ich nicht im Geringsten. Ich wette, der Herzog wird in den glühendsten Worten über dich schreiben. ‹General Maitlands Adjutant, Fähnrich Lord Hay –›«
Alles lachte.
»‹Ich habe allen Grund, mit dem Verhalten des Fähnrichs Lord Hay zufrieden zu sein›«, zitierte Hay steif. »Die alte Krummnase und in glühenden Ausdrücken schreiben! Das ist ja gut!«
»Jetzt aber genug! Ich möchte nicht ein Wort gegen den Herzog hören. Er ist der größte Mann der Welt!«
Es war nicht zu erwarten, dass Mr. Creevey, ein überzeugter Whig, diese großherzige Beurteilung unwidersprochen passieren lassen würde. In dem Lärm des heiteren Streitgesprächs begab sich Sir Peregrine Taverner zum Kamin, vor dem sein Schwager stand, und sagte leise:
»Du weißt wohl auch nicht, Worth, wann der Herzog in Brüssel zu erwarten ist?«
»Nein; wie sollte ich?«, antwortete Worth in seiner kühlen Art.
»Ich dachte, du hättest es vielleicht von deinem Bruder erfahren.«
»Deine Schwester erhielt vor ungefähr einer Woche einen Brief von ihm, aber zu der Zeit, als er ihn schrieb, wusste er nicht, wann der Herzog Wien würde verlassen können.«
»Er sollte hier sein. Man erzählte mir jedoch, seit Lord Hill ankam, habe der Prinz nicht mehr davon gesprochen, in Frankreich einzumarschieren. Ich nehme an, es stimmt, dass Hill geschickt wurde, um den Prinzen zum Schweigen zu veranlassen!«
»Ich nehme an, dass deine Information genauso stichhaltig ist wie die meine, mein lieber Peregrine.«
Sir Peregrine Taverner hatte das reife Alter von dreiundzwanzig erreicht, war seit drei Jahren verheiratet, seit zwei Jahren der Vormundschaft des Earls of Worth entronnen und war außerdem der Vater zweier hoffnungsvoller Kinder, aber er ließ sich immer noch von seinem Schwager etwas imponieren. Er quittierte den Verweis mit einem Seufzer und sagte nur: »Man ist halt etwas ängstlich, nicht? Schließlich, Worth, bin ich ja jetzt Familienvater.«
Der Earl lächelte. »Stimmt.«
»Hätte ich gewusst, dass Bonaparte imstande sein würde, von Elba zu entkommen, hätte ich wohl kaum ein Haus in Brüssel gemietet. Du musst zugeben, für einen Zivilisten ist es durchaus keine behagliche Situation.« Sein Ton war zum Schluss ganz leicht kläglich geworden und sein Blick wanderte zu der Scharlachpracht Lord Hays hinüber.
»In Wirklichkeit«, sagte der Earl, »möchtest du nur zu gern zum Militär gehen.«
Sir Peregrine grinste verlegen. »Nun, zugegeben, ja. Man fühlt sich so verdammt abseits stehend. Du ja freilich nicht, du gehörst selbst zum Militär!«
»Mein lieber Perry, ich bin vor Jahren ausgeschieden!« Der Earl wandte sich von seinem jungen Verwandten ab, während er noch sprach, denn Lady Georgiana war aufgestanden, um sich zu verabschieden.
Neben Judith Worths goldener Pracht schien Lady Georgiana winzig. Sie ließ sich ihre Pelisse von ihrer großen Freundin bis zum Hals zuknöpfen, denn selbst an diesem 4. April war das Wetter immer noch kühl; stellte sich auf die Fußspitzen, um Judiths Wange küssen zu können; beteuerte, wie sie sich freue, sie heute Abend bei Lady Charlotte Creville wiederzusehen; und ging, von Hay begleitet, zu ihrer Mutter, der Herzogin von Richmond, die im Haus des Marquis d’Assche an der Ecke des Parks wohnte.
Da Mr. Creevey keinerlei Anstalten machte, fortzugehen, setzte sich Lady Worth wieder nieder und fragte freundlich nach seiner Frau und seinen Stieftöchtern. Eine der jungen Damen Ord, vertraute er ihr an, hatte sich verlobt. Lady Worth stieß den passenden Ausruf aus, und Mr. Creevey gab, über sein ganzes freundliches Gesicht strahlend, den Namen des Glücklichen preis. Es war Hamilton; jawohl, Major Andrew Hamilton vom Stab des Generaladjutanten: ein ganz vorzüglicher Bursche! Ganz unter uns – Hamilton hielt ihn ausgezeichnet auf dem Laufenden. Er erhielt alle Neuigkeiten aus Frankreich, aber natürlich mit dem Versprechen strengster Geheimhaltung. Lady Worth würde verstehen, dass seine Lippen versiegelt waren. »Aber auch Sie«, fügte er hinzu und starrte sie durchdringend an, »ich wette, Sie haben ebenfalls Informationen für den Privatgebrauch, wie?«
»Ich?«, sagte Lady Worth. »Mein lieber Mr. Creevey, nicht die geringsten in der Welt! Wie kommen Sie nur darauf?«
Er blickte überlegen drein. »Aber, aber – ist denn nicht Oberst Audley bei dem Großen Mann?«
»Mein Schwager! Ja, natürlich ist er in Wien, aber ich versichere Ihnen, er erzählt mir nicht das kleinste Geheimnis. Wir wissen nicht einmal, wann wir ihn hier erwarten können.«
Er war enttäuscht, denn Neuigkeiten, Skandälchen, interessante Vertraulichkeiten, die man hinter vorgehaltener Hand flüsterte, waren sein Lebenselement. Da jedoch von seiner Gastgeberin nichts zu erfahren war, musste er sich damit begnügen, sich mit ihr auf den Austausch dessen zu beschränken, was er »gemütliche Prosa« nannte. Er hatte ihr schon, als er das erste Mal in ihren Salon gekommen war, von einer seltsamen Begebenheit erzählt, aber er konnte nicht widerstehen, sie noch einmal zu verkünden: sie war so außerordentlich bemerkenswert. Sir Peregrine war nicht anwesend gewesen, als er den Umstand zuerst erzählt hatte, so nickte er ihm zu und sagte: »Sie werden ja von den Neuankömmlingen gehört haben, wette ich. Ich habe Ihrer Schwester von ihnen erzählt.«
»Der König?«, sagte Peregrine. »Ich meine, der französische König? Kommt er nach Brüssel? Ich hörte Gerüchte, aber irgendjemand sagte, es sei nicht wahr.«
»Ach, der König!« Mr. Creevey fegte Seine Geheiligte Majestät mit seiner dicklichen Hand beiseite. »Ich meinte nicht ihn – obwohl ich mit gutem Grund glaube, dass er vorderhand in Gent bleiben wird. Ein erbärmlicher Bursche, nicht? Etwas Seltsameres – oder so schien mir’s wenigstens: drei der alten Marschälle Bonapartes – nicht weniger als drei! Ich hatte das Glück, sie alle ankommen zu sehen, vor nicht ganz zehn Tagen. Einer war Marmont, der im Hôtel d’Angleterre abstieg; dann Berthier, im Palais des Herzogs von Aremberg; und Victor – was glauben Sie, wo der abstieg? Ausgerechnet im Hôtel Wellington!«
»Welche Ironie!«, bemerkte Worth, der wieder in das Zimmer zurückkam, nachdem er seine Gäste hinausbegleitet hatte. »Ist das wahr oder wieder nur eine Ihrer Geschichten, Creevey?«
»Nein, nein, ich schwöre Ihnen, es ist absolut wahr! Ich wusste doch, der Spaß würde Sie ergötzen!«
Lady Worth, der die Geschichte beim zweiten Anhören nicht mehr als ein höfliches Lächeln zu entlocken vermochte, sagte nachdenklich: »Es ist ja wirklich sehr seltsam, ausgerechnet Marmont im englischen Lager zu finden.«
»Im alliierten Lager, meine Liebste«, verbesserte der Earl mit einem sardonischen Lächeln.
»Nun ja«, gab sie zu, »aber weißt du, ich kann es einfach nicht glauben, dass die holländisch-belgischen Truppen viel taugen; und was die Preußen betrifft, habe ich von ihnen nur General Röder gesehen, und – nun ja –!« Sie machte eine ausdrucksvolle Geste. »Er ist immer so steif und ist bei der geringsten Kleinigkeit dummerweise so beleidigt, dass ich einfach alle Geduld mit ihm verliere.«
»Stimmt, der wird dem Herzog nie passen«, bekräftigte Mr. Creevey. »Hamilton erzählte mir, dass man mit ihm überhaupt nicht auskommen kann. Er fasst es schon als persönliche Beleidigung auf, wenn einer unserer Offiziere in seiner Gegenwart sitzen bleibt! So ein Getue! Ein Mann, der so viel Wert auf den ganzen zeremoniellen Unsinn legt, wird in das Hauptquartier des Herzogs einfach nicht passen. Sie hätten keinen schlechteren als Kommissionär wählen können. Es gibt übrigens noch einen zweiten, von dem sie behaupten, er werde dem Herzog nie im Leben passen.« Er nickte und verkündete: »Unser verehrter Generalquartiermeister!«
»O, der arme Sir Hudson Lowe! Auch der ist sehr steif«, sagte Lady Worth. »Die Leute sagen, er sei jedoch ein sehr tüchtiger Offizier.«
»Möglich, dass er das ist, aber Sie wissen, wie das mit diesen Kerlen ist, die bei den Preußen gedient haben: es ist nichts mit ihnen anzufangen. Nun, wir werden zweifellos einige Veränderungen erleben, wenn der Beau aus Wien ankommt.«
»Wenn er nur schon käme! Es ist sehr unbehaglich, ihn so weit weg zu wissen. Man kann sich eines Gefühls der Unruhe nicht erwehren. Jetzt, da alle Verbindung mit Paris abgebrochen ist, scheint der Krieg vor der Tür zu stehen. Und dann noch dazu, dass man Lord Fitzroy Somerset und allen Leuten von der Gesandtschaft die Pässe für den Grenzübergang verweigert hat, und sie sich von Dieppe aus einschiffen mussten! Sie müssen zugeben, wenn schon einmal unser Chargé d’Affaires so behandelt wird, steht es sehr schlecht.«
»Ja«, warf Peregrine ein, »und unsere besten Truppen in Amerika! Das ist das Schreckliche daran! Ich kann mir nicht vorstellen, wie man auch nur einen Teil von ihnen rechtzeitig zurückschaffen kann, damit sie im Geringsten von Nutzen sein können. Als ich den Prinzen sah, erwartete er jeden Augenblick den Kriegsausbruch.«
»Davon kann keine Rede sein, versichere ich Ihnen. Der junge Frosch weiß nicht, wovon er redet. Immerhin haben wir, wie sie wissen, einige sehr gute Regimenter hier stehen.«
»Wir haben einige sehr junge und unerfahrene Truppen«, sagte Worth. »Zum Glück ging nicht die Kavallerie nach Amerika.«
»Natürlich, du warst ja selbst bei den Husaren, aber du wirst sehr gut wissen, dass Kavallerie ohne Infanterie sinnlos ist«, gab Peregrine belehrend zurück. »Nein, wenn man daran denkt, dass alle erprobten Soldaten, die den Englisch-Spanischen Krieg mitgemacht haben, zu dem verdammten amerikanischen Krieg verfrachtet wurden! Noch nie ist etwas so schlecht disponiert worden.«
»Es ist leicht, klug im Nachhinein zu sein, mein lieber Perry.«
Lady Worth, die schon viele solcher Diskussionen erlebt hatte, schaltete sich ein, um dem Gespräch eine Wendung zu weniger strittigen Themen zu geben. Mr. Creevey stand ihr bereitwilligst bei, denn er hatte einigen unterhaltsamen Klatsch auf Lager, und für den Rest seines Besuches wurden nur noch gesellschaftliche Themen erörtert.
Deren allerdings gab es viele, denn Brüssel floss über vor englischen Besuchern. Die Engländer waren so lange auf ihre Insel beschränkt gewesen, dass sie nach der Abdankung Kaiser Napoleons und nachdem er sich nach Elba zurückgezogen hatte, in Scharen auf den Kontinent gekommen waren. Die Anwesenheit einer Besetzungsarmee in den Niederlanden machte Brüssel zu einem Anziehungspunkt. Mütter mit Weitblick transportierten ihre heiratsfähigen Töchter im Kielwasser der Gardetruppen über den Kanal, vergnügungssüchtige Damen wie eine Caroline Lamb und Lady Vidal packten ihre gewagtesten Gazegewänder ein und schlugen ihre Hofhaltung in Häusern auf, die sie in dem mondänsten Teil Brüssels auf unbestimmte Zeit mieteten.
Die Anwesenheit der Gardetruppen war natürlich nicht die einzige Anziehungskraft Brüssels. Mr. Creevey zum Beispiel hatte seine Gattin um ihrer Gesundheit willen in einer behaglichen kleinen Wohnung in der Rue du Musée untergebracht. Andere wieder waren gekommen, um an den Festlichkeiten teilzunehmen, die zu Ehren der Wiedereinsetzung des lange verbannt gewesenen Wilhelm von Oranien als König der Niederlande veranstaltet wurden.
Wilhelm von Oranien, den Mr. Creevey und seine Freunde nur den »Frosch« nannten, war in London gut bekannt gewesen; und sein ältester Sohn, der Erbprinz von Oranien, war ein hoffnungsvoller Jüngling von einnehmenden Manieren und mit dem Ruf kühner Tapferkeit vor dem Feind, der kurze Zeit sogar mit der Prinzessin Charlotte von Wales verlobt gewesen war. Die Auflösung der Verlobung seitens der sehr klugen kleinen Dame hatte anscheinend nicht den geringsten Schatten auf die gute Laune des Prinzen zu werfen vermocht, obwohl dieses Ereignis Seine Hoheit in den Augen der Engländer etwas lächerlich machte und Mr. Creevey und dessen Freunden tiefe Genugtuung bereitet hatte. Man erwartete, dass sich heiteres Treiben an seine Schritte heften würde, und die Vergnügungssuchenden wurden auch durchaus nicht enttäuscht. Brüssel wurde innerhalb seiner alten Stadtmauern zum Mittelpunkt alles Mondänen und Leichtherzigen. König Wilhelm, eine ziemlich glanzlose Erscheinung, wurde in Brüssel mit gebührendem Pomp wieder zum König eingesetzt, und wenn etwa seine neuen Untertanen, die unter dem bonapartistischen Regime ganz zufrieden gewesen waren, ihre Verschmelzung mit den holländischen Nachbarn mit Unbehagen betrachteten, so durften sie es nicht zeigen. Dem Erbprinzen, der besser Englisch und Französisch sprach als seine Muttersprache und behauptete, die Strenge des Lebens in Den Haag nicht ertragen zu können, gelang es, einen gewissen Grad an Popularität zu erringen; sie hätte längere Dauer versprochen, wenn er es nicht zu deutlich hätte merken lassen, dass ihm zwar die belgischen Untertanen seines Vater lieber waren als seine holländischen, er ihnen allen aber doch die Engländer vorzog. Er wurde denn auch ausschließlich in Gesellschaft seiner englischen Freunde gesehen, ein Umstand der so viel deutlichen Unmut erregte, dass der einzige Mann, der Einfluss auf ihn hatte, dringend ersucht wurde, ihm zu schreiben und ihn zu ermahnen, sich etwas diplomatischer zu benehmen. Es war gerade ein kühler Dezembertag, als M. Fagel Seiner Hoheit einen Brief vom englischen Gesandten in Paris überbrachte, und in dem gestrengen Inhalt der Botschaft war nichts enthalten, was den Tag hätte wärmer erscheinen lassen können. Ein vorwurfsvoller Brief Seiner Gnaden, des Herzogs von Wellington, so höflich er auch abgefasst sein mochte, erzeugte in dem Empfänger immer unweigerlich das Gefühl, in eiskaltes Wasser geworfen worden zu sein. Der Prinz machte einige erbitterte Bemerkungen über Zwischenträger im Allgemeinen und seinen Vater im Besonderen, setzte sich hin, versprach seinem Mentor schriftlich ein vorbildliches Verhalten und erfüllte sein Versprechen anschließend, indem er sich Hals über Kopf in das gesellschaftliche Leben Brüssels stürzte.
Mit Ausnahme einer starken bonapartistischen Partei mochten aber auch die Brüsseler selbst die Engländer gern. Gold floss aus sorglosen englischen Händen in belgische Taschen; englische Besucher machten Brüssel zur heitersten Stadt Europas und wurden von den Brüsselern mit offenen Armen aufgenommen. Auch den Herzog von Wellington würden sie willkommen heißen, sollte er endlich eintreffen. Er war ein Jahr vorher mit ungeheurer Begeisterung empfangen worden, als er Belgien auf seinem Weg nach Paris besucht hatte. Er war Europas Großer Mann, die Brüsseler hatten ihm einen fast hysterischen Empfang bereitet und sogar zwei sehr jungen und sehr verlegenen Adjutanten zugejubelt, die eines Abends in seiner Loge in der Oper saßen. Das war natürlich ein Irrtum gewesen, aber es zeigte die Zuneigung der Brüsseler. Von den Bonapartisten konnte man natürlich nicht erwarten, dass sie an dieser Begeisterung teilnehmen würden, aber es war entschieden nicht der geeignete Augenblick für einen Bonapartisten, sich als solcher zu deklarieren, und diese Leute mussten sich damit begnügen, insgeheim ihren Glauben an den Stern des Kaisers zu heften.
Die Nachricht von der Landung Napoleons in Südfrankreich hatte für den Augenblick eine ernüchternde Wirkung auf die allzeit Vergnügten gehabt, aber trotz Gerüchten und Unruhe waren die Theater, Konzerte und Bälle weitergegangen, und nur einige wenige vorsichtige Seelen hatten Brüssel verlassen.
Dennoch herrschte allgemein ein Gefühl des Unbehagens. Wien, wo der Herzog von Wellington dem Kongress beiwohnte, war weit von Brüssel; wie immer es um den persönlichen Wagemut des Prinzen von Oranien bestellt sein mochte – zwei Jahre Erfahrung im Englisch-Spanischen Krieg als einer der Adjutanten des Herzogs schienen denn doch nicht genug zu sein, um einen jungen Mann von noch nicht vierundzwanzig für den Oberbefehl über eine Armee geeignet erscheinen zu lassen, die sich Napoleon Bonaparte stellen sollte. Ja, die ersten ungestümen Aktionen des Prinzen und seine etwas unbesonnene Redeweise alarmierten ernsthafte Leute nicht wenig. Der Prinz zweifelte nicht im Geringsten an seiner Fähigkeit, Bonaparte Widerpart bieten zu können; er sprach davon, an der Spitze alliierter Truppen in Frankreich einzumarschieren; schrieb nachdrückliche Forderungen nach England um mehr Soldaten und mehr Munition; lud General Kleist ein, seine Preußen die Meuse entlang in Marsch zu setzen, um zu ihm zu stoßen; und war im Übrigen so erhaben über die Tatsache, dass England mit Frankreich nicht auf Kriegsfuß stand, dass sich Englands Regierung, peinlich berührt, bemüßigt sah, in aller Eile Generalleutnant Lord Hill zu ihm zu entsenden, um ihm die delikate Situation, in der sie sich befand, zu erklären.
Die Wahl des Mentors war glücklich. In seiner etwas gehobenen Stimmung war der Prinz von Oranien leicht gereizt und geneigt, die geringste Einmischung in seine Befugnisse übelzunehmen. General Clinton, den er nicht mochte, und Sir Hudson Lowe, den er für einen verpreussten Zuchtmeister hielt, sahen sich nicht imstande, sein Urteil zu beeinflussen, und vermochten ihn nur zu beleidigen. Aber es gab keinen, der je etwas gegen Väterchen Hill gehabt hätte. Er kam in Brüssel an und sah eher wie ein Landedelmann denn ein vielfach ausgezeichneter General aus und behandelte den eifersüchtig auf seine Ehre bedachten jungen Kommandeur mit sanfter Hand. Die Überängstlichen atmeten auf; der Prinz von Oranien mochte etwas verschnupft sein bei der Aussicht, dass er sein Kommando bald würde abgeben müssen; aber er war nicht länger widerspenstig und hatte sich bald so weit überwunden, Lord Bathurst nach London die befriedigende Auskunft zu schreiben: er könne, obwohl es für ihn demütigend gewesen wäre, sein Kommando an jeden anderen abzugeben, dies mit Vergnügen dem Herzog gegenüber tun; ja, er würde ihm sogar mit einem so großen Eifer dienen, als sei er noch sein Adjutant.
»Ich werde jene Periode meines Lebens nie vergessen«, schrieb der Prinz und vergaß in einem Ausbruch der Begeisterung alle ihm angetane Beleidigung. »Ich verdanke ihr alles; und wenn ich nunmehr hoffen darf, meinem Land von Nutzen zu sein, so habe ich dies der Erfahrung zuzuschreiben, die ich unter ihm erwarb.«
Eine solche Gemütsverfassung verhieß Gutes für die Zukunft; aber die Aufgabe, die kriegerische Betätigung des Prinzen in Schach zu halten, blieb nach wie vor schwierig. Der britische Gesandte in Den Haag verlegte seine Niederlassung nach Brüssel in erster Linie, um Lord Hill bei seiner Aufgabe zur Seite zu stehen, und fand sie so anstrengend, dass er mehr als einmal dem Herzog schrieb, wie nötig dessen Anwesenheit in Brüssel sei. »Sie werden sehen, dass ich keine Anstrengung scheute, den Prinzen ruhig zu halten«, schrieb Sir Charles Stuart in seiner offenherzigen Art. »Unter den herrschenden Umständen überlasse ich es Ihnen, zu beurteilen, welch äußerste Wichtigkeit wir alle Ihrer baldigsten Ankunft beimessen.«
Mochte der Wiener Kongress mittlerweile Napoleon für hors la loi erklären – man sah dennoch tagtäglich französische Royalisten etwas verschämt über die Grenze eilen. Ludwig XVIII. – einer mehr unter den unbedeutenden europäischen Monarchen – verlegte seinen Hof von Paris nach Gent und erklärte gelassen, dass er in Frankreich unentwegt gezwungen gewesen sei, unzuverlässige Personen anzustellen, weil keiner, dem er trauen konnte, für würdig erachtet wurde, angestellt zu werden. Es schien in der Tat, dass mit Ausnahme seines Neffen, des Herzogs von Angoulême, kein Mensch sich im Geringsten angestrengt hatte, in der herrschenden Krise von Nutzen zu sein. Der Herzog hatte gemischte Streitkräfte in Nîmes ausgehoben und plänkelte, von einer herrschsüchtigen Gattin angefeuert, in Südfrankreich herum. Sein Bruder, der Herzog von Berri, der seinen Onkel nach Belgien begleitet hatte, fand eine weniger gefährliche Beschäftigung darin, mit der Handvoll royalistischer Truppen, die unter seinem Kommando in Alost standen, leicht komische Paraden abzuhalten.
Das alles war für die ängstlichen Gemüter nicht sehr tröstlich, aber dafür war die Nähe der preußischen Armee etwas beruhigender. Da jedoch die Vorstellung General Kleists von der Verpflegung seiner Armee ganz einfach darin bestand, sie sich jeweils aus dem Land selbst ernähren zu lassen, in dem sie in Quartier lag, weigerte sich der König der Niederlande, sie über die Meuse setzen zu lassen, zumal er in diesem Punkt völlig anderer Ansicht war und überdies mit den preußischen Verwandten seiner Gattin auf schlechtem Fuß stand. Dies führte verständlicherweise zu ziemlich vielen Unstimmigkeiten.
»Die Anwesenheit Eurer Lordschaft ist dringend nötig, um die Maßnahmen der aus so verschiedenartigen Elementen zusammengesetzten Streitkräfte, die dieses Land verteidigen sollen, zu koordinieren«, schrieb Sir Charles Stuart mit diplomatischer Zurückhaltung an den Herzog.
Jedermann war sich einig, dass die Anwesenheit des Herzogs nötig war; jedermann war überzeugt, alle Streitereien und Schwierigkeiten würden beseitigt sein, sobald er das Kommando übernommen haben würde; selbst Mr. Creevey war dieser Ansicht, der bisher nicht gewöhnt war, »diesen verdammten Wellesleys« viel zuzutrauen.
Es war wunderbar, wie sich die Meinungen Mr. Creeveys allmählich wandelten; es war außergewöhnlich, ihn die ehemaligen Siege des Herzogs in Spanien preisen zu hören – als hätte er nie erklärt, sie seien maßlos übertrieben. Sein Urteil über den Herzog war zwar immer noch etwas gönnerhaft, aber er gab zu, dass er sich viel geborgener fühlen würde – durch seine kränkelnde Frau nun einmal an Brüssel gebunden –, stünde schon der Herzog an der Spitze der Armee.
Er fand es jedoch sehr seltsam, dass Worth keinerlei Nachrichten von seinem Bruder in Wien haben sollte. Soviel er auch nachbohrte, es war nichts herauszuholen. Oberst Audley hatte das Thema der Ankunft seines Chefs nicht erwähnt.
So musste denn Mr. Creevey unbefriedigt abziehen. Sir Peregrine zögerte zu gehen. »Ich muss gestehen, er hat recht; es ist sonderbar von Charles, dass er dir nicht mitgeteilt hat, wann er hier zu sein gedenkt«, beklagte er sich.
»Mein lieber Perry, ich glaube sagen zu können, dass er es selbst nicht wissen dürfte«, sagte Lady Worth.
»Nun, wenn man bedenkt, dass er dem persönlichen Stab des Herzogs angehört, seit er nach eurer Heirat im August 1812 aus Spanien zurückkam, scheint es ungewöhnlich, dass er so wenig Vertrauen bei Wellington genießen sollte«, sagte Sir Peregrine.
Seine Schwester zog ihren Nähtisch näher heran und begann sich mit ihrer Stickerei zu beschäftigen. »Vielleicht hat der Herzog selbst noch keinen endgültigen Entschluss gefasst. Verlass dich darauf, er wird bald genug hier sein. Es ist sehr aufregend, aber schließlich muss er wissen, was er zu tun hat.«
Er machte eine Runde durch das Zimmer. »Ich wollte, ich wüsste, was ich tun soll!«, rief er aus. »Du hast gut lachen, Judith, aber es ist verdammt unangenehm! Wenn ich nicht verheiratet wäre, würde ich mich selbstverständlich freiwillig melden. Aber das geht jetzt nicht.«
»Nein, wirklich nicht«, sagte Judith ziemlich erschrocken.
»Worth, was wirst du tun? Bleibst du hier?«
»O, ich glaube schon!«, antwortete der Earl.
Sir Peregrines Miene hellte sich auf. »O! Wenn du glaubst, dass es sicher genug ist – ich nehme an, du behieltest Judith und das Kind nicht hier, wenn du anderer Meinung wärst?«
»Ich glaube nicht, dass ich es täte«, stimmte der Earl zu.
»Was will eigentlich Harriet?«, fragte Lady Worth.
»O, wenn es für die Kinder hier sicher genug ist, will sie nicht weggehen!« Sir Peregrine erblickte sich im Spiegel über dem Kamin und zupfte unzufrieden an den gestärkten Falten seiner Halsbinde. Vor seiner Ehe hatte er die schwindelnden Höhen des Dandyismus angestrebt, und obwohl er nun den größten Teil des Jahres auf seinen Gütern in Yorkshire lebte, neigte er immer noch dazu, seiner Kleidung viel Gedanken und Zeit zu widmen. »Dieser neue Kammerdiener taugt überhaupt nichts!«, sagte er etwas ärgerlich. »Schau dir bloß meine Halsbinde an!«
»Ist das wirklich nötig!«, sagte der Earl. »Eine Stunde lang habe ich mich nach Kräften bemüht, sie einfach nicht zu sehen.«
Ein Grinsen erhellte Sir Peregrines verärgerte Miene. »O, verdammt, Worth! Ich kann dir sagen, woran das liegt: du hast als mein Vormund ja wirklich viel für mich getan, aber wenn du mir beigebracht hättest, wie du deine Halstücher bindest, wäre ich dir viel dankbarer als für alle deine sonstige ewige verflixte Einmischerei.«
»Sehr hübsch ausgedrückt, Perry. Aber diese Kunst ist angeboren und kann nicht gelehrt werden.«
Sir Peregrine knurrte verächtlich, gab den Versuch auf, den Sitz seiner Halsbinde zu verbessern, und wandte sich vom Spiegel ab. Er blickte auf seine Schwester hinunter und sagte in einem Ausbruch von Vertraulichkeit: »Du musst verstehen, dass ich besorgt bin. Ich selbst will ja nicht heimlaufen, aber der springende Punkt ist, dass Harriet wieder in einer delikaten Verfassung ist.«
»Du lieber Himmel, schon wieder?«, rief Judith aus.
»Ja, und daher wirst du verstehen, in was für eine heikle Situation mich das bringt. Ich möchte sie um alles in der Welt nicht aufregen. Aber es scheint ja sicher zu sein, dass Bonaparte vorderhand noch nicht gegen uns losgehen kann. Ich werde mit meinen Entschlüssen warten, bis der Herzog kommt. Das wird das Beste sein.«
Der Earl stimmte mit einer Feierlichkeit zu, die nur vom Zucken eines Muskels im Mundwinkel Lügen gestraft wurde. Sir Peregrine beschwor ihn, ihm jede verlässliche Nachricht zukommen zu lassen, deren er habhaft werden könne und empfahl sich sichtlich erleichtert.
Endlich konnte sich seine Schwester auf seine Kosten herzhaft auslachen. »Julian, ich glaube, du musst an Sinnesverwirrung gelitten haben, als du ihm erlaubtest, Harriet zu heiraten! Zwei Kinder, und schon wieder eines unterwegs! Das ist einfach absurd! Er ist doch selbst noch ein Kind!«
»Sehr richtig, aber du solltest bedenken, wenn er nicht verheiratet wäre, müssten wir ihm erlauben, sich freiwillig zu melden.«
Der Gedanke ernüchterte sie. Sie zögerte und hob ihre schönen blauen Augen zu Worth auf. »Nun, Julian – unsere morgendlichen Besucher haben zwar eine Menge geredet, aber du selbst hast nichts gesagt.«
»Ich hatte den Eindruck, dass ich alles gesagt habe, was die Höflichkeit gebot.«
»Genau das – aber nichts Wesentliches. Ich wünschte, du verrietest mir, was du denkst. Bleiben wir hier?«
»Nicht, wenn du nach Hause fahren willst, meine Liebe.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das musst du beurteilen. Mir liegt nichts an mir, aber du weißt, wir müssen an den kleinen Julian denken.«
»Ich habe ihn nicht vergessen. Aber Antwerpen ist ja in erreichbarer Nähe. Freilich, wenn du es wünschst, begleite ich euch beide nach England.«
Sie warf ihm einen klugen Blick zu. »Sie sind ja sehr bereitwillig, mein Herr! Nein danke, ich kenne dich zu gut, um dieses Angebot anzunehmen. Kaum hättest du uns in England abgesetzt, wärst du wieder hier, du grässlicher Mensch!«
Er lachte. »Ehrlich gestanden, Judith, ich glaube, es wird sehr interessant werden, in diesem Frühjahr in Brüssel zu sein.«
»Ja«, stimmte sie zu. »Aber was wird geschehen?«
»Ich weiß nicht mehr als der Nächstbeste.«
»Ich nehme an, der Krieg ist uns sicher? Wird es der Herzog mit Bonaparte aufnehmen können, glaubst du?«
»Das ist es ja, was wir sehen werden, meine Liebe.«
»Jedermann, ich nicht ausgenommen, redet, als würde durch seine Ankunft alles sicher werden; aber obwohl er in Spanien so erfolgreich war, hat er doch nie gegen Bonaparte gekämpft, wie?«
»Ein Umstand, der die Situation noch interessanter gestaltet«, sagte Worth.
»Nun«, sagte sie und nahm ihre Stickerei wieder auf, »du bist ja sehr kühl. Wir bleiben also. Ja, es täte mir sogar sehr leid, wenn wir fort müssten, gerade wenn Charles wieder bei uns sein könnte.«
Der Earl hob sein Lorgnon. »A! Darf ich fragen, meine Liebste, ob du etwa Pläne für das zukünftige Wohlergehen Charles’ machst?«
Die Stickerei sank; Ihre Gnaden blickte ihn empört und vorwurfsvoll an. »Du bist doch der grässlichste Mann, der mir je begegnet ist!«, erklärte sie. »Natürlich mache ich für Charles keine Pläne! Das klingt ja nach einer fürchterlichen ehestiftenden Mama. Wie in der Welt kommst du denn darauf?«
»Deine überaus große Freundlichkeit Miss Devenish gegenüber verlangt eine Erklärung. Und diese war die wahrscheinlichste, die sich mir bot.«
»Nun, hältst du sie nicht auch für ein bezauberndes Mädchen, Julian?«
»Möglich. Aber du weißt, mein Geschmack sind Reiterinnen.«
Ihre Gnaden überging diese Feststellung mit betonter Würde. »Sie ist außerordentlich hübsch und von so einnehmenden Manieren und einem so sanften Gemüt im Allgemeinen, dass ich glaube, sie ist wirklich eine Partie.«
»Ich gebe zu, dass dies alles stimmt.«
»Du denkst natürlich an Mr. Fisher. Ich kenne die üblen Seiten in ihrem Fall, aber bedenke, dass Mr. Fisher ja nur ihr angeheirateter Onkel ist! Er mag vielleicht ein bisschen gewöhnlich sein – bitte, sehr gewöhnlich, wenn du willst –, aber ich bin überzeugt, er ist ein freundlicher, anständiger Mann, der sie behandelt, als sei sie seine eigene Tochter, und er wird ihr sein ganzes Vermögen vererben.«
»Das ist zweifellos in Betracht zu ziehen«, sagte Worth.
»Ihre eigene Herkunft, wenn auch nicht von Adel, ist durchaus respektabel. Ihre Familie ist alt – aber es hat keinen Sinn, darüber zu sprechen. Charles wird seine eigene Wahl treffen.«
»Genau das, was ich selbst sagen wollte, meine Liebe.«
»Rege dich nur nicht auf! Ich habe keine Absicht, ihm Lucy an den Hals zu werfen. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn er nicht Gefallen an ihr fände.«
»Ich sehe«, sagte der Earl leicht amüsiert, »dass das Leben in Brüssel sogar noch viel interessanter werden wird, als ich erwartete.«
Kapitel 2
Als Judith auf dem Weg zur Abendgesellschaft bei Lady Charlotte Creville ihren Gatten bat, den Kutscher am Haus Mr. Fishers halten zu lassen, um Miss Devenish abzuholen, blickte sie doch etwas verlegen drein. Sie vermied seinen ironischen Blick, doch als er sich neben sie gesetzt hatte und die Kutsche über das Pflaster rollte, verteidigte sie sich: »Aber es ist doch nichts Besonderes, dass ich Lucy mitnehme!«
»Durchaus nicht«, stimmte Worth zu. »Ich habe nichts gesagt.« »Mrs. Fisher geht nicht gern in Gesellschaft, musst du wissen, und für das arme Kind wäre es sehr langweilig, wenn sie niemand mitnimmt.« »Sehr richtig.«
Judith warf seinem Profil einen versengenden Blick zu. »Ich glaube nicht, dass ich je einem so aufreizenden Menschen wie dir begegnet bin«, sagte sie.
Er lächelte, sagte aber nichts. Als die Kutsche kurz danach vor einem ansehnlichen Haus in einer der stillen Straßen in der Nähe der Place Royale vorfuhr, stieg er aus, um dem Schützling seiner Frau in den Wagen zu helfen.
Das Mädchen ließ nicht lange auf sich warten und kam in Begleitung des Onkels heraus, eines kleinen stämmigen Mannes von fröhlicher Gewöhnlichkeit, der sich vor dem Earl sehr tief verneigte und sich in einem Schwall von Dankens- und Begrüßungsworten erging. Worth antwortete ihm mit der kühlen Höflichkeit eines Fremden, aber Lady Worth, die sich aus der Kutsche neigte, war sehr freundlich zu ihm, erkundigte sich nach Mrs. Fisher, die von einer fiebrigen Erkältung ans Haus gefesselt war, und versicherte ihm, sie würde sich sehr um Miss Devenish kümmern.
»Euer Gnaden sind doch immer zu aufmerksam – welch schmeichelhafte Auszeichnung! Ich bin Ihnen zutiefst verpflichtet!«, sagte er und verbeugte sich vor ihr. »Es ist ganz in der richtigen Ordnung, denn ich bin überzeugt, Lucy passt in die vornehmsten Kreise – gewiss ja – und ist obendrein geeignet, eine gute Partie zu machen, was, Lucy? A, sie mag gar nicht, wenn ich sie damit aufziehe: sie ist bestimmt rot geworden, was? Es ist nur zu finster, um es sehen zu können.«
Judith war etwas verärgert, dass er sich Worth gegenüber so bloßstellte, aber sie ging taktvoll darüber hinweg. Miss Devenish bestieg die Kutsche, der Earl folgte ihr, und einen Augenblick später rollten sie davon, während Mr. Fisher sich immer noch hinter ihnen her verbeugte.
»Liebe Lady Worth, dies ist zu freundlich von Ihnen!«, sagte Miss Devenish mit einer hübschen, leisen Stimme. »Meine Tante trug mir Empfehlungen auf. Ich hoffe, ich habe Sie nicht warten lassen?«
»Nein, durchaus nicht. Ich hoffe nur, dass es kein langweiliger Abend wird. Ich glaube, es wird getanzt, und ich nehme an, alle Welt, einschließlich der Gattinnen, wird anwesend sein.«
Dies schien auch tatsächlich der Fall zu sein. Als sie ankamen, waren Lady Charlottes Gesellschaftsräume schon überfüllt. Die Engländer herrschten vor, aber auch andere vornehme Ausländer waren zahlreich vertreten. Da und dort sah man das Blau einer holländischen Uniform und das schicke Grün eines belgischen Dragoners; und wo immer der Blick hinfiel, konnte man sicher sein, Scharlach aufblitzen zu sehen: leuchtende Flecken Scharlach, neben dem die zarten Farben der Musselingewänder der Damen und die nüchternen Nuancen der Zivilistenröcke verblassten. Die Zivilisten waren offenkundig in der Minderzahl, und eine junge Dame, die nicht wenigstens eine Scharlachuniform an ihrer Seite aufweisen konnte, war tief unglücklich. Salonlöwen und Gelehrte gingen einfach unter; am dichtesten war die Schar um Lord Hill, der auf eine halbe Stunde vorbeigekommen war. Sein rundes Gesicht trug das übliche freundliche Lächeln; mit unerschöpflicher Geduld beantwortete er gutgelaunt die ängstlichen Fragen der Damen, die ihn umdrängten. Der liebe Lord Hill! So freundlich, so zuverlässig! Zwar war er natürlich nicht der Herzog, aber immerhin brauchte man seine Koffer nicht zu packen und ständig die Pferde bereitzuhalten, um nach Antwerpen zu fliehen, solange er da war und sein Wort dafür verpfändete, dass das korsische Ungeheuer noch in Paris saß.
Er hatte gerade die Schwestern Annesley, zwei ätherische Blondinen, an denen selbst noch die Ringellöckchen sehr anziehend waren, beruhigt. Als Worth mit seinen Damen eintrat, hatten sie eben Lord Hill verlassen und standen neben der Tür, ein reizendes, zerbrechlich zartes Paar, einander so ähnlich, einander so zärtlich zugetan!
Sie waren beide verheiratet; die jüngere, Catherine, mit einem ungewöhnlich jungen Gatten, Lord John Somerset, der vorübergehend dem persönlichen Stab des Prinzen von Oranien zugeteilt war. Es war seltsam, dass Catherine, die ihrer Schwester entschieden an Schönheit und Verstand unterlegen war, auf dem Heiratsmarkt so viel besser abgeschnitten hatte. Die arme Frances mit ihrer unbegrenzten Fähigkeit zur Heldenverehrung hatte schwer danebengegriffen, denn eine langweiligere Figur als ihr vernagelter, plappernder, schüchterner Mr. Webster wäre schwer zu finden gewesen. Man konnte ihr wohl kaum einen Vorwurf daraus machen, dass sie sich so schwer in Lord Byron verliebt hatte. Es war eine ziemliche Affäre gewesen, solange es gedauert hatte – lang genug freilich, wenn man Catherines indiskretem Mundwerk trauen durfte, dass sie imstande gewesen war, sich eine der kostbaren Locken des Dichters zu sichern. Das war immerhin mehr als sich Caro Lamb, die Arme, rühmen konnte.
Auch sie war in Brüssel und schockierte die altmodischen Leute mit ihren hauchzarten Gazetoiletten, die sie immer aufdämpfte, um sie anliegender zu machen, und die ihr meist von der Schulter glitten, um so den daran Interessierten einen näheren Eindruck von ihrer Figur zu gewähren. Die alte Lady Mount Norris war bereit, jede Wette einzugehen, dass Caroline unter ihren Gazegewändern nicht um einen Faden mehr als den »unsichtbaren Unterrock« trug. Nun, Lady Mount Norris’ Tochter mochte zwar eine Locke Lord Byrons besitzen, aber immerhin war man imstande, Gott dafür zu danken, dass sie sich nicht halbnackt zur Schau stellte.
Lord Byron war nicht in Brüssel. Vielleicht war er zu sehr mit seiner seltsamen, ernsthaften jungen Gattin beschäftigt; vielleicht auch wusste er, dass selbst ein so schöner, düsterer Poet wie er in dem Brüssel am Vorabend eines Krieges keinen besonderen Eindruck machen konnte.
Seine Verheiratung war ein großer Schock für Caro Lamb gewesen, behaupteten die Klatschbasen. Armes Ding, sie tat einem richtig leid, so lächerlich sie sich auch gemacht haben mochte. Es war ausschließlich ihre eigene Schuld, wenn sie nun so abgehärmt aussah. Außerdem war sie dünn bis zur Unkleidsamkeit; darüber waren sich alle Damen einig. Elfe? Gazelle? Nun, man hatte diese Schmeichelnamen für sie immer schon übertrieben gefunden; man hatte sie nie wirklich bewundert. Nur Männer waren manchmal so einfältig!
Es gab eine ganze Anzahl Männer, die sich um Lady Caroline drängten, alle leider so einfältig. Ein Murmeln von Miss Devenish drang an Lady Worths Ohr: »O! Sie ist so lieblich! Ich schaue sie so gern an!«
Judith wollte nicht lieblos sein, aber mehr als ein Lächeln und eine leichte Verbeugung mochte sie wirklich nicht mit Caro wechseln. Man war sicherlich nicht prüde, aber dieses Fliederfarbene war tatsächlich ganz durchsichtig. Und was Lieblichkeit betraf, fand Judith, konnte es ihr Schützling mit jeder der anwesenden Damen aufnehmen. Wenn auch ihre Wimpern nicht so lang und dicht wie die der Lady Frances Webster waren, so waren ihre Augen selbst entschieden strahlender, und taubensanft dazu. Ihre Figur, mochte sie sie freilich diskreter verhüllen, war ebenso gut wie die Caro Lamps; und ihre glänzenden braunen Locken waren entschieden dichter als die fiedrigen kurzen Löckchen Carolines. Vor allem aber war ihr Ausdruck bezaubernd, ihr Lächeln so herzlich, der ernste, nachdenkliche Blick stand ihr so besonders gut an! Außerdem kleidete sie sich mit großem Geschmack; teuer, aber nie ausgefallen. Jeder Mann konnte sich gratulieren, dem es gelingen würde, eine solche Frau zu erringen.
Diese Überlegungen wurden unterbrochen, weil Judith die Marquise d’Assche begrüßen musste. Als sich Judith wieder von ihr abwandte, stand Miss Devenish wartend neben ihr.
»Liebe Lady Worth«, sagte sie, »ich glaube, Sie kennen doch jedermann. Sagen Sie mir, bitte, nur, wer dieses wunderschöne Geschöpf ist, das mit Lady Vidal gekommen ist. Ist es sehr unverschämt von mir? – Mir stockte der Atem und ich konnte nur denken: O, wenn ich bloß solche Haare hätte! Sie stellt alle in den Schatten!«
»Du lieber Himmel, wen in der Welt können Sie da gesehen haben?«, sagte Judith leicht amüsiert. Als ihre Augen jedoch in die Richtung wanderten, in die der bewundernde Blick Miss Devenishs deutete, verschwand ihr Lächeln rasch.
»Guter Gott!«, sagte sie. »Ich hatte keine Ahnung, dass sie wieder in Brüssel ist! Lucy, wenn Sie vielleicht die Dame mit den Haaren meinen, die wie mein bester kupferner Kohleneimer leuchten, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es niemand anderer als Barbara Childe ist.«
»Lady Barbara!«, hauchte Miss Devenish. »Ich fragte mich schon – Sie müssen wissen, dass ich sie noch nie vorher gesehen habe. Ja, man sieht die Ähnlichkeit: sie sieht ein bisschen ihrem Bruder ähnlich, Lord Vidal, nicht wahr?«
»Mehr Lord George, würde ich sagen. Sie kennen ihn nicht: ein ungestümer junger Mann, fürchte ich; seiner Schwester sehr ähnlich.«
Auf diese Bemerkung erwiderte Miss Devenish nichts. Ihre Aufmerksamkeit galt weiterhin den beiden Damen, die den Salon betreten hatten.
Die ältere, Lady Vidal, war eine hübsche Brünette, deren Ausdruck, Kleidung und Haltung die Dame von Welt verrieten. Sie war in Begleitung ihres Gatten, das Marquis von Vidal, eines fleischigen Mannes mit einem rötlichen Schopf, einer ständigen Falte zwischen dichten, sandfarbenen Brauen und einem ziemlich mürrischen Mund.
Neben Lady Vidal stand der Gegenstand von Miss Devenishs eifriger Betrachtung, die Hand leicht auf den Arm eines Offiziers in holländisch-belgischer Uniform gelegt.
Lady Barbara Childe war nicht mehr in der ersten Jugendblüte. Sie hatte im Alter von siebzehn Jahren ihrer Familie zuliebe geheiratet und das Glück gehabt, fünf Jahre später einen Gatten zu verlieren, der dreimal so alt wie sie gewesen war. Ihre Trauer war äußerst oberflächlich gewesen: ja, man behauptete, sie habe den Tod ihres Vaters weit mehr bedauert, eines luxuriös lebenden Edelmannes von egoistischem Gehaben und abstoßendem Ruf. Aber in Wirklichkeit betrauerte sie niemanden sehr. Sie war herzlos.
Das war das Urteil aller, die sie kannten, und vieler, die sie nicht kannten. Niemand konnte leugnen, dass sie schön war und Charme hatte, aber beides wurde als fatal bezeichnet. Ihre Eroberungen waren zahllos; die Männer verliebten sich so unsterblich in sie, dass sie hohläugig vor Verlangen wurden und häufig die einfältigsten Dinge taten, wenn sie darauf kamen, dass ihr nicht das Geringste an ihnen lag. Der junge Mr. Vane hatte sich buchstäblich zu Tode getrunken; und der arme Sir Henry Drew hatte sich in ein Regiment eingekauft und war in den spanischen Krieg gezogen mit der erklärten Absicht, sich totschießen zu lassen, was ihm denn auch bald widerfuhr; zur gleichen Zeit hatte Barbara – empörender als alles andere – ihre verheerenden Augen auf Philip Darcy geworfen, mit dem Ergebnis, dass die arme, liebe Marianne, die ihm zehn Jahre lang ein treues Weib gewesen war, nun, von ihm vernachlässigt, weinend zu Hause saß.
Es war den Damen unerklärlich, was die Männer so Anziehendes an den grünen Augen fanden, die so trügerisch aufrichtig dreinblickten. Denn grün waren sie, wer immer sie blau nennen mochte. Bab brauchte nur ein grünes Kleid anzuziehen, um jeden Zweifel daran auszuschalten. Sie saßen unter zart gewölbten Brauen und waren von Wimpern umrahmt, die ganz offensichtlich gefärbt waren. Das aufreizende Rot der Haare mochte Natur sein, aber die schwarzen Wimpern waren es nicht. Noch war es der zauberhafte Teint, darüber waren sich die bissigsten Zungen einig. Neben allen anderen Schlechtigkeiten: Lady Barbara Childe schminkte sich.
Es wurde zudem allen, die sie anstarrten, klar, dass Lady Barbara an diesem Aprilabend nicht dabei stehengeblieben war. Ein Fuß lugte unter den Volants des gelben, flitterübersäten Gewandes hervor, und es war zu sehen, dass Lady Barbara, in griechischen Sandalen, ihre Fußnägel vergoldet hatte.
Miss Devenish entfuhr ein Seufzer. Lady Sarah Lennox am Arm General Maitlands sagte: »Lieber Himmel, schaut euch bloß Babs Füße an! Den Trick hat sie natürlich aus Paris.«
»Aufregend, beim Zeus!«, sagte der General anerkennend.
»Sehr, sehr gewagt!«, sagte Lady Sarah. »Empörend!«
Ein großer Teil von Barabaras Zauber lag darin, dass sie sich des Eindrucks, den sie in einer auffallenden Toilette machte, völlig unbewusst zu sein schien. Sie zupfte nie an ihren Locken, sie warf nie einen prüfenden Blick in den Spiegel. Kein Geringerer als Mr. Brummell hatte sie diese großartige Unbekümmertheit gelehrt. »Wenn Sie einmal überzeugt sind, dass die geringste Einzelheit Ihrer Kleidung vollkommen ist«, hatte ihr jener Modeexperte verkündet, »dürfen Sie keinen Gedanken mehr an sie verschwenden. Ich glaube, mich hat noch nie jemand dabei ertappt, dass ich an meiner Halsbinde herumfingere, an meinen Rockaufschlägen zupfe oder meine Ärmel glattstreiche.«
Daher war sich Lady Barbara anscheinend völlig unbewusst, in dem flitterübersäten, golden schimmernden Gewand, das sich wie angegossen an ihre hohe Gestalt schmiegte, mit ihren goldenen Fußnägeln und der Fülle roter Locken, die von einem goldenen Stirnband gebändigt wurden, die gewagtest gekleidete Dame im Saal zu sein. Fünfzig Augenpaare hingen an ihr, einige mit offener Missbilligung, einige in ebenso offener Bewunderung; und nicht das leiseste Wimperzucken ließ merken, dass sie von ihrer Anziehungskraft wusste. Ihr schrecklich entwaffnendes Lächeln huschte um ihre Lippen, als sie auf Lady Worth zuging, ihr die Hand entgegenstreckte und mit ihrer verblüffenden Knabenstimme sagte: »Wie geht es Ihnen? Geht es Ihrem Jungen gut?«
Obwohl Judith durchaus nicht erfreut gewesen war, als sie vor drei Monaten sehen musste, dass ihr winziger Sohn vom Charme Lady Babs völlig eingefangen wurde, konnte sie nicht umhin, sich natürlich über diese Anrede zu freuen. »Sehr gut, danke«, antwortete sie. »Sind Sie schon lange wieder in Brüssel?«
»Nein, erst seit zwei Tagen.«
»Ich wusste nicht, dass Sie vorhatten, hierher zurückzukehren.«
»O –! London war verdammt langweilig«, sagte Bab leichthin.
Miss Devenish, die noch nie eine so burschikose Ausdrucksweise von Damenlippen vernommen hatte, machte große Augen. Lady Bab blickte von ihrer anmutigen Höhe auf sie herunter und schaute dann mit fragend erhobenen Brauen zu Judith. Etwas zögernd – nun, immerhin, Bab würde wohl kaum mehr als zwei Minuten ihrer Zeit an die kleine Lucy Devenish verschwenden – machte Judith die Damen miteinander bekannt. Barbara gönnte Lucy ein Lächeln und die Hand; dann machte sie eine vage Geste mit ihrem Fächer, die den Offizier mit einschloss, an dessen Seite sie den Saal betreten hatte. »Lady Worth, kennen Sie den Hauptmann Graf Lavisse?«
»Ich glaube, wir kennen einander«, nickte Judith und hoffte inständigst, dass der berüchtigste Roué Brüssels nicht etwa seine zweifelhafte Neigung der jungen Dame in ihrer Obhut zuwenden würde.
Die dunklen Augen des Grafen verrieten jedoch nicht mehr als ein flüchtiges Interesse an Miss Devenish, und bevor es noch zu einer Vorstellung kam, trat ein junger Mann an die Gruppe heran, mit einem winzigen Schnurrbärtchen und einem roten Haarschopf, der in jämmerlichem Gegensatz zu seinem scharlachfarbenen Rock stand. »’n Abend, Bab!«, sagte Lord Harry Alastair. »Ihr ergebener Diener, Lady Worth! Miss Devenish, wissen Sie, dass sie drüben schon tanzen? Darf ich um die Ehre bitten?«
Lady Worth lächelte in gnädiger Zustimmung und fühlte, wie schwer der Weg einer Ballmutter doch sein konnte. Der Ruf der Alastairs, von Dominic, Herzog von Avon, herunter bis zu seiner Enkelin Barbara war nicht so, dass eine gewissenhafte Duenna mit Vergnügen zuschauen konnte, wie einer von ihnen ihren Schützling entführte. Sie tröstete sich mit der Überlegung, dass Lord Harry, ein achtzehnjähriger Fähnrich, wohl kaum als gefährlich anzusehen war; wäre es Lord George gewesen, ja dann –! Aber Lord George war glücklicherweise nicht in Belgien.
Während Lord Harry Miss Devenish in den Ballsaal führte, sammelte sich der unvermeidliche Hofstaat um seine Schwester. Lady Worth entrann dem Gedränge aber nicht, bevor man sie – es schien einfach unvermeidlich zu sein, dachte sie – nach Neuigkeiten aus Wien fragte.
Die widerspruchvollsten Gerüchte liefen um; die Engländer in Brüssel schienen mit einem Fuß auf der Flucht zu sein; und das Einzige, was die Ängstlichen unfehlbar beruhigen konnte, waren gesicherte Nachrichten von der Rückkehr des Herzogs.
Es war leicht vorauszusehen, was Brüssel anstellen würde, wenn er einmal ankäme. »Das Piedestal für den Helden steht bereit«, sagte Judith mit einem ziemlich herausfordernden Lächeln. »Und was uns betrifft, sind wir bereit, niederzuknien und anzubeten. Ich hoffe, er ist unserer Bewunderung würdig.«
General Maitland, an den sie sich mit dieser Bemerkung gewandt hatte, sagte: »Kennen Sie ihn, Lady Worth?«
»Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Bitte, erwähnen Sie es nicht, aber ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Ist das nicht fürchterlich?«
»O!«, sagte der General.
Sie hob die Brauen. »Was habe ich darunter zu verstehen, bitte? Werde ich enttäuscht werden? Ich warne Sie: ich erwarte mir einen Halbgott!«
»Halbgott«, wiederholte der General und strich sich über den schönen Bart. »Nun – ich weiß nicht. Würde ihn nicht so bezeichnen.«
»Ach, ich werde also enttäuscht sein! Das habe ich gefürchtet.«
»Nein – nein«, sagte der General. »Nicht enttäuscht. Er ist ein sehr fähiger Oberbefehlshaber.«
»Das klingt etwas flau, muss ich sagen. Beten ihn nur die Damen an? Seine Soldaten nicht?«
»O nein, durchaus nicht!«, sagte der General erleichtert, weil er eine einfache Frage zu beantworten hatte. »Ich glaube schon, dass sie ihn gern haben – auf alle Fälle sind sie froh, wenn sie seine Hakennase bei sich auftauchen sehen; aber sie beten ihn nicht an. Glaube jedoch nicht, es läge ihm was daran, wenn sie es täten.«
Sie war interessiert. »Sie malen mir ein neues Bild, General. Ich glaube, mein Schwager ist ihm sehr ergeben.«
»Audley? Nun, er gehört zu seiner ‹Familie›, müssen Sie wissen.« Er sah ihr Erstaunen und fügte hinzu: »Ich meine zu seinem Stab. Das ist wieder etwas ganz anderes. Sein Stab kennt ihn viel besser, als wir anderen alle zusammen.«
»Das klingt schon besser. Er ist unnahbar. Das muss ja ein Halbgott auch sein.«
Er lachte plötzlich. »Nein, nein, Ihnen gegenüber, Lady Worth, wird er bestimmt nicht unnahbar sein, dafür verpfände ich mein Wort!«
Ihr Gespräch wurde von Sarah und Georgiana Lennox unterbrochen, die Arm in Arm auf sie zutraten. Der General begrüßte die ältere Schwester mit einem so warmen Lächeln, dass Lady Worth mit Genugtuung feststellte, die Gerüchte über seine geplante Wiederverheiratung waren anscheinend nicht erlogen. Lady Sarah entschwebte an seinem Arm; Georgiana blieb bei Judith stehen und blickte eine Weile in das Gedränge. Dann sagte sie nachdenklich: »Haben Sie bemerkt, dass Lady Childe wieder da ist?«
»Ja, ich habe mit ihr gesprochen.«
»Ich muss gestehen, ich wollte, sie wäre weggeblieben«, vertraute ihr Georgiana an. »Es ist schon sehr seltsam, denn ich selbst mag sie ganz gern, aber wo immer sie auftaucht, entsteht stets eine schreckliche Verwirrung oder ein Unglück. Sogar Mama, die wirklich nicht einfältig ist, fürchtet ein bisschen, sie könnte ihre Augen auf March werfen. Natürlich sagen wir daheim nicht das Leiseste darüber, aber es ist absolut wahr.«
»Was, dass Ihr Bruder –«
»O nein, nein, aber dass Mama fürchtet, er könnte! Man kann es ihr nicht verdenken. An Bab scheint etwas zu sein, das den vernünftigsten Mann verrückt macht. Schrecklich, nicht?«
»Das meine ich auch.«
»Ja, ich auch«, sagte Georgiana bekümmert. »Ich wünschte, ich hätte das selbst.«
Judith musste lachen, beruhigte aber ihre lebhafte junge Freundin, dass sie gerade richtig sei, so wie sie sei. »Georgy machen die nettesten Männer den Hof«, sagte sie. »Nur Männer wie Graf Lavisse laufen Lady Barbara nach.«
»Ja«, sagte Georgiana und blickte nachdenklich zu dem Grafen hinüber. »Das stimmt wirklich. Natürlich möchte man nicht von einem solchen Menschen bewundert werden.«
Diese Empfindung wurde viel später im Verlauf des Abends auch bei Lady Barbaras Bruder laut. Als sein Wagen ihn und seine Damen in die Rue Ducale heimfuhr, sagte er verdrießlich, er könne nicht begreifen, wie Bab diesen Ausländer ständig an ihrer Seite ertragen könne.
Sie lachte nur, aber seine Frau, die in ihrer Ecke vor sich hin gähnte, sagte scharf: »Solltest du Lavisse meinen, so weiß ich wirklich nicht, was du gegen ihn hast. Ich wollte, Bab würde nicht mit ihm herumspielen und ihn verlieren. Ich glaube, er ist sehr reich.«
Dieses Argument konnte seine Wirkung auf den Marquis nicht verfehlen. Er schwieg eine Zeitlang, sagte aber dann: »Darüber weiß ich nichts, aber ich kann dir nur sagen, seinen Ruf dürfte man nicht näher untersuchen.«
»Wenn es darauf ankommt, dann ist Babs Ruf auch nicht über jeden Vorwurf erhaben!«
Aus der anderen Ecke des Wagens perlte Gelächter. Der Marquis sagte streng: »Du hast gut lachen. Zweifellos macht es dir Spaß, deinen Namen zu einem Spitznamen zu machen. Was mich betrifft, so habe ich von deinen Skandalen genug.«
»O, ich flehe dich an, erspar uns eine Predigt!«, sagte seine Frau und gähnte wieder.
»Keine Angst, Vidal! Sie schließen Wetten darüber ab, dass Lavisse keinen Monat lang durchhalten wird.«
Die Kutsche holperte über eine unebene Stelle im Pflaster. Verärgert von dem Ruck sagte Vidal: »Auf mein Wort! Gefällt es dir etwa, dass dein Name herumgezogen wird? Deine Affären zum Gegenstand von Wetten gemacht werden?«
»Das ist mir egal«, sagte Barbara gleichgültig. »Nein; ich glaube sogar, mir gefällt das ganz gut.«
»Du bist schamlos! Wer hat es dir eigentlich gesagt?«
»Harry.«
»Das hätte ich wissen können! Nette Sachen, die er seiner Schwester zuträgt.«
»O Gott, warum soll er nicht?«, sagte Lady Vidal. »Du wärst dümmer, als ich glaube, Bab, wenn du dir Lavisse durch die Finger rutschen lässt.«
»Ich lasse sie nicht durch die Finger rutschen«, gab Bab zurück. »Ich lasse sie fallen. Ich glaube schon, dass ich auch ihn fallen lasse.«
»Gib nur acht, dass nicht er dich fallen lässt!«, sagte Ihre Gnaden.
Die Kutsche war vor einem der großen Häuser in der Rue Ducale gegenüber dem Park vorgefahren. Als der Diener den Schlag öffnete, murmelte Barbara: »Aber nein, glaubst du wirklich? Das wäre interessant.«
Ihre Schwägerin versagte es sich, darauf zu antworten, und ging in das Haus. Barbara folgte ihr, sagte nur Gute Nacht, nahm ihre Kerze und ging die Treppe zu ihrem Schlafzimmer hinauf.
Sie hatte jedoch Lady Vidal nicht zum letzten Mal gesehen. Diese klopfte eine halbe Stunde später an ihre Tür und trat ein, ganz wie jemand, der vorhat, eine Zeitlang zu bleiben. Barbara saß vor dem Spiegel; ihr Kopf schwebte über der schaumigen meergrünen Gaze ihres Morgenrocks. »Ach, zum Teufel, was willst du hier, Gussie?«, sagte sie.
»Schick deine Zofe weg: ich will mit dir reden«, verlangte Augusta und ließ sich in dem bequemsten Sessel nieder, den es im Zimmer gab.
Barbara seufzte ungeduldig, gehorchte aber. Als sich die Tür hinter dem Mädchen geschlossen hatte, sagte sie: »Nun, was gibt’s? Willst du mir zureden, Etienne zu heiraten? Ich wollte, du gäbst dir keine so große Mühe!«
»Du könntest es schlechter treffen«, sagte Augusta.
»Sicher könnte ich das. Da sind wir uns also einig.«
»Weißt du, du solltest wirklich ernstlich ans Heiraten denken. Du bist fünfundzwanzig, meine Liebe.«
»Ach, Ehe ist so langweilig!«
»Wenn du damit sagen willst, dass Ehemänner langweilig sind, kann ich dir nur herzhaft zustimmen«, antwortete Augusta. »Aber sie müssen um der Vorteile willen ertragen werden, die sie sonst haben. Wenn man unverheiratet ist, hat man weder eine gesellschaftliche Stellung noch Einfluss.«
»Ich will dir etwas sagen, Gussie: das Beste ist, Witwe zu sein – eine faszinierende Witwe!«
»Das magst du vielleicht denken, solange du noch immer einen Schimmer von Schönheit besitzt. Aber nicht länger, versichere ich dir. Was das ‹faszinierend› betrifft, bringt mich das auf etwas anderes, das ich dir zu sagen habe. Ich glaube, ich bin nicht prüde, aber diese vergoldeten Fußnägel waren etwas zu viel, Bab.«
Barbara lüftete eine Falte ihres Gazegewandes und betrachtete ihre Füße. »Hübsch, nicht?«
»Vidal erzählte mir, er habe nur Französinnen – und die von einer bestimmten Sorte – mit bemalten Nägeln gesehen.«
»O, großartig!«
Barbara schien von dieser Neuigkeit so aufrichtig entzückt zu sein, dass es Lady Vidal für klüger hielt, das Thema fallen zu lassen. »Das mag sein, wie es will. Wichtiger aber ist, was du eigentlich mit deiner Zukunft anzufangen gedenkst. Wenn du auf meinen Rat hörst, heiratest du Lavisse.«
»Nein; er wäre ein Teufel von einem Ehemann.«
»Und du ein Teufel von einer Ehefrau, meine Liebe.«
»Stimmt. Ich will als Witwe leben und sterben.«
»Ich bitte dich, erzähl mir nicht so einen Unsinn!«, sagte Augusta gereizt. »Wenn du alle deine Chancen, einen Mann zu bekommen, einfach fahren lässt, dann bist du eine große Närrin.«