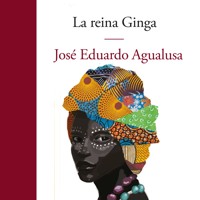12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dem Schriftsteller Bartolomeu Falcato fällt eine Frau buchstäblich vor die Füße. Allerdings nicht aus heiterem Himmel, sondern aus einem Unwetter heraus, und es ist klar, dass sie nicht freiwillig gestürzt ist. Bei der Toten handelt es sich um Núbia de Matos, Model und angebliche Ex-Geliebte der Präsidentin. Nur fünf Tage zuvor hatte sie Falcato in der Abflughalle des Flughafens angesprochen, ihn bedrängt und pikante Details aus den Hinterzimmern der politischen Elite erzählt. Doch statt sich um die Aufklärung des mysteriösen Todesfalls kümmern zu können, wird Falcato selbst zum Verfolgten. Ominöse Anrufer warnen ihn, in seine Wohnung zurückzukehren. Und auch seine Frau darf nicht wissen, was er zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort zu suchen hatte, und vor allem nicht, mit wem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Bartolomeu Falcato fällt eine Frau buchstäblich vor die Füße. Allerdings nicht aus heiterem Himmel, und nicht freiwillig – sie ist tot. Es folgt eine rasante Odyssee durch den Untergrund der angolanischen Hauptstadt Luanda. Vierundzwanzig Stunden, in denen Falcato in einen Strudel aus skrupelloser Gewalt, Liebe, Leidenschaft und Eifersucht gerät.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
José Eduardo Agualusa (*1960 in Angola) veröffentlicht Gedichte, Erzählungen und Romane. Er wurde u. a. mit dem International Dublin Literary Award, dem Independent Foreign Fiction Prize und dem Prémio Nacional de Cultura e Artes ausgezeichnet. Er lebt in Portugal, Angola und Brasilien.
Zur Webseite von José Eduardo Agualusa.
Michael Kegler wurde 1967 in Gießen geboren und hat einen Teil seiner Kindheit in Liberia und Brasilien verbracht. Er arbeitete als Buchhändler und Journalist und übersetzt seit Ende der Neunzigerjahre aus dem Portugiesischen. 2014 erhielt er den Straelener Übersetzerpreis.
Zur Webseite von Michael Kegler.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
José Eduardo Agualusa
Barroco Tropical
Roman
Aus dem Portugiesischen von Michael Kegler
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2009 bei Publicações Dom Quixote, Lissabon.
Die deutsche Erstausgabe erschien im A1 Verlag, München.
Originaltitel: Barroco Tropical
© by José Eduardo Agualusa, 2009
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit der Literarischen Agentur Mertin, Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am Main
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Sharon McCutcheon (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31022-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 15:10h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
BARROCO TROPICAL
1 — Eine Frau fällt vom Himmel.2 — Die Hauptpersonen stellen sich vor.3 — Die Nebendarsteller stellen sich vor. Wäre dies ein Theaterstück, kämen sie auf die Bühne, sagten ihren Namen und erzählten ihre jeweilige Geschichte. Der Leser wird bemerken, dass die Geschichten miteinander verwoben sind. Sie erklären sich gegenseitig.4 — Zurück zum Anfang. Das ist einer der Vorteile der Literatur gegenüber dem wirklichen Leben: Wir können immer wieder zum Anfang zurück.5 — Mãe Mocinha und das smaragdfarbene Zimmer.6 — Noch ein paar Dinge für den kleinen Essay über ungeeignete Liebe.7 — Abstieg in die Hölle.8 — Das erste Gespräch mit der Heiligen Cäcilia.9 — Der Mythos vom schwarzen Engel.10 — Noch ein Haiku.11 — Zweites Gespräch mit der Heiligen Cäcilia.12 — Fragmente aus dem letzten Tagebuch von László Magyar.13 — Die Skrupel des Terroristen.14 — Die Nacht ist das Privileg der Blinden.15 — Von der anderen Seite, oder Das kleine Leben der Núbia de Matos.16 — Kurze Geschichte von Licht und Dunkelheit.17 — Der sprechende Schädel – eine bekannte afrikanische Geschichte.18 — Eine Maus im Labyrinth.19 — Die messianische Werkstatt.20 — Der Spiegelverkäufer, gefolgt von einer Diskussion über Sprachen und Identitäten, um meine neo-nativistischen Kritiker zu verwirren.21 — Nun einige unzusammenhängende Notizen ohne chronologische oder sonstige Ordnung aus dem »Klinischen Tagebuch der Patientin Núbia de Matos« des traditionellen Heilers Tata Ambroise, übersetzt aus dem Kimbundu von meinem Freund Maurice Kabasele, genannt Dálmata.22 — Erinnern Sie sich noch an Humberto Chiteculo? Dachten Sie, ich hätte ihn vergessen, nachdem ich ihn auf die Liste der zweitrangigen Protagonisten gesetzt habe?Tatsächlich kommt Chiteculo in einigen Kapiteln dieser Geschichte vor, aber das wird erst jetzt deutlich.Leider ist er tot. Lesern mit etwas schwächerem Gedächtnis empfehle ich, noch einmal zurückzublättern und nachzulesen, was ich in Kapitel 3 über ihn schrieb.23 — Die Königin des Abyssos.24 — Wie Lulu Banzo Pombeiro mir das Elucidarium von Kianda übergibt. Hier kommt auch Licht in die Rolle, die Lulu im Leben von Salomé Monteiro Astrobello gespielt hat, gefolgt von seiner Rehabilitierung.25 — Die letzten Seiten des Elucidariums.EpilogErläuterungen und DanksagungenWorterklärungenZitierte WerkeMehr über dieses Buch
Über José Eduardo Agualusa
José Eduardo Agualusa: »Das Fantastische ist Teil der angolanischen Realität.«
Über Michael Kegler
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von José Eduardo Agualusa
Zum Thema Angola
Zum Thema Afrika
Als ob es nicht genug wäre, in der Erkenntnis Gottes zu irren, nennen sie in dem heftigen Zwiespalt, den die Unwissenheit in ihr Leben bringt, so große Übel auch noch Frieden.
Heilige Schrift, WeisheitGötzendienst der Seefahrer 14, 22
Mich interessiert nicht die Ordnung des Chaos. Mein Ziel ist, es zum Blühen zu bringen.
Mouche Shaba im Interview mit Malaquias da Palma Chambão, O Impoluto, 10. Mai 2008
Die Hölle ist die Abwesenheit von Vernunft.
Chris Taylor (Charlie Sheen), in Platoon
1
Eine Frau fällt vom Himmel.
Ich zählte die Sekunden zwischen Blitz und Donner – eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Multiplizierte sie mit dreihundertvierzig, die Meter, die der Schall pro Sekunde zurücklegt, um auszurechnen, in welcher Entfernung der erste Blitz eingeschlagen hatte: zwei Kilometer und dreihundertachtzig Meter. Ich berechnete den zweiten, den dritten, den vierten Blitz. Das Unwetter stürmte auf uns zu. Noch bevor der fünfte Blitz den Himmel aufriss, wusste ich bereits, wo er einschlagen würde.
Kianda war hundert Meter entfernt von mir und lief weiter voran, immer weiter, wie auf einer Bühne, angetrieben vom Licht. Ihre Schuhe versanken im Morast, rotes Lackleder auf rotem Rot. In der Ferne tanzten die Palmen. Dahinter ragte die unerschütterliche Silhouette eines Baobab auf. Kianda ging aufrecht, mit erhobenem Haupt, ihre schönen Hände mit den langen, schlanken Fingern über der Brust gekreuzt. Das Licht war wie eine goldene Substanz, zäh, fast schon flüssig, an die sich trockene Blätter hefteten, Papierschnipsel, feiner, aufgewirbelter Staub, Material, das der Wind in seinen gewundenen Armen mit sich riss.
Und meine Liebe schritt weiter der schwarzen Wolkenmasse entgegen. Ich musste daran denken, was ein berühmter Musikkritiker, ein alter, exzentrischer Engländer, einmal über sie gesagt hatte, um ihren Erfolg zu erklären: »Als Erstes berührt uns der Gegensatz zwischen der Zerbrechlichkeit ihrer auf eigentümliche Weise schroffen Gestalt und dem ungezähmten Stolz in ihrem Blick. Ihre mächtige und doch sanfte Stimme. Man möchte sie in Schutz nehmen und gleichzeitig schlagen.«
Kianda geriet in den Regen. Ihr leichtes, strahlend rotes Kleid aus Seide klebte an ihrer Haut, wurde dunkler, fast violett. Im tiefen Rückenausschnitt sah man die zwei blauen Flügel, die sie sich in Japan hatte tätowieren lassen. Je länger ich sie kannte, desto mehr faszinierten sie mich. Die Trompe-l’oeil-Technik lässt sie wie echt aussehen. Flügel, die sich bewegen, wenn sie atmet. Ihre wilde, flammende Mähne, die so viele Frauen nachzuahmen versuchen, hatte sich aufgelöst, hatte Fülle und Glanz verloren und hing nun über ihre sich deutlich abzeichnenden Schultern herab.
Ich öffnete die Autotür und stieg aus. Ein alter, dunkelgelber Chrysler, ein Oldtimer. Der nasse Wind schlug mir ins Gesicht. Ich rief ihren Namen, übertönte das Donnern des Unwetters. Kianda drehte sich zu mir um, und in diesem Moment ging ihr Blick in stummem Entsetzen nach oben.
Jetzt, wo ich alles noch einmal durchlese, merke ich, dass es sich liest wie das Drehbuch zu einem Werbespot. Nun käme die Parfumflasche ins Bild. Mit einem passenden Namen. »La tempête« oder so ähnlich. Aber nein. Ab hier kippt der Film.
Ich folgte Kiandas Blick und sah, wie die Frau vom Himmel gefallen kam – sie stürzte, nackt, schwarz, mit ausgebreiteten Armen –, fast im selben Moment wie der Blitz. Der Blitz schlug in einen Baobab ein und zerfetzte ihn. Ein Meteorologe hat mir vor Jahren einmal erklärt, dass Blitze Bäume sprengen, weil sich das Harz schlagartig erhitzt. Ich rannte zu ihr. Ihr Körper steckte halb im Morast. Ihr Kopf war nach hinten geknickt. Ich konnte die aufgerissenen, tiefschwarzen Augen erkennen. Sie leuchteten noch. Entsetzt wich ich zurück. Ich wollte nicht, dass Kianda das sah. »Lass uns gehen!«
»Gehen? Und sie?«
»Sie ist tot, Liebling! Um die musst du dich nicht mehr kümmern. Willst du die Polizei rufen?«
»Nein, nein! Nicht die Polizei. Ich will niemanden rufen. Du weißt genau, dass wir nicht zusammen gesehen werden dürfen.«
Ich nahm sie in den Arm. Kianda zitterte. Ich begleitete sie zum Wagen, setzte sie auf den Beifahrersitz und wir fuhren schweigend nach Luanda zurück. Als wir die Stadt erreichten, begann es gerade, dunkel zu werden. Ich parkte den Wagen zwei Straßen von ihrer Wohnung entfernt und beugte mich zu ihr herüber, um sie zu küssen.
Kianda wandte sich ab. »Nein! Nie wieder.«
Ich stieg aus. Sie rutschte auf meinen Platz, startete den Wagen und verschwand. Ich hielt ein Taxi an. Lange hatte es in Luanda keine richtigen Taxis gegeben, nur Candongueiros, Sammeltaxis im Dienste des Volkes.
Das Volk oder sie, so nennen wir, die Reichen oder fast Reichen Angolas, diejenigen, die überhaupt nichts haben. Also die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung.
Der Taxifahrer war ein dicker Kongolese. Sein Gesicht war glatt und glänzte im kupferfarbenen Licht des untergehenden Tages wie ein Spiegel. Er schenkte mir ein riesiges Lächeln.
»Wo soll’s denn hingehen?«
»Keine Ahnung«, gestand ich mit tonloser Stimme. Die Angst ließ mich keinen klaren Gedanken fassen. »Irgendwohin.«
Der Mann lächelte wieder. »Keine Sorge. Ich bringe Sie hin.«
Eine halbe Stunde später setzte er mich vor einer kleinen Bar ab. Mir fiel die pulsierende Neonschrift über der Tür auf: »O Orgulho Grego« – Der griechische Stolz. Das Grinsen des Taxifahrers hatte inzwischen die Ausmaße einer ganzen Welt angenommen.
»Gehen Sie hinein und fragen Sie nach Mãe Mocinha. Sie wird Ihnen sagen, wo es hingehen soll. Sie irrt sich nie.«
Die stürzende Frau, fünf Tage davor
Ich sah sie, kaum dass ich die Abflughalle betreten hatte. Auch die Frau hatte mich gesehen und heftete das unbarmherzige Strahlen ihrer großen schwarzen Augen auf mich, so intensiv, dass ich zu Boden sah. Als ich wieder aufblickte, war sie immer noch da, saß nun aufrecht auf einem Stuhl, elegant und erhaben wie eine äthiopische Prinzessin. Sie trug eine Pelzjacke von archaischem Luxus und eine schwarze Schlaghose. Ich setzte mich zwei Reihen hinter sie, um diesem Blick zu entkommen und sie ungestört beobachten zu können.
Wer war sie? Oder besser, was …? Ich begann mir verschiedene Varianten vorzustellen. Aus gutem Hause wahrscheinlich, aus einer der alten Familien von Luanda oder Benguela. Einer der Großväter könnte Beamter der Kolonialverwaltung gewesen sein. Der Vater dann Bürokrat im Dienste der Regierung, vielleicht auch erfolgreicher Unternehmer, ein zum Bergbau-Unternehmer konvertierter General. Sie könnte in Lissabon studiert haben oder in London oder New York. Oder gar in Lissabon, London und New York. Ihrer Kleidung nach zu urteilen widersprach ihr Geschmack allen aktuellen ökologischen Standards. Vielleicht machte es ihr aber auch nur Spaß zu provozieren, oder sie war reich genug, um über dem Urteil der Masse zu stehen. Immerhin war ich mir sicher, sie noch nie zuvor gesehen zu haben. Ich musste an »Dornröschens Flugzeug« denken, eine der »Zwölf Geschichten aus der Fremde« von Gabriel García Márquez. Darin erzählt der Kolumbianer von einer Reise an der Seite der schönsten Frau der Welt, die kein einziges Wort mit ihm spricht. Ich bin oft mit dem Flugzeug unterwegs, fast jeden Monat, und kann mich nicht erinnern, je neben einer schönen Frau gesessen zu haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Fluggesellschaften Anweisung haben, schöne Frauen nicht neben Männer zu setzen, ganz gleich welche, ausgenommen sehr respektable Alte oder Priester vielleicht.
Als der Flug aufgerufen wurde, wartete ich, bis die Frau aufgestanden war, und stellte mich hinter sie in die Schlange. Zu meiner Überraschung drehte sie sich um, deutete mit ihrem rechten Zeigefinger auf mich und fragte: »Sind Sie Bartolomeu Falcato?«
»Meistens schon«, sagte ich und versuchte krampfhaft, mir etwas Geistreiches auszudenken, einen witzigen Spruch, irgendetwas, womit ich mir Luft verschaffen und meine Sicherheit wiedererlangen könnte. »Ich bin allerdings bereit, alles zu sein, was Sie möchten, wann und wo immer es Ihnen beliebt.« Ich sehe ein, das war nicht besonders originell. Meine Plumpheit schien sie jedoch nicht weiter zu stören.
»Ich heiße Núbia«, sagte sie einen Tick zu laut. »Ich wusste, dass wir uns begegnen würden, in Lissabon, in Luanda, irgendwo auf der Welt. Ich war mir sicher.«
Ich traute mich nicht zu fragen, warum sie so sicher war. Stattdessen wollte ich wissen, was sie machte. Sie lächelte nur. Dann rief jemand ihren Namen, sie ging, und ich sah sie erst im Flugzeug wieder. Sie saß ein gutes Stück vor mir. Der Sitz neben mir war frei. Als Núbia dies bemerkte, kam sie, legte ihre Pelzjacke ab und verstaute sie im Gepäckfach. Sie trug eine einfache weiße Bluse, sehr elegant, unter der große, feste Brüste zu erahnen waren. Dann öffnete sie einen kleinen roten Koffer aus Plastik, holte einen Stapel Zeitschriften heraus und legte ihn mir auf den Schoß.
»Damit Sie mich besser kennenlernen.«
Die Illustrierten hatten Namen wie »Cacau«, »Mulher Africana«, »Tropical«, »Caras e Cores«. Auf allen Titelblättern war Núbia. Einmal als Braut, die eine lange gewendelte Treppe hinabschreitet, auf dem zweiten posierte sie im Bikini auf einem Strandlaken, im Hintergrund schimmerte zwischen den Felsen ein smaragdgrünes Meer. Auf dem dritten trug sie nichts als knappe Jeans-Shorts und lachte ein jugendliches Lachen, während ihre Hände versuchten, die Brüste zu verbergen.
»Ach so«, seufzte ich erstaunt. »Sie sind Fotomodell …«
»Ich war vor zehn Jahren einmal Miss Angola. Danach habe ich eine Karriere als Model begonnen. Ich hatte auch mal eine Fernsehsendung.«
»Jetzt nicht mehr?«
»Nein, man hat mich zum Schweigen gebracht! Sie wollen nicht, dass ich rede!«
Sie nahm mir die Zeitschriften aus der Hand und gab mir stattdessen ein dickes Fotoalbum. Sie selbst schlug es auf. Die ersten Bilder zeigten eine Misswahl. Núbia tauchte erst etliche Bilder weiter hinten auf, immer mit demselben Lächeln, neben der Präsidentin und ihrem Ehemann. An der Seite eines berühmten Fußballspielers. An der Seite einer Schauspielerin. Im Arm eines erfolgreichen amerikanischen Unternehmers. Im Arm von zwei erfolgreichen angolanischen Unternehmern. Auf dem Schoß eines bekannten Waffenschiebers. Auf der riesigen Yacht der Präsidentin. Ich deutete auf ein Foto, auf dem sie zu Pferd zu sehen war. Im Hintergrund, ebenfalls zu Pferd, ein eleganter Mann mit Oberlippen- und Kinnbart. Das Gesicht kam mir bekannt vor. »Wer ist das?«
»Das ist der Geliebte der Frau Präsidentin!«
»Wie bitte?«
Sie überging mein Staunen und zeigte mir weitere Fotos. Mit wachsender Begeisterung. Redete, fast ohne Luft zu holen, wie ein Wasserfall, und nach und nach änderte sich auch ihr Tonfall. Hinter der weichen, klagenden Aussprache der alten Bourgeoisie von Luanda kam nun eine andere, breitere, vollere, derbere Färbung zum Vorschein. Als versuchte eine zweite Frau, aus dem Volk, aus ihr – der falschen – herauszuschlüpfen, nicht wie ein Schmetterling aus einer Puppe, sondern eher wie eine Raupe aus einem Schmetterling. Ich fragte sie nach ihrem Familiennamen. Sie lächelte, um zu zeigen, dass sie verstanden hatte, worauf ich hinauswollte.
»Meine Familie war arm. Ich konnte nicht einmal Portugiesisch, jedenfalls nur sehr schlecht. Die hier hat es mir beigebracht.« Dabei deutete sie auf die Präsidentin auf einem der Fotos. Und lachte kurz auf. »Das ist eine ganz Ordinäre. Sie schaute immer zu, wenn ihr Ehemann es mit mir trieb. Weißt du, wozu sie mich zwangen? Nein, das kannst du nicht wissen. Keiner kann es wissen. Mich und die anderen Mädchen. Zu Orgien mit wichtigen Leuten. Drogen …«
»Das glaube ich nicht!«
»Doch, ich habe jede Menge Drogen genommen. Liamba, Heroin, Koks. Heute nehme ich keine Drogen mehr. Gott erlaubt es mir nicht …«
»Gott?«
»Ja, Gott.« Sie senkte die Stimme und kam mit ihren süßen Lippen ganz nah an mein Ohr. »Weißt du, dass Gott gesehen wurde, wie er über die Strandpromenade spazierte? Gott redet mit mir. Einmal hat er mir eins deiner Bücher gezeigt. Am nächsten Tag bin ich in eine Buchhandlung gegangen und habe es gekauft.«
»Und hast du es gelesen?«
»Gelesen schon, aber nicht verstanden. Ich habe es gelesen, weil Gott mir gesagt hat: ›Kind, mach dich bereit. Du bist Núbia, die Hure, und du bist Maria, die Reine. Gebenedeit sei die Frucht deines Leibes.‹ Das sagte er zu mir, denn ich werde schwanger werden und den neuen Heiland zur Welt bringen …«
Ich war perplex und erschrocken. »Und wer wird der Vater sein?«
Núbia schaute mich verblüfft an. »Der Vater? Du natürlich. Das hat mir Gott offenbart. Du wirst mein Josef sein.«
»Und wie soll unser Kind heißen?«
»Emanuel selbstverständlich.«
Nachdem das geklärt war, erzählte sie mir, dass sie früher ein Junge gewesen sei. Inzwischen waren die Lichter im Flugzeug ausgegangen. Es war schon nach Mitternacht. Draußen leuchteten friedlich die Sterne.
»Als ich ein Junge war, trieb ich es mit der Präsidentin …«
Ich hörte schon nicht mehr zu. Der Kopf tat mir weh. Der Schlaf löschte allmählich mein Bewusstsein aus wie ein Blackout eine Stadt, damals, in Zeiten des Krieges; erst ein Stadtviertel, dann das nächste, riesige Gebiete, die im Dunkelverschwanden. Zugleich tauchten, aus welchem verborgenen Ozean auch immer, unzusammenhängende Bilder auf aus dem tiefsten Inneren meines Gehirns: ich, wie ich Laurentina küsse, meine Mutter beim Tanzen in einem rosafarbenen Kleid, ein toter Hund auf dem Bürgersteig mit durchschnittener Kehle. Ich kämpfte verzweifelt dagegen an, unterzugehen. Schließlich schlief ich ein, muss eingeschlafen sein, denn ich weiß, dass ich nackt über einen Strand lief, neben mir Núbia, als ich plötzlich die Augen wieder aufriss und sah, wie sie sich über mich beugte. Sie hatte ihre Bluse aufgeknöpft und den Büstenhalter gelöst. Dort, mitten in der rasenden Nacht, in elftausend Metern Höhe, erschien sie mir wie eine unantastbare Gottheit. Eine moderne (reichlich moderne, das gebe ich zu) Variante der Mutter Gottes. Noch völlig benommen wachte ich auf.
»Was machst du da?«
»Ich ziehe meine Bluse aus. Wir werden uns lieben.«
»Hier?«
»Ja, warte, ich ziehe nur kurz meine Hose aus.«
»Wirst du nicht. Und du wirst die Bluse wieder zuknöpfen!«
»Gefalle ich dir nicht?«
»Du gefällst mir, ja doch, aber ich glaube auch, dass du ein Problem hast. Du solltest zu einem Psychologen gehen.«
»Ich spreche lieber mit Gott. Was kann ein Psychologe mir schon mehr sagen als Gott?«
Das Argument war entwaffnend, und Núbia nahm mein Schweigen als Zustimmung. Spöttisch fügte sie hinzu: »Oder willst du, dass ich mit Bárbara Dulce rede? Sie ist doch Psychologin?«
»Bárbara? Bárbara ist Psychoanalytikerin. Wissenschaftlerin. Sie hat sich spezialisiert auf Schlafstörungen. Und Träume. Woher kennst du überhaupt meine Frau?«
»Ich weiß alles über dich …«
Nicht alles, zum Glück. Nicht einmal meine Telefonnummer kannte sie. Ich gab ihr eine falsche Nummer, schrieb mir aber ihre auf. Wir verabschiedeten uns mit einem flüchtigen Kuss in der Schlange vor der Grenzkontrolle. Ich versprach, mich zu melden, sagte ihr noch einmal, dass sie Ruhe brauche, und sah zu, dass ich verschwand. Bárbara Dulce wartete draußen auf mich, und ich hatte keine Lust auf einen Skandal.
Mãe Mocinha führte mich in ein kleines, smaragdgrün gestrichenes Zimmer, in das man von der Bar aus durch einen schmalen Gang gelangte. Sie riet mir, in den nächsten Tagen besser nicht nach Hause zu gehen. Ich schenkte ihr keine Beachtung. Doch dann sagte sie etwas – mit einer Stimme, von der ich nicht weiß, wo sie sie her hatte –, das mich unruhig werden ließ. Daraufhin schlief sie ein auf ihrem alten Sofa, ihr Kopf sank auf die Brust. Ich ging zurück in die Bar. In dem Moment, als ich das Orgulho Grego verlassen wollte, bellte mein Telefon.
Ja, mein Telefon bellt. Serena, meine mittlere Tochter, hat den alten Klingelton, ein diskretes, altmodisches Klingeln, durch ein wildes Bellen ersetzt. Wenn ich nicht aufpasse und nicht gleich drangehe, dreht das Teil – oder besser der Köter, der in ihm sitzt – durch. Es ist mir schon passiert, dass mich jemand auf offener Straße angerufen hat und von irgendwoher ein streunender Hund aufgetaucht ist, bellend und heulend wie mein Telefon, und ich die Flucht antreten musste wie ein Strauchdieb, mit einem Hund in der Tasche und einem anderen auf den Fersen. Ich habe versucht, den alten Klingelton wiederherzustellen, aber ohne Erfolg.
Es war Kianda. Sie erzählte mir, ihr Ehemann habe sich von ihr getrennt, wegen einer anderen Frau. Und sie wolle mich nie wieder sehen. Nie wieder. Als sie aufgelegt hatte, setzte ich mich an einen Tisch und bestellte ein Bier. Der Betreiber des Etablissements, ein sehr netter portugiesischer Tölpel, brachte mir zwei Cuca-Bier und ein Tellerchen mit Stockfischbällchen. Die besten, die ich bis heute gegessen habe. Er setzte sich zu mir und begann, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und dann, wie er Mãe Mocinha kennengelernt hatte. Beides großartige Geschichten.
Es war schon nach acht, als ich aufstand. Ich rief Bárbara Dulce an. Das Telefon klingelte und klingelte, aber niemand ging dran. Ich musste unbedingt mit ihr reden. Ihr erzählen, dass ich mit Núbia de Matos geflogen war. Bárbara würde sich wundern. »Warum hast du mir das nicht vorher gesagt?«, würde sie fragen. »Ach Schatz, ich wollte dich nicht aufregen. Diese Frau ist verrückt. Total durchgeknallt.« Dann wollte ich ihr erzählen, dass ich gesehen hatte, wie sie vom Himmel gefallen war, direkt vor meine Füße, als ich im Taxi mit einem Kongolesen am Steuer unterwegs nach Cajueiro gewesen sei. Bárbara würde sicher noch einmal nachhaken und mit einer nur um Nuancen lauteren Stimme fragen: »Und was wolltest du in Cajueiro, bitte schön?« Und ich würde mit den Schultern zucken: »Keine Ahnung! Einen portugiesischen Hinterwäldler interviewen, eine Art Hellseher, weißt du? Für meinen neuen Roman.«
Wieder und wieder legte ich mir den Dialog zurecht, während ich nach einem Taxi Ausschau hielt. Bárbara würde zu ihrem Vater gehen. Mein Schwiegervater ist ein einflussreicher Mann seit der Unabhängigkeit, eigentlich schon immer, mit guten Verbindungen zum Ministerium für Staatssicherheit. Benigno würde schon wissen, wie man mir helfen kann. Die Strategie zurechtzulegen half mir, ruhiger zu werden.
Ein Taxi hielt vor dem Orgulho Grego. Diesmal saß ein junger Inder am Steuer. Ich stieg ein und ließ mich zum Termiteira-Hochhaus fahren. In weniger als fünfzehn Minuten waren wir dort. Die riesige Eingangshalle war menschenleer. Ein schon ziemlich betagter Wachmann schlief mit dem Kopf auf seinem Schreibtisch, und vor ihm flimmerte auf einem winzigen Fernseher »Blade Runner«, einer meiner Lieblingsfilme. Ich stieg in den Aufzug und ließ mich vom Liftboy in den siebenundvierzigsten Stock fahren. Es war niemand zu Hause. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein Zettel: »Bartolomeu! Kianda war in meiner Praxis und hat mir alles erzählt. Ich bin mit den Kindern bei meinen Eltern. Ruf mich nicht an und versuche nicht, mich zu treffen. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken, was aus meinem Leben werden soll. Bárbara.«
Aufgewühlt ließ ich mich aufs Sofa fallen. Schaltete gedankenverloren, ganz automatisch, den Fernseher ein, und plötzlich war sie da: Núbia de Matos, ihr Gesicht in Großaufnahme, die Augen geschlossen. Dann ihre Leiche von oben, in einem Morast aus Licht. Die Kamera fuhr weiter nach oben und nach und nach kamen weitere Darsteller ins Bild. Zwei Polizisten, von denen einer neben dem Körper des Models kniete, der zweite stand und schrieb etwas auf, und die Kamera fuhr zurück, während sich die Stimme des Sprechers in dem ihn umgebenden Lärm steigerte: »Die Leiche von Núbia de Matos, frühere Miss Angola, Fotomodell und Journalistin, wurde am frühen Abend von zwei Landarbeitern in der Gegend von Embondeiros bei Bom Jesus gefunden. Núbia de Matos wurde vor einigen Jahren landesweit bekannt, als sie zur Miss Angola gekürt wurde. Anschließend schlug sie eine Laufbahn als Fotomodell ein. Mehrere Jahre war sie das wichtigste Model der Gebrüder Congo und präsentierte die Modemarke Congo Twins in den Modehauptstädten der Welt. Zwei Jahre lang hatte Núbia außerdem eine Fernsehsendung mit Prominenten im Televisão Independente de Angola. Die Modewelt ist betroffen über ihren plötzlichen Tod im Alter von nur zweiunddreißig Jahren. Die Polizei hat noch keine Einzelheiten zum Tod des Fotomodells freigegeben, das allein in einer Mietwohnung im Süden Luandas lebte …«
Wieder bellte das Telefon in meiner Tasche. Rufnummer unterdrückt. Wenn dort »Rufnummer unterdrückt« steht, ist es meistens Kianda. Ich ging dran und hörte die Stimme eines Mannes, dunkel, und im Hintergrund etwas, das sich für mich wie der Lärm einer Feier anhörte.
»Bartolomeu Falcato, der Schriftsteller?«
»Ja bitte …«
»Fliehen Sie! Falls Sie zu Hause sind, gehen Sie schnell. Man will Sie umbringen.«
Dann brach das Gespräch ab. Ich stand auf und zog die Vorhänge zu. Schaltete das Licht aus und setzte mich wieder, diesmal auf den Boden in eine Ecke, und blieb dort, im Dunklen und zitternd wie ein kleines, gehetztes Tier. Ich hatte dem, was Núbia gesagt hatte, keine Beachtung geschenkt. Es war so tief in der Nacht gewesen, alles so schnell und so verwirrend und ich so müde, irgendwo zwischen meinen Träumen und ihren Albträumen.
Wenn nur zwei oder drei Dinge von dem, was mir Núbia erzählt hatte, stimmten, hatten sie allen Grund, sie aus einem Flugzeug oder Helikopter zu werfen. Und angenommen, sie war verhört worden, bevor man sie hinausgestoßen hatte, gehörte nicht viel Fantasie dazu, um zu ahnen, dass sie auch meinen Namen erwähnt hatte.
Von den zahlreichen Dokumentarfilmen, die ich gedreht habe, mag ich einen besonders. Er handelt von politischen Gefangenen in Afrika. Siebenundzwanzig habe ich interviewt. Irgendwann, hatten einige von ihnen mir anvertraut, seien sie an einem Punkt angelangt, an dem sie das Gefühl bekommen hätten, den Verstand zu verlieren.
»Ich war dort«, erzählte mir ein Priester aus Zimbabwe mit gesenktem Blick. »Ich bin durch diese andere Welt gegangen, als Besucher. Viele Male. Immer wenn sie mich schlugen, schloss ich die Augen und ließ mich fallen. Ich floh. Eines Tages merkte ich, dass ich nie wieder zurückkehren würde. Da bekam ich Angst, große Angst. In dieser Situation muss ich meine Kameraden verraten haben. Nicht aus Schmerz habe ich den Mund aufgemacht, sondern aus Angst, verrückt zu werden.«
Nach einigen Stunden läuft auch der Verhörende Gefahr, sich vom Wahnsinn anstecken zu lassen. Mein Schwiegervater erzählte mir von einem Dissidenten, einem jungen Ökonomiestudenten, der nach dreißig Stunden Stehen unter dem gleißenden Licht eines Scheinwerfers plötzlich anfing, in einer Sprache zu sprechen, die ein Bewacher, ein Anhänger von Simon Kimbangu, als Aramäisch erkannte, die Sprache von Jesus Christus (die er in Äthiopien gehört hatte). Vom Aramäischen wechselte der Student ins Französische mit einem Akzent von den Antillen und danach in ein lupenreines Umbundu, was insofern überraschend war, als er in Luanda als Sohn kleiner portugiesischer Kolonisten geboren worden und nie weiter herumgekommen war als bis nach Cacuaco. In all diesen Sprachen beleidigte er munter den Vater der Nation und versicherte, er sei in der Lage, alle seine Peiniger in Eidechsen zu verwandeln. Einer von ihnen, der Anhänger Kimbangus mit den Aramäischkenntnissen, weigerte sich schließlich weiterzumachen, als er am dritten Tag einen seltsamen Ausschlag an der Hand bekam. Später wurde auch er festgenommen und verlor den Verstand, überzeugt davon, dass er sich wirklich in eine Eidechse verwandelt hatte.
Gestatten Sie mir unterdessen eine Korrektur: Mein Schwiegervater hat zu keinem Zeitpunkt das Wort Dissident gebraucht. Benigno wählt seine Worte sehr genau. Die ins Exil Getriebenen nennt er politische Emigranten. Die Dissidenten der regierenden Partei nennt er Fraktionisten. Besagte Person hatte bis 1977 wichtige Ämter in der Parteiführung innegehabt, sich dann einer Gruppe angeschlossen, die den Führungsanspruch von Agostinho Neto infrage stellte, und war festgenommen und gefoltert worden. Nach seiner Freilassung war er nach Portugal geflohen. Benigno nannte ihn entweder einen politischen Emigranten oder aber Fraktionist.
Was will ich mit all dem sagen?
Stellen Sie sich vor, Núbia wird einer harten Befragung unterzogen – um einen weiteren Euphemismus zu bemühen, der meinem Schwiegervater sicher auch gefallen würde. Stellen Sie sich außerdem vor, sie hätte von Anfang an die intimen Intrigen bei Hofe mit den Offenbarungen durcheinandergewürfelt, die ihr Gott der Herr gemacht hatte. Vielleicht dachten die Verhörer, Núbia tue nur so, als sei sie verrückt oder dort nur zu Besuch wie jener Priester aus Zimbabwe. Vielleicht war es ihnen auch egal. Verrückt oder nicht, sie wusste zu viel und hatte geredet.
Ich nahm mir einen Whiskey und ging im Wohnzimmer mit großen Schritten auf und ab. Am wahrscheinlichsten war, dass sie bereits nach mir suchten. Ein Vernichtungskommando, so wie im Film. Was meinen lieben Schwiegervater Benigno dos Anjos Negreiros anging, konnte ich wohl kaum darauf hoffen, dass er mir half. Nicht, nachdem Bárbara Dulce verheult bei ihm aufgetaucht war, mit beiden Kindern an der Hand.
Am Tag unserer Hochzeit, wenige Minuten bevor Bárbara strahlend die Kirche betrat, hatte mich Benigno in einer düsteren Arkade zur Seite genommen, sich vorgebeugt, um mir die Krawatte zurechtzurücken, und mir zugeflüstert – wobei er nicht aufgehört hatte zu lächeln –, während er mir tief die Augen schaute: »Sie nehmen mir meinen größten Schatz weg, Herr Bartolomeu Falcato. Bereiten Sie ihr niemals Kummer. Sollte ich je erleben, dass mein kleines Mädchen Ihretwegen weint, sollte ich bei ihr je auch nur die kleinste Träne entdecken, bringe ich Sie um, das schwöre ich Ihnen.«
Hinter mir hing der Heilige Sebastian leidend an seinem Felsen, die weiße Brust von Pfeilen durchbohrt, und ich versuchte zu scherzen: »Wenn Bárbara weint, dann nur vor Glück.«
Benigno richtete sich auf: »Davon bin ich überzeugt.«
Die Türklingel riss mich aus meinen Gedanken. Lautlos stand ich auf und lugte durch den Spion. Vor mir sah ich das ernste Gesicht eines Mannes um die dreißig, mit einem fein rasierten Oberlippen- und Kinnbart. Er schaute mich direkt an, auch wenn er mich natürlich nicht sehen konnte. Dann trat er ein paar Schritte zurück. Er trug einen dunklen Anzug, der ihm wie auf den Leib geschnitten war und eine Seidenkrawatte mit dem Bild einer Geisha darauf, die Shamisen spielt. Ich schlich von der Tür weg. Der Mann sah nicht aus wie ein professioneller Killer, noch weniger wie ein Agent der politischen Polizei. Ich kannte einige, von einfachen Schlägern bis hin zu hohen Funktionären der Staatssicherheit, keiner von ihnen würde je eine Krawatte mit dem Bild einer Geisha tragen, die Shamisen spielt. Aber vielleicht waren die jüngeren ja inzwischen schlauer. Ich schlüpfte durch die Küchentür hinaus und stieg die Dienstbotentreppe hinauf. Einen Stock über mir wohnte Mouche Shaba, die Architektin, die das Termiteira-Hochhaus entworfen hatte. Mouche ist eine Freundin. Ich dachte, dass sie mir vielleicht helfen könnte.
2
Die Hauptpersonen stellen sich vor.
Guten Abend, Bárbara, darf ich hereinkommen? Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihrer Praxis belästige. Ich weiß keine bessere Lösung. Sie kennen mich nicht. Sie glauben, Sie kennen mich, aber Sie kennen mich nicht. Niemand kennt mich. Ich bin ein Star, sagen sie, und ich glaube, das stimmt: Ich bin ein Stern, denn ich glänze. Und dann kommt eine Explosion und ich werde verglühen. Mit meinem Tod werde ich alles, was mich umgibt, mit in meinen Abgrund reißen. Auch das Licht. Alles Licht. Aber noch bin ich ein Stern. Manchmal, wenn ich gerade am Einschlafen bin, an der Grenze, wo man noch weiß, wer man ist, oder glaubt es zu wissen, aber die Augen schon nicht mehr aufbekommt, träume ich, wieder ein Mensch zu sein, habe Gefühle und lache und weine. Ich träume, dass ich liebe und dass ich geliebt werde. Ich kann staunen und spüre die Freude erwiderter Liebe.
Darf ich mich setzen? Danke.
Wenn ich fast träume, überkommt mich auch Unsicherheit, ein plötzlicher Einbruch von Trauer, beißende Eifersucht. Ich will mir die Pulsadern aufschneiden. Und ich schneide mir die Pulsadern auf. Ich möchte töten, und manchmal töte ich. Selbst in wachem Zustand gibt es noch einige Momente, in denen ich wieder ein Mensch bin. Ich lebe in Intervallen. Liebe in Intervallen. Wie ein Blitzschlag, verstehen Sie? Ich liebe wie jemand, der erwacht, und danach tauche ich wieder ein in die Blindheit des Schlafes. Ich glaube, die Liebe ist das Gegenteil von Tod.
Doch das wird immer seltener. Inzwischen ist Glänzen fast alles, was ich noch kann. Ich glänze, mal ja, mal nein, und manchmal nächtelang hintereinander, auf den berühmtesten Bühnen der Welt. Das Olympia in Paris? Natürlich, ich kenne es gut, habe dort bereits vier Mal gesungen. In der Oper von Sydney fühle ich mich zu Hause, von der Royal Albert Hall ganz zu schweigen. Die Engländer mögen mich. Die Amerikaner auch. Als ich zum ersten Mal mein Gesicht auf einem Plakat sah, in der Carnegie Hall, konnte ich nicht glauben, dass ich es tatsächlich war. Man sagt, ein Mann habe einmal den Violinisten Jascha Heifetz gefragt, als dieser gerade über die Seventh Avenue schlenderte, wie man zur Carnegie Hall kommt. »Da gibt es nur einen Weg«, soll Heifetz geantwortet haben: »Üben, üben, üben.« Und das stimmt. Durch viel Üben kam auch ich in die Carnegie Hall.
In Kuala Lumpur, in der Dewan Philharmonik Petronas Hall, schaute ich einmal nach oben und sah eine riesige künstliche Sonne. Sie erinnerte mich an die Sonne in meiner Wüste. Seit Tagen hatte ich wie immer vor den Konzerten nur Suppe gegessen und etwas Obst zu Mittag. Ich spürte, wie der Boden unter mir nachgab, und fiel in Ohnmacht. In der Berliner Philharmonie hörte ich, umgeben von lang anhaltendem Applaus, einen Knall. Später erfuhr ich, dass ein Wahnsinniger irgendwo aus dem Parkett auf mich geschossen hatte. Die Kugel hatte den Kontrabass getroffen. Im Teatro Principal von Saragossa streckte mir jemand nach dem dritten Vorhang einen riesigen Strauß roter Rosen entgegen und einen Umschlag. Ich öffnete ihn in der Garderobe. Darin lag ein Scheck über fünftausend Dollar und eine Visitenkarte. Auf der Rückseite stand in einem entsetzlichen Englisch und ebenso schrecklicher Handschrift mit lila Tinte: »Ich wohne im selben Hotel wie Sie, Zimmer 306. Ich warte auf Sie. Ich verspreche Ihnen eine rauschende Nacht.«
Seit diesem Tag weigere ich mich, im Zimmer 306 abzusteigen, egal in welchem Hotel.
Jede Bühne erinnert mich an etwas anderes.
Ich kann nicht behaupten, dass ich Paris kenne, London oder New York. Außer den Bühnen kenne ich nur noch die Flughäfen gut, und die Hotelzimmer. Ich könnte auch Kurse geben für Leute, die regelmäßig auf Reisen sind, darüber, wie man Langeweile und Atemnot im metallenen Rumpf von Flugzeugen überlebt. Ich komme in einer Stadt an und gehe sofort ins Hotel, ruhe mich etwas aus und lege die Kleidung für meinen Auftritt zurecht. Nachmittags schaue ich mir den Saal an, um mich zu akklimatisieren und den Soundcheck zu machen. Danach gehe ich zurück ins Hotel und versuche, ein wenig zu schlafen. Dann stehe ich auf, lasse mir ein heißes Bad ein und bleibe mit geschlossenen Augen lange in der Wanne liegen, vergesse alles um mich herum. Vergessen erfordert Disziplin. Eine Stunde vor dem Konzert lasse ich mir eine Suppe bringen, eine Fischsuppe oder Caldo Verde, irgendeine, nur keine Tomatensuppe, ich kann Tomatensuppe nicht ausstehen, und esse sie langsam, Löffel für Löffel, und auch das ist eine Übung im Vergessen. Ich kleide mich an und trete auf. Nach dem Konzert empfange ich einige Leute in der Garderobe. Anschließend speise ich mit den Musikern – manchmal auch mit irgendeinem VIP, einem Völlig Idiotischen Prominenten – und danach gehe ich zurück ins Hotel, schlucke eine Valium und schlafe zwölf Stunden am Stück. Ein weißer Schlaf, vollkommen frei von Träumen, ohne Farben, ohne Töne, ohne Gefühle. Nach dem Aufwachen ist es, als würde ich immer noch schlafen. Auch wach träume ich nicht. Ich stehe auf und muss schon zum Flughafen.
Ich habe keine Zeit, etwas zu spüren.
Ich habe keine Zeit zu spüren, verstehen Sie? Ich kann nicht innehalten. Ich darf keine Zeit haben, etwas zu spüren. Ich will nichts spüren.
In dem Moment, in dem ich wieder etwas spüre, sterbe ich vor Gefühl.
Der Abgrund, ja, und so weiter …
Ich übertreibe?! Glauben Sie, ich übertreibe?
Sie haben recht. Ich bin dramatisch veranlagt, kulturell und von meiner Bildung her. Wir Angolaner sind einfach ein wenig theatralisch, nicht wahr? Wir lieben die Übertreibung. Auf der anderen Seite neige ich dazu, an die Figur zu glauben, die ich auf der Bühne verkörpere. Oft spreche ich so, wie ich singe, verwende, ohne es zu merken, Verse aus meinen Liedern. Meine, sage ich, aber es sind gar nicht meine, wie Sie ja wissen. Die Komponisten kommen zu mir, bieten mir ihre Kompositionen an. Viele komponieren ausschließlich für mich. Sie wissen, was meine Stimme kann, dreieinhalb Oktaven, und komponieren für mich. Dem einen oder anderen gebe ich auch Verse, die mir gefallen, und lasse sie die Melodien finden, die in diesen Versen wohnen. Ich lese viele Gedichte. Gedichte und Klatschzeitungen lese ich. Durch die Lyrik kann ich die unterschiedlichsten Gefühle erleben, Sehnsucht, Empörung, Melancholie, als wäre da eine andere Person, die für mich empfindet. Es sind keine echten Gefühle. Oder anders: Sie sind so echt wie Sonnenlicht, das durch eine Gardine fällt. Es ist immer noch Sonnenlicht, aber es tut nicht mehr weh. Die Klatschzeitungen erzählen auch vom Leben. Dem von wirklichen Menschen, das trotzdem nicht echt ist. Wie meines, in dem auch nicht viel Leben steckt.
Nur auf der Bühne erlaube ich mir Gefühle. Auf der Bühne, ja, sterbe ich vor Gefühlen. Doch natürlich ist auch dieser Tod nur gespielt. Ich spüre alles, was ich singe, es schmerzt mir in der Brust, manchmal weine ich sogar, und diese Tränen sind echt. … Sie sehen schon, wir sprechen wieder von Wahrheit …
Ich kehre dem Publikum den Rücken zu, um meine Tränen zu verbergen, wische sie mit der freien Hand weg, es ist mir peinlich, dass die Leute mich so aufrichtig, so wehrlos sehen, so als mich selbst, wo es doch nur eine Inszenierung sein soll. Doch während ich die Verse singe, jeden für sich, einen nach dem anderen, in einer Reihenfolge, die sich von Konzert zu Konzert wiederholt, während ich sie singe und spüre und weine und mir die Augen brennen, weiß ich, dass ich nicht sterbe. Es gibt Abende, an denen möchte ich sterben, tatsächlich sterben, und zwar genau dort unter dem Scheinwerferlicht, aber mein Herz schlägt einfach weiter.
Ich bin in einem kleinen Fischerort zur Welt gekommen. Das einzige nennenswerte Gebäude der Stadt war eine Fischmehlfabrik. Ich kann mich an die Fabrik nicht mehr erinnern, also wie sie aussah, wahrscheinlich ein niedriger Quader, schmutzig und vom Salz angefressen. Erinnern kann ich mich an den Geruch. Noch heute ist mir dieser Geruch gegenwärtiger als jedes Bild. Meine Eltern arbeiteten in der Fischmehlfabrik. Nein, sie waren keine Arbeiter, sondern die Besitzer. Meine Mutter war Stewardess gewesen, mein Vater Pianist. Ich kann die Haare meiner Mutter riechen, die meines Vaters nicht, denn er hat keine mehr, und sie riechen nach Fischmehl.
Einmal sagte mir ein Journalist: »Ihre Stadt gibt es nicht mehr. Sie ist verschwunden. Sie wurde von allen Menschen verlassen, danach kam der Sand und hat sie verschlungen.«
Das sagte er mir forsch ins Gesicht, um mich zu schocken. Er hatte einen Fotografen dabei. Natürlich wollte er meine Tränen anschließend zu Geld machen. Ich gab mir Mühe und setzte das Lächeln auf, mit dem ich auf der Bühne meine Musiker tadele, wenn sie sich verspielen. Ich lächle und das wirkt, als würde ich sie ohrfeigen, aber nur sie verstehen es. Ich erwiderte: »Ich habe keine Vergangenheit. Sie können suchen, solange Sie wollen, Herr Journalist, Sie werden nichts finden. Weder eine Geburtsstadt noch ein Geburtsland, keine Freunde aus Kindertagen. Nichts! Nichts und noch mal nichts! Ich werde auf jeder Bühne neu geboren, manchmal ja, manchmal nein, manchmal Abend für Abend hintereinander, und zuletzt sterbe ich auf der Bühne. Mich gibt es nicht, außer auf der Bühne. An den Abenden, an denen ich nicht singe, existiere ich auch nicht.
Der Journalist, ein Typ namens Chambão, Malaquias Chambão, kennen Sie ihn? Ich sehe seine Visage noch vor mir, ein Mäusegesicht, ich sehe, wie er die Mundwinkel verzieht zu einem bleichen Lächeln. Grausame Zähne, winzig und gelb. Eine düstere Stimme, irgendwie dumpf, als spräche er unter einer Kapuze hervor. Stellen Sie sich einen Terroristen vor mit einer Sturmhaube über dem Kopf, einen von der ETA oder der IRA, einen Taliban, einen Terroristen eben. Stellen Sie sich dessen Stimme vor. So war seine Stimme.
»Sie existieren doch jeden Abend«, sagte er zu mir. »Es gab Sie schon, bevor Sie berühmt wurden. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sie bereits als Kind gekannt haben. Ich weiß viel über Sie und Ihre Familie. Dinge, über die Sie normalerweise nicht sprechen. Ich glaube, es ist Ihnen peinlich, und ich glaube, das ist gar nicht nötig. Im Gegenteil, Sie sollten sehr stolz darauf sein.«
Saurer Atem. Tiefe Augenringe auf schlaffer Haut. Vielleicht war er krank. Ich habe entsetzliche Angst vor Krankheiten. Also stand ich auf und erklärte das Interview für beendet. Ich mag keine Journalisten, aber ich bin gezwungen, mit ihnen umzugehen, sie anzulächeln. Als lebte man in einem Haus voller Skorpione und müsste sie jeden Tag küssen, anstatt sie zu zertreten. Ich umarme sie – die Journalisten –, umarme und küsse sie, und wir tauschen Erinnerungen aus an frühere Begegnungen. Manche bringen mir Geschenke. Ich heuchle Freude, lächle. Lächle ständig. In meinem Beruf ist ein gutes Lächeln oft wichtiger als eine gute Stimme. Die meisten Menschen können eine außerordentlich gute Stimme nicht von einer leidlich guten unterscheiden. Nur wenige merken, wenn ein Sänger falsch singt, doch alle sind hingerissen von einem netten Lächeln, selbst wenn es falsch ist.
Möchten Sie wissen, wie alles begann?
Im Bauch meiner Mutter. Mein Vater ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, Italiener. Er kam aus politischen Gründen nach Angola und verliebte sich in die traditionelle Musik. Er lernte Quissanje spielen. Meistens spielte er auf einem wunderschönen Instrument, das heute mir gehört, direkt am Bauch meiner Mutter. Er glaubte, das Wesen der Tiefe, halb Fisch, halb Mensch, das ich zu dieser Zeit war, könne, wenn nicht den Klang, so doch wenigstens die Schwingungen hören und begreifen.
»Du warst von Anfang an recht unruhig«, sagt Papa immer, wenn er sich an diese Momente erinnert, und lacht. Er lacht gern. »Du hast den ganzen Tag im Bauch deiner Mutter gezappelt. Wenn ich Quissanje spielte, wurdest du ruhig. Ich hörte auf, und du hast wieder getreten. Ich spielte große Quissanje-Konzerte nur für dich allein.«
Später ließ er die Quissanje zusammen mit Jazz und mit brasilianischer Popmusik erklingen: Charles Mingus, Ron Carter, Ray Brown, der, wie Sie wissen, mit Ella Fitzgerald verheiratet war. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Os Novos Baianos. Die Kopfhörer legte er direkt auf den riesigen Bauch von Mama. Er ließ mich auch die sanfte Stimme von Nat King Cole hören. Papa mochte Nat King Cole sehr. »The boulevard of broken dreams«, »I don’t want to see tomorrow«, »Impossible«, all das.
Na ja, wem gefällt das nicht?
Ihnen nicht?
Na ja, Bartolomeu sagte mir schon, dass Sie einen seltsamen Geschmack haben. Entschuldigung, verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht beleidigen. Deswegen bin ich nicht hergekommen. Sie wissen, warum ich hier bin, Bárbara, nicht wahr?
Ich war glücklich mit ihr und glaube doch, dass ich sie nie wirklich gekannt habe. Hätte ich sie gekannt, wäre ich dann auch glücklich gewesen?
Daran muss ich die ganze Zeit denken.
Was ich sagen will, ist, dass ich nach all diesen Jahren noch immer an Kianda denken muss. Als ich sie zum ersten Mal singen hörte, war sie mir ein komplettes Rätsel. Ich glaube, das war, bevor sie die erste Platte aufnahm.
In mein Tagebuch schrieb ich:
»Lissabon. Heute habe ich an einer Podiumsdiskussion über Literatur und Identität teilgenommen. Ist gut gelaufen. Nach dem Abendessen war ich mit einer Gruppe lateinamerikanischer Schriftsteller in einer kleinen Bar in der Mouraria. Backsteinwände, Zementboden, eine kleine Bühne. Eine junge Angolanerin sang Jazz. Eigenkompositionen, ein paar traditionelle afrikanische Stücke und alte Sachen von N’Gola Ritmos, als Jazz arrangiert. Großer Gott, was für eine Stimme! Zum Klang einer solchen Stimme würde ich gern jeden Tag aufwachen.«
Es war keine glückliche Begegnung. Wir haben uns gestritten. Rückblickend bin ich mir noch heute nicht sicher, was geschehen ist. Kianda hatte mich provoziert, ich hatte reagiert. Ein kurzer, heftiger Schlagabtausch, so absurd, dass die Lateinamerikaner fälschlicherweise dachten, wir würden uns kennen.
Wir hatten sie singen hören und konnten über nichts anderes mehr reden, denn es war klar, hier in dieser geschichtslosen Bar wurde gerade ein Star geboren. Ich weiß, das klingt albern, aber in diesem Moment – ich schwöre es! – klang es kein bisschen albern. Nicht einmal abgedroschen. Genauer gesagt, es war ein Satz, der genau auf diesen Moment passte. Es war, wie bei einer Geburt zuzusehen, nur ohne Blut, ohne Schreie, ohne die pompöse Angestrengtheit einer Geburt. Kianda brachte ihre Stimme, wohin sie wollte, in unvorstellbare Höhen, was bei ihr nicht nur leicht, sondern geradezu unvermeidlich wirkte. Wir warteten, bis sie aufgehört hatte zu singen. Einer der Schriftsteller, ein rundlicher, jovialer Mexikaner mit einem stattlichen Schnurrbart – die Karikatur eines Mexikaners –, beschloss, sie von der Bühne zu holen, führte sie an unseren Tisch und stellte uns ohne große Umschweife vor.
»Sie schreiben, die armen Teufel. Das ist das Einzige, was sie können. Sie leben von ihrer Geschwätzigkeit.«
Kianda wirkte etwas angespannt und eingeschüchtert. Sie bestellte einen schwarzen Tee. Sie lese nur wenig, flüsterte sie, und wenn, dann fast nur Gedichte. Ein Kolumbianer, ein älterer Herr schon, würdig, aber dekadent wie ein verfallener Palast, beeilte sich zu betonen, dass er auch Verse schrieb. Und überreichte ihr ein dünnes, trauriges Büchlein, dessen völlig unpassenden Titel ich nie vergessen habe, auch wenn ich den Namen des Autors nicht mehr weiß: »Alles über Gott«. Anschließend sprachen wir über brasilianische Musik. Irgendwann, und mehr, um das Gespräch in Gang zu halten, als aus wirklicher Überzeugung, erklärte ich mich zum Anhänger der Thesen des Musikhistorikers und -kritikers José Ramos Tinhorão über die Bossa Nova. Tinhorão war nie ein Freund der Bossa Nova. Er sagt, die Schöpfer der Bossa Nova, junge Komponisten aus der Mittelschicht, hätten sich der Volkskultur bemächtigt und in den Dienst der großen Plattenfirmen und des amerikanischen Kulturimperialismus gestellt. Kianda lächelte und behielt ihren neutralen Ton bei, mit dem sie bis dahin all unsere Fragen beantwortet hatte. Doch auf mich wirkte es wie eine Ohrfeige: »Tom Jobim ist also nichts anderes als ein zufällig in Brasilien geborener Broadway-Komponist?«
»Sie haben recht«, erwiderte ich irritiert. »Tinhorão hat manchmal übertrieben …«
»Was Sie Übertreibung nennen, nenne ich Dummheit.«
Sie stand auf und entschuldigte sich, sie müsse jetzt gehen. Sie sei müde und habe Kopfschmerzen. Als sie weg war, drehten sich die lateinamerikanischen Schriftsteller feixend zu mir um.