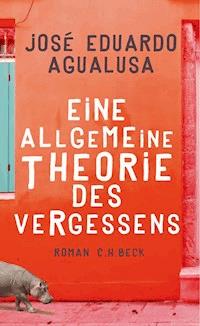12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Faustino Manso, ein berühmter angolanischer Musiker, hinterlässt nach seinem Tod sieben Frauen und achtzehn Kinder. Als seine jüngste Tochter Laurentina, eine in Portugal lebende Filmemacherin, von ihrem leiblichen Vater erfährt, reist sie nach Angola, um das turbulente Leben des verstorbenen Musikers nachzuzeichnen. Faustinos Spuren führen Laurentina und ihre drei Mitreisenden – Mandume, Bartolomeu und Pouca Sorte – durch die Küstenstädte des südlichen Afrika. Auf ihrer Suche lernen sie Faustinos Frauen, Musikerkollegen und Kinder kennen, und es entsteht das Bild eines Mannes, der durch Charme und Musik einen tiefen Eindruck im Leben vieler Menschen hinterlassen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Ähnliche
Über dieses Buch
Faustino Manso, ein berühmter angolanischer Musiker, hinterlässt sieben Frauen und achtzehn Kinder. Als seine jüngste Tochter Laurentina von ihrem leiblichen Vater erfährt, fliegt sie nach Angola, um mehr über ihn herauszufinden. Die Spurensuche führt sie auf eine abenteuerliche Reise, in eine Welt voller Musik, Poesie und Leidenschaft.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
José Eduardo Agualusa (*1960 in Angola) veröffentlicht Gedichte, Erzählungen und Romane. Er wurde u. a. mit dem International Dublin Literary Award ausgezeichnet und war für den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt nominiert. Er lebt in Portugal, Angola und Brasilien.
Zur Webseite von José Eduardo Agualusa.
Michael Kegler wurde 1967 in Gießen geboren und hat einen Teil seiner Kindheit in Liberia und Brasilien verbracht. Er arbeitete als Buchhändler und Journalist und übersetzt seit Ende der Neunzigerjahre aus dem Portugiesischen. 2014 erhielt er den Straelener Übersetzerpreis.
Zur Webseite von Michael Kegler.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
José Eduardo Agualusa
Die Frauen meines Vaters
Roman
Aus dem Portugiesischen von Michael Kegler
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2007 bei Publicações Dom Quixote, Lissabon.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2010 im A1 Verlag, München.
Originaltitel: As Mulheres do Meu Pai
Die erste Ausgabe dieses Werks im Unionsverlag erschien am 15.7.2019
© José Eduardo Agualusa, 2007
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit der Literarischen Agentur Mertin, Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am Main
© by Unionsverlag, Zürich 2019
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Al Martin (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31020-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 08.04.2019, 16:54h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE FRAUEN MEINES VATERS
Erster Satz — allegro ma non troppo
Oncócua im Süden Angolas — Sonntag, den 6. November 2005
Grundlegende Lügen
Brief von Doroteia an Laurentina
Sünde ist es, nicht zu lieben
Rio de Janeiro, Brasilien — Freitag, den 24. Juni 2004
Über die Wurzeln
Träume riechen besser als die Realität
Die Beerdigung
Durban, Südafrika — Sonntag, 23. März 2006
Luanda, Angola — Sonntag, 1. Oktober 2006
Das Mädchen und das Huhn
Dário Reis
Quicombo, Angola — Sonntag, 30. Oktober 2005
Benguela, Angola — Montag, 31. Oktober 2005
Die Abfahrt
Lobito, Angola — Montag, 31. Oktober 2005
Der Unfall
Fatita de Matos, unglückliche Geliebte
Lubango, im Süden Angolas — Mittwoch, 2. November 2005
Die erste Meerfrau war tot
Die Stille der Schachspieler
Fragmente eines Interviews mit Victória Manso
Ein Held am Straßenrand
Fragmente eines Interviews mit Oberst Babaera Manso
Albino Amadors Geheimnis
Canyon, im Süden Angolas — Donnerstag, 3. November 2005
Ort und Identität
Das Geheimnis der Chamäleons
Espinheira, im Süden Angolas — Freitag, 4. November 2005
Oncócua, im Süden Angolas — Samstag, 5. November 2005
Ein anderer Anfang
Zweiter Satz — andante
Swakopmund, Namibia — Montag, 7. November 2005
Wlotzkas Baken
Moose’s Bar
Restaurant 1° de Maio, Lissabon — Dienstag, 27. Juli 2006
Sérgio Guerras Wohnung in Salvador, Brasilien — Montag, 31. Juli 2006
Über die Zivilisation
Long Street: Wo der Regenbogen beginnt
Eine ungewöhnliche Visitenkarte
Hotel Daddy Long Legs, Cape Town — Dienstag, 15. November 2005
Serafim Kussel über Faustino Manso
Die Aktivistin
Eine Vergewaltigung oder jedenfalls fast
Von der Liebe und vom Tod
Niemand verliebt sich in einen Bekannten
Wo zum ersten Mal von Elisa Mucavele die Rede ist
Trans-Karoo-Express, irgendwo zwischen Kapstadt und Johannesburg, Südafrika — Donnerstag, 17. November 2005
Das rote Haus
Dritter Satz — Menuett
Chez Rangel, Maputo — Freitag, 18. November 2005
Der Pianist ohne Hände
Ein Gespenst mit Beffchen
Triumph der Aufrichtigkeit
Jardim dos Namorados, Maputo — 14. September 2006
Die verlorenen Hände von Faustino Manso
Malaria
Elisas Augen
Fremde Gedanken
Die Tochter der Heilerin
Herrin des Landes
Pousada Vila Nagardás, Quelimane — 12. September 2006
Wir müssen reden!
Das Haus
Beredte Muscheln
Aphrodisiakum, Afrodisiakum
Bier, Lupinenkerne und Geschichten
Ilha de Moçambique — Samstag, 19. November 2005
Die Terrasse unter dem Frangipanibaum
Alines Traum
Ein Schuss im Morgengrauen
Die Rückkehr des Lächelns und zwei oder drei außergewöhnliche Enthüllungen
Meine Mutter, Dona Alima
Vierter Satz — presto e finale
Luanda, Angola — Samstag, 11. März 2006
Die Tänzerin
Rückkehr ins Chaos
Eine Epiphanie, oder besser: ihr Gegenteil
Ein neuer Onkel
Ein Kenotaph
Verspätung
Was das Leben von Träumen unterscheidet
Feindliche Brüder
Schwanger
Es spricht Alfonsina, die das Meer liebt
Der Mann mit dem roten Motorroller
Funje am Samstag
Durban, Südafrika — Sonntag, 23. März 2006
Der Rächer oder Lob der Euthanasie
Luanda, Angola — 16. Februar 2007
Die wahre Geschichte von Faustino Manso
Familiengericht
Rostige Träume und andere
Arquimedes Moran
Diamantenjäger
Ein grauer Tag
Eine Überraschung
Die Briefe von Faustino Manso an Seretha du Toit. Fragmente
Luanda, Angola — 4. März 2007
Senhor Malan
Fast das Ende oder auch nicht
Morans Erfindung
Das Geheimnis von Albino Amador wird enthüllt
Mandume spricht zum letzten Mal
Faustino Manso und die Staatssicherheit
Auszug eines Berichts der Abteilung Information und Sicherheit über den Bürger Faustino Manso, Musiker, Verwaltungsangestellter. Ohne Unterschrift
Auszug des Abhörprotokolls eines Telefonats zwischen dem Bürger Faustino Manso, Musiker, Verwaltungsangestellter, und der Hausfrau Fátima, genannt Fatita, de Matos, seiner Geliebten bzw. Ex-Geliebten in Benguela
Auszug eines Berichts der Abteilung Information und Sicherheit über den Bürger Faustino Manso, Musiker, Verwaltungsangestellter. Gez. Agent Ermelindo Lindo, Deckname Caxexe
Brief von Alima an ihre Tochter Laurentina
Laurentina findet ihren Vater
Hotel Terminus, Lobito, Angola — 16. März 2007
Glossar
Personenregister
Anmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über José Eduardo Agualusa
José Eduardo Agualusa: »Das Fantastische ist Teil der angolanischen Realität.«
Über Michael Kegler
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von José Eduardo Agualusa
Zum Thema Angola
Zum Thema Südafrika
Zum Thema Afrika
Zum Thema Musik
Für Karen Boswall, mit der ich Faustino Mansound seine Frauen entdeckte.Für Jordi Burch, der uns auf dieser Reise begleitete.Für Sérgio Guerra, der sie ermöglichte.
Erster Satz
allegro ma non troppo
Oncócua im Süden Angolas
Sonntag, den 6. November 2005
Ich erwachte umgeben von schimmerndem Licht. Ich träumte von Laurentina. Sie redete mit ihrem Vater, der, warum auch immer, aussah wie Nelson Mandela. Es war Nelson Mandela und es war ihr Vater, und in meinem Traum erschien mir das alles vollkommen normal. Sie saßen an einem Tisch aus dunklem Holz, in einer Küche, die aussah wie die in meiner Wohnung in Lissabon, im Stadtteil Lapa. Und ich träumte einen Satz. Das passiert mir öfter. Der Satz lautete: »Aus wie vielen Wahrheiten besteht eine Lüge?«
Das Licht wurde durch ein feines Netz vor dem Fenster gefiltert und noch einmal vom Moskitonetz über dem Bett. Unglaublich rein, unglaublich kräftig steckte es die Wirklichkeit mit seinem eigenen Staunen an. Ich drehte mich um und sah in Karens Gesicht. Sie schlief. Wenn sie schläft, ist Karen wieder jung, so jung, wie sie wohl vor ihrer Krankheit (dem Fluch) war.
Wir sind in Oncócua in einer kleinen, von einer deutschen Hilfsorganisation betriebenen Sanitätsstation. Oncócua wurde, wie viele andere Orte in Angola, mit breiten Straßen angelegt, um in der Zukunft einmal eine große Stadt zu werden. Doch die Zukunft hat sich verspätet. Kommt vielleicht nie. Ich stand vorsichtig auf und schaute aus dem Fenster. Ein riesiger Berg in der Form eines perfekten Kegels schwebte am Horizont. Zwei Mucubal-Frauen kamen lautlos näher. Die größere war kaum älter als sechzehn, schmale Taille, bunte Armbänder um die feinen, goldfarbenen Handgelenke; als ich sie sah, musste ich an einen Vers von Ruy Duarte de Carvalho denken – »die Brüste: zerbrechliche Dornen auf dem Rippenschild«. Ruy Duarte hat schöne Verse geschrieben über die Brüste der Mucubal-Mädchen. Ich kann ihn gut verstehen. Wäre ich Dichter, ich hätte kein anderes Thema. Die andere Frau hatte ihren Körper mit einem grüngelb gemusterten Tuch bedeckt. Sie hinkte ein wenig.
»Sie sind schön, nicht wahr?«
Karen saß auf der Bettkante, das braune Haar zerzaust. Ich sagte: »Ich habe von Laurentina geträumt …«
»Wirklich? Das ist gut. Figuren beginnen von dem Moment an zu existieren, in dem sie uns im Traum erscheinen.«
»In meinem Traum war sie Inderin. Ein schönes Mädchen mit glattem Haar, großen Augen und sehr dunkler Haut.«
»Das kann nicht sein. Vielleicht halb Inderin, vergiss nicht, ihr Vater ist Portugiese.«
»Der Vater? Welcher denn?«
»Gute Frage. Faustino Manso war aus Luanda, Mulatte oder schwarz. Der, der sie adoptiert hat, war Portugiese, und der biologische …«
»Das haben wir nicht bedacht.«
»Du hast recht, das haben wir nicht bedacht. Wer zum Teufel war der wirkliche Vater von Laurentina?«
Grundlegende Lügen
Ich schließe die Augen und im selben Moment bin ich wieder bei dem Nachmittag, an dem meine Mutter starb. Mein Vater empfing mich an der Zimmertür.
»Sie ist sehr aufgewühlt«, murmelte er. »Versuche sie zu beruhigen.«
Ich ging hinein. Sah ihre wachen Augen im Halbdunkel.
»Tochter!« Sie legte mir einen Umschlag in die Hand. »Man ruft mich. Ich muss gehen. Das hier ist für dich, Laurentina. Verzeih mir …«
Ich sagte nichts mehr. Später war Mandume gekommen. Ich erinnere mich, wie er am Bett kniete und die Hand meiner Mutter hielt. Mein Vater kehrte uns den Rücken zu. Mein Vater, oder besser: der Mann, von dem ich bis zu diesem Abend gedacht hatte, dass er mein Vater sei. Nun sitzt er vor mir. Er hat ein herbes Gesicht, knochig, mit hervorstehenden Wangen, volles, graues Haar, zurückgekämmt. Die Frage muss er nächtelang eingeübt haben in der Einsamkeit seines Witwerzimmers.
»Aus wie vielen Wahrheiten besteht eine Lüge?« Er schweigt einen Moment lang, die Augen starr auf einen Punkt hinter mir gerichtet, dann setzt er heftig hinzu: »Viele, Laurentina, viele! Eine Lüge muss, um zu funktionieren, aus sehr vielen Wahrheiten bestehen.« Glänzende, feuchte Augen. Er lächelt traurig. »Es war eine gute Lüge, unsere Lüge, aus vielen glücklichen Wahrheiten. Die Liebe zum Beispiel, die Doroteia für dich empfand, war echte Mutterliebe. Das weißt du, nicht wahr?«
Ich sehe ihn ängstlich an. Stehe auf und gehe ans Fenster. Von dort kann ich den sonnenbeschienenen Hof sehen. Den Feigenbaum, den ich vor Jahren gerettet habe, als ich ihn aus einem kleinen zerbrochenen Kübel auf einer Müllhalde zog und in einen riesigen Keramiktopf pflanzte. Es geht ihm gut neben dem langen Schornstein aus Backsteinen, mitten im Hof. Er ist um einiges gewachsen und schief, wie es Feigenbäume so an sich haben.
Die Bougainvillea weiter hinten hat schon alle Blüten abgeworfen. Der Januar neigt sich dem Ende zu. Ein schlechter Monat zum Sterben, auch in Lissabon, wo selbst im Winter hin und wieder, versprengt und verschlafen wie Mohnblumen in einem Kornfeld, zwei oder drei strahlende Sommertage vorkommen.
Mein Vater hätte gern gehabt, dass ich ein Junge geworden wäre. Bis ich zwölf Jahre alt war, kaufte er mir, ungeachtet der Proteste meiner Mutter, kurze Hosen und Kappen und spielte Fußball mit mir. Wir haben eine starke Beziehung zueinander. Schon immer.
»Die Ilha, Papa, wie ist das Wetter in Mosambik um diese Jahreszeit?«
Die Frage überrascht ihn nicht. Ich glaube, er ist froh, dass er das Thema wechseln kann. Er seufzt. »Im Januar«, sagt er, »ist es meistens sehr heiß auf der Ilha. Das Meer strahlt grün, das Wasser ist fast übertrieben warm, Tochter, es wird bis zu fünfunddreißig Grad warm, eine Smaragdsuppe.« Er zieht eine Münze aus der Tasche. »Erinnerst du dich?«
Natürlich erinnere ich mich. Ich nehme die Münze. Zwanzig Réis. Sie ist abgegriffen, trotzdem kann ich das Datum erkennen: »1824«. Mein Vater fand die Münze an einem Strand auf der Ilha, am ersten Tag, den er dort verbrachte, dem Tag, an dem er meine Mutter kennenlernte. Doroteia war fünfzehn Jahre alt, Dário neunundvierzig. Das war am 18. Dezember 1973. Zwei Jahre später wurde ich geboren. Daran muss ich denken, an meine Geburt, und eine plötzliche Wut steigt in mir auf. Ich merke, wie meine Stimme lauter wird, und weine fast. Ich will nicht weinen1: »Ich bin hier, um zu verstehen, wie ihr in der Lage wart, so etwas all die Jahre vor mir geheim zu halten! Kannst du mir das erklären?«
Dário duckt sich wie ein kleiner Junge. In meinem Büro an der Wand hängt ein gerahmtes Foto von Nelson Mandela und eines von meinem Vater gleich daneben. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden, trotz ihrer unterschiedlichen Hautfarbe, erstaunt alle.
»Ich habe oft mit deiner Mutter über deine Geburt geredet. Ich wollte es dir sagen, aber Doroteia hat mich nicht gelassen. Es gibt Wahrheiten, sagte sie, die mehr lügen als jede Lüge. Deine Mutter, deine biologische Mutter, wollte dich nicht behalten. Sie war ein fünfzehnjähriges Mädchen, Tochter der reichsten Leute der Ilha, eines indischen Händlers. Sie verliebte sich in einen angolanischen Musiker, der aus Quelimane gekommen war und ein wenig blieb. Sie wurde schwanger. Der Mann ging fort, zurück nach Luanda, soweit ich weiß, und das Mädchen wurde verrückt vor Kummer. Aß nichts mehr. Ihr Vater wollte sie umbringen, als er herausfand, dass sie schwanger war, wollte sie aus dem Haus werfen, ein Wahnsinn, aber die Mutter verhinderte es. Der Vater hoffte, sie würden bei der Geburt sterben. Sie und das Kind. Er fand, das sei besser für alle Beteiligten.«
»Erinnerst du dich an den Namen des Musikers?«
»Ich erinnere mich, Lau, natürlich erinnere ich mich. Ich erinnere mich auch an den Namen des Mädchens, sie war ja noch ein Mädchen, deine biologische Mutter: Alima. Den Musiker, den kannten alle. Er war sehr bekannt damals.«
»Wie bekannt?«
»Bekannt, wie man eben bekannt ist! Er hatte mehrere Platten aufgenommen, Singles, und seine Lieder wurden oft im Radio gespielt. Er war ein distinguierter Herr, sehr elegant, ich kann mich erinnern, dass er stets gut gekleidet war. Ein Schwarzer, ein dunkler Mulatte vielleicht, in feinstes weißes Leinen gekleidet, mit einem Einstecktuch, das aus seiner Brusttasche lugte, dort, wo das Herz sitzt. Ah, und das ist wichtig, seine zweifarbigen Schuhe, und auf dem Kopf, den er stets hoch erhoben trug, ein prächtiger Panamahut.«
»Wie hieß er?«
»Faustino. Faustino Manso. Das war ein Typ, dieser Faustino Manso.«
Brief von Doroteia an Laurentina
Liebe Tochter,
ich werde dich Tochter nennen bis zum Ende.
Es gibt etwas, das du wissen musst, und ich will, dass du es von mir erfährst, denn wenn du es bisher nicht erfahren hast, so war das nur meine Schuld, mir fehlte der Mut.
Du bist nicht aus meinem Leib geboren. An dem Tag, als du geboren wurdest, verlor ich ein Mädchen. In dem Zimmer, in dem ich lag, in einem einfachen Krankenhaus auf der Ilha de Moçambique, brachte noch eine Frau ein Kind auf die Welt. Die Geburt verlief kompliziert, und sie hat nicht überlebt. Die Eltern dieser Frau fragten mich, ob ich das Kind haben wolle – und ich sagte Ja. Von dem Moment an, als ich dich sah, liebte ich dich wie mein eigenes Kind.
Das wollte ich dir sagen. Verzeih mir, dass ich es nicht früher gesagt habe. Kümmere dich um deinen Vater. Ich mache mir Sorgen um ihn. Dário kann nicht allein leben. Wir haben uns manchmal gestritten. Ich glaube, ich war oft viel zu hart mit ihm. Doch ich liebe ihn sehr, verstehst du? Er war der einzige Mann in meinem Leben. Es war schwer für mich zu akzeptieren, dass er andere Frauen vor mir hatte, schlimmer noch – während er mit mir zusammen war. Aber so sind die Männer.
Du warst das Beste, was mir das Leben gegeben hat.
Deine Mutter
Doroteia
Sünde ist es, nicht zu lieben
Ein unglücklicher Zufall. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Faustino Manso, mein Vater, ist gestern Abend gestorben. Am Flughafen kaufte ich kurz nach der Landung das »Jornal de Angola«. Die Meldung, kurz und trocken, stand auf der Kulturseite: »Seripipi Viajante gestorben – In der Nacht auf gestern ist nach langer schwerer Krankheit Faustino Manso (81) in der Klinik Sagrada Esperança, Ilha de Luanda, verstorben. Manso, den seine Bewunderer Seripipi Viajante, den reisenden Vogel, nannten, war in den sechziger und siebziger Jahren ein nicht nur in Angola, sondern im gesamten südlichen Afrika bekannter Musiker. Er lebte in verschiedenen Städten Angolas sowie in Kapstadt, Südafrika, und in Maputo, Mosambik, dem damaligen Lourenço Marques. 1975 kehrte er kurz nach der Unabhängigkeit in seine Geburtsstadt Luanda zurück und war dort lange am Nationalen Institut für Bücher und Schallplatten tätig. Er hinterlässt eine Witwe, Senhora Anacleta Correia da Silva Manso, sowie drei Kinder und zwölf Enkel.«
Die Seite mit den Todesanzeigen sagt mehr. In gleich vier Anzeigen steht Faustino Mansos Name. Die erste ist von Anacleta Correia da Silva Manso unterzeichnet. Es ist die größte. Auch die Fotografie ist etwas größer und jüngeren Datums. Dort heißt es: »Du gingst ohne ein letztes Lebewohl, lieber Mann. Die Sonne meines Lebens ist erloschen. Eine großartige Stimme ist verstummt. Wer wird nun für mich singen, wenn ich sticke? Du hast mich betrogen, du versprachst, bei mir zu bleiben, bis das Ende gekommen ist, und mir die Hand zu halten, damit ich mich nicht fürchte. Jetzt habe ich Angst. Schließlich hast du mich doch verlassen, und die Reise ist so lang. Ich weiß nicht, ob ich dir verzeihen kann.«
Die zweite ist von den drei Kindern N’Gola, Francisca (Cuca) und João (Johnny) unterzeichnet. Das Foto zeigt Faustino Manso mit einer Gitarre im Arm. »Lieber Vater, erst spät lernten wir uns kennen, aber zum Glück nicht zu spät. Du gingst, aber du hast uns deine Lieder dagelassen. Heute singen wir mit dir: Kein Weg hat ein Ziel / Fern von deiner Umarmung.«
Die dritte und vierte Anzeige überraschten mich. Irritiert setzte ich mich auf meinen Koffer und bat Mandume, mir eine Flasche Wasser zu holen. Wahrscheinlich wurde mir erst in diesem Moment die Hitze bewusst, die feucht und undurchdringlich vom Boden aufstieg, sich an die Haut heftete, sich um meine Haare schlang und sauer war wie der Atem alter Leute. Eine gewisse Fatita de Matos aus Benguela unterzeichnete die einzige Anzeige ohne Bild. Der Text war kurz, aber deutlich: »Sünde ist es, nicht zu lieben. Noch schlimmer ist, nicht bis zum Ende der Liebe zu lieben. Ich bereue nichts, Tino, mein Seripipi. Ruhe in Frieden.«
In der letzten Anzeige posierte mein Vater für die Ewigkeit, mit der Kraft seiner dreißig Jahre, an einem Tisch in einer Bar. Vor sich eine Flasche Bier. Man kann das Etikett erkennen: Cuca. Während ich dies schreibe, trinke auch ich Cuca. Es ist gut, leicht und frisch. Ich lese den Text noch einmal: »Lieber Vater, gib Mutter einen Kuss, falls du sie triffst. Leopoldina hat so lange darauf gewartet. Sag ihr, ihre Kinder, eure Kinder, haben Sehnsucht, doch sie denken jeden Tag an euch. Euer Vorbild, euer Mut und eure Aufrichtigkeit leiten uns und werden uns immer leiten. Unser Land ist trauriger geworden ohne den fröhlichen Klang deines Kontrabasses. Wer wird ihn jetzt spielen? Deine Kinder Babaera und Smirnoff.«
Mandumes Eltern heirateten 1975 in Lissabon, sie waren damals zwanzig Jahre alt. Marcolino studierte Architektur, Manuela Krankenpflege. Vermutlich waren sie recht naiv und sie sind es noch heute. Manuela erzählte mir: »Zu dieser Zeit waren wir alle Nationalisten, es war wie eine Krankheit. Wir hassten Portugal. Wir wollten das Studium beenden und in die wehrhaften Schützengräben des Sozialismus in Afrika zurückkehren.«
Manuela gab mir alte Schallplatten aus Vinyl und mit angolanischer Musik. Einige Lieder erzählen von den wehrhaften Schützengräben des Sozialismus in Afrika. Genau so, ohne jeden Hauch von Ironie. Die portugiesische Bürokratie wollte nicht zulassen, dass sie ihren ersten Sohn Mutu nannten, nach einem König aus der zentralen Hochebene Angolas: Mutuya-Kevela. Also wurde er offiziell Marcelo genannt und Mutu nur von der Familie und Freunden. Mandume, der mittlere Sohn, heißt in Wahrheit Mariano, und Mandela, der jüngste, Martinho. 1977, als Mandume zur Welt kam, wurden beide Brüder Marcolinos in Luanda erschossen, weil ihnen vorgeworfen wurde, in einen Staatsstreich verwickelt gewesen zu sein. Marcolino hatte das sehr mitgenommen und er sprach nie wieder davon, zurückzukehren. Nach dem Studium hatte er eine Stelle in einem Architekturbüro bekommen, das einem gebürtigen Angolaner gehörte, die portugiesische Staatsbürgerschaft angenommen und sich nur noch auf die Arbeit konzentriert. Mandume lernte ich vor sieben Monaten kennen. Das Erste, was mir an ihm auffiel, waren seine Augen. Der Glanz seiner Augen. Sein Haar, in kleine abstehende Zöpfe geflochten, verleiht ihm etwas Rebellisches, das ganz im Gegensatz zu seinen sanften Bewegungen und seiner Stimme steht. Ich mag es, wie er geht. In der Welt, in der er sich bewegt, gibt es keine Reibung.
»Wie eine Katze?« Aline beugt sich, hauchend und mit feuchten Lippen, über den Tisch.
Wenn man sagt, jemand geht leichtfüßig, denken die Leute sofort an Katzen.
Nein, liebe Aline, Mandume wirkt nicht wie eine Katze. Wenn Katzen sich bewegen, strahlen sie Arroganz aus, eine hochmütige Verachtung der Menschheit, und das hat nichts mit Mandume zu tun. Er ist bescheiden und stolz zugleich. Zumindest sehe ich es so. Vielleicht nur mit meinen Augen. Vielleicht aus Liebe. Aline lachte. Ich denke daran, wie sie lachte, als ich ihr zum ersten Mal von Mandume erzählte. Sie hat ein schönes Lachen. Sie ist meine beste Freundin.
»Und Mandume, was bedeutet das?«
Mandume? Ach, auch ein König. Ein Soba der Cuanhama, der sich im Kampf gegen die Deutschen im Süden Angolas das Leben nahm. Mandume, meinen Mandume, interessiert es nicht weiter, wer die historische Figur war, nach der er benannt ist. Als ich ihn nach seinem Namen fragte, sagte er: »Mariano. Mariano Maciel.«
Und Mário, der Tontechniker, ein kleiner, bleicher Mann mit dünnen, aber langen, sehr blonden Haaren, hatte lächelnd entgegnet: »Oder auch Mandume, der weißeste Schwarze von ganz Portugal.«
Ein unglücklicher Satz. Ich hatte ihn angeblafft: »Ach ja? Soll das vielleicht eine Auszeichnung sein?«
Das hatte es sein sollen. Heute bin ich manchmal versucht, dem armen Mário zuzustimmen, und habe Mandume sogar selbst schon einmal so genannt. Es gibt Momente, in denen ich richtig verliebt bin in Mandume. Manchmal aber könnte ich ihn hassen. Seine Verachtung gegenüber Afrika macht mich wütend. Mandume hat beschlossen, Portugiese zu sein. Das ist sein Recht. Doch ich glaube nicht, dass man, um ein guter Portugiese zu sein, seine Vorfahren verleugnen muss. Ich bin sicher eine gute Portugiesin, doch ich empfinde mich auch ein bisschen als indisch, und schließlich bin ich nach Angola gekommen, um herauszufinden, was von Afrika ich in mir trage.
Mandume hat mich widerwillig begleitet.
»Bist du verrückt geworden? Was willst du denn in Afrika?«
Schließlich ist er mitgekommen, um mich vor Afrika zu retten. Um uns zu retten. Er ist ein Schatz, das weiß ich, ich muss geduldiger mit ihm sein. Außerdem gefällt mir, was er macht. Er verbringt den ganzen Tag damit, mich mit der Videokamera zu verfolgen. Ich sage ihm, nimm dieses oder jenes auf, und er gibt vor, es zu tun, doch dann sehe ich, dass er nur mich filmt.
Rio de Janeiro, Brasilien
Freitag, den 24. Juni 2004
10 Uhr – Gestern mit Karen zu Abend gegessen. Sie will unbedingt, dass ich ihr helfe, das Script zu einem Musical oder einem Musikfilm über die Situation der Frau im südlichen Afrika zu schreiben.
20 Uhr – Karen holte mich vom Hotel ab, dann gingen wir zum Strand. Einen Großteil des Vormittags und ein paar Stunden nach dem Mittagessen haben wir uns über den Film unterhalten. Ein Drehbuch skizziert. Wir wollen die Geschichte einer portugiesischen Dokumentarfilmerin erzählen, die nach Luanda reist, zur Beerdigung ihres Vaters Faustino Manso, einem berühmten angolanischen Sänger und Komponisten. Irgendwann beschließt Laurentina, den Weg ihres Vaters nachzuzeichnen, der in den sechziger und siebziger Jahren die gesamte Küstenregion des südlichen Afrika bereiste, von Luanda bis zur Ilha de Moçambique. Zwei, drei Jahre hielt sich Faustino jeweils in einer Stadt auf, manchmal auch länger, gründete eine Familie und machte sich dann wieder auf den Weg. In jeder Stadt, die sie besucht, zeichnet Laurentina Gespräche mit Faustinos Witwen, deren zahlreichen Kindern sowie vielen anderen Leuten auf, die Faustino gekannt haben. Das Bild, das sich nach und nach ergibt, ist das eines geheimnisvoll vielschichtigen Menschen. Am Ende findet Laurentina heraus, dass Faustino unfruchtbar war.
Zum ersten Mal sah ich Karen Boswall auf einer Bühne des französisch-mosambikanischen Kulturzentrums in Maputo. Eine Saxofonistin mit hellbraunen Haaren, mit schwarzen Ethnomustern im Gesicht und auf den Armen. Die übrigen Musiker an den Marimbas, Percussions und mit zwei Gitarren waren alle sehr jung und trugen gleiche Bemalungen mit weißer Farbe auf ihrer dunklen Haut. Die Gruppe hieß Timbila Muzimba. Sie erinnerte mich an Carlinhos Brown aus Bahia und sein Orchester Timbalada, das vor Jahren mit derselben Show und derselben fröhlichen und kraftvollen Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Rhythmen arbeitete. Das französisch-mosambikanische Kulturzentrum befindet sich im Gebäude des ehemaligen, 1896 erbauten Hotel Clube, das in der Kolonialzeit wegen seiner ausladenden Balkone und der eleganten schmiedeeisernen Säulen berühmt war. Es war im August 2003 während des Festival d’Agosto, einer Initiative des Teatro Trigo Limpo aus Tondela, Portugal, und der mosambikanischen Theatergruppe Mutumbela Gogo. Der Saal war voll. Rechts von mir stand ein elegant gekleideter Rastafari in hellblauem Anzug mit weißen Nadelstreifen und nickte im Rhythmus der Musik mit dem Kopf. Ich fragte ihn, ob die Saxofonistin Mosambikanerin sei.
»Negativ, brother«, sagte er und schüttelte seine Zöpfe. »Sie ist aus Zimbabwe.«
War sie nicht, doch das erfuhr ich erst ein Jahr später im September, auf den 31. Internationalen Filmfestspielen von Bahia. Ich war gerade vom Flughafen ins Hotel gekommen und füllte meine Meldekarte aus, als Karen mit einem gelben Koffer aus Kunststoff wie meiner und einem Metallkoffer für das Saxofon hereinkam. Ich erkannte sie nicht. Später stellte uns jemand vor, und selbst dann war mir noch nicht klar, dass diese große, gut aussehende Frau mit dem unverkennbar mosambikanischen Akzent diejenige war, die ich schon einmal Saxofon hatte spielen sehen. Karen war nach Salvador gekommen, um »Marrabentando«, einen ihrer Dokumentarfilme über mosambikanische Popmusik, zu zeigen. Jemand sagte zu mir: »Sie ist eine englische Filmemacherin, die seit fünfzehn Jahren in Mosambik lebt.«
Ich sah den Film auf einer Open-Air-Vorführung. Es war noch nicht dunkel, und rund um den kleinen Platz, wo die Organisatoren der Filmtage eine riesige Leinwand hatten aufstellen lassen, brodelte der Verkehr mit mechanischem Brausen. Das wenige, das ich erkennen und auch hören konnte, gefiel mir. Als der Film zu Ende war, kam Karen und spielte auf ihrem Saxofon. Erst da begriff ich, dass ich sie schon einmal gesehen hatte.
Über die Wurzeln
Mein Alter wollte nicht, dass ich hierherfahre. Ich sollte mich hüten, sagte er, vor den Leuten, vor allem vor den freundlichen und redseligen, die anstatt eines Händedrucks gleich ihre Arme ausbreiten: »Erst umarmen sie dich, mein Sohn, und dann erwürgen sie dich.«
Er hätte mich nicht warnen müssen. Ich mochte Afrika noch nie. Ich habe gesehen, wie Afrika meine Eltern zerstört hat. Habe ein paar Bücher gelesen, die sie in ihrem Büro haben, so Zeug, das andere »angolanische Literatur« nennen: »Der Sieg ist sicher, Genosse!«, »Poesie ist eine Waffe«, »Roter Samstag«. Politische Pamphlete, zumeist mit den Füßen geschrieben.
Wurzeln? Pflanzen haben Wurzeln, deswegen können sie nicht weg. Ich hingegen habe keine Wurzeln. Ich bin ein freier Mensch. War frei, bis ich Laurentina kennenlernte. Ich sage zu ihr: »Du bist meine Heimat, meine Vergangenheit, meine ganze Zukunft.«
Sie lacht spöttisch. Versteht mich nicht. Doroteia mochte mich. Ich mochte sie. Ich hielt ihre Hand im Krankenhaus, als sie starb. Laurentina litt sehr unter dem Tod ihrer Mutter. Kurz bevor die Mutter starb, gab sie ihr einen Brief. Darin stand, dass sie adoptiert worden war. Und sofort hatte Laurentina sich in ihren sturen Kopf gesetzt, ihre biologischen Eltern kennenlernen zu wollen. Ich war entsetzt, als sie mir sagte, sie wolle nach Afrika zurück.
»Bist zu verrückt geworden? Was suchst du denn in Afrika?«
Wurzeln. Sie wollte Wurzeln suchen.
»Bäume haben Wurzeln«, brüllte ich, »weder ich noch du sind Afrikaner.«
Sie hörte mir nicht zu. Laurentina ist stur. Oder entschlossen, wie der alte Dário es ausdrückt. Sicher ist, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, bringt sie nichts mehr davon ab. Aber das war noch nicht alles. Ich schlug ihr vor, einen Dokumentarfilm über ihre Rückkehr nach Afrika und das Wiedersehen mit der Familie zu drehen. Ihr gefiel die Idee.
Und nun sind wir hier.
Träume riechen besser als die Realität
Mein Vater ist ein Mann der Leidenschaften. Ein paar Jahre lang widmete er sich der Fotografie und dem Film. Er kaufte eine Super-8-Kamera, die er überallhin mitschleppte. Wegen ihm und seiner Begeisterung und auch wegen dieser alten Kamera, die heute mir gehört, wurde ich Dokumentarfilmerin. Ich erinnere mich, wie Dário – ich war damals noch Teenager – in Lissabon eine kleine Leinwand im Wohnzimmer aufstellte und Dias oder Filme über Lourenço Marques oder die Ilha de Moçambique zeigte. Auf einem bin ich zu sehen, kaum älter als ein Jahr, in einem Schwimmbad, mit einem Schwimmreif, der aussieht wie eine Ente, und ich schlage mit beiden Händen aufs Wasser.
Dário betrachtete die Bilder schweigend und nippte an einem Martini. Am Ende seufzte er: »Ach Mosambik! Das waren glückliche Jahre. Manchmal träume ich von dieser Zeit. Dann wache ich auf, und das Bett riecht nach Afrika. Wer den Duft Afrikas nicht kennt, weiß nicht, wie Leben riecht!«
Als das Flugzeug in Luanda landete und die Türen aufgingen, blieb ich einen Moment oben auf der Treppe stehen und atmete tief ein. Ich wollte den Duft Afrikas aufnehmen. Mandume schüttelte missmutig den Kopf. »Scheiß Hitze!« Ich wurde böse. »Wir haben noch keinen Boden unter den Füßen und du meckerst schon. Kannst du dich nicht über schöne Dinge freuen?«
»Was für schöne Dinge?«
»Was weiß ich, den Duft zum Beispiel. Den Geruch Afrikas!«
Mandume schaute mich entgeistert an. »Der Duft Afrikas? Es riecht nach Pisse, verdammt!«
Ich schwieg. Denn er hatte recht.
Die Beerdigung
Heute Nachmittag ist Faustino Manso beerdigt worden. Ich trug eine dunkelblaue Bluse, einen schwarzen engen Rock und schwarze Strümpfe. Das Haar hatte ich im Nacken zusammengebunden. Mandume mag es, wenn ich das Haar so trage. Er meint, ich wirke dann größer. Ich bin groß. Einsfünfundsiebzig, zehn Zentimeter kleiner als er. Ich rief in der Rezeption an und bat, mir ein Taxi zu rufen. Man erklärte mir, dass es in Luanda keine Taxis gebe, zumindest nicht das, was wir in Europa darunter verstünden, aber man könne mir einen Fahrer mit eigenem Wagen besorgen. Das war mir recht. Eine halbe Stunde später erschien der Fahrer, ein schöner Mann, hager, mit hervorstehenden Wangenknochen und einem eckigen Kinn. Ich fragte ihn nach seinem Namen.
»Pouca Sorte, Mädchen.«
Das »Mädchen« gefiel mir. Seit Jahren hatte mich niemand mehr so genannt. Über den Namen wunderte ich mich. »Pouca Sorte, Pechvogel? Das ist natürlich ein Spitzname. Wie heißen Sie wirklich?«
»Albino. Albino Amador. Man nennt mich Pouca Sorte, weil die Frauen nichts von mir wissen wollen.« Das sagte er mit einem spitzbübischen Lächeln und ließ dabei ein paar ebenmäßige, strahlende Zähne erkennen. Pouca Sorte hat eine tiefe Stimme und einen fröhlichen, aber diskreten Ton, eleganter als die meisten.
Das Auto, ein blauer Lieferwagen wie es Tausende hier in Luanda gibt, heißt Malembelembe. In schwarzen Buchstaben steht der Name auf der Heckscheibe. Ich fragte ihn, was das bedeute.
Wieder lächelte Pouca Sorte sein fröhliches Lächeln. »Malembelembe sagt man hier für langsam. Es geht langsam voran.«
Mandume kam mit. Es waren viele Leute auf dem Friedhof am Alto das Cruzes. Sie schienen sich alle zu kennen. Sie umarmten sich. Manche Frauen weinten an der Schulter anderer Frauen. Niemand störte sich an uns. Ein Mann mit einem üppigen, störrischen Patriarchenbart trat neben die Urne, hob die Stimme und sprach, zur Menge gewandt, lange über das Leben meines Vaters. Einiges davon konnte ich aufschreiben:
»Faustino Manso sah ich zum ersten Mal, da war er zwölf Jahre alt und ich keine zehn, im Haus meines Vaters, an dem Tag, an dem Joe Louis Max Schmeling schlug. Mein Vater war damals einer der wenigen Leute in Luanda, die ein Radio hatten. Ich weiß noch, wie wir alle um den Apparat herumsaßen, und erinnere mich an die Freude, als Joe Louis den Deutschen gleich in der ersten Runde zu Boden schickte und wieder Weltmeister im Schwergewicht wurde. Gleich nach der Übertragung des Kampfes erklang ein Piano. Da erhob sich Faustino und verkündete: ›Wenn ich groß bin, will ich Pianist werden.‹ Das sagte er mit einer solchen Überzeugung, dass niemand lachte […]«
»Bitte verzeihen Sie mir, aber ich will die große Leidenschaft nicht verschweigen, die mein Freund für das schöne Geschlecht hegte. Faustino liebte die Frauen […] Es stimmt, dass er gesagt hat, von allen Frauen, die er gehabt hat, hätte er nur eine einzige geliebt, Dona Anacleta, seine Ehefrau, und ich glaube, das stimmt, denn schließlich ist er in ihre Arme zurückgekehrt, nachdem er mehr als zwanzig Jahre durch Afrika gezogen ist […]«
»Faustino, mein alter Freund, das Leben ist ein schneller Traum. Ich schaue zurück und sehe dich Fußball spielen – du warst ein schlechter Spieler – mit Velhinho, Mascote, Camauindo, Antoninho, dem Sohn von Moreira aus der Kneipe, der Mannschaftskapitän war. Ich erinnere mich außerdem an Zeca Pequenino, unseren Torwart, der später sogar Profi geworden ist, fast berühmt geworden wäre und sich nicht mehr an uns erinnert. Wer kennt ihn heute noch? Ich schaue zurück und sehe dich, Jahre später, wie du auf den Tanzveranstaltungen der Liga Africana Klavier spielst […]«
»Einmal, da warst du schon lange weg, kam ich nach Lourenço Marques, und jemand nahm mich mit ins Hotel Polana. Als ich in den Salon kam, begann der Pianist, Muxima zu spielen. Das warst du, schon mit ein paar weißen Haaren, aber immer noch jung und elegant. Du sagtest zu mir: ›Schwarze kommen hier nicht rein‹, und wirklich, wir waren die einzigen farbigen Männer. Du ließest ein paar von deinen Lachern los, voller Leben, voller Klang und Zorn und fügtest hinzu: ›Ich komme mir vor wie eine Gazelle, die in einem Rudel Löwen weidet. Der Trick ist, die Mähne zu schütteln und dabei laut zu brüllen.‹ Tatsache ist, dass Faustino Manso immer überall hineinkam, wo er wollte. Er hat sich nie an einer Tür abweisen lassen und nie hat es jemand gewagt, ihn an der Tür abzuweisen […]«
Als der Alte fertig war, trat eine beinahe vollkommene Stille ein. Insekten summten. Mir fielen die Frangipanibäume auf, ohne Blätter, aber voller Blüten. Große weiße Blüten mit fünf Blütenblättern ruhten auf den nackten Zweigen wie aufgewirbelte Schneeflocken. Ein steinerner Engel betete kniend gleich rechts von mir. Ich trat einen Schritt vor. Vor der Urne stand eine alte Frau, sehr elegant, sehr zerbrechlich, auf zwei andere Frauen gestützt. Ich sah, wie sie ihren Blick hob und zu singen begann, erst mit einem brüchigen Stimmchen und dann, als hätte sie Flügel bekommen, in einer Sprache ohne Kanten, die nur zum Singen geschaffen zu sein schien. Nach und nach schlossen sich der Witwe andere Frauen an, dann alle Männer und schließlich die Kinder, ein perfekter Chor. Die Melodie war von erschreckender Schönheit. Mir fiel erst auf, dass ich weinte, als ein bildschönes Mädchen, schlank und mit kurzem Haar wie ein Junge, aber blond gefärbt, mir ein Päckchen Papiertaschentücher entgegenstreckte.
»Nimm, Cousine, behalte sie. Ich habe mich vorbereitet. Das tue ich immer.«
»Cousine?«
»Sind wir denn keine Cousinen? Ich glaube, wir alle hier sind Cousins und Cousinen. Ich bin Merengue, die Tochter von General N’Gola.«
Merengue war es dann auch, die mich Dona Anacleta vorstellte. Die alte Dame schaute mich einen Moment lang argwöhnisch an.
»Entschuldige, Mädchen, ich kann mich an dich nicht erinnern. Du bist die Tochter von …?«
Ich nahm meinen Mut zusammen.
»Ich bin eine Tochter des Verstorbenen«, antwortete ich. »Ich bin eine Tochter Ihres Mannes.« Ich dachte, sie würde sauer werden. Fürchtete, sie würde mich schreiend vom Friedhof vertreiben. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie umarmte mich mit ehrlicher Herzlichkeit, fast glücklich.
»Du bist noch so jung. Wie alt bist du? Dreißig? Du kannst nur das Nesthäkchen sein, Laurentina. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Kind. Willkommen in deiner Familie.«
So fand ich mich nach der Beerdigung im Haus von General N’Gola wieder, dem zweiten Sohn von Anacleta. Das Haus lag am Ende einer heruntergekommenen, staubigen Straße ohne Bäume, die zu einem kleinen Hügel voller Baracken führte. Merengue, meine Nichte, erzählte mir, dass in dieser Straße zu Kolonialzeiten die obere Mittelschicht gewohnt habe. Heute stehen dort sehr schöne, sehr gepflegte, wenn auch hinter hohen Mauern versteckte Häuser neben anderen, die fast zusammenfallen. Merengue sagte mir auch, dass Häuser in Luanda ein Vermögen kosten, selbst die heruntergekommenen. Viele seien kurz nach der Unabhängigkeit von armen Bauern besetzt worden, die aus den Musseques gekommen seien und die Häuser anschließend ausgeschlachtet und abgewohnt hätten. Und sie jetzt zu Fantasiepreisen, eine Million Dollar oder mehr, verkauften und dann verschwänden. Ich staunte. Gerne würde ich einen Film über einen dieser Hausbesetzer drehen. Herausfinden, was ein armer Mensch tut, der plötzlich eine Million Dollar bekommt. Wo geht er hin? Mandume dagegen ist erschüttert und jammert ununterbrochen über den Lärm, den chaotischen Straßenverkehr, die ziellos umhertreibenden Menschenmassen in den Straßen.
Ich sagte: »Energie!«
»Energie?«
»Energie. Was ich spüre, ist Energie. Diese Stadt pulsiert.«
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch nicht, ob ich sie liebe oder hasse. Luanda meine ich.
Die Villa von General N’Gola lag in einem großen tropischen Garten mit Palmen, Bananenstauden und einem Teich mit Springbrunnen und roten Fischen. Rund um ein herrliches Schwimmbecken standen zahlreiche runde Eisentische. Die Leute plauderten. Aßen und tranken. Am Tisch, an den wir gesetzt wurden, saß bereits ein junger Unternehmer – »Ich importiere Wein und Spirituosen«, sagte er, als er sich vorstellte – mit seiner Frau, einem dicken Mädchen mit makellosem Gesicht, frisch diplomiert in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Rio de Janeiro. Außerdem noch ein hoch gewachsener junger Mann mit breiten Schultern, der mich mit fröhlicher Offenheit begrüßte.
»Tante Laurentina, stimmt’s? Oma hat es mir schon erzählt. Es wurden Wetten abgeschlossen, wie viele Kinder von Großvater Faustino, unbekannte natürlich, auf der Beerdigung auftauchen würden. Zwei sind gekommen. Sie und ein Militär aus dem Süden.«
Ich muss rot geworden sein. Er bemerkte mein Unbehagen.
»Ach was, ärgern Sie sich nicht. Sie sind Teil der Familie. Es tut mir leid, dass Sie den Alten nicht mehr lebend kennenlernen konnten. Er war ein außergewöhnlicher Mensch. Wir alle freuen uns, dass Sie gekommen sind. Vor allem ich, weil ich jetzt eine so schöne Tante habe. Habe ich mich schon vorgestellt? Entschuldigung, mein Name ist Bartolomeu, Bartolomeu Falcato, ich bin der älteste Sohn von Cuca.«
Mandume unterbrach ihn: »Wie viele Kinder hatte Ihr Großvater?«
Bartolomeu lachte. Und der Unternehmer und seine Frau lachten mit.
»Großmutter sagt immer, achtzehn. Sieben Frauen und achtzehn Kinder.«
»Er war ein afrikanischer Mann.« Der Unternehmer zwinkerte mir verschwörerisch zu. »Wir hier in Afrika wissen noch, wie man Kinder macht, nicht so wie ihr in Europa. Europa wird doch nur noch von den afrikanischen Einwanderern vor dem Untergang bewahrt. Die Europäer machen schon längst keine Kinder mehr. Sie haben wahrscheinlich Besseres zu tun.«
»Wie viele Kinder haben Sie?«
»Ich? Nur eins, aber ich bin ja noch jung.«
»Jung? Du bist dreiunddreißig, mein Lieber. Hierzulande bist du schon ein alter Mann«, sagte Bartolomeu und lachte. »Denk daran, dass die Lebenserwartung in Angola bei zweiundvierzig Jahren liegt. Ein Kind, das in Portugal zur Welt kommt, kann es auf siebenundsiebzig bringen. Ein dreiunddreißigjähriger Angolaner entspricht einem achtundsechzigjährigen Portugiesen, als Afrikaner bist du ein Versager!«
»Und Sie, wie viele Kinder haben Sie?«
»Kein einziges, liebe Tante. Ich bin ein kompletter Fehlschlag. Das fängt schon bei dieser Hautfarbe an, die mich als Afrikaner total unglaubwürdig macht. Vor einem Monat war ich in Durban auf einem Schriftstellertreffen. Da gab es Autoren aus verschiedenen Ländern des sogenannten Schwarzafrika, außerdem einen Amerikaner, einen Inder und eine junge Indonesierin, zum Sterben schön, aber das nur nebenbei. Einige der Schriftsteller staunten, als ich mich ihnen vorstellte: ›Bartolomeu Falcato aus Angola.‹ Zwei wollten wissen, ob ich einen portugiesischen Pass hätte. Die dritte Person, die mir diese Frage stellte, die junge Indonesierin, erwischte es. Ich explodierte. In meinem Land interessierten sich nur Grenzbeamte für Pässe, sagte ich zu ihr und fragte, ob sie für die Einwanderungsbehörde arbeite. Damit hatte ich natürlich eine schöne Feindin gewonnen. Möchten Sie meinen Pass sehen, Tante? Lesen Sie hier, wo Hautfarbe steht, sehen Sie? Da steht ›weiß‹. Mein älterer Bruder, am Tisch dort drüben, der Schwarze, ist als schwarz eingestuft worden. Wir sind Kinder desselben Vaters und derselben Mutter. Zumindest die Mutter ist sicher.«
»He, Bartolomeu!«, schimpfte der junge Unternehmer. »Etwas mehr Respekt vor den Älteren!«
Bartolomeu lachte. Es war wie auf einem Geburtstagsfest, auch wenn ich sah, wie die eine oder andere Dame mit dem Taschentuch eine flüchtige Träne wegwischte. Nur Dona Anacleta nicht. Sie thronte am längsten Tisch, sehr aufrecht und würdevoll, und kommandierte die Hausangestellten mit der bloßen Autorität ihres Blickes. Bartolomeu legte mir seine Hand auf den Arm.
»Ich hörte, Sie sind Dokumentarfilmerin.«
»Ja, lieber Neffe, das mache ich seit einiger Zeit.«
»Dann haben wir noch etwas gemeinsam, außer dass wir verwandt sind. Ich arbeite für das Fernsehen. Hier können wir ›das Fernsehen‹ sagen, denn es gibt nur eines. Ich habe Filmwissenschaften in Kuba studiert. Und außerdem schreibe ich. Ich habe schon zwei Romane veröffentlicht.«
Mandume starrte auf die Hand. Aber er sagte nichts. Bartolomeu fuhr fort: »Ich hörte auch, dass Sie einen Dokumentarfilm über Ihre Reise planen.«
»Woher wissen Sie das?«
»In diesem Land erfährt man alles. Ich möchte einen Vorschlag machen. Vielleicht interessiert er Sie …«
»Ich gehe nur auf ernste Vorschläge ein.«
»Es ist ernst gemeint, liebe Tante. Ich würde gern mit dir filmen, wir duzen uns, einverstanden? Ich würde gern mit dir einen Dokumentarfilm machen, über das Leben des alten Faustino. Ein Roadmovie. Meine Idee wäre, mit einem guten Geländewagen in Luanda aufzubrechen und alle Städte zu besuchen, in denen er gelebt hat: Benguela, Moçâmedes, Kapstadt, Maputo, Quelimane und die Ilha de Moçambique. Wir interviewen Menschen, die ihn kannten, Musiker, die mit ihm gearbeitet haben. Hugh Masekela zum Beispiel, wusstest du, dass der Alte mit dem großen Hugh Masekela gespielt hat?«
Das wusste ich nicht. Ich schreibe diese Zeilen in unserem Zimmer im Hotel Panorama, einem eleganten Gebäude auf dem Sand der Ilha de Luanda. Mit Blick auf das Meer und mit dem Meer im Rücken. Durch das Fenster sehe ich die Lichter der Stadt, wie sie sich im dunklen Spiegel der Bucht vervielfachen. Bei Nacht und von hier aus betrachtet sieht Luanda wie eine riesige, entwickelte Metropole aus. Die Dunkelheit überdeckt den Müll und das Chaos. Ich muss an meinen Vater denken.
Ich fragte Mandume, was er von Bartolomeus Vorschlag hielt.
»Totaler Schwachsinn!«, brüllte er. »Wir wollten nicht mehr, als das Zusammentreffen mit deiner Familie filmen. Jetzt bleiben wir noch zwei Wochen, wie ausgemacht, und dann fliegen wir nach Portugal zurück.«
Ich versuchte, ihn zu überzeugen. Je mehr ich über das Projekt meines jungen Neffen nachdenke, desto mehr kann ich mich dafür begeistern. Ich sagte ihm, dass ich das für eine sehr gute Idee hielte und dass es mir guttäte, denn es würde mir helfen, meinen Vater zu finden. Und in Mosambik würde ich Alima suchen können, meine biologische Mutter.
Man stelle sich vor, ich fände meine Mutter?
»Ja, und wenn du sie findest, was sagst du dann zu ihr?« Mandume ironisch: »Hallo Mutter, ich bin deine Tochter. Die Tochter, von der du dachtest, sie sei bei der Geburt gestorben.«
Ich wurde sauer und schrie: »Es reicht mir mit dir!«
Wütend verließ Mandume das Zimmer. Er schlug die Tür hinter sich zu. Es ist schon nach ein Uhr, und er ist immer noch nicht zurück.
Durban, Südafrika
Sonntag, 23. März 2006
Fragmente eines Interviews mit Karen Boswall
Ich bin die Tochter einer Lehrerin und eines Chemikers. Mein Vater wurde 1924 in Portsmouth geboren, einer Hafenstadt der britischen Armada. Er hat einiges abbekommen im Zweiten Weltkrieg, der Hafen, nicht mein Vater. Mein Vater war Sohn eines Seemanns und eines Zimmermädchens, eine von denen aus der viktorianischen Zeit, die im Erdgeschoss mit den übrigen Dienern warteten, bis der Hausherr oder die Dame des Hauses sie mit einer Klingel riefen. Sein Vater war nie zu Hause. Im Krieg meldete er sich zur Marine und starb früh. Arme Leute. Die Schwester meines Vaters starb an Tuberkulose. Sie war wohl eine der letzten in England, die noch an Tuberkulose gestorben sind. Meine Mutter wurde 1927 geboren, in Beaminster, einem Dorf im Hinterland von Dorset, im Südosten Englands. Als Tochter von Farmeiros, Kleinbauern. Bevor sie heirateten, waren meine Großeltern Schauspieler. Meine Großmutter war mit einem anderen Mann verlobt gewesen. Sie lernte meinen Großvater kennen, als sie die Kate, und so hieß sie tatsächlich, in ›Much Ado about Nothing‹ von Shakespeare spielte. Mein Großvater spielte den Lehrer. Sie verliebten sich, was ein Skandal war in den zwanziger Jahren, denn meine Großmutter sagte ihre geplante Hochzeit ab und floh mit meinem Großvater. Später gingen sie nach Portsmouth und eröffneten einen Lebensmittelladen. Mein Großvater lieferte Milch mit einem Pferdekarren in die Häuser. Meine Mutter ist eine umgängliche Frau, sehr sympathisch. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben studiert, sind aufgestiegen, jetzt sind sie beide pensioniert und leben trotzdem bis heute in der Angst, wieder in die Armut zurückzufallen. Ich wurde in London geboren, vierzehn Jahre nachdem meine Eltern geheiratet hatten. Meine Mutter bekam zuerst einen Sohn, der starb, dann meine Schwester und drei Jahre später mich. Mein Vater wollte keine Kinder. Er behandelte uns sehr distanziert. Ich glaube, ich bin so, wie ich heute bin, weil ich immer die Liebe meines Vaters suchte. Er malte, er war ein guter Maler, und spielte Geige, Zigeunergeige. Er stammte aus einer Zigeunerfamilie. Ich glaube, wir haben Verbindungen zum berühmten Circus Boswall […]«
»Mit sieben Jahren begann ich, Flöte zu spielen, danach Klarinette. Ich spielte sehr gut. Mit sechzehn trat ich bereits für Geld auf. Ich beschloss dann, auf Saxofon umzusteigen, um mich weiterzuentwickeln. Ich lernte auch Klavier. Zu dieser Zeit zog ich von zu Hause aus. Ich begann zu reisen. Erst arbeitete ich in Österreich, gab Japanern Englischunterricht, das waren interessante Gestalten, mehr oder weniger am Rande der Legalität. Gleichzeitig malte ich. Meine erste Einzelausstellung hatte ich mit achtzehn. Alle Bilder wurden verkauft. Mit einer Gruppe von klassischen Komponisten lebte ich auch sechs Monate in Israel. Damals begann ich zu komponieren. Ich ging zurück nach England und wandte mich von der klassischen Musik ab. Ich schloss mich einer Afro-Latin-Jazz-Band an, den ›Legless‹, so nennt man einen, der zu viel getrunken oder getanzt hat. Danach lebte ich in New York von einem Stipendium. Dort malte ich viel und entwarf große Multimedia-Installationen, sprechende Skulpturen, solche Sachen. Anfang der achtziger Jahre, zurück in London, spielte ich mit einer lesbischen Band, es war die Zeit der feministischen und ökologischen Bewegungen, der Solidarität mit den Bergarbeiterstreiks, der Demonstrationen gegen die Politik von Margaret Thatcher. Wir waren acht Frauen in der Band, und alle wollten mit mir ins Bett. Ich war die große Herausforderung. Wir waren viel unterwegs. Während der Tourneen, die manchmal wochenlang dauerten, durften wir mit keinem einzigen Mann reden. Wir übernachteten in Frauenhotels, gingen in Frauenkneipen und Frauenbars. Deutschland, Schweiz, Holland. Du gehst durch die Stadt und siehst diese rosa Winkel, mit denen homosexuelle Etablissements gekennzeichnet sind. Es gibt viele davon. Die meisten meiner Bandkolleginnen haben später Männer geheiratet. Nur noch zwei machen Musik. Ich bin nur einmal mit einer Frau ins Bett gegangen. Letztendlich ist nichts passiert. Nur ein paar Küsse. Das war nichts für mich […]«
»Anfang der achtziger Jahre begann ich mich für afrikanische Musik zu interessieren. Es gab eine Bar, in der afrikanische Musik gespielt wurde. Wir hörten unglaubliche Dinge. Der erste afrikanische Musiker, den ich für mich entdeckte, war Youssou N’Dour. Dann kamen Abdullah Ibrahim, Hugh Masekela, Fela Kuti, Manu Dibango […]«
»Nach Mosambik kam ich 1990, um Musik und Ton für einen Film des brasilianischen Regisseurs Sérgio Rezende zu machen: ›Ein Kind des Südens‹. Gleich an meinem ersten Tag spielte ich schon in einer mosambikanischen Band Saxofon. Dann ging ich wieder nach London zurück, aber als sie mich das nächste Mal für ein anderes Projekt engagierten, bin ich geblieben. […]«
»2002 bekam ich den Auftrag, einen Dokumentarfilm über HIV-infizierte Frauen zu drehen. Meine Idee war, das Drama von Antonieta zu erzählen, einer seropositiven Frau, modern und intelligent, die mit Unterstützung einer NGO davon lebt, andere Frauen für den Gebrauch von Kondomen zu sensibilisieren. Im Verlauf der Recherchen fiel mir auf, dass viele mosambikanische Frauen lieber den Traditionen treu bleiben, auch wenn sie damit ihre Gesundheit gefährden. Antonieta zum Beispiel beschließt irgendwann, ihre Tochter Matilde zu einem Initiationsritual mitzunehmen, in einem Dorf irgendwo im Hinterland von Zambézia. Sie weiß, dass die Unterweisungen, die ihre Tochter im Verlauf des Rituals bekommen wird, dem widersprechen, was sie selbst lehrt. Und doch ist es in ihren Augen das Wichtigste, die Geister nicht zu verärgern. Also beschloss ich, die Rituale zu filmen. Ich verbrachte Wochen in diesem Dorf. Um dorthin zu kommen, musste man stundenlang zu Fuß gehen. Einmal konnten wir uns Fahrräder leihen. Ich erinnere mich noch an den Mann, der sie uns vermietete. Nachdem er uns an der Straße abgesetzt hatte, nahm er das eine Fahrrad auf den Rücken und verschwand auf dem anderen kräftig strampelnd in Richtung Dorf, fünfzehn Kilometer die Trampelpfade bergauf und bergab […] Ich überlegte mir, ob auch ich die Rituale erfüllen sollte, selbst wenn sie mir Angst machten, denn die Frauen dort weiten seit ihrer Kindheit ihre Schamlippen. Ich nahm an, sie würden mich auch dazu zwingen, was zum Glück nicht der Fall war […] Wir waren ein Team von vier Leuten und filmten sieben Tage und Nächte lang. Die ganze Zeit über wurde getrommelt. Es gibt einen Ort, an dem die Männer Trommeln schlagen. Nur die Trommler dürfen das Ritual sehen, vier Trommler. Wir hatten weder Wasser noch Strom. Licht bekamen wir von riesigen Feuern. Ich hatte Gita Cerveira als Tontechniker dabei. Sidónio, mein Mann, war Produzent. Kameramann war Giulio Biccari, ein Italiener aus Kapstadt. […]
Jedes Mädchen hat eine Patin. Auch die Mütter kommen mit. Sie machen das Essen, während die Patinnen sich an einem geheimen Ort um die Mädchen kümmern. Jedes Ritual hat mit dem Leiden der Frauen zu tun. Die Frauen müssen den Männern dienen, ihnen Kinder und ein glückliches Sexualleben schenken. Es handelte sich nicht um Unterricht, sondern um symbolische Rituale, doch das begriff ich erst viel später. Damals, als ich filmte, verstand ich nicht, was da vor sich ging. Ich hatte sieben Übersetzer angeheuert, doch jeder erzählte mir eine jeweils andere Version. Nur wenige Leute, die Portugiesisch können, sprechen auch die Sprache dieser Region. Beim Schneiden des Films hatte ich das Gefühl, dass alles zwar fantastisch war, ich aber kein bisschen begriffen hatte […] Der Film bekam den Titel ›Na Corda Bamba/Dancing on the Edge‹, und zeigte kaum sechs Minuten lang Initiationsrituale. Natürlich hatte ich viel mehr Material, ich hätte allein daraus einen eigenen Dokumentarfilm machen können. Doch am Abend des 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, als bei der Premiere in einem Kino in Kapstadt die Szene mit den Ritualen lief, platzte der Wasserspeicher in dem neuen, schönen Gebäude, in dem ich arbeitete, und das ganze Rohmaterial wurde zerstört. Einige Filmrollen hatte ich zur Entwicklung an ein Labor in Kapstadt geschickt. Die Techniker riefen mich aufgeregt an: Die Negative waren verbrannt. Und dann wurde ich krank. Kaum einen Monat nachdem der Film fertiggestellt war, diagnostizierten mir die Ärzte Brustkrebs […]«
Luanda, Angola
Sonntag, 1. Oktober 2006
Auszug aus einem Text für den Katalog einer Ausstellung von Kiluange Liberdade, einem jungen angolanischen Künstler, der in Lissabon lebt, im portugiesischen Kulturzentrum
Luanda. Oder Lua (Mond), wie es zärtlich genannt wird. Oder Loanda. Literarisch: Luuanda (vgl. Luandino Vieira). Mit vollem Namen São Paulo da Assunção de Luanda, gegründet 1575 von Paulo Dias de Novais. Zwanzig Jahre später kamen die ersten zwölf weißen Frauen in die Ansiedlung, suchten sich sogleich Männer und bekamen Kinder. 1641 wurde die Stadt von den Holländern besetzt, die nur sieben Jahre später mit Pauken und Trompeten wieder abzogen. Am 15. August 1648 landete eine bunte Truppe von Weißen, Schwarzen und Indios, die ein unglaublich erfolgreicher Landbesitzer und Sklavenhalter aus Rio de Janeiro, gebürtiger Spanier aus Cádiz, Salvador Correia de Sá e Benevides, in seinen Galeonen nach Afrika verschifft hatte, in Luanda. Von einigen listigen Manövern Correia de Sás in die Irre geführt, ergaben sich mehr als tausend holländische Soldaten und hinterließen einer erschöpften Armee von kaum sechshundert Mann ihre weitgehend unbeschädigten Festungen.
So entstand ein wundervolles Durcheinander an Hautfarben, Sprachen, Dialekten, Pfeifen, Hupen und Trommeln, das im Lauf der Jahrhunderte nichts anderes tat, als sich zu perfektionieren. Chaos, das noch größeres Chaos hervorbringt.
Heute mischen sich in den Straßen Luandas das verschlungene Umbundu der Ovimbundos, Lingala (eine Sprache, die zum Singen geschaffen wurde) und das kratzende Französisch der Regrês. Das feine Portugiesisch der Bourgeoisie, das dumpfe Portugiesisch der Portugiesen, das selten zu hörende Kimbundu der echten Bessanganas. In jüngster Zeit gesellt sich das Pfeifen des elliptischen Mandarin der Chinesen dazu, ein Hauch von Spezereien des sonnigen Arabisch der Libanesen und sogar ein paar Worte wiederauferstandenes Hebräisch, gemächlich aufgelesen an Sonntagvormittagen in den edelsten Bars der Ilha de Luanda. Und natürlich Englisch, in den unterschiedlichen Varianten der Engländer, Amerikaner, Südafrikaner. Das fröhliche Portugiesisch der Brasilianer, das verzückte Spanisch des einen oder anderen hängen gebliebenen Kubaners.
Und all diese Leute schieben sich über die Bürgersteige, rempeln sich an Straßenecken an wie in einem weltumspannenden Blinde-Kuh-Spiel. Lyrische junge Männer, schwindsüchtige Mädchen. Firmen für private Hoffnungen. Und (noch einmal) Chinesen in Scharen. Zigaretten, Schlüssel, Batterien, Popcorn, Vorhängeschlösser, Kissen, Kleiderbügel, Parfum, Handys, Waagen, Schuhe, Radios, Tische, Staubsauger verkaufende Kinder. Mädchen, die sich selbst verkaufen vor den Türen der Hotels. Kleine Jungen, die Glitzerkram anpreisen, Spiegel, Alleskleber, Halsketten, Plastikbälle, Haargummis. Mädchen, die mit blonden Haaren handeln, »hundert Prozent menschlich«, Zöpfe zum Flechten. Krüppel, die ihre Prothesen zu Geld machen. Marktfrauen, die Papayas, Maracujas, Apfelsinen, Zitronen, Birnen, Äpfel, saftige Weintrauben und weitgereiste Kiwis feilbieten.
Onkel! He, Väterchen! Schau her, mein Freund. Schnäppchen! Nur heute für fünfhundert die Schallplatte, brother!
… Wasche Wäsche …
… Bewache Ihr Auto …
… Putze …
Wäre Luanda ein Vogel, es wäre ein riesiger Ara, trunken von Tiefe und Blau. Als Katastrophe ein Erdbeben: unbändige Energie, unisono die Tiefen der Erde erschütternd. Als Frau wäre es eine dunkelhäutige Dirne mit unglaublichen Schenkeln, üppigen Brüsten, die – schon ein wenig müde – nackt durch den Karneval tanzt. Wäre Luanda eine Krankheit, dann sicherlich ein Aneurysma.
Der Lärm erdrückt die Stadt wie ein Deckbett aus Stacheldraht. Mittags hallt die knapp werdende Luft. Motoren, Tausende und Abertausende Motoren von Autos, Generatoren, Maschinen, in rasender Bewegung. Kräne, die Gebäude errichten. Klagefrauen, die in langen Trauergesängen einen Toten beweinen, in irgendeiner Wohnung eines vornehmen Hauses. Und Schläge. Menschen, die sich keifend beschimpfen, Geschrei, Gebell, Lachen, Stöhnen, Rapper, die ihre Empörung hinausschreien über den unglaublichen Lärm des flammenden Chaos.
Das Mädchen und das Huhn
I