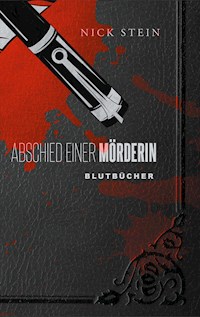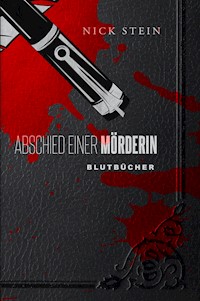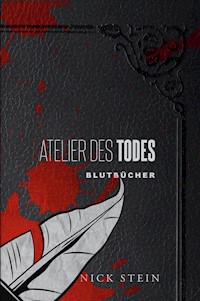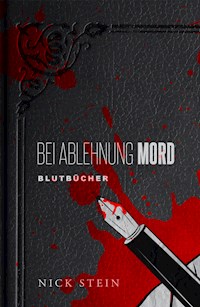
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Blutbücher
- Sprache: Deutsch
Was macht ein hoffnungsvoller Autor, wenn sein Roman ein ums andere Mal abgelehnt und verrissen wird? Gero von Witzleben lässt sich das nicht länger gefallen. Er beginnt, die fiesesten Lektoren und Literaturagenten spurlos verschwinden zu lassen, und baut diese Morde als neue Kapitel in seinen Krimi ein. Trotzdem muss er weitere Ablehnungen hinnehmen. Schließlich wähnt er sich am Ziel. Eine Lektorin interessiert sich für sein Werk und möchte es groß herausbringen. Aber auch die Polizei ist ihm auf den Fersen. Die Zeit rennt ihm davon. Wird er sein Ziel erreichen, bevor er erwischt wird? Ihm erwächst ein Widersacher, mit dem er nicht gerechnet hat. Er setzt alles auf eine Karte ... Muss man Lektoren, die ein Werk grundlos ablehnen, gleich umbringen? Man muss nicht. Aber man kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nick Stein
Bei Ablehnung Mord
Lektorkiller
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
Impressum neobooks
Kapitel 1
Bei Ablehnung Mord
Teil eins der Serie
Blutbücher
Nick Stein
Muss man Lektoren, die ein Werk grundlos ablehnen,
denn gleich umbringen?
Man muss nicht.
Aber man kann.
Im Café
Als die Frau am Nebentisch den Titel meines Buches aussprach, durchfuhr es mich wie ein Stromschlag. Mein Herzschlag beschleunigte sich, ich atmete tiefer. Vermutlich hatten sich auch meine Pupillen gerade aufs Doppelte ausgedehnt. War ich am Ziel meiner Wünsche?
Monatelang hatte ich nichts als Ablehnungen erhalten, wenn überhaupt eine Antwort gekommen war. Meist liefen die vom jeweiligen Verlag genannten Fristen einfach ab.
Ich saß in einem Straßencafé gegenüber vom Grauslinger Verlag in München, wie jeden Tag in den vergangenen zwei Wochen. Ich hatte mich schlau gemacht und wusste, dass die Lektorin für Krimis hier ab zwei Uhr mit ihrer Assistentin bei Kaffee und Kuchen die Einsendungen der letzten Zeit durchging. Die Fotos der beiden standen auf der Webseite von Grauslinger, und ich hatte alles über die beiden herausgefunden, was mir wichtig erschien.
Mona Meyer-Hinrichsen, eine sportliche Frau in den Dreißigern, und ihre Assistentin Lea Walter hatten bereits drei Ablehnungen hinter sich. Lea, frisch vom Studium, trug vor, was sie von den Leseproben hielt, und Mona schüttelte entweder gleich den Kopf oder ließ sich das Manuskript auf Wiedervorlage legen. Das hatte sie allerdings nur einmal in diesen zwei Wochen gemacht, bei der siebten Folge einer Krimiserie, deren ersten sechs Folgen ihr die Buchhändler aus den Händen gerissen hatten. Da war sie auf der sicheren Seite.
Würde mein »Lektorkiller«, den ich an Grauslinger geschickt hatte, das nächste Werk werden, das sie lesen wollte? Mein Herz pochte bis zum Hals, und ich versteckte mich tiefer hinter meiner Zeitung und lauschte dem Gespräch.
»Ich find’ den klasse«, sagte die Assistentin gerade. »Spannend. Da bringt so ein Autor die Lektoren, die ihn abgelehnt hatten, nicht nur einfach so um. Das ist erst der Einstieg. Er erniedrigt sie auch nach dem Tod noch weiter, und er macht das so geschickt, dass er mit seinen Morden davonkommt. Obwohl jeder weiß, dass er es war. Sowas wie ein perfektes Verbrechen. Ich konnte das gar nicht wieder aus der Hand legen.«
So etwas Positives hatte noch niemand über meinen Roman gesagt. Ich war so aufgeregt, dass sich meine Verdauung meldete, aber ich konnte hier jetzt unmöglich weg.
Die Lektorin saugte mit gespitzten Lippen den Schaum von ihrem Cappuccino und blieb stumm.
»Und? Möchtest du das lesen?«, strahlte Lea Walter ihre Chefin an.
Ja, ja, ja, sagte meine innere Stimme. Sag ja! Mach mir den Weg frei, Mona!
»Was hältst du davon?«, setzte Lea Walter nach.
Mona Meyer-Hinrichsen setzte ihre Tasse wieder ab. »Das ist doch a Schmarrn«, sagte sie. »Wieder so ein Arsch, das sich an einen Trend anhängen will. Diese Schwachköpfe gehen mir aufs Hirn, die depperten. Ich kann den Scheiß nicht mehr lesen. Schreib ihm, dass er sich zum Teufel scheren soll, und weiter in dem Stil. Aber nett wie immer, natürlich. Du weißt schon. Du formulierst das immer so schön. Oder antworte erst gar nicht, dann ersparst du dir die Rückfragen, Lea.«
Mir fiel die Kinnlade runter. Die Zeitung entglitt meinen Händen. Das durfte nicht wahr sein.
»Aber der ist wirklich gut«, verteidigte sich die Assistentin. »Ich würd’ ihn dir empfehlen.«
Ich nahm einen Schluck von meinem schon kalten Kaffee. Noch gab es Hoffnung. Aber eine böse Vorahnung schickte mir kalte Schauer über den Rücken.
»Das will doch keiner lesen«, entschied die Lektorin. »Das ist nicht im Trend. Bring mir einen Killer, der junge Mädchen im Keller foltert, das geht vielleicht noch. Mit einem knackigen Kommissar, der sie zum Schluss rettet. Die Jungfrau und ihr Held. Oder was von kaputten jungen Frauen, die es irgendwie trotzdem schaffen, ihr Ziel zu erreichen, in einer noch kaputteren Umwelt. Sowas läuft. Neben den Autoren, die sowieso laufen, die haben Vorrang. Aber lass mich mit diesem Dünnschiss in Ruhe. Solche Selbstbeweihräucherungen kannst du knicken, Lea. Total. Hast du sonst noch was?«
Ich stand auf. Ich musste dringend aufs Klo. Die letzten Worte dieser Frau hatten meinen Körper so erschüttert, dass ich nicht länger stillsitzen konnte. Das tat meiner Gesundheit nicht gut.
Und ich schwor mir, als ich bei den beiden vorbeiging, dass dieser Verriss der Gesundheit der Lektorin ebenso wenig guttun würde.
* * *
Als ich von der Toilette zurückkam, waren die beiden bereits wieder verschwunden. Ich setzte mich wieder an meinen Tisch.
Klar, ich war in den letzten Jahren aus der Übung gekommen. Mir fehlte die Praxis, und auch die Nonchalance, die mich früher so belebt und ausgezeichnet hatte. Vielleicht hatte ich einfach zu viel Zeit zum Nachdenken gehabt.
Aber das eben war zu viel gewesen. Das konnte ich mir nicht gefallen lassen. Nicht von so einer schnöseligen Lektorin, die den Job vermutlich auch nur durch Protektion erhalten hatte. Schade, dass die Assistentin nicht die Lektorin war, dachte ich.
Ich war einiges gewohnt. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Frau Meyer-Hinrichsen hatte eine rote Linie überschritten.
Ich bezahlte meinen Kaffee am Tresen und trat aus dem Café, den Blick auf das Verlagsgebäude gerichtet. Das war meine Ablehnung Nummer einhundertsechsundvierzig gewesen, wenn ich richtig gezählt hatte. Die fieseste von allen.
Ich wanderte durch die Straßen Münchens, zu keinem klaren Gedanken fähig. Einerseits musste ich Mona bestrafen. Andererseits wollte ich endlich meine Romane veröffentlichen, bis ich endlich so bekannt war, dass ich auch meine eigene Geschichte erzählen konnte.
Ihre Bestrafung musste ich mir sorgsam überlegen. Sie musste fehlerfrei vor sich gehen.
In der Zwischenzeit konnte ich meinen Roman aber auch gleich an die nächste Lektorin senden, die ich mir als Ziel ausgespäht hatte. Frau Herzog. Wenn ich das hinter mir hatte, konnte ich mich wieder Frau Meyer-Hinrichsen zuwenden.
Ich lenkte meine Schritte zu meiner kleinen Münchner Mietwohnung. Eine Stunde später saß ich vor meinem Computer.
Kapitel 2
Schreiben an Frau Herzog
Ich sah mir die Textprobe vom »Lektorkiller« noch mal durch, die ich an Frau Herzog schicken wollte. Der Text war für meinen Geschmack soweit ganz in Ordnung, und vermutlich auch für Frau Herzog. Jetzt konnte ich ihn an die Lektorin meiner Wahl absenden.
FrauCorinnaHerzog
Krimiredaktion
Verlag Buch und Leben
Frankfurt/Main
Per E-Mail
Betreff: Manuskript »Lektorkiller«
SehrgeehrteFrauHerzog,
waswürdenSiesagen,wennSiedasnächsteMordopferwerdensollen?Denndarumgehtes: EinbrutalerKillerbringtLektorenum,dieseineWerkeabgelehnthaben. UndergibtsichnichteinmalMühe,sichgroßzutarnenoderinSicherheitzubringen;ertarntsichdurchÖffentlichkeit. Allessprichtanfangsdagegen,dassausgerechneter,derMittelpunktderGesellschaft,der kaltblütigeTäterseinkönnte.
UnddochfälltesHauptkommissarStefanBeinundderhübschenOberkommissarinElenaDenizogluausEssenschwer,einenKillerzuüberführen,als derinihrerStadteineLiteraturagentinentführtundermordetunddieLeicheöffentlichzurSchaustellt. ZuvielefalscheSpuren,dieerausgelegthat,führenin die Irre,aberimmerglänzterineinerHauptrolle,währenddasErmittlerteamvoneinemFettnäpfcheninsnächstetapptundsichinsAbseitsmanövriert. ZumEndehinwerdendiebeidendurcheinanderesTeamersetztundmüssenhilfloszusehen,wieihreneuenKollegendaranscheitern,denmutmaßlichenTäter hinterSchlossundRiegelzubringen.
Der Killer lässt es nicht mit einem Fall bewenden. EinLiteraturagent muss dranglauben. Er und das erste Opfer sindPersonen,dieihren VerdächtigenalsAutorenabgelehnthaben. Zufall?
AlleOpferbefandensichindergleichenPositionwieSie,FrauHerzog. AuchIhnenkönntesoetwaszustoßen,solltees so einemKillereinfallen,sichanIhrenVerlagzuwenden. NatürlichgeschiehtdiesallesimReichderFiktion,nichtsdavonistrealodergarautobiografisch. AlsokeineAngst! Aberschonmorgenkönntesichsoetwaswirklichzutragen. UndSiekönntendasnächsteOpfersein! GuterStofffüreinenRoman?
Der TäterspieltmitseinenOpfern,aberauchmitseinenVerfolgern. Erweiß,dass sein Gegenspieler, KriminalhauptkommissarStefanBein,ProblememitseinemdrogensüchtigenSohnundmitseinervonderEhemaßlosenttäuschtenFrauEvahat,undernutztdaszuseinemVorteil. ElenaDenizoglu, die Partnerin von Bein,dagegenlässtsichaufseinecharmantenAvancenein,wosiedochgutdarangetanhätte,ihrverwirrtesGefühlslebenzuverdrängenoderanalysierenzulassen. Sie ahnt, dass ihr Lover mit dem gesuchten Killer identisch sein könnte, verdrängt ihren Verdacht aber immer wieder. Siehasstsichdafür. DennseltenhatihreinMannsogutgefallenundihrsogutgetan.
Abersieistnichtallein. Alssieherausfindet,dassihr LovernochandereAffärenhat,willsieihnumbringen,soeifersüchtigundwütendmachtsiedas. JetztkommenalleVerdachtsmomentewiederhoch,diesiemitsichherumgetragenundverdrängthatte,sieistsichnunsicher,ihr Loverwar’s,niemandanderes,abersiekannesnichtbeweisen. Sieschießtihnan,imletztenMomentkannStefanBeindenVerletztendavorbewahren,vonDenizogluerschossenzuwerden.
Hatte der Killerdasallessogeplant?
EristnunvomVerdächtigenzumOpfergeworden. DieAffärenfliegenauf,einVerfahrengegendenmutmaßlichenTätermussausstrafrechtlichenVerfahrensgründenniedergeschlagenwerden. Waresdas?Nichtganz. ElenaDenizoglujagtdenehemaligenGeliebtenjetztaufeigeneFaust,abererbleibtspurlosverschwunden. ErhatsichinLuftaufgelöst,nichtsvondem,wassichererschien,warreal. Der Spuk verfliegt, dasRuhrgebietwendetsichanderen Fällen zu.
Ein halbes Jahr später wird Elena Denizoglu totaufgefunden,ähnlichzugerichtetwiediefrüherenOpfer. Nur Stefan Bein, inzwischen zu Interpol gewechselt, jagt allein auf weiter Flur nach ihrem Mörder.
So vielalskurzeInhaltsangabe. MehrkönnenSiebittedenAnlagenentnehmen,daruntereineKurzbeschreibungunddieersten 30 SeitenalsLeseprobe.
DerKrimihat 280 Normseiten,einTitelbildistinArbeit. ErwendetsichaneinvorallemweiblichesPublikum,dasnebenMordenaucheinwenigRomanzeerwartet;inbeidenFällenistprickelndeErregunggarantiert. AuchregionaleAspektekommennichtzukurz.
WarumbrauchtdieliterarischeWeltdiesenRoman?Diese Mordekönntenjedentreffen,Lektoren,Agenten,Autoren,Verleger. Alledürfensichhierbetroffenfühlen. DieAutoren,dieihrenFrustundihreRachegefühlenachlesenkönnen;siewerdensichbestätigtfühlen. DieBuchindustrie,weildieRacheeinesdurchgeknalltenMöchtegern-Autorsauchsietreffenkann,jederzeit undüberall. EsgehtalsoummindestenseinehalbeMillionpotenziellerLeser. SchonbeizehnProzentdavonwärediesesBuchderBestsellerdesJahres.
LiebeFrauHerzog,ichfinde,SiesolltensichdieseguteChanceaufeinenweiterenErfolgnichtentgehenlassen. IchfreuemichaufIhrebaldigeRückantwort.
MitfreundlichenGrüßen
IhrHerbertHesse
Kapitel 3
Leseprobe für Frau Herzog
Lektorkiller
Herbert Hesse
___
»Der erste Fremde sticht«, sagte Stefan Bein zu seinen drei Mitspielern. »Ich habe Hochzeit!«
Bein freute sich, dass er mal wieder Zeit zum Doppelkopf gefunden hatte. Er wollte etwas tun für die Freundschaften, die er noch pflegte, und seine drei Mitspieler hatte er schon länger nicht mehr gesehen. Gelegenheit zum Kartenspielen und Biertrinken hatte der Kriminalhauptkommissar vielleicht zweimal im Jahr.
Hochzeit hatte er schon lange nicht mehr gefeiert. Er war verheiratet, ja, aber geschlafen hatte er mit seiner Frau Eva das letzte Mal vor drei oder vier Jahren, nach einer der wenigen Partys, auf die sie noch eingeladen wurden. Wenn sie sich sahen, hatten sie Streit. Darüber, dass er Tag und Nacht nur für die Kripo da war, nicht für sie. Dass er sie vernachlässigte. Dass er nicht genug verdiente mit seiner beschissenen Polizeiarbeit. Und dass er an allem schuld war, vor allem aber daran, dass ihr Sohn Jan an der Spritze hing und häufiger in U-Haft als in der Schule war.
In seiner Hose rappelte es. Bein hatte sein Handy auf lautlos gestellt, an einem dieser wenigen Abende, die er ausnahmsweise einmal genießen und an denen er einfach nur »der Stefan« sein wollte.
Dennoch zog er das Gerät aus der Tasche. Seine Freunde sahen sich entnervt an.
»Die Dienststelle«, sagte Bein, stand auf und ging in einen Nebenraum.
»Das wird wieder nix«, hörte er einen seiner Freunde sagen. »Komm, lasst uns Skat spielen. Da sind wir auf der sicheren Seite.«
»Wie, abgestochen und zersägt?«, sagte Bein und stöhnte. »Um Gottes willen! Ich komme sofort!« Er ging mit bleichem Gesicht zurück ins Zimmer.
»Hast du doch gerade gesagt«, scherzte einer seiner Freunde. »Der erste Fremde sticht! Dann bis nächstes Jahr, Stefan. Viel Erfolg. – Gerd, du gibst.«
* * *
Beins Navi lotste ihn zu einem Reihenmittelhaus in der Schmachtenbergstraße in Kettwig. Direkt am Wald. Parkplatz war nicht, die Straße war an beiden Seiten mit rotweißen Banderolen abgesperrt und ansonsten von Polizeifahrzeugen und einem Leichenwagen komplett zugeparkt. Stefan Bein fuhr eine Straße weiter und stellte sich an die nächste Ecke ins Parkverbot. Hier kam jetzt sowieso niemand mehr durch.
Vor dem Haus wartete bereits seine Kollegin auf ihn. »Menschenskind, Stefan! Wo bleibst du denn so lange!? Siehst du nicht, was hier los ist?«, fragte ihn die hübsche Kollegin.
Elena Denizoglu war die Tochter einer Deutschgriechin und eines Vaters, der eine blonde Norwegerin und einen Türken als Eltern hatte. Sie sah umwerfend aus, auch wenn sie die Dreißig gerade hinter sich gelassen hatte. Bein fragte sich, wie sie das machte, bei dem Dienst, den sie schoben.
Vielleicht lag es an ihrem griechischen Profil, ihrer vollen Figur und ihren dichtumflorten Augen. Vielleicht aber auch an dem vielen und wilden Sex, den ihr alle nachsagten.
Sie funkelte ihn aus ihren großen, dunkelbraunen Augen an. »Weißt du, was da drin los ist? Und irgendein Arsch hat das alles schon der Presse gesteckt!«
Bein sah sich um. Tatsächlich lungerten einige Typen mit Kameras hinter einer Absperrung auf der anderen Straßenseite und gestikulierten wild auf einen jungen Beamten ein.
»Wo warst du denn?«, fragte sie erneut, jetzt etwas milder.
»Mit Freunden Karten spielen«, entgegnete Bein matt. »Was ist hier denn nun genau passiert?«
»Komm mit rein. Ich zeig’ es dir.«
Gehorsam trottete Bein hinter der Oberkommissarin ins Haus. Ein schönes Haus, wie er fand. Eine Art Maisonette über drei Etagen, mit einem riesigen Fenster zum Wald hinaus. Aber jetzt stand die Wohnung voll mit weiß gekleideten Menschen. Jemand drückte ihnen Überschuhe in die Hand. »Nichts anfassen«, erklärte er überflüssigerweise.
Denizoglu zog Bein in einen fensterlosen Raum auf der nächsten Halbetage. »Keller nennen die das hier, dabei liegt es höher als das Wohnzimmer«, sagte sie. »Und hier steht die Kühltruhe.«
Die Truhe war ein massiver Kasten, in dem vermutlich Vorräte für mehrere Monate gelagert werden konnten.
»Komm.« Denizoglu drängte ihn weiter nach vorn. »Macht mal ein bisschen Platz«, bat sie zwei Kollegen von der Spurensicherung und lächelte dabei.
Ihn hätten sie nicht so bereitwillig durchgelassen, dachte Bein.
»Hier.«
Bein blickte auf weiße, mit Frost überzogene Päckchen. Aber dann sah ihn aus einem der Gebilde ein ebenfalls weiß überfrorenes Auge an. Ein Menschenauge, mit langen Wimpern darüber. Aus einem anderen Paket ragte ein rotlackierter Zeh heraus.
»Menschliche Körperteile?«, fragte er. »Von wem?«
»Das ist doch euer Job«, sagte der neben ihm stehende Kollege von der Kriminaltechnik, den Bein schon mal irgendwo gesehen hatte. »Eine Frau jedenfalls, oder besser, der Kopf, der linke Arm und zwei in der Mitte der Oberschenkel abgetrennte Beine. Möglicherweise von der gleichen Person.«
Bein schüttelte den Kopf. »Und wieso abgestochen?«, fragte er.
»Wie, abgestochen?«, fragte seine Kollegin zurück. »Ach so, ja, zeig ihm mal das Messer, Victor.«
Victor. Den kannte sie also auch näher, dachte Bein. Jetzt fiel ihm auch der Name wieder ein. Victor Oberstein, der stellvertretende Leiter der Kriminaltechnik Essen. Der immer als Erster am Tatort war, um Spuren zu sichern und nur ja nichts kontaminieren zu lassen.
Oberstein nahm einen Plastikbeutel von einem Plastikständer. Bein erkannte ein blutverschmiertes Steakmesser mit einer Klinge von mindestens 30 Zentimeter Länge. »Das steckte zwischen Truhe und Deckel«, erklärte Oberstein. »Und das hier steckte auf der anderen Seite.« Er nahm einen weiteren Beutel zur Hand und hielt ihn Bein unter die Nase. »Ein Tranchiermesser. Batteriegetrieben. Unübersehbar übrigens. Das sollte gefunden werden, wenn Sie mich fragen.«
»Verdacht auf Kannibalismus?«, fragte Bein seine Kollegin.
»Nur, weil wir in Essen sind?«, fragte die zurück. »Alles vernaschen die hier auch nicht.«
Bein verzog das Gesicht. »Wer hat das hier entdeckt, und wann war das? Und habt ihr eine Ahnung, wie lange der oder die Toten hier schon hinüber sind?«, fragte er in Richtung der Spurensicherung.
Der Kollege zuckte nur mit den Achseln. »Wir bringen das nachher in die Pathologie, der Richter wird’s dann schon richten.«
Georg Richter, dachte Bein. Ihr Gerichtsmediziner, und ein Arsch vor dem Herrn.
»Die Putzfrau«, beantwortete Denizoglu seine erste Frage. »Die kommt hier zweimal die Woche. Sie hat einen eigenen Schlüssel, aber sie hat die Wohnungseigentümerin schon seit Monaten nicht mehr angetroffen. Es war alles immer sauber und aufgeräumt, sagte sie. Die Eigentümerin ist übrigens Veganerin, was deine erste Frage beantwortet. Kein Fleisch. Nur Grünzeug und Körner in den Schränken.«
Bein sah sie fragend an.
»Eine Frau Segers, Monika Segers. Ihr gehört die Wohnung. Würde vom Alter her zu unserem Kopf passen, würde ich sagen.«
»Wissen wir noch mehr über sie? Und wo ist der restliche Körper – oder weitere Teile?«
»Anfrage läuft«, beschied ihm seine Kollegin achselzuckend. »Gesehen wurde hier auch keiner, ich habe die Nachbarn schon befragen lassen. Und es ist elf Uhr, ich habe noch was vor. Was dagegen, wenn wir die Kollegen alles einpacken lassen, und ich dampfe ab?«, fragte sie und legte ihr hübsches Köpfchen schief, sodass die verschiedenfarbigen Strähnchen ihr zu kleines Ohr freilegten. »Wie sehe ich aus?«, fragte sie ihn und baute sich vor ihm auf.
Bein musterte sie. Ihre eigentlich mediterran-gelbblonden Haare hatte sie schwarz gefärbt, und am unteren Rand und in Höhe der Ohren einige rote Strähnen eingefügt. Es sah aus, als ob sie in Flammen stünde. Der sehr kurze Rock zeigte ihre rundlichen Hüften und noch mehr von ihren langen, aber etwas zu kräftigen Beinen.
Ihre hohen Hacken ließen die Beine noch länger wirken – und das, obwohl Denizoglu viel kleiner war als er selbst. Auf ihr Oberteil zu schauen, oder eher zu starren, hatte Bein sich schon länger abgewöhnt. Das machte ihn nur unruhig. »Nuttig«, brummte er unwillig.
Sie grinste, wackelte mit den Hüften und klappte die eine Seite ihrer roten Lederjacke mehrmals auf und zu. Dem konnte auch Stefan Bein nicht widerstehen. »Zisch schon ab. Wir sehen uns morgen im Büro. Pünktlich.«
* * *
Am nächsten Morgen war es Bein selbst, der zu spät und unausgeschlafen mit grauem Gesicht ins Büro geschlurft kam. Nach einer guten Stunde Streit mit seiner Frau hatte er nur bis drei Uhr geschlafen und war dann von seinem Sohn geweckt worden, der laut und zugedröhnt nach Haus gekommen war. Nach einem sinnlosen Gesprächsversuch mit ihm hatte er dann bis zum Morgen schlaflos auf der Couch im Wohnzimmer gelegen und Gott und die Welt verflucht.
Denizoglu dagegen pfiff munter eine flotte Melodie und strahlte aus allen Poren Vergnügtheit aus. »Wenn du so weitermachst, Stefan, kannst du bald mit deinen Tränensäcken einkaufen gehen«, schlug sie vor. »Ärger?«
»Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt«, klagte er.
»Ich auch nicht«, strahlte sie. »Das Leben ist schön!«
»Das Leben ist scheiße«, erwiderte Bein. »Und für unseren Tiefkühl-Kopf vorbei. Hat sich die Pathologie schon gemeldet? Oder hat die Spurensicherung was?«
»Wir sollen gleich rüberkommen«, klärte sie ihn auf. »Zu beiden. Oberstein hat was für uns. Georg Richter auch. Die scheinen auch die halbe Nacht wach gewesen zu sein.«
Sie gingen zum Parkplatz. Bein fuhr.
Unterwegs klingelte das Telefon seiner Kollegin. Warum riefen alle immer nur sie an und nicht ihn, dachte er. Na klar, weil sie besser aussah als er. Und weil sie immer freundlich war. Und weil sie so aussah, als ob sie leicht zu haben wäre. Von dir will doch keiner was, meldete sich hämisch und abschätzig seine innere Stimme.
»Wo?«, fragte sie. Sie waren nach der kurzen Fahrt bereits in der Nähe der Rechtsmedizin angekommen. »Okay, danke. Wir kommen etwas später. Seht zu, dass das alles abgesperrt wird. Wir brauchen keine Zuschauer.«
Jetzt entschied sie schon selbständig. »Darf ich vielleicht auch mal erfahren, was los ist?«, schäumte er. »Oder werde ich hier gar nicht mehr gefragt?«
»Du bist der Boss«, gab sie zu. »Kann ich doch nichts für, wenn die bei mir anrufen.«
»Und was ist jetzt?«, fragte Bein ungeduldig.
»Die haben einen Torso gefunden. Passend zu unserer Tiefkühlkost.«
Sie hatten den Eingang zur Rechtsmedizin in der Ruhrlandklinik erreicht.
»Gut. Erzähl mir das gleich. Jetzt hören wir uns erst mal an, was die hier haben.« Bein öffnete die Tür zu dem weißgefliesten Raum. Gott sei Dank roch es nach Meister Proper, nicht nach Leiche.
»Mehr weiß ich auch noch nicht«, sagte Denizoglu eine Spur leiser und leicht beleidigt.
Zum Glück war es nicht Georg Richter selbst, der Dienst hatte und ihnen die Leichenteile zeigte, sondern sein junger und hübscher Assistent Carlo di Angelo, der genau wie Denizoglu permanent gut drauf war. Seine Kollegin nahm ihn auch gleich in den Arm, Bussi links, Bussi rechts.
»Schön dich zu sehen, Engel.«
»Selber Engel!«
»Guten Morgen«, sagte Bein. »Wir haben nicht viel Zeit. Klären Sie uns bitte mal auf, di Angelo.«
Der grinste seine Kollegin an und zeigte mit seinem Kinn auf den Sektionsraum. »Da drin.«
Auf der ausziehbaren Bahre lag anders als sonst kaum etwas unter dem grünlichen Tuch. Di Angelo warf es mit einem weiten Schwung zurück. Bein sah, dass er den Kopf, den Arm und die beiden Beine so hingelegt hatte wie bei einem kompletten Körper. Alles war jetzt abgetaut und sah halbwegs normal aus.
Die Frau musste hübsch gewesen sein. Ebenmäßige Züge, gepflegtes Haar. Relativ lange Beine, wenn man nach den Unterschenkeln urteilen konnte, leichte Bräunung am Körper. Irgendwie wirkte ihr Kopf intellektuell, aristokratisch. Wie jemand aus einer guten Talkshow oder aus einem Uni-Vorstand. Jetzt sah ihr Gesicht aber stark eingefallen aus. Die Augenlider waren zugedrückt worden.
»Natürlich können wir über die Todesursache noch nicht so viel sagen,« begann der junge Arzt. »Ohne den kompletten Körper. Aber wir können einiges ausschließen. Kein Gift, keine Gewalteinwirkung auf die hier liegenden Körperteile. Die Frau war kerngesund. Aber wir haben doch was rausgefunden.« Er grinste Denizoglu an.
Bein nahm er kaum wahr. »Machen Sie schon!«
»Die Amputationen sind erst erfolgt, als kein Blut mehr im Körper war. Oder kaum noch welches. Das können wir feststellen. Was wir hier haben, ist viel zu leicht für eine normale Frau.«
»Sie ist also verblutet«, mutmaßte Bein.
»Sie ist geschächtet worden«, erklärte der Arzt. »Wie ein Hammel bei den Türken, Entschuldigung, Elena, oder von mir aus wie ein Kaninchen. Deshalb hat sie auch weniger Adrenalin und andere mit Schmerz und Angst verbundene Stoffe im Gewebe. Das tut nicht so weh. Sehen Sie, hier«, er deutete auf den Halsansatz.
»Hier ist ein Längseinschnitt in die Carotis zu sehen, der sich vermutlich noch weiter nach unten erstreckt. Hier unten am Kopf, auf der Trennfläche, war nur sehr wenig Blut. Der Kopf ist erst abgetrennt worden, als der Körper schon ausgeblutet war.« Wie um seine Worte zu beweisen, fuhr er mit einer Art Wattestäbchen über den Schnitt durch Muskeln, Knochen, Adern, Speise- und Luftröhre. »Fast nichts.«
Er zog eine andere Schublade auf. »Hier. Das ist eine Ziege, die war für ein Fest in der jüdischen Gemeinde vorgesehen. Ich bin denen gerade noch zuvorgekommen. Die kriegen die wieder, wenn das hier vorbei ist. Sehen Sie sich das bitte mal an.«
Er klappte ein Tuch zurück. Bein fragte sich, ob das aus Pietätsgründen oder der Hygiene dort lag. Der Ziegenkopf lag separat vom Körper, sodass man die Schnittstelle gut sehen konnte. »Hier. Exakt die gleichen Wunden, sehen Sie sich bitte die Gefäße an. Ich kann aber auch noch ein Schaf besorgen und das ohne Ausbluten köpfen, dann sehen Sie den Unterschied.«
»Nicht nötig«, beschied ihm Bein gallig. »Ich glaube Ihnen das gerne. Sonst noch was zu der Toten?«
Di Angelo blätterte in einer Akte, die er von einem Seitentisch genommen hatte. »Hm. Sie nimmt die Pille. Und Mittel gegen hohen Blutdruck. Viel mehr habe ich nicht. Dafür brauche ich den Rest des Körpers. Außerdem ist die offizielle Obduktion erst später. Wir haben den richterlichen Bescheid noch nicht. Wir rufen Sie an, Herr Bein.«
»Okay. Das reicht uns auch schon mal. Geschächtet!« Er schüttelte den Kopf. »Wer macht denn so was?« Er wandte sich zum Gehen. »Danke und auf Wiedersehen, Herr di Angelo.«
»Ciao, Engel«, rief seine Kollegin dem Pathologen zu.
»Hast du heute Abend schon was vor?«, fragte der zurück.
»Leider ja. Melde mich. Du weißt schon.« Denizoglu strahlte über das ganze Gesicht.
Der Pathologe grinste nur. Bein schloss rasch die Tür hinter sich. Er konnte diesen amourösen Frohsinn nicht ertragen. »Ich möchte noch zurück zur Zentralen Spurensicherung. Vielleicht haben die auch was für uns. Und dann sehen wir uns den zweiten Fundort an. Wo war das eigentlich?«
»Am Moltkeplatz.«
Bein fuhr mit seiner Kollegin zum Kriminalkommissariat 43, das wie ihr eigenes KK11 im Gebäude des Polizeipräsidiums untergebracht war.
Oberstein war ebenfalls zurück und führte sie in sein Labor. »Viel haben wir nicht«, leitete er seinen Bericht ein. »Der oder die Täter waren sehr ordentlich. Wir haben Fingerabdrücke von insgesamt sieben Personen, aber alle älter oder von der Frau selbst. Aber eins haben wir doch.« Er sah sie beide leicht von oben herab an.
»Und das wäre?«, fragte Bein genervt.
»Maden. Von Calliphora vomitoria, etwa einen Tag alt. Das ist eine Schmeißfliegenart, die vor allem im Freien und in Kuhställen und ähnlichen Umgebungen vorkommt, ein wenig größer als unsere Stubenfliege.« Oberstein nahm ein Glasröhrchen zur Hand, in dem einige lebende Exemplare herumflogen, und zeigte es ihnen. »Und hier ist die dazugehörige Made vom Bein der Leiche.« Er nahm ein anderes Glas, das ein kleines, verschrumpeltes Würmchen enthielt.
»Das beweist noch nichts, aber es lässt darauf schließen, dass die Leiche zumindest eine Zeit lang im Freien gelegen hat, oder in einem Raum mit offenen Fenstern, in einem ländlichen Gebiet. Eher nicht in der Luxuswohnung der Toten.«
Bein nickte.
Oberstein fuhr fort. »Die Made ist dann mit eingefroren worden und hat sich nicht mehr wesentlich entwickelt. Aber sie ist geschrumpft und hat Flüssigkeit verloren. Ich würde sagen, sie hat mindestens drei bis vier Wochen in der Kälte gelegen. Entsprechend lange muss das Opfer schon tot gewesen sein, plus minus drei, vier Tage. Calliphora ist ein Erstbesiedler, die Leiche muss vor dem Einfrieren noch frisch gewesen sein.«
»Die Tote ist dann vermutlich nicht in ihrer Wohnung ermordet worden, sondern ist dort nur hingebracht worden«, schloss Bein aus seinen Worten. »Der Mord liegt also schon einen Monat zurück.«
»Sie muss doch vermisst worden sein«, warf seine Kollegin ein. »Vier Wochen verschwindet doch niemand einfach so.«
»Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen?«, fragte Oberstein, der sie ansah wie lästige Besucher.
»Melden Sie sich einfach, wenn Sie neue Erkenntnisse haben«, nickte ihm Bein zu. »Vielen Dank fürs Erste.«
»Jetzt aber zum Moltkeplatz«, forderte Bein seine Kollegin auf. »Danach kümmern wir uns um die Vergangenheit der Toten.«
Als sie am Moltkeplatz eintrafen, war auf der Skulpturenwiese der Teufel los. Sonst war der Platz ein eher beschaulicher Ort zwischen Straße, Bahn und Baumbestand, heute war es der belebteste Ort Essens. Drei Kollegen von der Schutzpolizei versuchten vergeblich, den Ort einigermaßen abzuriegeln, ohne Aussicht auf Erfolg.
Von allen Seiten drängten Leute mit ihren Smartphones oder Kameras auf die Grünfläche, Spaziergänger mit Hunden, Jogger und sogar ein Rollstuhlfahrer. Neben einer Marmorstatue stand neben einem in Weiß gekleideten Spurensicherer eine Frau mittleren Alters, die ihrer kleinen Tochter mit beiden Händen die Augen zuhielt.
»Mama, was hat die Frau da?«, fragte das Kind und versuchte, die Hand seiner Mutter von den Augen fortzuzerren.
Die Frau sah sich um, als sie Bein und Denizoglu näherkommen hörte. »Jemand sollte sofort das Ordnungsamt holen!«, rief sie in ihre Richtung. »Schauen Sie sich das doch nur mal an! Das ist doch keine Kunst mehr! Das ist doch Pornographie!«
»Die Frau hat den Fund hier gemeldet«, erklärte der Mann von der Spurensicherung. Bein kannte ihn nur vom Sehen.
»Labia minora stark gespreizt, Vagina erweitert, beides vermutlich postkoital«, sagte der Mann in Weiß zu dem Handy in seiner Hand. Er nahm einen ersten Befund auf.
Bein sah sich die Statue an. Sie erinnerte ihn an die Körperhaltung der Venus von Milo. Allerdings fehlten der Kopf und der linke Arm, und in der Rechten hielt sie ein offenes Buch, dessen Seiten dem fehlenden Kopf zugewandt waren. Die Statue stand mit ihren halbierten Oberschenkeln auf einem Marmorsockel von der gleichen Farbe wie das Kunstwerk selbst.
Beins Blick wanderte von den eher kleinen, halbrunden Brüsten auf die Stelle, die der Spurensicherer gerade beschrieben hatte. In der Tat waren die Geschlechtsteile überdeutlich ausgeprägt und in allen Details dargestellt. Irgendwie sah die Statue tatsächlich benutzt aus. Als ob der Künstler sie sofort nach einem Geschlechtsverkehr dargestellt hätte. Mit geradezu erschreckender Präzision, was die Geschlechtsteile anging. Sogar die Stoppeln der rasierten Schamhaare waren exakt herausgearbeitet worden.
Dann fiel bei ihm der Groschen.
»Das ist gar keine Statue!« flüsterte er, zu Denizoglu gewandt.
Die kratzte sich gerade den hübschen Kopf und schien zu überlegen.
»Flüssigkeitsspuren am rechten Oberschenkel«, notierte der Spurensicherer.
»Das ist unser fehlender Körper,« erklärte die Oberkommissarin. »Aber irgendwie zu Stein erstarrt.«
Der Spurensicherer sah sie an. »Kripo Essen?«
Denizoglu nickte nur.
»Haben wir die Personalien von der Zeugin hier?«, fragte Bein.
»Die habe ich doch ihren Kollegen schon gegeben!«, beklagte sich die Frau. »Kann ich jetzt endlich gehen? Ich kann meiner Tochter doch nicht ewig die Augen zuhalten!«
»Gehen Sie, bitte«, bat Bein sie. »Wir kommen auf Sie zu. Und danke für die Meldung.«
»Und was ist mit dem Ordnungsamt?«, fragte sie. »Ich möchte mich beschweren! Das ist doch keine Kunst!«
»Das ist auch keine Kunst, das war Mord«, erklärte Bein so ruhig er konnte. »Sie haben eine Leiche gefunden, kein obszönes Kunstwerk.«
Die Frau schlug die Hände vor dem Mund zusammen. Sofort sah das Mädchen, das vielleicht vier Jahre alt war, zu der Frau auf dem Sockel hoch. »Was hat die Frau da, Mami? Hast du das auch?«
Die Frau zerrte das Kind weg und verschwand.
»Hier, klopfen sie ihr damit mal auf den Körper«, forderte der Spurensicherer Denizoglu auf. »Keine Bange, da passiert nichts. Nur bitte auf keinen Fall anfassen.« Er gab ihr eine Art Löffel, und die Oberkommissarin klopfte der Statue damit zaghaft auf den Po. Nichts passierte.
»Fester!«, sagte der Mann in Weiß. »Als ob sie ein Ei aufschlagen würden!«
Denizoglu klopfte fester. Jetzt war ein heller Klang zu hören.
»Das macht kein Körper«, erklärte der Mann. »Das ist oder war zwar eine Frau, das ist auch noch ihr Körper. Er ist aber behandelt worden, vermutlich mit einem Härter ausgespritzt und dann mit einem Steinspray angesprüht, deshalb ist sie so fest und sieht aus wie Marmor. Und ganz kurz vor dem Aushärten hat sie noch einer«, er sah zu der hübschen Oberkommissarin hinüber, »hatte sie noch Verkehr. Vielleicht hat sie sogar noch gelebt. Die Spuren hier« – er zeigte auf den Oberschenkel, an dem sich eine feuchte Schneckenspur herunterzog – »sehen mir aus wie eine Mischung aus Sekret und Sperma. Aber mehr kann ich Ihnen jetzt noch gar nicht sagen, ohne Untersuchung. Die mache aber leider nicht ich. Sie kann jetzt auch weg in die Rechtsmedizin. Da erfahren Sie dann mehr.«
Er winkte den Kollegen von der Schutzpolizei, die ihrerseits einen Leichenwagen heranwinkten, der unter den Straßenbäumen am Rande der Grünfläche gewartet hatte. Bein sah ihn erst jetzt.
Die Reporter und Wissensdurstigen nahmen das zum Anlass, hinter den Polizisten und dem Wagen den Rasen zu stürmen und mit allem, was sie hatten, Fotos zu machen.
Zwei Leute schossen auf Bein und Denizoglu zu. »Sind sie von der Kripo?”, fragte eine junge Frau, die sich ausnahmsweise mal an Bein wendete. »Wer ist das? Die Tote? Wir bringen Sie ganz groß raus, sagen Sie schon!«
Bein und Denizoglu ergriffen die Flucht.
Kapitel 4
Frau Meyer-Hinrichsen
Der Text an Frau Herzog war weg, ich hatte ihn eben zur Post gebracht. Das hatte ein paar Tage Zeit. Jetzt hatte ich noch eine andere Leiche im Keller, wenn ich hier dieser so oft bemühten Redewendung einmal folgen darf. Ich hoffe, Sie werden mir das nicht übelnehmen.
Es ging um die Lektorin, Frau Meyer-Hinrichsen, die alles andere als tot war. Und sie lag auch nicht in meinem Keller, sondern in dem eines verfallenden Schlachthofes nahe München, in dem früher die Überreste der Schlachtungen in den Kanal entsorgt worden waren.
Die Lektorin war nach längerer Zeit der Abstinenz und der Abwesenheit aus Deutschland mein erster frischer Fall. So geschockt wie ich im Café von ihrer Ablehnung im ersten Moment gewesen war, so sehr freute ich mich jetzt über diesen neuen Job. Ich hatte einige Jahre im Ausland zubringen müssen, nachdem ein allzu hartnäckiger Kommissar mir viel zu eng auf den Fersen gewesen war. Ich hatte den penetranten Polizisten schließlich nur mithilfe der argentinischen Justiz abschütteln können.
Aber jetzt war ich wieder hier und konnte mein Werk weiterführen. Ich war gespannt, wo das hinführen würde.
Es war Zeit, mich um die Lektorin zu kümmern. Und um das, was jetzt in ihrem Kopf vorgehen musste. Es war wichtig, dass ich alles, was sich in ihrem Kopf abspielen musste, zu Papier brachte. Denn das würde ich alles in meinen Krimi mit einbauen, hatte ich beschlossen. Jede neue fiese Ablehnung würde ein neues Kapitel ergeben. Was jetzt wohl in Mona vorging? Ich begann zu schreiben.
* * *
Mona war stinksauer. Dieser Typ hatte sie beim Joggen betäubt und hierher verschleppt, in irgendeinen dunklen, unbequemen Keller, in den sie ganz gewiss nicht gehörte. Sie sah sich um. Außerhalb des Lichtkegels, der von der Decke auf sie herabfiel, konnte sie kaum etwas erkennen. Sie lag auf einer grauen Yoga-Matte, die schon reichlich zerschlissen und abgewetzt war. Die Matte lag teils auf Fliesen, teils auf Gitterrosten, unter denen sich etwas Kaltes, Dunkles verbarg, ein zugiger Abgrund, von dem sie gar nicht wissen wollte, was es genau war. Es roch vage nach altem Blut und Exkrementen. Nach Verlies und Moder. Nach Pfuhl.
Die Handschellen waren ihre eigenen. Rosa gefüttert, für ganz bestimmte Stunden. Sie schnaubte vor Wut. Wo hatte der Typ die her? War der etwa in ihrer Wohnung gewesen und hatte sie durchwühlt? Na klar, dachte sie, nachdem er sie betäubt hatte, war er mühelos an ihre Schlüssel gekommen. Aber woher wusste er, wo sie wohnte? Der Personalausweis in ihrer Tasche. Klar. War das so einfach gewesen, oder hatte der das von langer Hand geplant? Wie naiv war sie eigentlich gewesen, dem den Zugang zu ihrem Privatleben so einfach zu machen?
Die Lektorin hob den Kopf, so gut es ging. Ganz aufrichten konnte sie sich nicht, das ließen ihre Fesseln nicht zu. Immerhin konnte sie ihre Füße sehen, die mit rosa Bändern an das Bodengitter gebunden waren. Zu allem Überfluss hatte ihr Entführer auch noch Schleifchen in die Bänder gemacht. Sie hatte versucht, die Schleifen und Knoten durch Zerren und Treten aufzubekommen, aber das hatte zu nichts geführt. Sie war jetzt nur müde und schrecklich enttäuscht.
Nachdem sie aufgewacht war, hatte sie um Hilfe geschrien, so laut sie konnte. Es musste sie doch jemand hören können! Bis sie merkte, dass da niemand war. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Wie lange sie bewusstlos gewesen war. Wie der Typ sie hierhergebracht und gefesselt hatte. Was er vielleicht noch mit ihr gemacht hatte. Was er mit ihr vorhatte.
Es war drückend schwül und warm in diesem Keller, der bis auf den Lichtkegel um sie herum im Halbdunkel lag, und Mona war durstig. »Hey! Ich habe Durst! Ich brauche was zu trinken! Hilfe!!«, schrie sie noch einmal.
Keine Reaktion.
Immerhin war sie noch mit ihrer Unterwäsche bekleidet. Hatte der sie da unten angefasst? Schwer zu sagen. Aber getan hatte er ihr wohl nichts. Noch nicht. Das hätte sie gemerkt, aber untenrum fühlte sich alles normal an. Dennoch, ihre Lage war alles andere als gut. Der konnte jeden Moment runterkommen und sie vergewaltigen oder umbringen.
Sie zermarterte sich ihren Kopf. Was sollte sie hier?
Beim Fesseln an diese Gitter hier hatte der Typ etwas davon gesagt, dass sie seinen Roman verrissen hätte. Wenn sie das genau verstanden hatte, sie war noch benommen gewesen. Und dass sie statt seines Romans einen vorgezogen hätte, in dem eine Frau im Keller gefoltert würde. Es gäbe da einen, den hätte er extra noch gelesen, da war so eine Frau im Keller. Und genau das würde er jetzt mit ihr nachspielen. Sie, die Frau im Keller. Das Folteropfer. Er, der kaltblütige Killer. Der Folterknecht.
Hatte sie das wirklich gehört, oder im Tran nur eingebildet? Fakt war, dass sie gefesselt hier unten lag.
Im Krimi, den sie lektoriert haben sollte und den er gelesen hatte, sollte sich seinen Worten zufolge eine Frau aus genau der gleichen Lage befreit haben. Nur wie? Verdammt! Wie sollte sie denn hier bloß rauskommen?! War das ein blöder Test, womöglich eine Art Dschungelcamp für Lektoren, und die halbe Republik sah ihr im Fernsehen zu und lachte sich kaputt, weil sie hier nicht rauskam?
Blöd, dass sie ihre Assistentinnen die ganze Arbeit machen ließ. Sie hatte keine Ahnung, was in dem Roman gestanden hatte.
Was wollte der eigentlich von ihr? Sich rächen, weil sie ihn beleidigt hatte, weil sie ihn verächtlich behandelt hatte, so was in der Art. So ein selbstherrlicher, beleidigter Typ, der Wunder was von seinem Geschreibsel hielt, wobei es unter Garantie wieder derselbe Mist war, den sie täglich hundertfach auf den Tisch bekam.
Ich will doch nur, dass mein Werk mit Respekt und Würde behandelt wird;diese Worte von ihm hallten immer noch in ihrem Kopf nach.
Aber das sagte doch jeder von ihnen, all die achthundert zukünftigen Literaturnobelpreisträger, die sich monatlich bei ihr meldeten und ihr Geschreibsel unbedingt gedruckt sehen wollten. Eine stinkende Flut, bei der es nur half, so rasch wie möglich die Spülung zu ziehen und den Mist loszuwerden.
Aber dieser Psycho hatte ihr das krummgenommen. Und jetzt lag sie hier unten und kam und kam nicht drauf, wie sie hier wieder rauskommen sollte. Es musste irgendwie gehen. Was, wenn das wirklich ein Test oder Teil einer Show war? Dann würde sie sich scheußlich blamieren. Wenn der jetzt was von ihr wollte, womöglich vor laufenden Kameras? In ihr sträubte sich alles bei dem Gedanken. Aber sie sah nichts von technischen Geräten in diesem stinkenden Verlies, so sehr sie den Kopf auch drehte.
Mona blähte ihre Nasenflügel und stieß hörbar ihren heißen Atem aus. Sie hatte keine Zeit für so einen Scheiß. Sie hatte zu tun, im Verlag und auch sonst, sie hatte gesellschaftliche Verpflichtungen, sie hatte diese Woche ein Date, und sie musste dringend aufs Klo.
»Hey! Ich brauche was zu trinken! Und ich muss zur Toilette!«, schrie sie ins Dunkle, in Richtung Treppe, über die der Typ verschwunden war.
* * *
So oder so ähnlich musste die Frau sich da unten jetzt wohl fühlen. Ich hatte zumindest schon mal einen Text. Aber jetzt musste ich sehen, wie es ihr wirklich ging. Und auch das musste ich dokumentieren. Denn Ihnen kann ich das beichten. Wenn Sie ein Leser und nicht auch ein Lektor oder eine Lektorin sind. Oder von der Polizei.
Ich hatte jetzt einen Plan. Den nächsten Lektor-Mord, ob fiktiv oder real, in meinen Krimi einbauen, den Roman an das nächste Lektorat senden, und vielleicht eine weitere Ablehnung erhalten; einen weiteren Lektor bestrafen und aus alldem eine Stafette aus Lektormorden aufbauen, solange bis das endlich jemand druckte, oder bis mich schließlich doch die Polizei erwischte? Oder bis der Republik die Lektoren ausgingen? War das ein guter Plan?
Ich war mir noch nicht sicher. Denn dann musste ich die Lektorin ja wirklich zum Verstummen bringen. Wollte ich das? Sicher, ich wollte sie bestrafen. Um viel mehr war es mir bis hierher nicht gegangen.
Musste ich jetzt weitermachen und sie töten, nachdem ich sie entführt hatte und hier gefangen hielt? Kaum vorstellbar, dass ich sie jetzt noch zu einer Zusammenarbeit überreden konnte. Aber vielleicht konnte ich sie zu mehr Einsicht bewegen; dann könnte ich ihr später, anonym natürlich, ein anderes Werk anbieten. Dann war sie womöglich einsichtiger geworden.
War es schon zu spät für eine Rehabilitation und eine Freilassung? Musste ich sie jetzt aus der Welt schaffen? Nicht, dass ich das nicht zu Ende bringen könnte, ganz im Gegenteil. Ich bin viele Jahre lang Soldat gewesen, und wer einmal Soldat war, bleibt es sein Leben lang. Töten ist leicht, und Skrupel habe ich noch nie gehabt.
Trotzdem. Ich habe ein gewisses Problem mit den Opfern. Sie hinterlassen Blut und Dreck, wenn sie sterben. Davon hatte ich in meinem Leben schon genug gesehen. Ich finde das widerlich. Das Blut spritzt und schmiert, es läuft überall hin, es klebt und riecht und hinterlässt Spuren. Darm und Blase entleeren sich unkontrolliert. Man muss das wegmachen, man kommt mit diesem Unrat in Kontakt. Macht sich schmutzig. Es stinkt zum Himmel. Und all die Drecksarbeit bleibt an einem selbst hängen. Keine afghanischen Helfer, die einem das klaglos wegräumen. Jemanden beseitigen, gut. Aber der ganze Dreck kann mir gestohlen bleiben.
Frau Meyer-Hinrichsen lebte ja noch.
Wie sollen Leser denn meine Werke in die Hände bekommen, wenn sich diese lustlosen und bequemen Lektorinnen nicht einmal bemühen, sie auch nur anzulesen?
Mona Meyer-Hinrichsen schrie unten im Keller herum. Jetzt brauchte sie mich. Dafür hatte ich schon mal gesorgt. Vorher hatte sie mich ja anscheinend überhaupt nicht gebraucht.
Es gab eine Zeit, da war es mir um spektakuläre und geniale Exzesse gegangen, um Bestrafungen, die ihresgleichen suchten, öffentliche Bloßstellungen, Hinrichtungen, ohne dafür belangt werden zu können. Perfekte, großartige Morde. Heute bin ich bescheidener geworden; das Spektakel brauche ich nicht mehr.
Mir geht es inzwischen mehr um chirurgische Präzision, wenn jemand verschwinden muss. Nicht, was Sie jetzt beim Wort chirurgisch denken; jemanden langsam und genüsslich mit dem Skalpell aufzuschlitzen. Sicher, manch einer mag das, und solche Leute habe ich in Afghanistan zur Genüge kennengelernt.
Wenn man den Opfern in die aufgerissenen Augen sieht, wie die armen Kerle versuchen zu begreifen und doch mitansehen müssen, wie das Leben aus ihnen herausspritzt. Die aufgerissenen Münder, die den Schmerz herausschreien, all das. Natürlich. Manch einer findet das sehr, sehr schön. Es hat auch was.
Mein Ideal ist das trotzdem nicht, im Gegenteil. Das geht auch eleganter, sauberer und klinischer. Und ohne Spuren zu hinterlassen. Leute ohne das ganze Geschmiere zu beseitigen, das ist eine reizvolle und lohnenswerte Aufgabe.
Mein Ideal ist die chirurgische, non-invasive Entfernung einer störenden Person aus dieser Welt. Sauber. Perfekt. Unauffällig. Elegant. Vielleicht verstehen Sie ja, was ich meine. Ein soziales Skalpell, mit dem man jemanden für immer verschwinden lassen kann. Ohne den ganzen Dreck. Ich bin kein Sadist. Ich bin nur entsetzlich enttäuscht. Und gewohnt, ordentlich zu arbeiten. Und ich wollte endlich ein Buch veröffentlichen. Mein Buch. Meine Geschichte.
Die Lektorin lag da wie das wunderschöne Opfer in dem Roman, der ihren Wünschen entsprach. Es war schön, wie sie ihr Wunschthema in die Realität übertrug, ohne es zu wissen. Wenn sie selbst auch längst nicht so schön war wie das literarische Opfer; sie war eher klein und mager, hatte aber ein ansprechendes Gesicht zwischen ihren kleinen Ohren und unter ihren kurzen, schwarzen Haaren.
»Ich habe Durst, und ich muss mal«, stöhnte sie leise. Immerhin nicht: Wo bin ich? Dann hätte ich sie womöglich gleich umgebracht. Ich hasse Klischees.
»Das ist bald vorbei«, sagte ich zu ihr.
Sie drehte langsam den Kopf. Sehen konnte sie mich nicht. Sie lag im Lichtkegel eines Deckenstrahlers, der Rest des Kellers lag im Dunkeln. Ich trug Schwarz, über dem Kopf eine leichte Skimaske, die mir hervorragend stand, dazu eine verspiegelte Brille. Das würde das Einzige sein, was sie je von mir zu sehen bekam. Ich sehe zu markant aus, als dass man mein Gesicht wieder vergessen könnte. Und solange sie mich nicht sehen konnte, hatte sie eine Chance, zu überleben.
»Wer sind Sie? Was mache ich hier?«, krächzte sie. Und dann leider doch: »Wo sind wir hier?« Sie versuchte sich aufzurichten, aber das scheiterte. Sie war mit Hand- und Fußschellen lose an das Gitterrost am Boden gekettet, die Ketten dazwischen ließen der am Boden gekreuzigten Lektorin ein wenig Spielraum. Aber nicht genug, um sich ganz aufzusetzen.
Okay, sie war durstig und musste auf die Toilette. Zumindest dafür hatte sie mein Mitgefühl. Ich ging rüber und lockerte mit dem Fuß vorsichtig eine der Bodenfliesen, auf denen sie lag. Darunter verborgen lag ein Schlüssel für ihre Handschellen. Hätte sie ihn entdeckt, hätte sie sich befreien können, so viel Spielraum ließ ihr die Fesselung. Aber nichts dergleichen hatte sie geschafft. Ein Zeichen mehr dafür, dass sie keine Ahnung und kein Gespür hatte. Ein guter Lektor hätte alles probiert und sich vielleicht befreien können.
Aber sie hatte keinen blassen Schimmer.
Ich trat einen Schritt näher an sie heran, so dass sie meine Umrisse sehen konnte. Sie ließ den Kopf auf den Boden sinken und schloss die Augen.
»Scheiße«, stöhnte sie halblaut. »Ein Irrer.« Sie zerrte wie zur Probe an den Armfesseln. Dann mit aller Kraft. »Mist.« Sie schnaubte ärgerlich. Noch hatte sie ihre Situation nicht vollkommen verstanden. Den Ernst der Lage. Sie hatte noch Hoffnung. Sie fand sich gerade erst zurecht.
»Da lag auch ein Mädchen im Keller«, sagte ich ihr. »In einem Krimi, den du selbst lektoriert hast. Der muss doch ganz nach deinem Geschmack sein. So, wie du es gern hast.«
Sie runzelte nur die Stirn. Schüttelte den Kopf.
Ich nannte ihr den Titel des Romans, den wir hier nachspielten. Mädchenbeute. Aber sie hatte ihn wohl nur lektoriert, aber nicht gelesen. Sonst hätte sie sich befreien können. Meine Achtung vor ihr sank weiter.
Ich ging langsam um sie herum. Ihre warmen Wintersachen hatte ich ihr ausgezogen, hier im Keller war es warm genug. Sie hatte nur noch ihre Unterwäsche an. Ich beendete meine Runde und stand wieder an meinem alten Platz.
Sie war mir mit den Augen gefolgt.
»Und?«, fragte ich.
Sie schloss die Augen wieder und schien nachzudenken. »Nein. Tut mir leid. Nie gehört.«
»Du hast im Café mit der Praktikantin über meinen Krimi gesprochen«, erklärte ich. »Lea Walter. Die hatte ihn durchgelesen und fand ihn eigentlich ziemlich gut. Sie hat dir eine Synopse davon gegeben, bei Kaffee und Kuchen.« Ich ging zu ihr hinüber und setzte mich vor ihre nackten Füße.
Frau Meyer-Hinrichsen saugte die Wange auf einer Seite in den Mund ein. Sie dachte nach. »Ja, und?«
»Du hast gesagt, das wäre ein Schmarrn von einem Arschloch. Der Autor wäre deppert. So in dem Stil. Ich möge mich doch bitte zum Teufel scheren. Und Lea Walter hast du gesagt, dass sie mir eine Ablehnung schicken soll.«
»Aber sie schreibt das doch wirklich immer so nett«, versuchte sie sich rauszureden.
»Schon. Wir bedauern, leider, gegenwärtig nicht möglich, schade, viel Glück weiterhin. So was in der Art. Aber ich hatte euch beiden ja zugehört. Ich habe dich bei diesem Betrug erwischt, Mona. Und das läuft mit mir nicht.«
Sie überlegte und zerrte dann wieder an ihren rasselnden Ketten. »Lassen Sie mich hier raus! Ich verspreche Ihnen, ich lese mir Ihr Werk sofort selbst und sehr aufmerksam durch.« Sie zog wie wild an der rechten Handfessel, ihre Haut rötete sich bereits stark. Tat ihr das nicht weh? »Na los! Ich hab’ zu tun, verdammt noch mal!!«
»Du bist keine gute Lektorin«, erklärte ich ihr sehr behutsam. »Du nimmst deinen Job nicht ernst genug. Du lässt deine Arbeit von anderen machen und hörst nicht zu. Du bist faul. Du lässt dich von Wunschdenken treiben. Und du hast mich schwer beleidigt.«
Frau Meyer-Hinrichsen versuchte es an den Fußfesseln und zog mit aller Kraft die Knie hoch. Ihr Fußknöchel knackte laut. »Au! Das tut weh, Mann! Machen Sie mich sofort los! Ich muss mal!«
Ich hörte darüber hinweg. »Wir beide werden jetzt überprüfen, wie gut dein Wunschkrimi ist. Du und ich. Wir spielen das jetzt bis zum Ende durch. Du bist das Mädchen, ich bin der Täter. Ganz so, wie du es magst.«
Sie sah indigniert in meine Richtung, wie zu einem räudigen Köter, der ihr gerade einen Haufen vors Auto gesetzt hatte. »Ach leck mich doch! Lassen Sie mich sofort hier raus!« Auf ihrer Stirn erschienen trotz ihrer Forschheit die ersten Perlen der Angst. Dann fiel ihr Blick auf die Fesseln. »Und das sind meine Handschellen! Die hat mir mein Freund geschenkt!« Sie sah in meine Richtung. »Sie waren in meiner Wohnung«, stellte sie angewidert fest.
Ich trat an ihre rechte Seite, kniete nieder, klappte die lose Fliese hoch, nahm den Schlüssel heraus und zeigt ihn ihr. »Der war für die Handschellen. Mit etwas Nachdenken hättest du ihn gefunden und hättest fliehen können. Stand so in dem Roman.«
Ich stand auf, trat einen Schritt zurück und warf den Schlüssel durch das Bodengitter in den darunterliegenden Kanal. Einen Moment später platschte es dumpf, als ob er in einen zähflüssigen Morast geplumpst wäre. Irgendetwas quiekte dort unten. Und hörte ich da ein Geräusch von kleinen, trappelnden Füßchen?
»Jetzt musst du hier durch. Tut mir leid.«
Das brauchte eine Weile, um einzusinken. Die junge Frau sackte auf ihre dünne Matratze zurück und seufzte. Sie atmete tief durch. Noch hatte sie Kraft und Mut. »Ich muss jetzt wirklich dringend aufs Klo«, verlangte sie.
Schön! Ich mochte das. Sie wehrte sich mit allen Mitteln. Aufs Klo gehen war ein Naturrecht. Ein Akt der Würde. Ein Menschenrecht. Wenn ich sie ließ, hatte sie einen Punkt gegen mich gemacht.
»Zieh einfach deine Matratze etwas zur Seite«, empfahl ich ihr. »Darunter ist ein grobes Gitter und unter dem ein tiefer Schacht. Anschließend ziehst du deine Matratze wieder unter dich.«
Dass das Gitter zu einem Fluchtweg führte, hatte auch in diesem Roman gestanden, der ihr gefallen hätte. Mit dem gefolterten Mädchen im Keller. Es war ein unangenehmer und stinkiger Fluchtweg, der von dem stillgelegten, alten Schlachthof in die städtische Kanalisation führte, aber ein gangbarer Weg. Wenn sie das Gitter aufbekam. Auch dazu musste sie etwas wissen, das im Krimi gestanden hatte.
Sie klang jetzt etwas kleinlauter. »Das geht nicht. Ich komme doch nicht an mein Höschen. Und ich muss mich auch saubermachen können.« Sie sah besorgt aus, als sie das Wort Höschen aussprach. Hoffentlich führt das nicht noch zu etwas Schlimmerem, sagte ihr Gesichtsausdruck.