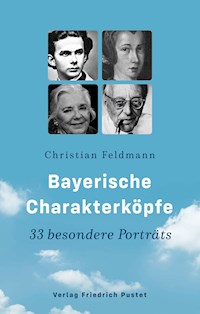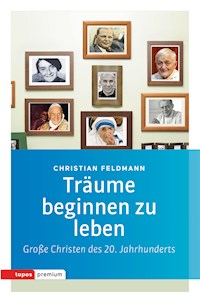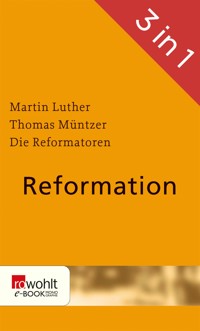Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie lassen sich Menschenwürde und absolutes Recht auf Leben begründen? Wer setzt die Maßstäbe? Genügt die Vernunft? Und wer sagt, was Vernunft ist? Sind alle Religionen gleich viel wert? – Papst Benedikt XVI. war für manche Überraschung gut. Seine Fragen waren so tiefgründig, seine Argumente so niveauvoll, dass sich die Auseinandersetzung damit auch für den lohnt, der seine Weltsicht nicht teilt. Warum wurde er gewählt? Warum ist er zurückgetreten? Warum verschwanden seine Visionen hinter den Pannen des vatikanischen Apparats? Christian Feldmann schildert die Brüche und die Wunder in diesem Leben, Joseph Ratzingers kühne Konzentration auf das Wesentliche, seine Angst vor dem eigenen Mut und seine größte Sorge: dass die Christen vor lauter Scheu, als intolerant zu gelten, die Leidenschaft für die Wahrheit verlieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Feldmann
Benedikt XVI.
Sein Leben, sein Denken,seine Botschaft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3074-5
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2023
eISBN 978-3-7917-6152-7 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unterwww.verlag-pustet.de
Inhalt
1Ein Papst aus dem Land der frommen Anarchisten
„Mach ma halt a Revolution, damit a Ruah is!“ / Ratzinger, Karl Valentin und die Freude an der Ironie / „Schlampige Religiosität“ unter Barocktürmen
2Der Hitlerjunge, der keiner war
Träumen in der alten Scheune / Ein fantasieloser Lausbub und Hitlers Überfall auf Polen / „Vom Hitlerjungen zum Papa Ratzi!“
3Senkrechtstarter mit liberalen Anflügen
Von Kindern und von Augustinus lernen / Hochschulkarriere vor dem Aus / Der Griff in die Schatzkiste / Ghostwriter eines aufmüpfigen Kardinals / Schutzpatron der Denunzierten / Gegen ein „Christentum zu herabgesetzten Preisen“
4Tübingen, Regensburg, München: Trauma und Wende
„Es ist ordinär zugegangen“ / Theologen als Zugpferde der marxistischen Revolte? / Das Gedächtnis eines Elefanten / Der „Glaube der Einfachen“ und die gefährliche politische Theologie
5Rom: Der ewige Konflikt zwischen dem Privatmann und dem Beamten
„Wir sind keine Unmenschen“, sagt der Großinquisitor / Zwei Seelen in der Brust des Präfekten / „Tu was für dein Vaterland, töte einen Priester!“ / „Szenen keiner Ehe“: Der Kardinal und die deutschen Katholiken
6Plötzlich Papst: Visionen und Ängste
Angstwahl oder Befreiungsschlag? / Wie er die Menschen zu bezaubern vermochte / Das schrecklich langweilige ewige Leben / Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte / Zu scheu für die große Pose / Bücher schreiben wie ein Rabbiner / Christi Erlöserblut und ein lernender Papst / Rom und Jerusalem und die Sache mit dem Sühnetod / Professor Benedikt und die Hirten von Bethlehem / Herzliche Worte für Kinder und Obdachlose / Geheimnisvolles Signal am Papstgrab
7Don Quijote oder Professor Petrus
Der Kampf gegen Windmühlenflügel / „Wer sagt, was Vernunft ist?“ / Auch die Religion hat ihre „Pathologien“ / Die Aufklärung ist noch nicht zu Ende gedacht / „Im Christentum ist Aufklärung Religion geworden“ / Gott hat ein Gesicht und ein Herz / Evolutionssprung mit Jesus Christus
8Warum die großen Visionen hinter den kleinen Pannen verschwanden
Glauben heißt fliegen können / Dialog im „Vorhof der Völker“ / Bezaubernd liebenswürdig – und doch manchmal menschenfern? / Benedikt im Fegfeuer / „Der Papst soll auf seine Kehle aufpassen!“ / Gescheiterte Versöhnung mit den Ultras / „Wir haben absolut nichts von diesem Williamson gewusst“ / „Mit sprungbereiter Feindseligkeit …“ / Pannen über Pannen / Auschwitz: „Wo war Gott in jenen Tagen?“ / „Einige von Euch haben furchtbar versagt“ / Vatileaks: Gestohlene Dokumente und das Chaos an der Kurie
9Der Eremit schwieg nicht immer
Warum nach Benedikts Rücktritt nichts mehr so sein wird, wie es war / Zwei Päpste im Vatikan / Der Einsiedler bricht sein Schweigen / Über den Missbrauchsskandal gestolpert
10 Was bleibt von Papst Benedikt?
Träume sind immer offen / Ein nüchterner Visionär / Ganz neu anfangen, wie die ersten Christen
Anhang
Zeittafel / Bildnachweis / Benutzte Literatur in Auswahl
1
Ein Papst aus dem Land der frommen Anarchisten
„Ich bin natürlich ein Bayer geblieben,auch als Bischof von Rom“
Das Konklave, die Wahlprozedur, womit die katholische Kirche nach dem Tod eines Papstes ihr neues Oberhaupt bestimmt, erinnert an die mysteriöse Erwählung des Dalai Lama im fernen Osten. Hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt, tagen die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans unter Michelangelos „Jüngstem Gericht“. Über Personen und Programme dürfen sie kein Wort verlieren – während sie in Wirklichkeit natürlich hektisch an Kandidatenprofilen feilen und über Wahlbündnisse diskutieren. Der Welt tun sie das Ergebnis ihrer Stimmabgabe kund, indem sie die Wahlscheine mit feuchtem Stroh und Pech verbrennen. Das ergibt schwarze Rauchschwaden. Ist der neue Papst gewählt, lässt man das Pech weg, und aus dem Schornstein der Sixtina dringt weißer Rauch. Ein Ritual wie aus alten Sagen.
Das Konklave ist immer für Überraschungen gut. Die letzten Male hat es der katholischen Christenheit ausgesprochene Exoten beschert: 1978 den Papst aus Polen, der mit seinem Hofstaat gern mal Wodka trank, Aktenstudium hasste, lieber auf Reisen ging und die Kommunisten in seiner Heimat unter der Fahne der Schwarzen Madonna von Tschenstochau das Fürchten lehrte. 2005 dann den bayerischen Gendarmensohn, nach oberflächlichem Medienurteil eine Mixtur aus fröhlichem Schöngeist und finsterem Aufklärungsgegner, beängstigend gescheit und gleichzeitig auf eine sture Weise fromm, ein eigentlich ganz sympathisches Fossil aus dem Land der Kuhglocken und Zwiebeltürme, in dem die Uhren etwas anders gehen. Auf jeden Fall langsamer. Und schließlich 2013 nach Benedikts sensationellem Rücktritt den argentinischen Jesuiten Bergoglio, der sich nach dem Heiligen der Armen und der Schöpfung Franziskus nennt und manchen Vatikanbeamten zur Verzweiflung bringt, weil er auf all das barocke Brimborium verzichtet, mit Obdachlosen Mittag isst und ständig von den im Mittelmeer ertrinkenden Geflüchteten redet.
Doch die Klischees über Ratzinger-Benedikt, den nobelpreisverdächtigen theologischen Vordenker mit dem Kinderglauben, stimmen ebenso wenig wie die über seine hinterwäldlerische Heimat.
„Mach ma halt a Revolution, damit a Ruah is!“
„In Bayern sind 60 Prozent der Bevölkerung Anarchisten, und die wählen alle die CSU.“ Der listig-krude Poet und Filmemacher Herbert Achternbusch – aufgewachsen bei seiner Oma im Bayerischen Wald – brachte es auf den Punkt: Zum bayerischen Nationalcharakter gehören eine wilde Freiheitsliebe und viel mehr Toleranz, als man glaubt. „Leben und leben lassen“ heißt das oberste Motto. Ob Städter oder Bauern, kleine Tagelöhner oder Klosterbewohner, die Bayern haben sich von weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten noch nie viel gefallen lassen, und die Staatspartei CSU hat ihre Traumergebnisse über Jahrzehnte hinweg weniger der eigenen politischen Leistung verdankt als der Furcht ihrer Wähler, von den Preußen, der Bundespolitik oder den Europa-Behörden in Brüssel geschluckt zu werden.
Mit einem Trauma beginnt die bayerische Geschichte: 788 steckte Karl der Große den vermeintlich unzuverlässigen Bayernherzog Tassilo III. mit seiner ganzen Sippschaft in ein Klosterverlies und zog seine Güter ein, Bayern gehörte fortan zum Reich. Was sich ein paar Jahrzehnte später freilich wieder änderte, das Herzogtum Bayern erstand neu – mit Österreich als Anhängsel –, die Wittelsbacherherzöge erwarben 1214 die Rheinpfalz dazu, Kaiser Ludwig der Bayer arrondierte seine Besitztümer mit Brandenburg, Tirol und Holland. Irgendwie kann das Klischee von den Hinterwäldlern nicht so recht stimmen. Das Verhältnis zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und dem starken Voralpenstaat schwankte jahrhundertelang zwischen Symbiose, Bündnistreue und Rebellion.
So betrachtet, war der Schlösser bauende und Kriege hassende „Märchenkönig“ Ludwig II. weniger eine psychopathische Ausnahmeerscheinung als ein typischer sturer Bayer, als er sich einen Dreck um die Weltmachtansprüche seiner Monarchenkollegen scherte und Bismarcks Visionen vom neuen kleindeutschen Reich lange die kalte Schulter zeigte.
Am anderen Ende der gesellschaftlichen Skala finden sich die Robin Hoods aus den Wäldern. Banditen mit Herz wie den Räuber Heigl oder den zu Film- und Bühnenehren gelangten Mathias Kneißl bewunderte und liebte das Landvolk: Rebellen, die den Reichen von ihrem unverschämten Luxus etwas wegnahmen und es nicht selten den Armen gaben, stellvertretende Rächer, die für ausgleichende Gerechtigkeit sorgten und der Staatsmacht kühn ein Schnippchen nach dem andern schlugen.
Einödbauern, Wirtsleute, fahrende Krämer versteckten die Outlaws, versorgten sie mit Essen, führten die Gendarmen irre. Langsam, aber beharrlich entwickelten die gegängelten kleinen Leute einen Anspruch, an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen mitzuwirken und über das eigene Leben selbst zu bestimmen. 1918 rief der Sozialist Kurt Eisner in München die bayerische Republik aus. Seine meist sehr besonnen agierenden Arbeiter- und Soldatenräte wirkten überraschend harmonisch mit aufgeschlossenen Bauernvertretern aus dem Umland zusammen. Die Bauernbünde kämpften schon lange gegen Großbauern, Adel und hohen Klerus – gemeinsam mit Dorfkaplänen, Lehrern und katholischer Arbeiterbewegung.
Die bayerischen Revolutionäre waren offenbar erheblich gelassener und weniger fanatisch als ihre Berliner und Hamburger Gesinnungsgenossen, die es ihnen kurz darauf nachtaten: 1918 kam es im Münchner Mathäserbräu zu erregten Diskussionen zwischen den Eisner-Leuten und den bedächtigeren Sozialdemokraten. Da stand ein gewisser Zankl Sepp auf und besänftigte die Gemüter mit der Parole: „No ja, Genossen, mach ma halt a Revolution, damit a Ruah is!“
Ratzinger, Karl Valentin und die Freude an der Ironie
Als am 11. Februar 1948 auf dem Waldfriedhof Planegg der Tragikomiker Karl Valentin zu Grabe getragen wurde, marschierte ein 20-jähriger Theologiestudent aus München stundenlang über verschneite Landstraßen, um dem von ihm vergötterten Sprachakrobatiker die letzte Ehre zu geben. Sein Name: Joseph Ratzinger.
Wer sich in der Barockliteratur und in der süddeutschen Theaterlandschaft auskennt, wird in Karl Valentins Misstrauen gegenüber Selbstverständlichkeiten und in seinem tiefgründelnd-destruktiven, zertrümmernden Umgang mit der Sprache etwas von der bayerischen Seele erkennen. Auch Bert Brecht – privat ein gefühlsarmer Pascha und gleichzeitig zartfühlender Anwalt der Würde klein gehaltener Menschen – war ein Bayer. Und wie Ratzinger ein Bewunderer von Karl Valentin: „Dieser Mensch ist ein durchaus komplizierter, blutiger Witz. (…) Hier wird gezeigt die Unzulänglichkeit aller Dinge, einschließlich uns selber.“
Zu Brechts und Valentins literarischen Vorfahren zählt Graf Franz von Pocci, Zeremonienmeister am Münchner Hof des kunstsinnigen Königs Ludwig I., Komponist, Karikaturist und Märchendichter. Der Pocci Franzl holte den charmanten Possenreißer Pulcinello aus der italienischen Commedia dell’Arte ins Bayerische herüber und machte ihn zum Kasperl Larifari, den nicht nur die Kinder lieben. Der Kasperl erscheint zwar als Hoffnungsträger wider Tod und Teufel und führt letztlich immer das Gute zum Sieg; aber er erscheint auch als verantwortungsloser Nichtsnutz, der sich dem möglichen Sinn von Welt und Geschichte verweigert und alle Weisheit und Moral in bloßes Spektakel verwandelt.
Die bayerische Kulturfracht ist bunt und zwiespältig. Die bis heute nachwirkende rauschhaft-sinnliche Barockfrömmigkeit gehört dazu mit ihren todtraurigen Ölbergandachten und prächtigen Fronleichnamsprozessionen. Am Fest Christi Himmelfahrt zog man während des Gottesdienstes eine Statue des auferstandenen Heilands durch ein Loch in der Kirchendecke empor, unter Gesang und Orgeljubel – und kaum war Christus auf den Dachboden entschwunden, ließen die Ministranten durch dieselbe Öffnung Hostien und Wasser auf die Kirchenbesucher herunterregnen: Trotz Himmelfahrt bleibt der Herr in Taufe und Mahlfeier bei den Seinen.
Die Lust am Sinnlichen, Greifbaren paart sich bei den Bayern mit einer gesunden Skepsis gegenüber großmäuligen Worten und geschwätzigen Theorien. Auf dem Dorf pflegten die Männer einst während der Sonntagspredigt die Kirche zu verlassen, weil da „ja bloß geredet wird“. Nüchtern und unromantisch ist dieser Menschenschlag – dabei von einem wortkargen, zupackenden Mitgefühl und bisweilen ziemlich sentimental. Wirklichkeit ist hierzulande etwas höchst Zweifelhaftes, so dass der echte Bayer am liebsten gar nichts wissen, sondern nur glauben will – was sich freilich sogleich wieder an seiner tief eingewurzelten Skepsis bricht: „Geh weiter!“ (auf Norddeutsch: Was du nicht sagst!), beginnt er in verblüfftem Ton seine Kommentare, was den staunenden Zweifel beinhaltet und das Denken im Irrealis befördert.
„Schlampige Religiosität“ unter Barocktürmen
Der Passauer Kabarettist Bruno Jonas hat eine interessante Erklärung dafür, warum die ungeschlachten Bajuwaren im 8. Jahrhundert Christen wurden: Wenn die argwöhnischen Ur-Bayern die iroschottischen Missionare damals nicht gleich wieder heimgeschickt oder umgebracht hätten (Ausnahmen bestätigen die Regel), dann könne das nur daran liegen, dass sie mit ihren keltischen und germanischen Göttern unzufrieden gewesen seien. Und an der raffinierten Toleranz der Missionare, die einfach ein zusätzliches Glaubensangebot gemacht, einen attraktiven Blick ins Jenseits ermöglicht hätten. Der frühe Bayer werde darauf wohl gesagt haben: „Probiern kannt ma’s ja amoi. Wenn’s net schad’. Schaden wird’s scho net!“
Georg Ratzinger, der ältere Bruder von Papst Benedikt und einst Chef der Regensburger „Domspatzen“, meinte wohl etwas Ähnliches, wenn er in den zahllosen Interviews nach dem Konklave von der „schlampigen Religiosität“ seiner bayerischen Landsleute sprach. Ein gelassener, unbefangener Umgang mit dem Himmel muss kein Zeichen von Ehrfurchtslosigkeit sein. Trübe Fundis haben in Bayern jedenfalls weniger Chancen als anderswo.
Der breitschädelige Oskar Maria Graf, Schwabinger Bohème-Dichter, 1933 emigriert, 1967 in New York gestorben, trat dort und in Moskau in Lederhose und Trachtenjanker auf – und war doch ein scharfsinniger politischer Denker, weltgewandt, tolerant, mit einem empfindlichen Gewissen. Er wusste, welche Probleme die Frömmler mit der legeren Spiritualität seiner Landsleute hatten; „aber schaut euch doch einmal das Innere unserer berühmtesten Barockkirchen genauer an, was da für ein sinnlich-unfrommer Witz, für eine ausschweifend weltliche Phantasie, was für eine geradezu knisternd-listige Humorigkeit und unbändig saftige Lebenslust herumgeistert, dann begreift ihr vielleicht, warum auch die heiligmäßigen Sachen für uns etwas Komisches und Fideles haben müssen wie alles Lebendige. Wär’s anders – wie könnten wir überhaupt katholisch sein!“
Nichts erscheint in diesem Land der versöhnten Widersprüche normaler als der an Intellektualität wie Glaubenskraft gleich starke Theologiestudent Ratzinger am offenen Grab des Erzkomikers Karl Valentin. „Derb, direkt und äußerst respektlos“ sei der bayerische Volksglaube, sagt Graf, mit einer Beimengung von viel „Heidnisch-Fetischhaftem“ und einem „fast animalischen Hang zum Greifbaren“: Nie werde ein Bayer abstrakt von „Gott“ reden, „er sagt stets ‚Herrgott‘, weil in dieser Verbindung die unantastbare Autorität des ‚Herrn‘ über alle vermeintlichen Herren den gültigen Ausdruck findet.“ Aber es sei eben ein Herrgott, der „ein unverwirrbares Zutrauen, eine arglose Heiterkeit und ein warmes Gernhaben in uns erweckt (…), nicht aber einer, vor dem man Angst und Furcht hat. Wir Bayern sind kein ‚gottesfürchtiges‘, sondern ein gottanhängliches Volk.“
Das renitente Hadern mit dem Schöpfer und seinen offensichtlichen Ungerechtigkeiten gehört zu dieser Religiosität genauso dazu wie das innige Vertrauen, dass er am Ende schon alles ins Lot bringen und heil machen wird. „Gott, nimm mi wieder“, lässt ein zeitgenössischer bayerischer Poet einen Sterbenden beten, „und mach aus mir, / was Du willst. / I woaß, / Du b’haltst mi scho. / Amen!“ Wenn er dann für immer schläft, so tief und glücklich, dass er es gar nicht mehr merkt, wenn er in der Ewigkeit aufwacht und die Welt fort ist, dann sollen seine Freunde „a Sehnsucht von mir / an Himmi nauf“ hängen wie einen Stern.
Typisch für eine solche Frömmigkeit sind wohl weniger die sauertöpfischen, „verdruckten“ Heuchler, wie man in Bayern die Verklemmten nennt, sondern im 19. Jahrhundert so menschenfreundliche Antiaufklärer wie Bischof Johann Michael Sailer, der gute Freundschaft mit Protestanten hielt, oder Professor Ignaz Döllinger, der stur die Vorherrschaft der Kirche über den Staat vertrat und ebenso hartnäckig gegen das überstürzt vom Ersten Vatikanischen Konzil verabschiedete Unfehlbarkeitsdogma focht.
So einfach ist das nicht mit den Schubladen, konservativ oder fortschrittlich, fromm oder aufgeklärt, bieder oder rebellisch. Und Ratzingers Vater, der gestrenge Gendarm? Der war ein armer Hund.
2
Der Hitlerjunge, der keiner war
„Ich gehöre zu den Menschen,die nicht fürs Internatgeschaffen sind“
Es ist ein merkwürdiges Phänomen: Während in den Jahren vor Hitlers Machtübernahme Studenten, Hochschullehrer, Ärzte, Juristen schon früh in hellen Scharen zu den Nazis überliefen, ihrem vermeintlichen akademischen Durchblick zum Trotz, zeigte sich die von intellektuellen Schnöseln gern verachtete bayerische Landbevölkerung erstaunlich resistent gegenüber den braunen Parolen. Die sogenannten kleinen Leute mit ihrem gesunden Wirklichkeitssinn bewiesen oft erheblich mehr Skepsis als promovierte Leitartikler, Schuldirektoren und Bischöfe.
Zu den unauffälligen Selbstdenkern mit ihren zaghaften, bisweilen lebensgefährlichen Widerstandsgesten gehörte Joseph Ratzinger, damals Kommandant der Gendarmeriestation Marktl am Inn (heute 2 700 Einwohner, Landkreis Altötting in Oberbayern). Er schätzte seine häusliche Ordnung und las den „Geraden Weg“, ein katholisches Wochenblatt mit Schlagzeilen wie „Der Nationalsozialismus ist eine Pest!“, „Hitler, der Bankrotteur“, „Deutsche, Eure Menschenrechte in Gefahr“ oder „Sperrt die Führer ein!“. Vier Tage nach den Reichstagswahlen im März 1933, die Hitler die absolute Mehrheit beschert hatten, stürmten SA-Horden die Redaktion in München, transportierten sämtliche Manuskripte und Akten ab, schlugen den Chefredakteur Dr. Fritz Gerlich halbtot und brachten ihn ins Polizeigefängnis. Ein Jahr später wurde er in das KZ Dachau verlegt und sofort nach der Ankunft dort ermordet.
Der Gendarmeriemeister Ratzinger moserte nicht nur hinter zugezogenen Gardinen. Er schritt bei Versammlungen gegen gewalttätige „Hakenkreuzler“ ein – so nannte man die Nazis in Bayern – und warnte regimekritische Priester vor Spitzeln. Um der Vereinnahmung durch den NS-Staat und unliebsamen Nachforschungen zu entgehen, ließ er sich ständig versetzen. Dass sein Hilfsgendarm, ein strammer Nazi, den Ortspfarrer denunzierte und Braunhemden den Priester daraufhin gnadenlos verprügelten, konnte er nicht verhindern.
Die Ratzinger-Kinder: Maria (* 1921), Georg (er leitete drei Jahrzehnte die Regensburger „Domspatzen“, * 1924) und in der Mitte das „Nesthäkchen“ Joseph (* 1927, zum Papst gewählt 2005)
Als Hitler an die Macht kam und das „Tausendjährige Reich“ ausrief, 1933, war der kleine Joseph Aloysius gerade fünf Jahre alt. Am 16. April 1927 hatte er am Marktplatz 11 in Marktl das Licht der Welt erblickt – oder genauer gesagt, erahnt. Denn es war Nacht, es herrschte bitterer Frost und es schneite fürchterlich. Die Geburt war überaus schwer gewesen. Umso glücklicher blinzelten Vater Joseph (50) und Mutter Maria (43) in das Schneetreiben, als sie das sorgsam verpackte Büblein am nächsten Morgen zur Taufe trugen. Die Schwester Maria, fünf Jahre alt, und das dreijährige Brüderchen Georg – der spätere Regensburger Domkapellmeister – blieben in ihrem warmen Zuhause.
Träumen in der alten Scheune
Die Eltern, Joseph und Maria, hießen wie die Figuren aus einem altbayerischen Krippenspiel. Kennen gelernt hatten sie sich, wie ein vom späteren Papst nie dementiertes Gerücht wissen will, über eine Heiratsanzeige im „Altöttinger Liebfrauenboten“. Vater Joseph wuchs auf einem Bauernhof im niederbayerischen Rickering auf, seine Frau Maria war die Tochter eines Bäckermeisters, der aus dem idyllischen Südtiroler Pustertal nach Oberbayern gezogen war.
Ein Gendarmerie-Kommandant war auf dem Land zwar eine Respektsperson, aber eine schlecht bezahlte, und im kleinen Marktl waren keine spektakulären Verbrechen zu verhindern oder ruhmreich aufzuklären. Joseph Ratzinger senior hatte höchstens mal eine Wirtshausrauferei zu schlichten oder einen Vagabunden zu arretieren. Zum Glück war seine hübsche Auserwählte eine gelernte Köchin, die – als die Kinder nicht mehr ganz so klein waren – in besseren Häusern in Stellung gehen und etwas dazuverdienen konnte.
Viel war das freilich nicht. Wenn man jeden Pfennig umdrehen muss, wird man entweder bitter – oder man entwickelt Fantasie und lernt sich an kleinen Dingen zu freuen. Die Armut habe seiner Familie eine tiefe „innere Solidarität“ beschert, erinnerte sich der Kurienkardinal, und „Freuden, die man im Reichtum nicht haben kann“. Grimmig autoritär scheint der Gendarm Ratzinger zu Hause nicht aufgetreten zu sein. Streng, aber gerecht sei er gewesen, berichten die Söhne, ein talentierter Erzähler und Musikant. Die Mutter muss ein herzensguter, fröhlicher Mensch gewesen sein, mit einem fast magischen Einfühlungsvermögen und der Fähigkeit, sich selbstlos mitzufreuen.
Kaum hatte sich die Familie irgendwo eingelebt, musste sie schon wieder umziehen: Marktl, Tittmoning an der Grenze zu Österreich, Aschau – ein Dörfchen am Inn –, schließlich Hufschlag bei Traunstein. Als Hitler die ganze Macht in Deutschland bekam, 1933, verkündete Vater Ratzinger wie ein Prophet: „Jetzt kommt der Krieg, jetzt brauchen wir ein Haus!“ Er fand es in Hufschlag am Waldrand, ein Häuschen, windschief und stark sanierungsbedürftig, etwas anderes konnte sich die Gendarmenfamilie nicht leisten. Aber die Kinder waren begeistert, vor allem vom Bauerngarten mit seinen Apfel- und Zwetschgenbäumen und von der alten Scheune, wo man wunderbar spielen und träumen konnte. Joseph vermisste allerdings das Marionettentheater, das bei einem Freund aus Tittmoning auf dem Dachboden aufgebaut gewesen war und im Halbdunkel einen geheimnisvollen Zauber ausgeübt hatte.
Der spätere Papst galt lange als kühler Intellektueller mit gebremster Emotionalität. Doch wenn man ihn nach seiner Kindheit fragte, begann er selig zu plaudern, in zärtlichen, bisweilen wehmütigen Worten. Von den Schlüsselblumen auf den Frühlingswiesen, von den Spaziergängen mit der Mutter zu einer versteckten Waldkapelle, vom Moossammeln für die Weihnachtskrippe und von den feierlichen Gottesdiensten mit Weihrauch und lateinischem Gesang, in denen er schon als kleiner Bub die große Liebe seines Lebens entdeckte: ein in Jahrhunderten gewachsenes kostbares „Gewebe von Text und Handlungen“, eine Individualitäten und Generationen übersteigende Wirklichkeit. Heimat.
Glückliche Kindheit: Dieses alte Bauernhaus in Hufschlag nahe Traunstein bezeichnete Joseph Ratzinger als seine eigentliche Heimat.
Obwohl die beiden Brüder zuhause mit Hingabe Messe spielten, wie das früher in katholischen Familien üblich gewesen ist, mit gerecht verteilten Rollen und Gewändern, die ihnen Omas und Tanten zurechtschneiderten, war noch keine Rede von einer klerikalen Zukunft. Der ästhetisch veranlagte Joseph wollte unbedingt Anstreicher werden; eine Hausfassade zu gestalten, schien ihm der Gipfel künstlerischer Macht.
Als jedoch der Münchner Kardinal Michael von Faulhaber zur Firmung nach Tittmoning gekommen war, ein Kirchenfürst wie aus dem Bilderbuch mit Burgtheaterstimme und im prächtigen Purpur, hatte der dreijährige Joseph Aloysius kurzfristig bereits mit dem Gedanken gespielt, auch so ein Kardinal zu werden.
Ein fantasieloser Lausbub und Hitlers Überfall auf Polen
Es spricht für Papst Ratzinger, dass er selbst und seine Biografen und PR-Angestellten nie der Versuchung erlegen sind, eine engelgleiche Kindheit und Jugend zu konstruieren. Kein Mensch schildert den kleinen Joseph als ätherischen Heiligen oder vergeistigtes Wunderkind, am wenigsten er selbst. Schulkinder pflegen gnadenlos zu urteilen, wenn sie einen Streber in der Klasse sitzen haben. Die Mitschüler aus dem Traunsteiner humanistischen Gymnasium, die noch am Leben sind, erinnern sich an einen blitzgescheiten, überhaupt nicht eingebildeten Überflieger, der sie bereitwillig in Latein und Griechisch abschreiben ließ.
Allerdings hat ihn auch niemand „Sepp“ oder „Beppi“ genannt, was im ländlichen Bayern damals fast einer Ausstoßung aus der menschlichen Gesellschaft gleichkam. Er blieb immer der Joseph, ein wenig überbehütet, mit einem Horror vor den Turnstunden und einer heißen Liebe zur Literatur: Stifter, Eichendorff, Goethe. Er schrieb Gedichte und nahm Harmonium-Unterricht. Vielleicht lag es auch an frühen Erfahrungen mit dem tückisch allgegenwärtigen Tod, dass der Joseph ein scheuer, immer irgendwie nach innen blickender Junge blieb: In seiner Aschauer Zeit wäre er beim Spielen beinahe in einem Karpfenteich ertrunken. Und in Tittmoning hatte er nur mit knapper Not eine lebensbedrohliche Diphterie überstanden.
Um Kardinal zu werden, musste der Einserschüler erst einmal 1939 in ein Knabenseminar eintreten; es war das Traunsteiner Erzbischöfliche Studienseminar, in dem sich schon sein Bruder Georg befand. Das war wohl auch der innerste Grund für die frühe Berufsentscheidung; Joseph vergötterte den Älteren und ließ sich von ihm führen. Den zweiten Grund – und das eigentliche Motiv, Priester zu werden – hat Joseph erst später verraten, er schob sich wohl erst im Lauf der Jahre in den Vordergrund. Als er schon Papst war und im April 2006 auf dem Petersplatz mit einer Gruppe Jugendlicher sprach, fragte ihn der 20-jährige Pädagogikstudent Vittorio aus Cinecittà danach. Benedikt antwortete, er habe damals erkannt, wie dringend man Priester brauche, um der „menschenfeindlichen Kultur“ der Nationalsozialisten zu widerstehen.
Das disziplinierte Lernen war Joseph gewöhnt. Seine Hausaufgaben hatte er immer schnell, aber exakt erledigt, nach einer kurzen Mittagspause. Doch für das Internatsleben sei er wohl nicht geschaffen gewesen, gab er später in seiner Autobiografie freimütig zu. „Ich hatte in großer Freiheit zu Hause gelebt, studiert, wie ich wollte, und meine eigene kindliche Welt gebaut. Nun in einen Studiersaal mit etwa sechzig anderen Buben eingefügt zu sein, war für mich eine Folter, in der mir das Lernen, das mir vorher so leicht gewesen war, fast unmöglich schien.“ Ganz besonders hasste der zierliche, ein wenig verträumte Junge die „Leibesübungen“ auf dem Sportplatz.
„Vom Hitlerjungen zum Papa Ratzi!“
So titelte die in deutschen Belangen gern hysterisch agierende englische „Sun“ nach der Papstwahl am 19. April 2005. Ratzingers Lieblingsjournalisten Peter Seewald fiel trotzdem ein Stein vom Herzen, dass die Kardinäle ihre Entscheidung so flott getroffen hatten und nicht einen Tag später, am 20. April: „Führers“ Geburtstag!
Als Benedikt XVI. noch der „Panzerkardinal“ war, hatte er eine Menge Gegner, und er lieferte ihnen mit drakonischen Entscheidungen und einem bisweilen autoritären Auftreten auch immer wieder Stoff zum Kritisieren. Doch nie im Leben hat man ihm so Unrecht getan wie mit solchen Verdächtigungen. Denn der junge Joseph Ratzinger war zwar Flakhelfer und kurze Zeit Rekrut in der Wehrmacht, aber nie an der Front – und er ist auch kein richtiger Hitlerjunge gewesen, sondern bloß ein halber. Und das kam so:
Als sich der großsprecherisch begonnene Krieg für Deutschland in ein verlustreiches Inferno verwandelte und immer mehr Transporte mit Verwundeten eintrafen, wurden auch die letzten noch verbliebenen kirchlichen Bildungsanstalten beschlagnahmt und zu Lazaretten umfunktioniert. 1941 schickte man die beiden Ratzinger-Brüder nach Hause. Georg (17) kam bald darauf zum Reichsarbeitsdienst und dann als Funker zur Wehrmacht. Joseph (14) durfte wieder auf das Gymnasium gehen, was ihn mächtig freute, und musste einmal pro Woche im HJ-Heim aufkreuzen, was er hasste: schon wieder Sport, Geländespiele, Exerzieren!
Vom Seminar aus war er zwangsweise in die Hitlerjugend gemeldet worden, das ließ sich nicht ändern, aber die „unfreiwilligen“ HJ-ler wurden argwöhnisch beobachtet, schikaniert und bekamen keine Uniform. Als das Seminar aufgelöst wurde, ging er nicht mehr zu den Appellen und Zusammenkünften – und fand zum Glück einen Nazi-Lehrer mit toleranten Anwandlungen, der es nicht so genau nahm und seinen Namen klammheimlich von der Liste löschte.
1943 zog man die Traunsteiner Seminaristen geschlossen zur Flugabwehr nach München ein. Der 16-jährige Joseph wohnte in einer Baracke und bediente in der Nähe der Stadt elektronische Messgeräte und Telefonanlagen, um Industriebetriebe (unter anderem die Düsenjägerproduktion von Dornier) zu schützen und die alliierten Bomber am Vordringen nach München zu hindern. Und nebenbei ging er zur Schule, auf das berühmte Münchner Max-Gymnasium, wo 1935 Franz Josef Strauß Abitur gemacht hatte – das beste seines Jahrgangs in Bayern.
Joseph hatte ein verteufeltes Glück, mehrfach. Während sein Bruder Georg an der italienischen Front im Granatenhagel verwundet wurde, kommandierte man ihn lediglich zum Arbeitsdienst an die österreichisch-ungarische Grenze ab, wo er mit einem ungeladenen Gewehr Zwangsarbeiter zu bewachen hatte. Und als er im November 1944 nach München zurückkehrte, schickte man ihn erst mal in die Traunsteiner Infanterie-Kaserne, wo er seine soldatische Grundausbildung nachholen sollte. Das zog sich bis in die letzten Kriegstage hin. Der „Schrecken aller Unteroffiziere“ soll er gewesen sein wegen seines absoluten militärischen Ungeschicks.
Ende April 1945, als die Amerikaner immer näher kamen, entschloss sich Joseph, einfach nach Hause zu gehen. Auf Schleichwegen natürlich, denn überall gab es Posten, die Deserteure kurzerhand erschießen sollten. An einer Bahnunterführung traf er tatsächlich auf zwei Soldaten. Weil er jedoch den Arm wegen einer leichten Verletzung in der Schlinge trug, ließen sie ihn als „Verwundeten“ passieren. „Es waren gottlob solche, die auch den Krieg satt hatten und nicht zu Mördern werden wollten.“
Zuhause drohte neue Gefahr: Zwei SS-Männer quartierten sich bei der Familie ein, Vater Ratzinger konnte sich nicht beherrschen und schrie ihnen seine Wut über Hitler und den Krieg ins Gesicht. Kaum waren die SS-ler verschwunden (ohne den offenherzigen Ex-Gendarmen aufzuhängen), marschierten die Amis ein, trieben die versprengten deutschen Soldaten auf der Wiese vor dem Ratzinger-Haus zusammen und führten sie ziemlich planlos drei Tagesmärsche weit durch Bayern. Joseph landete mit 50 000 anderen Gefangenen auf einem Ackergelände bei Ulm. Es gab keine Baracken oder Zelte und pro Tag einen Schöpflöffel Suppe mit einem Kanten Brot als Verpflegung.
In kluger Voraussicht hatte er sich daheim schnell noch einen Bleistift und ein leeres Schulheft eingesteckt, das er nun Tag für Tag mit Lebensweisheiten und griechischen Hexametern füllte. Theologiestudenten, Juristen, Kunsthistoriker, Philosophen arrangierten außerdem ein hochinteressantes Vortragsprogramm, eine Art Open-Air-Kolleg. Nach sechs Wochen wurde Joseph entlassen und mit einem Armeelastwagen nach München gebracht. Von dort marschierte er 120 Kilometer nach Hause. Wieder ein paar Wochen später stand plötzlich der verloren geglaubte Georg in der Tür, braun gebrannt von der Sonne Italiens. Ohne ein Wort zu verlieren, setzte er sich ans Klavier und intonierte ein brausendes „Großer Gott, wir loben dich“.
Die ganze Familie an einem Tisch: Vater Joseph, der mutige Gendarm, und Mutter Maria; rechts Tochter Maria und Georg, der im Priesterseminar „Orgel-Ratz“ hieß; links Joseph, der „Bücher-Ratz“, in charakteristischer Denkerpose.
3
Senkrechtstarter mit liberalen Anflügen
„Was der Kirche Not tut,sind nicht die Lobrednerdes Bestehenden“
„Orgelratz“ und „Bücherratz“ nannte man die unzertrennlichen Brüder im Freisinger Priesterseminar, den musikverliebten Georg und den jüngeren Joseph, der wie besessen Augustinus und Martin Buber, Dostojewskij und Paul Claudel, Max Planck und Werner Heisenberg in sich hineintrank. „Immer wenn man in die Bibliothek kam, saß dort schon der Joseph“, erinnert sich ein Kommilitone. An Weihnachten 1945 zogen rund 120 Priesteramtskandidaten, 40-jährige Kriegsheimkehrer und blutjunge Schulabgänger, im Seminar ein, das bislang als Lazarett für Kriegsgefangene gedient hatte. Und natürlich folgte der Joseph seinem bewunderten älteren Bruder wie ein Schatten.
Wie überall in der deutschen Bildungslandschaft herrschten erbarmungswürdige äußere Bedingungen: zerbombte Hörsäle, ausgebrannte Bibliotheken, kein Heizmaterial, wenig zu essen. Und wie überall änderte das überhaupt nichts an der begeisterten Aufbruchsstimmung, an der Freude, endlich wieder frei denken und reden zu dürfen. Im Herbst 1947 – die Münchner Universität lag noch in Trümmern – zog man in das einstige königliche Jagdschloss Fürstenried um, wo es so eng zuging, dass sich Joseph Ratzinger in seine Flak-Baracke zurückversetzt fühlte.