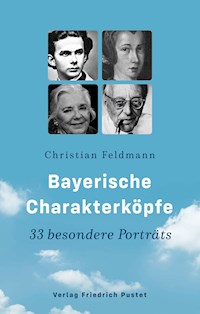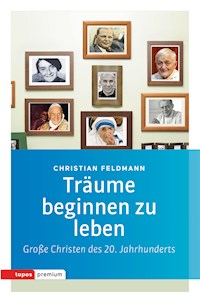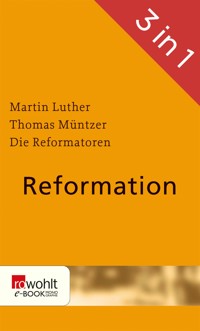
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Martin Luther (1483-1546) wollte weder eine neue Kirche gründen noch eine Revolution auslösen. Erst der Hochmut der klerikalen Hierarchie und das Ränkespiel der Politik machten aus ihm den wilden Kämpfer und Reformator. Vielleicht das aufregendste Leben der deutschen Religionsgeschichte – kenntnisreich und spannend erzählt. Thomas Müntzer (um 1490–1525) hat als Zeitgenosse und Widerpart von Martin Luther Geschichte geschrieben. Seine Überzeugung, die Kirche müsse für die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden arbeiten, machte ihn zum Gegner der etablierten Theologie; seine Empörung über die Willkürherrschaft der Fürsten ließ ihn zum Anführer der aufständischen Bauern werden. An der Spitze eines Bauernheeres wurde er im Mai 1525 verhaftet, gefoltert und in der Nähe von Mülhausen hingerichtet. Ihre Lehren waren Ausdruck einer Endzeit, ihr Wirken legte das Fundament einer neuen Epoche. Jeder Reformator steht für eine Phase der rasanten Entwicklung zur Neuzeit. Martin Luther war der fulminante Auftakt der Reformation; Thomas Müntzer radikalisierte ihre soziale Botschaft; Huldrych Zwingli verankerte sie im städtischen Bürgertum; Philipp Melanchthon modernisierte die Bildung; und Johannes Calvin schuf ihre individuelle Ethik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum
Sonderausgabe Juli 2017 Martin Luther Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2013 Copyright © 2009 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Thomas Müntzer Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2017 Copyright © 1972 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Die Reformatoren Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2017 Copyright © 2002 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke ISBN E-Book 978-3-644-40393-2 www.rowohlt.deChristian Feldmann, Gerhard Wehr, Veit-jakobus Dieterich
Reformation
Christian Feldmann
Martin Luther
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Maßloses Genie
Ist er ein mittelalterlicher Mönch gewesen oder ein Pionier der Moderne? Ein zutiefst Religiöser oder ein Renaissancemensch? War er ein Kirchenspalter oder Glaubensvater? Reaktionär oder Rebell? Humanist oder Antisemit? Aufklärer oder Teufelsgläubiger? Nationalist oder Europäer? Wer war Martin Luther?
Stärker als die 122 voluminösen Bände der 2009 abgeschlossenen «Weimarer» Gesamtausgabe seiner Werke, eindrucksvoller als die mehr als drei Millionen Belegkarten zu Personen, Orten, Stichwörtern im Tübinger «Luther-Archiv» dokumentieren die Mitgliederzahlen der protestantischen Kirchen – eine Drittelmilliarde, wenn man Lutheraner, Reformierte und Freikirchen zusammenrechnet –, welche Bedeutung dieses 1546 begrabene geniale, maßlose, chaotische, penible, intellektuell hochfliegende, schrecklich vereinfachende, in Gott und die Menschen verliebte, von wildem Hass getriebene, melancholische, cholerische, verletzend aggressive, an sich zweifelnde Energiebündel, das sich selbst abwechselnd als Doktor über alle Doktoren im ganzen Papsttum[1] und als armer stinkender Madensack[2] bezeichnet hat, bis heute besitzt.
Dass altvertraute Klischeevorstellungen das nüchterne Interesse an Fakten hartnäckig überwuchern, beweist nur, wie quicklebendig der Mythos Luther immer noch ist.
Höchstwahrscheinlich hat nicht der Professor Luther die berühmten 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen, sondern der Pedell der Universität, wie es üblich und von den Statuten sogar vorgeschrieben war[3] – wenn es den Thesenanschlag überhaupt gegeben hat.
Der trotzige Satz «Hier stehe ich, ich kann nicht anders» ist zwar in die Geschichte eingegangen und gehört zum Repertoire gängiger Redewendungen – aber Luther hat ihn nie gesagt vor dem in Worms versammelten Reichstag.
Seine Bibelübersetzung war zweifellos die schönste, genaueste und einflussreichste – aber keineswegs die erste. Schon vor Luther gab es vierzehn oberdeutsche und vier niederdeutsche Vollbibeln[4], ganz zu schweigen von den vielen Auswahlausgaben und den rund hundert Sammlungen der Sonntagsevangelien, die in den fünf Jahrzehnten vor der «Lutherbibel» erschienen sind.
Luthers kritische Anmerkungen zur Ablasspraxis entsprachen weitgehend traditioneller Theologie und offizieller römischer Lehre. Die Extremisten in den eigenen Reihen, die aus der religiösen Freiheitsbotschaft unbefangen politische und gesellschaftliche Revolutionsprogramme ableiteten, stoppte er mit eiserner Konsequenz, auch wenn dabei Blut floss. Er wies alle Versuche ab, ihn zum politischen Führer zu machen. Er wollte keine neue Kirche gründen, sondern dabei helfen, die Christenheit zu ihren schlichten Anfängen zurückzuführen. Ein Reformator wider Willen.
Und doch hat er die Welt verändert. Die von ihm ausgelöste Bewegung beendete das Mittelalter – als Epoche der Einheit von irdischer und himmlischer Welt und der kirchlichen Kontrolle über die Gesellschaft –, verstand das Christsein als individuelle Haltung, nicht mehr als automatischen Bestandteil einer politischen oder gesellschaftlichen Identität, und machte den Menschen mündig, weil zwischen ihm und Gott nun nur noch die Bibel stand, keine kirchlichen oder staatlichen Autoritäten. In der idealen Theorie, versteht sich.
Merkwürdig, dass man sich heute noch so für ihn interessiert. Wer soll in einer Zeit, die an Gottes Existenz überhaupt zweifelt, Luthers verzweifelte Suche nach einem gnädigen Vater im Himmel verstehen?
Aber hinter der postmodernen Fassade lauern all die uralten Ängste und Fragen, die Suche nach dem Sinn, die Sehnsucht nach etwas, das bleibt, die Furcht, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Was, wenn dieses absurde Universum, in dem Kinder verhungern und Menschen wegen ihrer Religion oder Hautfarbe massakriert werden, doch einen Schöpfer haben könnte, der um seine Kreaturen weint und sie glücklich sehen will? Was, wenn dieser Gott tatsächlich in Jesus ein menschliches Gesicht angenommen haben sollte?
Was, wenn Martin Luther recht hat mit seiner Auffassung, dass Glauben kein Für-wahr-Halten kirchenamtlich verordneter Lehrsätze bedeutet, sondern ein vertrauensvolles Sich-Einlassen auf diesen Gott, daß wir ihn annehmen sollen, ihn küssen und herzen, uns an ihn hängen, uns von ihm nicht reißen noch ihn uns nehmen lassen[5]?
«Ich bin oft vor dem Namen Jesu erschrocken»: Ein Aufsteiger wird Mönch (1483–1517)
Was über Martin Luther erzählt wird, stimmt nicht immer. Was er selbst von sich berichtet, noch viel weniger.
Er hieß bis zum 24. Lebensjahr gar nicht Luther, sondern Luder. Sein Geburtsjahr ist unsicher: Während er selbst das Jahr 1484 wegen der günstigen Planetenkonstellation favorisierte, hielten seine Mutter und später auch sein Weggefährte Philipp Melanchthon an 1483 fest. Er war keineswegs der Sohn eines Bauern[6] oder armen Bergmanns[7], sein Vater war ein aufstrebender Unternehmer, der Anteile an Hüttenwerken und Bergbaugesellschaften sowie eine repräsentative Hofanlage mit Stallungen und Lagerhäusern besaß. Und im Elternhaus herrschten nicht Prügel, Geiz und freudlose Strenge, sondern Sparsamkeit und nüchterne Zuneigung.
Die eigene Biographie nach bestimmten Mustern zu stilisieren erschien im 16. Jahrhundert noch weniger unmoralisch als heute. Beim Tischgespräch verklärte oder dramatisierte der alternde Luther manche Erinnerung. Und übertrieb gern etwas, im Bestreben, seinen Lebensweg als erstaunliche Fügung Gottes zu schildern.
Martins Großvater Heine Luder, vielleicht abgeleitet von Lothar, gehörte im Dorf Möhra bei Eisenach zu den wohlhabenden Bauern, und seine Frau stammte aus der reichsten Sippe im Ort. Weil nur der jüngste Sohn erbberechtigt war, musste Martins Vater Hans Luder, einer der älteren Söhne, einen anderen Beruf wählen. Er stieg in den Kupferschieferbergbau ein, damals die Zukunftstechnologie schlechthin, eine echte Goldgrube. An Elbe und Saale, im Erzgebirge, im Harz, in Tirol investierten große Handelshäuser wie die Fugger in Bergwerke, Schmelzhütten und metallverarbeitende Betriebe.
Hans Luder heiratete Margarete Lindemann aus einer noblen Eisenacher Familie, arbeitete sich vom Berghäuer zum Hüttenmeister hoch, zog in die Bergbaustadt Mansfeld und verkaufte auf der Leipziger Messe Rohkupfer an die Besitzer der sogenannten Seigerhütten, die aus dem Kupfer Silber herausfilterten. Während zeitgenössische Chronisten die Umweltzerstörung durch die expandierenden Bergwerksbetriebe anprangerten, sollte Martin Luther später den Abbau von Gold und Silber als sinnvolle Nutzung der Gaben Gottes preisen.[8]
Das Bergwerksgeschäft war riskant; Vater Luder musste sich hoch verschulden und eine Zeitlang jeden Pfennig umdrehen. Ausgrabungen und Bauforschungen im Bereich seines Mansfelder Hauses belegten 2003 jedoch den sozialen Status des Kleinunternehmers: Martin Luder wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Auf den Mittagstisch kamen junge Hühner, zartes Schweinefleisch, Karpfen, Hecht und Aal, dazu Singvögel wie Rotkehlchen, Goldammer und Dorngrasmücke. Man trank aus filigranen Pokalen und benutzte zierliche Messer. Und als einer der «Viermänner» vertrat Hans Luder die Bürgerschaft gegenüber dem Mansfelder Magistrat.
Folgt man den Legenden, so waren in Martins Elternhaus Schläge, Moralpredigten und düstere religiöse Riten an der Tagesordnung. Das alles nur, weil Martin zeitlebens ein gespanntes Verhältnis zu seinem Vater hatte – ziemlich normal zwischen einem hart arbeitenden Aufsteiger und einem ungebärdigen Sohn, der sich als frommer Revoluzzer aufführt, statt einen lukrativen Beruf zu ergreifen – und weil sich unter mehr als siebentausend «Tischgesprächen» zwei oder drei triste Erinnerungen finden, von studentischen Zuhörern notiert und von Luther niemals gegengelesen: Meine Mutter stäupte mich einmal um einer geringen Nuss willen, bis Blut kam.[9]– Mein Vater stäupte mich einmal so sehr, dass ich vor ihm floh und dass ihm bang war, bis er mich wieder an sich gewöhnt hatte.[10] Ein Vater, dem «bang» ist, weil er seinen Sohn durch Härte verschreckt hat, ein Vater, der bei meiner Mutter geschlafen und mit ihr gescherzt hat und sind fromme Leute gewesen[11], ein Vater, dem er bei dessen Tod einen überaus lieben Umgang[12] bescheinigt – so ein Vater kann kein gefühlloser Haustyrann gewesen sein.
Ließ sich der Austritt aus dem Kloster leichter erklären, wenn Martin sich hinter einem rigorosen Erziehungszwang verschanzte, der ihn hineingetrieben habe? Sogar jene psychiatrischen Beobachter, die Luther abwechselnd eine manisch-depressive Psychose, eine klassische Depression, die «quasi-hysterische Folge eines infantilen Sexualkomplexes»[13], Halluzinationen oder Analfixierung bescheinigen, mahnen hier zur Vorsicht, «denn Luther gehört zu den Autobiographen mit einem Hang zum Schauspielern, die selbst von ihrem neurotischen Leiden begeistert Gebrauch machen und aus sorgfältig ausgewählten Erinnerungen und den Hinweisen eines verlangenden Publikums ihre eigene offizielle Persönlichkeit erschaffen»[14].
Aus dem Jungen sollte etwas werden, Bergbauunternehmer wie sein Vater oder Beamter im fürstlichen Dienst. Hans Luder schickte seinen Martin zunächst auf die Mansfelder Stadtschule, dann auf die Domschule in der vornehmen Handelsstadt Magdeburg und schließlich nach Eisenach, wo er bei einer freundlichen Patrizierfamilie italienischer Abstammung wohnte und ein hervorragendes Latein lernte. Im Rechnen war er dagegen bis an sein Lebensende miserabel.
1501 begann der Siebzehnjährige in Erfurt zu studieren, noch kein spezielles Fach wie heute üblich, sondern Logik, Grammatik, Rhetorik und die anderen «freien Künste», eine Art philosophische Grundausbildung. Die Universität hatte einen ausgezeichneten Ruf, mit ihren Methoden und Lehrinhalten galt sie als ziemlich «modern». Erfurt zog viele Vertreter des Humanismus an, die sich damals noch auf die Wiederentdeckung der antiken Literatur beschränkten und nur ganz leise von einem freieren Geist in den Wissenschaften träumten.
Wie überall waren auch die Erfurter Studenten einem strengen Reglement unterworfen. Sie wohnten in sogenannten Bursen, die einem Kloster glichen: exakt geregelter Tageslauf von vier Uhr morgens bis zur Bettruhe um acht Uhr, gemeinsame Schlafsäle, Unterhaltung in Latein, täglicher Gottesdienst, kein Ausgang, kein Damenbesuch. Obwohl er bei den ersten Prüfungen nur zum Durchschnitt gehörte, muss sich Martin bei seinen Kommilitonen Respekt verschafft haben; sie gaben ihm den Spitznamen «der Philosoph».
1505 bestand er dann allerdings das Magisterexamen als Zweitbester von siebzehn Prüflingen, erhielt ein schönes rötlich braunes Barett und wurde von seinem stolzen Vater – der nie auch nur eine Schule besucht hatte – fortan nicht mehr geduzt. Für das Weiterstudium standen die Fakultäten Theologie, Medizin und Jura zur Wahl, und wer Vater Luders Ehrgeiz kannte, wusste, wie die Entscheidung ausfallen würde.
Doch Martins Jurastudium währte nur wenige Wochen. Das Fach muss ihm zutiefst zuwider gewesen sein, wie seine zahlreichen aggressiven und höhnischen Äußerungen aus späteren Jahren bezeugen: Ein Jurist, ein böser Christ.[15]– Das Studium des Rechts ist schmutzig und gewinnsüchtig, denn sein letzter Zweck ist Geld […].[16] Einem seiner Söhne drohte er mit gespieltem Grimm: Wenn du ein Jurist werden solltest, so wollte ich dich an einen Galgen hängen.[17] Offenbar konnte er den Juristen nicht verzeihen, dass es ihnen weniger um die Wahrheit ging als um den Erfolg ihres Auftraggebers.
Am 2. Juli 1505 wurde Martin beim Dorf Stotternheim nahe Erfurt von einem Gewitter überrascht. Ein Blitz schlug ganz in seiner Nähe ein, so die von ihm selbst verbreitete Legende, und versetzte ihn derart in Panik, dass er angsterfüllt ausrief: Hilf du, Sankt Anna, ich will ein Mönch werden![18] Später erzählte er die Geschichte so, als hätte ihn der Himmel selbst überrumpelt und zu einem überstürzten Gelübde genötigt: Ich bin nicht gern ein Mönch geworden.[19] Seinem wütenden Vater versicherte er, nicht etwa freiwillig oder auf eigenen Wunsch sei er Mönch geworden, sondern von Schrecken und der Furcht vor einem plötzlichen Tode umwallt legte ich ein gezwungenes und erdrungenes Gelübde ab.[20]
Die Geschichte klingt gut, hat aber ihre Tücken: Bekehrungen, grundstürzende Änderungen in einem Lebensentwurf sind niemals das Werk eines Augenblicks, sondern Ergebnis langer und schmerzhafter Lernprozesse. Ein in Todesangst überstürzt herausgestammeltes Gelübde war auch nach mittelalterlichem Kirchenrecht nicht bindend. Die heilige Anna – Mutter Mariens und Großmutter Jesu – wurde im ausgehenden Mittelalter hoch verehrt und galt als Patronin der Bergleute, aber in der Mansfelder Gegend lässt sich zumindest während Luthers Kindheit noch kein ausgesprochener Annenkult nachweisen, und er selbst erwähnt sie dreißig Jahre lang kein einziges Mal, wenn er über seinen Klostereintritt spricht.
Warum hat er das «gezwungene und erdrungene» Gelübde denn nicht widerrufen? Der Gedanke liegt nahe, dass ihn der Gedanke, Mönch zu werden, schon lange umtrieb, dass er aber Angst hatte, den Vater durch einen Studienabbruch in Rage zu versetzen. Doch wenn Gott selbst per Blitz und Donner ein Machtwort gesprochen hatte? Vater Luder scheint das Manöver durchschaut zu haben; er fragte nüchtern, ob der Blitzschlag vielleicht nur eine Täuschung und ein Blendwerk gewesen sei, und erinnerte den Sohn sarkastisch an Gottes Gebot, daß man seinen Eltern gehorchen soll.[21]
Dieser wiederum wirft seinem Vater sechzehn Jahre später in einem Widmungsbrief zu seiner Schrift De votis monasticis (Über die Mönchsgelübde) vor: Deine Absicht war es sogar, mich durch eine ehrenvolle und reiche Heirat zu fesseln.[22] Mitten im Semester war der unglückliche Jurastudent damals bei seinen Eltern in Mansfeld aufgetaucht. Ging es um eine vom Vater ausgesuchte Braut oder um eine von Martin initiierte Liebesgeschichte, oder wollte er den Eltern irgendwelche Klosterträume anvertrauen?
Über die tatsächlichen Gründe seines Klostereintritts kann nur spekuliert werden. Befand sich der frischgebackene Magister in einer Identitätskrise? Suchten ihn Depressionen heim, wie sie sich auch später immer wieder einstellten? Zwei seiner Brüder waren angeblich der Pest zum Opfer gefallen, ein guter Freund starb bei einem Raufhandel. Packte ihn bei dem verheerenden Gewitter vielleicht doch die lähmende Angst vor einem plötzlichen Tod, unvorbereitet und unversöhnt mit Gott? Luther gilt als Herold einer neuen, freieren Zeit und war doch viel stärker dem mittelalterlichen Empfinden verhaftet, als man gemeinhin denkt.
In Todesgefahr hatte sich Martin Luder offenbar schon früher einmal befunden, als er stolperte und ihm der Degen – in jenen unsicheren Zeiten liefen auch die Studenten bewaffnet herum – so unglücklich zwischen die Beine geriet, dass er mit aufgerissener Schlagader fast verblutet wäre. Eine abenteuerliche Erklärung will wissen, hinter dieser Jahrzehnte später bei Tisch zum Besten gegebenen Geschichte verberge sich ein mörderisches Duell, und Luder sei Hals über Kopf ins Kloster geflüchtet, um einer Anklage wegen Totschlags zu entgehen, denn als Mönch unterstand er nicht der allgemeinen Erfurter Gerichtsbarkeit. Aus den vorhandenen Quellen lässt sich diese These allerdings nicht schlüssig belegen.[23]
Vater Hans soll getobt haben, als sein Sohn am 17. Juli 1505 bei den Erfurter Augustiner-Eremiten eintrat – und damit in seinen Augen auf eine glänzende Zukunft verzichtete. Vielleicht kannte er ihn aber auch gut genug, um zu wissen, dass er mit der Klosterdisziplin und dem kirchlichen Führungspersonal über kurz oder lang Probleme bekommen würde.
Warum wurde der Magister Luder nicht Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner? Warum wählte er die Augustiner-Eremiten, einen Mitte des 13. Jahrhunderts in Italien aus verschiedenen Einsiedlerkongregationen zusammengewachsenen Zweig des Augustinerordens? Einsiedler und Bettler waren sie schon lange nicht mehr, sie wohnten in wohlhabenden Klöstern, besaßen – wie in Erfurt – große Ländereien und Weinberge, aber im Gegensatz zur internen Konkurrenz, den Augustiner-Chorherren, hielten sie strenge Disziplin und lebten persönlich ziemlich anspruchslos. Hoch gebildet und aufgeschlossen für die geistigen Strömungen der Zeit, waren sie an Universitäten und Schulen und in der städtischen Seelsorge tätig.
Der Erfurter Konvent war nicht nur die größte Niederlassung des Ordens in Sachsen, sondern auch Studienort für den Ordensnachwuchs. Um ein Uhr nachts wurden die Mönche das erste Mal zum Chorgebet mit Psalmen und Lesungen geweckt; von da an wechselten Gotteslob, Arbeit und Erholung im festen Rhythmus.
Die geistige Welt, in die Martin Luder nun eintauchte, war geprägt vom sogenannten «Augustinismus»: Gott ist absolut frei, und der Mensch bekommt seine Gnade ohne eigene Verdienste geschenkt. Glaube und Vernunft gehören zusammen, aber die theologische Erkenntnis steht weit über der philosophischen. Ein Sakrament ist unabhängig von der charakterlichen Qualität des Spenders wirksam. Die Seele erfährt Gott in mystischer Einsamkeit. Während seiner Konflikte mit dem Lehramt und dem theologischen Mainstream berief sich Luther anfangs hartnäckig auf Augustinus, der als Kirchenvater von Rom verehrt und zitiert, in den individuellen Nuancen seiner Theologie aber keineswegs immer anerkannt wurde.
Augustinus (354–430) machte in der römischen Provinz Nordafrika und in Mailand Karriere als Rhetor und Anwalt, bis er das Christentum entdeckte und mit Freunden eine klösterliche Wohngemeinschaft gründete. Vom Volk zum Bischof gemacht, wurde er mit seinen Abhandlungen, Predigten und Briefen zum einflussreichsten Theologen der frühen Kirche. Sein Denken schwankt zwischen mystischer Leidenschaft und Ordnungsfanatismus, seine Ordensregel sieht die brüderlich lebende Gemeinschaft als Ort der Gottesbegegnung.
Und schon wieder wuchern die Legenden: Von Anfang an, so kolportierten die katholischen Luther-Kritiker, als zwischen den Konfessionen noch Kalter Krieg herrschte, habe sich Bruder Martin gegen die klösterlichen Lebensgewohnheiten aufgelehnt und zum Beispiel wochenlang das gemeinsame Chorgebet sabotiert (was für einen unter Aufsicht stehenden Novizen gar nicht möglich war und ist). Protestantische Luther-Hagiographen wiederum erzählten Schauergeschichten von einem seelenlosen Reglement mit dem Ziel, die Persönlichkeit der Neueingetretenen zu brechen. Martin habe sich in diesem fromm verbrämten Kasernenklima zwangsläufig zu einem finsteren Skrupulanten und Neurotiker entwickeln müssen, was schließlich bei seiner ersten Messe nach der Priesterweihe am 2. Juni 1507 zu einem Zusammenbruch geführt habe.
Tatsächlich wird der in die Jahre gekommene Reformator im Kreis seiner Schüler und Bewunderer berichten: Ich geriet so in Furcht, dass ich davongelaufen wäre, hätte mich nicht der Prior ermahnt; denn als ich die Worte las: Te igitur, clementissime Pater etc. [Dich also, gütigster Vater], dachte ich, ich müsse mit Gott ohne Mittler reden, und wollte fliehen wie Judas im Angesicht der Welt.[24] Doch solche Geschichten waren im ausgehenden Mittelalter Legion – ganz abgesehen davon, dass die Erkenntnis dessen, was er da tut, einem Priester, der seine Sache ernst nimmt, durchaus den Atem rauben kann, ohne dass man um seine geistige Gesundheit fürchten müsste.
Es gibt noch mehr solcher Überlieferungen: Als während des Gottesdienstes das Evangelium von der Heilung eines Besessenen (moderne Schriftausleger würden von einer Geistes- oder Gemütskrankheit sprechen) durch Christus vorgetragen worden sei, habe sich Bruder Martin in einem Anfall von Raserei auf den Boden geworfen und laut geschrien: «Ich bin’s nicht, ich bin’s nicht!»[25] Er soll oft und endlos lange gebeichtet und die kleinsten Lappalien aufgelistet haben. Ich will der Hölle entlaufen mit meiner Möncherei[26], gesteht er und schildert die grässliche Furcht des Menschen vor einem Gott, der nur aus Zorn und Rachebedürfnis zu bestehen scheint: Da gibt’s keine Flucht, keinen Trost, weder innerlich noch äußerlich, sondern alles klagt an.[27]
Immer wieder Angst, Angst, Angst. Angst vor der ewigen Verdammnis, vor Gottes Ansprüchen und dem eigenen Versagen. Ich bin oft vor dem Namen Jesu erschrocken, und wenn ich ihn am Kreuz anblickte, so kam er mir vor wie ein Blitz, und wenn sein Name genannt wurde, so hätte ich lieber den Teufel nennen hören, denn ich dachte, ich müsse so lange gute Werke tun, bis Christus mir dadurch zum Freund und gnädig gemacht wurde.[28]
Während der junge Martin Luder in Erfurt und dann in Wittenberg studiert, gleichzeitig über die «Nikomachische Ethik» des Aristoteles doziert, sich – kräftig von den Ordensoberen gefördert – auf die Promotion vorbereitet, wird seine Sehnsucht nach einer Theologie immer stärker, welche den Kern der Nuß, das Innere des Weizenkorns und das Mark der Knochen erforscht[29]. Substanz statt Haarspaltereien, eine Wahrheit auf Leben und Tod statt trockener Begrifflichkeiten.
Denn Angst und zwanghafte Selbstüberforderung sind nur die eine Seite der Medaille. Hinter Bruder Martins gnadenloser Selbstreflexion, seinem Hadern mit den eigenen Schwächen, seiner obsessiven Beichtpraxis steht immer schon eine glühende Sehnsucht: Liebe statt Zwang. Innere Leidenschaft statt äußerer Normen. Vertrauensvoller Glaube statt furchtsamer Pflichterfüllung.
Seine Klosterjahre hat er wohl ambivalent betrachtet: als Verirrung, Gefahr, Verstärkung der eigenen Zwanghaftigkeit – aber auch als Annäherung an einen barmherzigen Gott, der ihm seine Ängste und Zweifel Stück für Stück nehmen sollte. Dieser liebevolle Gott hatte ein Gesicht: Johannes von Staupitz, und einen Boten: Johannes Tauler.
Johannes von Staupitz (1468–1524) war als Generalvikar für 30 deutsche Augustinerklöster zuständig, baute die Universität Wittenberg mit auf und hatte dort die später von Luther übernommene Bibelprofessur inne. Als Luthers unmittelbarer Ordensoberer, Beichtvater und Ratgeber besaß er entscheidenden Anteil an seiner geistigen Entwicklung. Wie Luther verließ er seinen Orden, trat aber bei den Benediktinern ein und machte als Abt von St. Peter in Salzburg seinen Frieden mit der «alten» Kirche. Kurz vor seinem Tod schrieb er Luther, er sei ihm mit einer Liebe zugetan, die Frauenliebe übersteige.
Staupitz als Ordensoberer war ein Glücksfall für den jungen Mönch in seinem verbissenen Ringen um Gottes Huld. Wie der erhaltene Briefwechsel zeigt, respektierte er Bruder Martins radikalen religiösen Ernst und schaffte es doch mit viel Fingerspitzengefühl, ihn auf den Boden der Tatsachen herunterzuholen. Als er sich wieder einmal aller möglichen Sünden anklagte, polterte Staupitz scherzhaft, Christus helfe nur bei rechtschaffner Sünde, als die Eltern ermorden, öffentlich lästern, Gott verachten, die Ehe brechen etc.[30], und er solle ihn mit solchen Puppensünden in Ruhe lassen.
Während der Fronleichnamsprozession beobachtete Staupitz, wie sein Schützling beim Anblick der Monstranz mit der Hostie, in der nach kirchlicher Lehre Christus gegenwärtig ist, wieder einmal in einen Angstzustand verfiel; er rüttelte ihn mit den Worten auf: Was dich erschreckt hat, ist nicht Christus, denn Christus erschreckt nicht, sondern tröstet.[31]
Der Einfluss, den Staupitz auf seinen jungen Mitbruder ausübte, belegt die These der neueren Lutherforschung, die zur Reformation führenden Entwicklungen in Wittenberg seien als «Gruppenphänomen» zu werten und die «Zentralfigur» dieser Gruppe von Vor- und Querdenkern sei nicht Martin Luder gewesen, sondern Johannes von Staupitz.[32] Unter dessen Anleitung las Martin vor allem den Straßburger Mystiker Johannes Tauler (um 1300–1361) aus dem Dominikanerorden und fand bei ihm mehr an ordentlicher und ernsthafter Theologie […] als bei sämtlichen scholastischen Gelehrten[33].
Tauler, von dem das Adventslied «Es kommt ein Schiff geladen» stammt, vertrat eine innige Christusmystik: Die Seele des Gott suchenden Menschen müsse von allen Bildern und Vorstellungen leer werden und eine Phase trostloser Gottverlassenheit durchleiden, bis sich auf dem Grund der Seele der immer schon dort wohnende Gott finden lasse. Bei Tauler hat dieser Gott aber nicht – wie bei dunklen Mystikern von der Art Meister Eckharts – die Gestalt einer «stillen Wüste» oder einer namenlosen «Nichtperson», sondern er wird in Jesus Christus als leidender, liebender Mensch erfahrbar.
Wer sprechen und hören will, muss lernen, einsam zu sein mit Christus. So geschah es mir. Meine Lehre und Predigt konnte ich nicht in allen Büchern erwerben, im Aristoteles, bei den Scholastikern, Thomas, Scotus, bis ich von der Menge abgesondert wurde und ihn allein hörte. Als ich das tat und jenen allein hörte und mich ihm mit Maria zu Füßen setzte, da habe ich gelernt, was Christus ist, und wurde ein Gelehrter im Glauben.[34] Wie Luther hier seine mystische Erfahrung schildert, wird nicht nur manchen nüchternen Protestanten überraschen. Deutlich wird auch, dass er keineswegs dem von Aberglauben und Dämonenangst beherrschten «finsteren Mittelalter» in einem plötzlichen, furiosen Befreiungsschlag eine ganz neue, unbefangenere, erwachsene Gottesbeziehung entgegensetzte, sondern dass es damals am Ausgang des Mittelalters durchaus unterschiedliche Christusbilder, Frömmigkeitsmuster und Glaubensmentalitäten gab: nicht nur die Furcht vor Weltuntergang und Höllenfeuer, sondern auch die zärtlich intime Christusmystik eines Bernhard von Clairvaux oder die um eine persönliche Gotteserfahrung im Alltag bemühten «Brüder vom gemeinsamen Leben», die der junge Martin in Magdeburg kennengelernt hatte.
So ein menschenscheuer, von Halluzinationen geplagter, in die Probleme der eigenen Seele verliebter Zwangsneurotiker kann der Mönch Martin Luder nicht gewesen sein, sonst hätte man ihm nicht immer mehr Verantwortung im Orden aufgebürdet. Als es hier in der Umsetzung von Reformtendenzen zu Spannungen zwischen verschiedenen Fraktionen kam, schickte man ihn mit einem anderen Delegierten im Winter 1510/11 zu klärenden Gesprächen nach Rom, zum Ordensgeneral. Bei klirrender Kälte pilgerte er zu Fuß über vereiste Alpenpässe, stieg in der Ewigen Stadt zu den Märtyrergräbern hinab und rutschte auf den Knien die «Pilatustreppe» hinauf, um seinen Großvater aus dem Fegfeuer erlösen zu helfen. Von den antiken Herrlichkeiten Roms hat er entgegen der Legende so wenig gesehen wie vom Glanz der aufblühenden Renaissance (der neue Petersdom existierte erst als Entwurf) und von der Verkommenheit des päpstlichen Hofes; er interessierte sich einfach nicht dafür.
Kaum zum Doktor der Theologie promoviert, begann der Achtundzwanzigjährige 1513 in Wittenberg mit einer höchst produktiven Vorlesungs- und Predigttätigkeit; über die Paulusbriefe, die Psalmen, das Buch Genesis hat er gelesen, morgens um sechs Uhr, im Winter um sieben Uhr, wie es zum Lebensrhythmus des ausklingenden Mittelalters passte. Gepredigt hat er in der Stadtkirche, mindestens an jedem Sonn- und Feiertag – und deren gab es viele. Mehr als zweitausend dieser Predigten sind ganz oder teilweise erhalten. Zwei Jahre später wählte ihn das Generalkapitel seines Ordens außerdem zum Distriktsvikar – was bedeutete, dass er elf Konvente zu beaufsichtigen hatte, unter anderem Dresden, Erfurt, Gotha, Magdeburg.
Ich brauche fast zwei Schreiber oder Kanzler, klagte er im selbstmitleidigen Ton eines Managers gegenüber einem Erfurter Professorenkollegen. Ich tue den ganzen Tag beinahe nichts weiter als Briefe schreiben. […] Ich bin Klosterprediger, Prediger bei Tisch, täglich werde ich auch als Pfarrprediger verlangt; ich bin Studien-Rektor, ich bin Vikar, das heißt ich bin elfmal Prior, Fischempfänger in Leitzkau, Rechtsanwalt der Herzberger in Torgau, halte Vorlesungen über Paulus, sammle [Material] für den Psalter, und das, was ich schon gesagt habe: die Arbeit des Briefschreibens nimmt den größten Teil meiner Zeit in Anspruch. Selten habe ich Zeit, das Stundengebet ohne Unterbrechung zu vollenden und zu halten. Dazu kommen die eigenen Anfechtungen des Fleisches, der Welt und des Teufels. Siehe, welch ein müßiger Mensch ich bin![35]
Wittenberg war ja keine alte Universitätsstadt mit eingefahrenen Strukturen, sondern ein Abenteuer versprechendes neues Pflaster. In Sachsen herrschte Kurfürst Friedrich der Weise aus der ernestinischen Linie der Wettiner, damals eine der stärksten und unabhängigsten politischen Führungsfiguren im Reich. Eben erst, 1502, hatte er die Wittenberger Hochschule gegründet, um der fast hundert Jahre alten Leipziger Universität – seit der 1485 erfolgten Erbteilung bei den Wettinern im Besitz seiner albertinischen Verwandten – Konkurrenz zu machen und die intellektuelle Elite seines Ländchens in eigener Regie auszubilden. Und siehe da, in dem verdreckten, armseligen Provinzstädtchen Wittenberg am Rand der Zivilisation[36] wuchs tatsächlich eine Denkfabrik mit einem ziemlich freien Forschungsklima empor, die parallel zur wachsenden Prominenz der Doctores Luther und (später) Melanchthon Studenten aus allen Ecken des Reiches anzog: 1520 waren es allein in Melanchthons Griechischkurs bis zu 600 Hörer – und Wittenberg hatte höchstens 2500 Einwohner!
Hier in den Wittenberger Lehrveranstaltungen blitzt bereits eine Menge von Luthers widerborstiger Theologie auf: Gestützt auf Augustinus, liest er Paulus auf eine erregende Weise neu, redet er ohne die bis dato übliche moralische oder metaphysische Brille von Sünde und Gnade, sagt er dem seit Jahrhunderten aufgetürmten scholastischen Gedankengebäude einfach dadurch den Kampf an, dass er die biblischen Grundlagen voraussetzungslos, ja naiv neu entdeckt, als hätte es all die zahllosen Auslegungen, Einschränkungen, Filtermethoden nie gegeben. Denn es ist am Tage, dass es, weil so etwas in den Universitäten eine lange Zeit nicht behandelt worden ist, dahin gebracht worden ist, dass das heilige Wort Gottes nicht allein unter der Bank gelegen hat, sondern von Staub und Motten nahezu verwest ist.[37]
Nicht durch unsere gerechten Taten werden wir gerecht, lässt Doktor Luder gegen Aristoteles – bisher unangefochten als Türhüter zur hohen Theologie – verlauten, sondern die Gnade Gottes macht uns erst fähig, gerecht zu handeln. Ohne diese Gnade kann der Mensch nichts Gutes tun, und deshalb hat auch der frömmste, religiös und menschlich sich absolut korrekt verhaltende Mensch Gott nicht einfach in der Tasche und keinen Grund, sich auf seine Leistungen etwas einzubilden. Gott gewährt seine Gnade frei und aus Liebe – nicht weil er muss. Zwischen Mensch und Gott gibt es nicht die Regeln einer Geschäftsbeziehung, sondern nur das Gesetz der Liebe.
Wer den Weg zum Himmel finden will, der muss lernen, sich nicht zu entschuldigen, sich nicht zu rechtfertigen, sich nicht selbst etwas zuzuschreiben[38], so oder so ähnlich sagt er es in seiner ersten Psalmenvorlesung 1513, von der wir keine studentische Nachschrift besitzen, sondern nur Luders Vorarbeiten und ausführliche Anmerkungen zum Bibeltext. Den hat er für die Studenten auf großen Blättern mit weitem Zeilenabstand drucken lassen, damit sie seine Vorlesungen mitschreiben und die Bibelverse am Rand und zwischen den Zeilen kommentieren können. Mit keinerlei Verdienst darf der Mensch prahlen, sondern einzig die nackte Barmherzigkeit Gottes und seine frei gespendete Güte preisen. Wenn du etwas hast, so sollst du das durchaus deutlich sagen. Aber nicht als ob es das deine wäre.[39]
Von der Vorlesung über den Römerbrief des Apostels Paulus hingegen liegen nicht weniger als fünf Mitschriften vor, die so frappant übereinstimmen, dass man von einem wörtlichen Diktat durch Professor Luder ausgehen kann.[40] Seine eigene Vorlesungshandschrift fand sich um die Wende zum 20. Jahrhundert in der Königlichen Staatsbibliothek Berlin – als anonymes Ausstellungsstück unter Glas. Die Grundbotschaft des Römerbriefs sei die, dass die Gerechtigkeit Gottes gänzlich aus dem Glauben kommt[41]. – Denn nicht etwa, weil er gerecht ist, wird er [der Mensch] von Gott [für gerecht] erachtet, sondern weil er von Gott [dafür] erachtet wird, ist er gerecht […]. Glaubt einer nämlich an Christus und sein Herz macht ihm Vorwürfe und klagt ihn dadurch an, dass es ein schlechtes Werk gegen ihn zum Zeugen aufruft, so wendet es sich alsbald davon ab, wendet sich Christus zu und sagt: Der hat aber Genugtuung geleistet, er ist gerecht, er ist meine Zuflucht, er ist für mich gestorben, er hat seine Gerechtigkeit zu meiner Gerechtigkeit gemacht und meine Sünde zu seiner Sünde.[42]
Und auch das wird deutlich an diesen frühen Aufzeichnungen aus dem Hörsaal: Der junge Professor Luder hatte keinesfalls den dramatischen Bruch mit der Kirche im Sinn. Jene sarkastische Kritik an Bischöfen, Prälaten und konservativen Kollegen, die sich in etlichen Passagen seines minutiös ausgearbeiteten Vorlesungsmanuskripts findet, fehlt in den studentischen Mitschriften oder taucht nur in stark abgeschwächter Form auf.[43] Offenbar wollte er die Heißsporne, die es unter Studenten immer gibt, nicht auch noch anstacheln.
Irgendwann in diesen Jahren, so will es die Legende, soll Luder sein sogenanntes «Turmerlebnis» gehabt haben.[44] Eine delikate Geschichte: In seinen Tischreden wird er sich 1532 erinnern, die zündende Erkenntnis der Rechtfertigung allein durch den Glauben habe ihm der S. S. [Spiritus Sanctus, der Heilige Geist] auf diss Cl. eingeben[45]. Johannes Schlaginhaufen, dem wir diese Mitschrift verdanken (er war damals Pfarrer im Dorf Zahna bei Wittenberg und führte später im Fürstentum Anhalt-Köthen die evangelische Gottesdienstordnung ein), hat wohl heute noch keine Ruhe im Grab gefunden, so wild wogt unter Experten der Streit über seine dezente Abkürzung.
Ist tatsächlich die «Cloaca» gemeint, der Abort jenes Wohnturms im Wittenberger Kloster, dessen mit einer Wandheizung versehenes Untergeschoss noch steht? Luther litt zeitlebens an Verstopfung und Harnverhaltung. Da sei es doch möglich, so spekulieren manche Psychiater, dass er am Ort seiner, nun ja, explosionsartigen körperlichen Erlösung auch ein seelisches, psychosomatisches, spirituelles Befreiungserlebnis gehabt habe!
Oder sprach er vom Arbeitszimmer über der Toilette? Oder führt uns wieder einmal Luthers ebenso derber wie metaphorischer Sprachstil in die Irre, und er wollte einfach sagen, dass diese Welt eigentlich zum Kotzen und gleichzeitig voll wunderbarer Weisheiten sei? Wie er es in einem Loblied auf die Musik und den Herrgott tat, der uns schon in diesem einem Scheißhaus[46] gleichenden Leben solche Schätze gegeben habe; wie werde das erst im ewigen Leben sein? Wofür spricht, dass er von diss Cl. spricht, also von einem Ort, an dem er sich jetzt in diesem Augenblick mit seinen Hörern befindet.
Der ganze Zwist ist müßig. Denn der «reformatorische Durchbruch», wie es in der Fachliteratur heißt, hat wohl kaum in einer am Studiertisch durchwachten Nacht oder während einer schmerzlösenden Toilettensitzung stattgefunden, sondern war das Produkt eines jahrelangen Ringens – intellektuell wie geistlich. Den alles verwandelnden Blitzstrahl vom Himmel gibt es selten, Bekehrungen dauern oft ein ganzes Leben. Auch wenn so ein mühsamer Lernprozess traditionell gern in ein genau datierbares Erlebnis verwandelt wird, wie es schon die Bibel mit Paulus vorexerziert und wie es Augustinus oder Calvin getan haben.
Es geht also um eine fortschreitende Entwicklung in Luthers Denken, um eine stufenweise bessere Durchdringung und stärkere Gewissheit. Eine ungefähre Datierung dieser allmählichen Wende ist den Forschern dennoch enorm wichtig. Denn wenn seine theologische Positionierung schon vor der Veröffentlichung der berühmten 95 Thesen 1517 abgeschlossen war, dann wäre es auch ohne diese Thesen zwangsläufig zum Konflikt mit Rom gekommen. Datiert man den «Durchbruch» aber auf das Jahr 1518 oder kurz danach, dann wird diese Auseinandersetzung mit Rom ihrerseits zum wichtigen Bestandteil von Luthers reformatorischer Theologie.
Und was war jetzt der Kern dieser umwälzenden neuen Rede von Gott und vom Menschen? In der Vorrede zur lateinischen Gesamtausgabe seiner Schriften gibt er 1545 selbst eine klassisch gewordene Zusammenfassung: Ich konnte den gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben, im Gegenteil, ich haßte ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder, und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, daß ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Und wenn ich mich auch nicht in Lästerung gegen Gott empörte, so murrte ich doch heimlich gewaltig gegen ihn: Als ob es noch nicht genug wäre, daß die elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder […] mit jeder Art von Unglück beladen sind – mußte denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen?
[…] Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete: ‹Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm [im Evangelium] offenbart, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben.› Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. […] Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein.[47]
Das heißt, dieselbe biblische Rede von der «Gerechtigkeit Gottes», die ihn lange Zeit in Angst und Schrecken gestürzt hat, wird ihm nun mehr und mehr zur Grundlage eines unerschütterlichen Vertrauens. Der Schlüsseltext dabei ist ein Vers aus dem Brief, den Paulus der Christengemeinde in Rom geschrieben hat (Röm 1,17). Statt sich vor dem Jüngsten Tag und einem zornigen Richtergott zu fürchten, darf einer, der an Christus glaubt und sich an ihm festhält, darauf bauen, dass Gottes Gerechtigkeit die Gestalt der Barmherzigkeit annimmt und den Glaubenden «gerecht macht».
«[…] Der Sohn dem Vater ghorsam ward,
er kam zu mir auf Erden
von einer Jungfrau rein und zart,
er sollt mein Bruder werden.
Gar heimlich führt er sein Gewalt,
er ging in meiner armen Gstalt,
den Teufel wollt er fangen.
Er sprach zu mir: halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen.
Denn ich bin dein, und du bist mein,
und wo ich bleib, da sollst du sein,
uns soll der Feind nicht scheiden.»
6. und 7. Strophe des Lutherlieds «Nu freut euch, lieben Christen gmein»
Ganz neu ist das alles nicht. Von einem leidenschaftlich liebenden Gott, der seine treulosen Geschöpfe umwirbt wie ein betrogener Ehemann seine zur Hure gewordene Frau (Hos 1–3), reden schon die Propheten Israels. Der Wanderrabbi Jesus verkündet einen zärtlichen Gott, den man «Abba» nennen darf, auf Deutsch: lieber Vater (Mt 6,9). Die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte schwärmen bisweilen in mystischem Überschwang von der Menschenfreundlichkeit Gottes; wenn der Teufel sieht, mit welcher Liebe er sie umgibt, wird er sich beschämt trollen.[48]
Aber in der mittelalterlichen Kirche war dieses Gottesbild zurückgedrängt worden von einer lähmenden Angst; Sühne, Buße, harte Askese und aufwendige Riten waren nötig, um den himmlischen Richter gnädig zu stimmen. Religion schien gleichbedeutend mit Leistung – und das Geschäft mit der Gnade, das die Ablassprediger betrieben, völlig normal. Da wirkte es wie eine Revolution, die biblische Wahrheit vom Geschenkcharakter der göttlichen Liebe wieder ins Bewusstsein zu rücken. Von einem Gott zu reden, der sich nicht ködern und kaufen lässt, sondern sich aus freiem Entschluss, aus Liebe dem Menschen zuwendet.
Im Grunde sei das eine «Theologie von unten»[49] gewesen, hat man gesagt, ein Paradigmenwechsel hin zum Menschen: Anders als die durch Thomas von Aquin und Wilhelm von Occam geprägten Scholastiker setzt Luther nicht bei Gott und seinem transzendenten Wesen an, sondern bei den Bedürfnissen des Menschen. Statt strohdürrer akademischer Diskussionen über die Möglichkeiten, Gott zu erkennen, die existenziell bedrängende Frage, was Gott von mir persönlich will und ob und wie er mich – mich! – retten und selig machen will.
Luther über die unfruchtbaren Spekulationen zu den Beziehungen innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit: Also haben ihn die Sophisten gemalt, wie er Mensch und Gott sei, zählen seine Beine und Arme, mischen seine beiden Naturen wunderlich ineinander, welches denn nur eine sophistische Erkenntnis des Herrn Christi ist, denn Christus ist nicht darum Christus genennet, daß er zwo Naturen hat, was geht mich dasselbige an? […] Daß er von Natur Mensch und Gott ist, das hat er für sich, aber daß er sein Amt dahin gewendet und seine Liebe ausgeschüttet und mein Heiland und Erlöser wird, das geschieht mir zu Trost und zu gut, es gilt mir darum, daß er sein Volk von Sünden los machen will.[50]
Bei allem Jubel über die Befreiung seiner bangen Seele bleibt Luther Realist – und nennt den Menschen sein Leben lang in einer berühmt gewordenen Formel simul iustus et peccator, gerecht und Sünder zugleich.[51] Der von Gott gerecht gemachte, zurechtgebrachte Mensch lebt weiterhin in einer sündigen, beschädigten Welt, er bleibt zwangsläufig hinter dem Anspruch Gottes zurück. Wenn er sich selbst anschaut, sieht er Sünde und Versagen; wenn er auf Gott blickt, Gnade und Gelingen. Für einen religiös empfindenden Menschen ist das eine atemberaubende Botschaft, die ein enormes Potenzial an Lebensmut freizusetzen vermag: «Mitten in seinem ständigen Widerstand gegen Gott kann so der Sünder gerecht sein – weil Gott seine Gemeinschaft mit dem Sünder auch gegen dessen Widerstreben nicht mehr widerruft. […] Er soll es sich sagen lassen, er soll, ganz einfach, glauben. Dadurch – nicht etwa, indem sie in sich selbst harmlos würde – verliert die Sünde ihre Macht, den Sünder von Gott zu trennen, das heißt ihn zu ‹verdammen›.»[52]
«Das hieß den Himmel herabstürzen und die Welt in Brand stecken»: der Streit um den Ablass (1517/18)
Mit großem Gefolge und einer eisenbeschlagenen Geldtruhe zieht 1517 der Dominikaner Johann Tetzel durch Sachsen, um im Namen des Papstes den «Petersablass» anzubieten. Er reist im Auftrag des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, der das für die Ablasszettel zu entrichtende Geld – jeweils 23 Rheinische Goldgulden von Königen und Bischöfen, von den kleinen Leuten mindestens einen halben Gulden – dringend braucht, um seine Schulden zu bezahlen. Die «Ablasskommissare», wie die Prediger heißen, sind zwar gehalten, erst einmal gewissenhaft Beichte zu hören und den Habenichtsen ihre Absolution auch für Gebet und Fasten zu geben. In der Öffentlichkeit setzt sich dennoch zwangsläufig der Eindruck fest, die Gnade sei ein Geschäft.
Albrecht II. von Brandenburg (1490–1545) war bereits Bischof von Magdeburg und Administrator (Verwalter) des Bistums Halberstadt, als er sich 1514 auch noch zum Erzbischof von Mainz wählen ließ, um die damit verbundene Würde eines Kurfürsten und Erzkanzlers des Reiches zu erlangen. Um die erforderlichen Gebühren an Kaiser und Papst zahlen zu können (einschließlich hoher Dispensgelder an die Kurie, weil die im Reich bisher beispiellose Ämterhäufung gegen das Kirchenrecht verstieß), nahm er bei den Fuggern einen Kredit von 29000 Goldgulden auf und verschrieb ihnen dafür die Hälfte der Erlöse aus dem «Petersablass», der wiederum den Neubau der Peterskirche in Rom finanzieren sollte. Albrecht war zwar geschäftstüchtig und hatte auch eine Mätresse, übte seine priesterlichen und bischöflichen Funktionen aber sehr pflichtbewusst aus. Der humanistisch gebildete, mit einem friedlichen Charakter gesegnete Kirchenfürst begegnete Luther mit Toleranz und Nachsicht; er weigerte sich, das «Wormser Edikt» zu unterzeichnen, und ließ es in seinen Territorien zunächst nicht veröffentlichen.
Der Ablass an sich war eine gängige Praxis und theologisch keineswegs umstritten. Er entwickelte sich aus der Bußpraxis heraus: In den ersten christlichen Jahrhunderten hatte es nur bei gravierenden Vergehen – Mord, Ehebruch, Abfall vom Glauben – ein öffentliches Bekenntnis gegeben und nach strengen Bußwerken die öffentliche Wiederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft, das war nur einmal im Leben möglich. Schlaue Christen warteten mit so einer Generalbeichte deshalb gern bis zum Totenbett. Vom irisch-angelsächsischen Raum her setzte sich dann die bis heute übliche Privatbeichte durch, beliebig wiederholbar und mit einer je nach Übertretung genau festgelegten «Tarifbuße» verbunden: Gebete, Fasten, Wallfahrten, Almosen. Wenn nun jemand starb und seine vielen kleinen Sünden noch nicht vollständig abgebüßt beziehungsweise seit der letzten Beichte neue begangen hatte, dann nahm er dieses Strafkonto einfach ins Jenseits mit – die Idee des «Fegfeuers» war geboren.
Schaudernd erzählte man sich, aus dem Ätna auf Sizilien lasse sich das Heulen der Teufel hören, die über die durch Almosen und Gebet ihren Händen entrissenen Seelen klagten. Dass die Lebenden den Verstorbenen durch Gebet und gute Werke zu Hilfe kommen wollten, war ja auch eine schöne Geste natürlicher Solidarität. Auf Erden profitierten die Besitzlosen, die Kranken, Witwen und Waisen von den mildtätigen Stiftungen, die im Gedenken an die sogenannten Armen Seelen eingerichtet wurden. Die kirchliche Hierarchie benutzte den Glauben an das Fegfeuer freilich auch als Machtinstrument und machte gute Geschäfte mit Mess-Stipendien und Ablässen für die Verstorbenen.
So ein durch Gebet, Pilgerfahrten, später zunehmend auch durch Geldspenden zu erlangender Ablass konnte also keinesfalls die Reue des Sünders und die Vergebung seiner Schuld durch Gott ersetzen, sondern lediglich die aus dem sündhaften Verhalten folgende Strafe lindern. Es waren auch die im Mittelalter fortlebenden germanischen Ideen von Wiedergutmachung und Sippenhaftung, die dahinterstanden. So weit, so gut. Nun hatte sich aber immer mehr die Möglichkeit in den Vordergrund geschoben, die mühsamen Bußwerke durch eine flinke Geldzahlung zu ersetzen, und eine aberwitzige Rechenkunst verdeckte den ursprünglichen Sinn der Ablasslehre.
Wer die Peterskirche in Rom in frommer Absicht besuchte, konnte pro Treppenstufe sieben Jahre und für das Gebet an einem der Altäre wieder sieben Jahre «Strafnachlass» erlangen, bei 30 Stufen und fünf Altären also an einem einzigen Pilgertag 245 Jahre Fegfeuer einsparen. Wenn das Schweißtuch der mitleidigen Veronika gezeigt wurde, in das Jesus damals auf dem Kreuzweg sein Antlitz eingeprägt hatte, gab es für das Betrachten der kostbaren Reliquie sogar 12000 Jahre Strafnachlass.
Ausgerechnet die Wittenberger Schlosskirche war bei ihrer Einweihung 1503 mit dem respektablen Ablassquantum von 100 Tagen pro Kirchenbesuch und Reliquie ausgestattet worden. Kurfürst Friedrich der Weise, der stolz auf seine umfangreiche Reliquiensammlung war – exakt 19013 «Partikel», darunter Brotkrumen vom Letzten Abendmahl Jesu und Muttermilch der Jungfrau Maria –, feilschte mit der römischen Kurie erfolgreich um eine Erhöhung des Ablassquantums, sodass im Jahr 1520 ein fleißiger Pilger bei einem einzigen Aufenthalt in Wittenberg sage und schreibe 1902202 Jahre und 270 Tage Ablass verdienen konnte.[53]
Und nun lief dieser Johann Tetzel herum und predigte: Er hätte solch eine Gnade und Gewalt vom Papst: wenn einer gleich die heilige Jungfrau Maria, Gottes Mutter, geschwächt [vergewaltigt] oder geschwängert hätte, so könnte ers vergeben, wenn derselbe in den Kasten lege, was sich gebühre. […] Weiter: es wäre nicht notwendig, Reue oder Leid oder Buße für die Sünde zu haben, wenn einer den Ablaß oder die Ablaßbriefe kaufe […]. Er verkaufe auch Ablaß für künftige Sünde.[54]
Wenn Luther im Rückblick (1541) richtig zitiert, hatten Tetzels Parolen nicht das Geringste mit solider Theologie zu tun. Und Rom hatte die Auswüchse der Ablasspredigt mehrfach scharf angeprangert – zuletzt Papst Sixtus IV. im Jahr 1478 –, freilich ohne den Worten überzeugende Taten folgen zu lassen. Doktor Luder sah sich als Seelsorger und Beichtvater zunehmend mit der irrigen Vorstellung konfrontiert, man könne Gottes Gnade und Vergebung kaufen und sich mit einer großzügigen Geldspende um die nötige Lebensänderung herumdrücken. Ein verantwortungsbewusster Theologe musste sich zu Wort melden und die Dinge klarstellen.
Mehr hatte er nicht im Sinn, als er am 31. Oktober 1517 seine berühmt gewordenen 95 Thesen[55] an den zuständigen Erzbischof Albrecht sandte – was sicher ist – und vielleicht auch noch an die Wittenberger Kirchentüren heften ließ – worüber man nur spekulieren kann. Universitätslehrer benutzten die Kirchenportale nicht selten als «Schwarzes Brett», um eine öffentliche Diskussion anzuregen, und so hat es Luthers Freund Melanchthon später auch zu Protokoll gegeben. Vom «Thesenanschlag» wusste er allerdings nur vom Hörensagen, er war ein Jahr später nach Wittenberg gekommen und erwähnte das Ereignis erst, als Luther schon tot war. In den drei Jahrzehnten, die dazwischenlagen, sprach kein Mensch vom Thesenanschlag.
Sicher ist dagegen, welche Bedeutung die Veröffentlichung der 95 Thesen für Luthers Selbstbewusstsein und Seelenleben gehabt haben muss: Seinen Brief an Erzbischof Albrecht unterschreibt er nicht mehr mit «Luder» wie bisher, sondern zum ersten Mal mit «Luther», einer Kurzform für den griechisch-lateinischen Namen «Eleutherius»: der Freie, Befreite. Unter Gelehrten war es üblich, den eigenen Familiennamen nach Humanistenmanier zu antikisieren. Luther verband mit der Namensänderung aber zusätzlich eine elektrisierende Botschaft. Bruder Martinus Eleutherius, ja Knecht und Gefangener allzu sehr, Augustiner zu Wittenberg[56], unterzeichnete er kurz darauf einen Brief an einen Erfurter Freund und gab ihm damit zu verstehen, dass er sich befreit fühlte – aus den Fesseln der scholastischen Theologie, aus der Furcht vor den Kirchengewaltigen, aus der Angst vor einem rächenden Gott.
Zunächst noch völlig konform mit der offiziellen Kirchenlehre, ruft Luther den ursprünglichen guten Sinn der Ablassidee, das Wesen der Buße und die Grenzen der päpstlichen Gewalt in Erinnerung: Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt: ‹Tut Buße› usw. (Mt 4,17), wollte er, daß das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte.[57]– Jeder Christ, der wahrhaft Reue empfindet, hat einen Anspruch auf vollkommenen Erlaß von Strafe und Schuld, auch ohne Ablaßbrief. Jeder wahre Christ, gleichviel ob lebendig oder tot, hat an allen Gütern Christi und der Kirche teil; Gott hat sie ihm auch ohne Ablaßbrief gegeben.[58]– Der Papst will und kann keine Strafen erlassen als solche, die er nach seiner eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat.[59]– Man soll die Christen lehren, daß es besser sei, den Armen etwas zu schenken und den Bedürftigen zu leihen, als Ablässe zu kaufen. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe im Menschen, und er wird besser; aber durch den Ablaß wird er nicht besser, sondern nur von der Strafe freier. Man soll die Christen lehren: wer einen Bedürftigen sieht und ihm nicht hilft, und statt dessen sein Geld für Ablaß gibt, der hat sich nicht des Papstes Ablaß, sondern Gottes Zorn erworben.[60]
Das war eigentlich keine neue Lehre, aber eine ziemlich vergessene Sicht der Dinge. Luthers Stärke bestand darin, die tausend Verästelungen der kirchlichen Tradition, all die Doktrinen und Rechtssätze und Ausnahmeregelungen und wunderlichen Frömmigkeitspraktiken, auf den schlichten Kern des Evangeliums zurückzuführen. Plötzlich wurde alles ganz einfach – aber sehr schwierig und vor allem peinlich für die Hierarchen, Kirchenbürokraten und Vatikanjuristen, die so eine arglose Rückfrage an Jesus nicht mehr gewohnt waren und deshalb zur Ketzerei erklären mussten.
Luther rückte das Bewusstsein, von Christus befreit und gerechtfertigt zu sein, in den Vordergrund; dann erübrigte sich die ganze furchtsame Rechnerei mit Fegfeuerjahren und Strafquanten. Gebet und Pilgern und Armenhilfe und all die anderen «Bußwerke» sollten nicht zur Entlastung von Sündenstrafen verrichtet werden, sondern selbstverständlicher Ausdruck einer gläubigen Lebenshaltung sein. Was so schlicht, fromm und logisch klingt, barg freilich gewaltigen Zündstoff für ein Kirchenimperium, das von ebendiesen Irrwegen lebte: Buße nicht als radikale, täglich zu erneuernde Lebensumkehr zu Jesus Christus, sondern viele kleine Sündenbekenntnisse, Strafnachlässe, Vergebungsakte und Gnadenhäppchen in Abhängigkeit von einer über Himmel und Hölle gebietenden, Christi Verzeihung dosierenden, die Liebe Gottes verwaltenden Priesterkaste – ein Zerrbild, gemessen an der klassischen römischen Theologie, aber traurige Realität Anfang des 16. Jahrhunderts in Rom, Paris, Köln und Wittenberg.
Und dass Gott den vertrauensvoll an ihn glaubenden Menschen bedingungslos annehmen sollte, also ohne dazwischengeschaltete priesterliche Vermittlung, das konnte dem Papst kaum gefallen, der die Kontrolle über den, wie man sagte, «Kirchenschatz» der Gnaden Christi und der Verdienste aller Heiligen beanspruchte. Die 95 Thesen sind alles andere gewesen als das Revolutionsfanal eines streitsüchtigen Eiferers, sondern die bedächtige, durchaus respektvolle Formulierung von Fragen, die vielen auf der Seele brannten. Und dennoch hat Luther recht, wenn er im Rückblick 1545 feststellt: Das hieß den Himmel herabstürzen und die Welt in Brand stecken.[61]
Denn während Erzbischof Albrecht ein Gutachten der Universität Mainz zu den Thesen erbat – so war es gängige Praxis und von Luther wohl auch gewollt – und das Schriftstück eilends direkt an den Papst schickte – was keinesfalls üblich war –, entfaltete die Wittenberger Wortmeldung eine ungeahnte Eigendynamik. Bevor das Jahr zu Ende ging, war sie in Leipzig, Nürnberg und Basel gedruckt, in Nürnberg auch in deutscher Übersetzung. Die gewünschte Disputation war zwar nicht zustande gekommen, aber überall sprach das gebildete – und bald auch das weniger gebildete – Publikum über die Thesen. Der Ruhm war mir nicht lieb, bekannte der damals noch recht scheue Wittenberger erschrocken, ich wußte selbst nicht, was der Ablaß wäre, und das Lied wollte meiner Stimme zu hoch werden.[62]
Sein Rivale Tetzel schlug vor, kurzen Prozess zu machen und den frechen Mönch auf den Scheiterhaufen zu schicken. Als Luther im März 1518 einen Sermon von Ablaß und Gnade[63] in deutscher Sprache nachreichte, der den Kern der 95 Thesen in populärer Verknappung enthielt, versuchte er ihm nachzuweisen, dass er auf den Spuren der Erzketzer Jan Hus (1415 in Konstanz verbrannt) und John Wyclif (1418 verbrannt, zum Glück nur seine Gebeine, gestorben war er schon 1384) wandele, während die Position des Papstes nicht zur Diskussion stehe. Was ihm kaum jemand abnahm. Ähnlich grob gestrickt, aber ernster zu nehmen waren die Gegenthesen, die der renommierte Ingolstädter Theologe Johannes Eck für den Bischof von Eichstätt erarbeitete; Eck sollte in der Folgezeit zu Luthers härtestem Gegenspieler in der Theologenzunft werden. Die Führung des Augustinerordens begann jedenfalls um den hoffnungsvollen jungen Mitbruder zu bangen und zu überlegen, wie man ihn aus der Schusslinie nehmen konnte. Denn der früher so schüchterne Professor Luther hatte plötzlich Kampfgeist entwickelt: Je mehr jene wüten, desto weiter gehe ich vor.[64]
Seine Thesen hätten keine so erstaunliche Öffentlichkeitswirkung entfaltet, wäre die Zeit nicht auf der Kippe gestanden. 1517 war noch Mittelalter und schon Neuzeit. Kaiser Maximilian I. (1459–1519) tat sich auf seine humanistische Bildung viel zugute, doch sterben wollte er wie ein armer Büßer: Nach seinem Tod solle man ihm das Haar scheren, die Zähne ausbrechen und seinen Leib auspeitschen, verfügte er testamentarisch.[65] Während sich die Latein beherrschende Bildungselite um Luthers kleine Schrift riss, sammelten Ablassprediger für den Wiederaufbau einer abgebrannten Kirche irgendwo in Böhmen mühelos 15000 Gulden. Die Menschen bewunderten den eben erst in Nürnberg erfundenen Globus, interessierten sich für die von Christoph Kolumbus entdeckten fernen Inseln und Leonardo da Vincis technische Errungenschaften – und glaubten felsenfest an die Hexenkünste der bösen Nachbarin, trugen Amulette gegen Liebeszauber und sprengten geweihtes Wasser über ihre Felder, um die Dämonen zu vertreiben.
«O Jahrhundert! O Wissenschaft! Es ist eine Lust zu leben», schrieb der Humanist Ulrich von Hutten 1518 an einen Freund, «die Studien blühen, die Geister regen sich; Barbarei, nimm einen Strick, deine Verbannung steht bevor.»[66] Die Bürgerkultur in den Städten, die urbane Atmosphäre im Umkreis der Fürstenhöfe, die neuen Möglichkeiten des Buchdrucks: all das beflügelte nicht nur das literarische Interesse, sondern auch das geistig-moralische Niveau.
An den großen Heiligenfesten und den vielen Feiertagen – rund fünfzig im Jahr – zogen Pilgerströme und Prozessionen durch die Städte. Angesichts der dunkel glühenden Farbenpracht der Glasfenster in den Kathedralen meinten sie in den Himmel zu schauen. Die Volksfrömmigkeit war von Äußerlichkeiten, Aberglauben, Vertrauen auf magische Riten getragen und gleichzeitig von einer vibrierenden religiösen Sehnsucht bestimmt. Man lief von Kirche zu Kirche, um einen Blick auf die während der Wandlung in die Höhe gehaltene Hostie zu erhaschen, und rannte los zum nächsten Gottesdienst. Wer nicht lesen konnte – und das war immer noch die große Mehrheit –, betrachtete die Fresken und Altargemälde in den Kirchen, die Totentänze, die biblischen Szenen; alles war voller Bilder und Lieder.
Das kirchliche Personal war auf den unteren Rängen erbarmungswürdig schlecht ausgebildet und wenig motiviert; in den großen Städten wimmelte es von Mönchen, Kaplänen, Vikaren – manchmal zehn Prozent der Bevölkerung –, die gerade ein Viertel vom Lohn eines Maurergesellen verdienten und sich ihr armseliges Leben mit einer Konkubine zu verschönern suchten, für die sie dann allerdings eine jährliche Abgabe zahlen mussten, damit der Bischof ein Auge zudrückte. Doch immer öfter stellte die selbstbewusst gewordene Bürgerschaft jetzt ihre eigenen Prediger an, die Theologie studiert hatten und ihre Seelsorgepflichten ernst nahmen. Handwerker und Kaufleute organisierten sich in Bruderschaften, die ein intensives Frömmigkeitsleben mit sozialen Hilfswerken verbanden. Lesekundige Laien verfolgten den Gottesdienst neuerdings mit deutschen Übersetzungen der lateinischen Liturgie und hatten daheim Gebetbüchlein mit so hübschen Namen wie «Himmelsstraß» oder «Seelenwurzgärtlein». Es war nicht alles krank, schlecht oder verkommen in der vorreformatorischen Christenheit.
Obwohl das Treiben am päpstlichen Hof oder das Luxusleben in manchen deutschen Bischofspalästen herzlich wenig mit dem Evangelium des armen, gekreuzigten Jesus zu tun hatte. Die blaublütigen Domherren brachten ihre Jagdhunde in die Kathedralen mit, tauschten im Chorraum den neuesten Klatsch aus und ließen sich beim Messelesen von Hilfsgeistlichen vertreten. In Rom war auf Alexander VI. aus dem Hause Borgia mit seinen zahlreichen Mätressen und Kindern und den begeisterten Feldherrn Julius II. der Medici-Papst Leo X. (1513–1521) gefolgt. Ein persönlich leidlich frommer Kirchenfürst, der den Vatikan zu einem Schatzhaus der Renaissancekultur machte, die römischen Sümpfe trockenlegte und die Spitäler ausbaute, aber für die nötige Reform der Kirche an Haupt und Gliedern wenig Sinn hatte. Und gar nicht spürte, dass die abendländische Christenheit auf einem Vulkan tanzte.
Auch in Politik und Gesellschaft lösten sich die alten Strukturen wie von selbst auf. Die wohlgeordnete Welt des Mittelalters brach auseinander: Fürsten, Ritter, Bürger, Bauern standen im Konflikt jeder gegen jeden. Der Adel verlor seine angestammten Aufgaben, weil die Geldwirtschaft plötzlich viel wichtiger war als Grundbesitz und die städtischen Magistrate, die herzoglichen Behörden, die Söldnertruppen seine bisherigen Funktionen übernahmen. Auf dem flachen Land gab es neben den – verstärkt in die Leibeigenschaft gezwungenen – Bauern immer mehr Kleinpächter, Häusler, Tagelöhner. Obwohl Bergbau und Fernhandel blühten, lebten in den Städten zwei Drittel der Bürger an der Armutsgrenze. An der Spitze der sozialen Pyramide standen die großen Kaufleute und Bankiers, ganz unten die Opfer der rasanten Wirtschaftsentwicklung: in Konkurs geratene kleine Handwerker und Familienbetriebe, «Hörige» auf dem Land, Schwerstarbeit verrichtende Kinder in den Bergbauregionen. Überall Gärung, Verzweiflung und die vage Hoffnung auf einen vom Himmel gesandten Retter.
Der Kaiser konnte das nicht sein, er führte zwar dauernd Krieg und hatte durch seine geschickte Heiratspolitik das Haus Habsburg zur Weltmachtstellung geführt, im Innern aber gewaltig an Autorität verloren. Das Reich war ein schwaches Gebilde, aufgesplittert in rund 300 Territorien, beherrscht von kleinen Fürsten und großen Geldsäcken, die in der Regel vollkommen egoistisch ihre Interessen verfolgten. Unter Kaiser Maximilian I. war der Reichstag zur festen Institution geworden, hier konnten der Adel, der hohe Klerus und neuerdings auch die Vertreter der Städte politischen Einfluss nehmen. Was sie auch massiv taten, denn das «Heilige Römische Reich Deutscher Nation» kannte keine Erbmonarchie; die Bewerber mussten sich der Wahl durch die sieben Kurfürsten stellen und entsprechende Zugeständnisse machen.
Ein Sturm wie die Reformation musste kommen und das zerbröckelnde Alte hinwegfegen, sagen viele Historiker; das mittelalterliche Ordnungsgefüge hätte der massiven Kirchenkritik, dem Aufbegehren der Laien, der bürgerlichen Bildungsbewegung, dem aufkommenden Nationalgefühl nicht mehr standhalten können. Die andere Fraktion der Fachleute macht ebenfalls eine Vielzahl von Krisenelementen aus, die aber unterschiedliche Ursachen und wenig Zusammenhang gehabt hätten. «Es war, so scheint es, vor dem Auftreten Luthers nicht einmal ausgemacht, ob die beharrenden oder die auf Veränderung zielenden Kräfte die Oberhand gewinnen würden.»[67]
Die interessanteste Rolle spielt in dem beginnenden Drama der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise (1463–1525). Seine Macht lag nicht nur in den reichen Bodenschätzen und der blühenden Bergbauindustrie Sachsens, sondern auch in seinem Charakter: Er galt als Meister in der Kunst, Konflikte zu vermeiden und widerstreitende Interessen zu versöhnen. Wie seine geliebte Reliquiensammlung zeigt – er hatte in Italien einen gutbezahlten Agenten sitzen, der ständig neue Heiligenknochen und andere Attraktionen auftreiben sollte –, war er im herkömmlichen Glauben verwurzelt und umstürzlerischen Ideen gegenüber eher skeptisch. Wenn er dennoch zu Luthers treuestem Schutzpatron wurde, dann aus zwei Gründen: Zum einen wollte er sich den prominentesten Professor der jungen Wittenberger Universität, auf die er so stolz war, nicht wegen irgendwelcher römischen Empfindlichkeiten wegnehmen lassen. Zum andern sträubte sich sein ausgeprägtes Rechtsempfinden dagegen, jemanden als Ketzer zu behandeln, bevor er in einem korrekten Verfahren überführt worden war.
Deshalb legte sich Friedrich quer, als Luther im August 1518 nach Rom vorgeladen werden sollte – denn höchstwahrscheinlich wäre er dort in einem Kerker verschwunden –, und setzte stattdessen ein Verhör auf deutschem Boden (im Oktober in Augsburg) und später die entscheidende Verhandlung auf dem Wormser Reichstag 1521 durch. Statt die Reichsacht gegen ihn zu vollziehen, versteckte er ihn auf der Wartburg. Luther hat ihm seine lebensrettende Solidarität nicht immer gedankt; 1523 machte er sich im Entwurf zu einer neuen Gottesdienstordnung öffentlich über die profitable Heiligenfrömmigkeit seines Landesherrn lustig und schlug vor, die Wittenberger Allerheiligen-Schlosskirche, wo er seine zahllosen Reliquien gegen Geld zur Schau stellte, lieber Allerteufeln[68] zu nennen. Friedrich machte seinem Beinamen «der Weise» alle Ehre: Er blieb dem Reformator vorsichtig gewogen, verhinderte den drohenden Bürgerkrieg zwischen Luther-Anhängern und Romtreuen und hielt sich persönlich aus den religiösen Zwistigkeiten heraus; erst kurz vor seinem Tod ließ er sich das Abendmahl in beiden Gestalten (Brot und Wein) reichen und bekannte sich damit zur neuen Lehre.
Der Augustinerorden versuchte die Aufregung über Luthers Thesen aufzufangen, indem er dem umstrittenen Mitbruder auf dem im Frühjahr 1518 turnusmäßig in Heidelberg tagenden Ordenskapitel Gelegenheit gab, seine Kritik am Ablasswesen in einem mehr internen Rahmen zu diskutieren. Als Distriktsvikar spielte er hier ohnehin eine wichtige Rolle. Doch Luther, vom Kurfürsten mit einem Schutzbrief für die Reise ausgestattet und von seinen Mitbrüdern, von Gästen aus anderen Orden und den Mitgliedern der Heidelberger Theologischen Fakultät mit Spannung erwartet, ließ das Thema Ablass links liegen: Ob etliche mich nun wohl einen Ketzer schelten, denen solche Wahrheit in der Kasse sehr schädlich ist, so achte ich doch solch Geplärre nicht groß; sintemal das niemand tut als etliche finstere Gehirne, die nie in die Bibel gerochen, die christlichen Lehrer nie gelesen, ihre eigenen Lehrer nie verstanden, sondern in ihren durchlöcherten und zerrissenen Schulmeinungen beinahe verwesen.[69]
In seinem Sarkasmus konnte er gnadenlos sein. Lieber stellte er in einer fulminanten Disputation noch einmal sein Verhältnis zur gängigen Leistungsfrömmigkeit klar: Nicht wer viel Werke tut, ist gerecht, sondern wer ohne Werk viel an Christus glaubt.[70] Und er scharte Bundesgenossen um sich, um sein Projekt einer gründlichen Studienreform zu forcieren und über Wittenberg hinauszutragen. Die Einrichtung einer Griechisch- und einer Hebräisch-Professur sollte der Theologie einen frischen Zugang zur Heiligen Schrift ermöglichen. Auch der Ausbau des Lehrangebots in Rhetorik, Naturkunde und Mathematik entsprach humanistischen Forderungen.
Im Sommer kam ein einundzwanzigjähriges Wunderkind nach Wittenberg, ein gewisser Philipp Melanchthon, der schon mit zwölf in Heidelberg studiert und mit siebzehn seinen Magister gemacht hatte. Als gefeierter Griechisch-Lehrer und messerscharfer Denker verband er die Luther’schen Visionen mit humanistischer Gelehrsamkeit und brachte damit die reformatorischen Ideen in eine solide Systematik. Die nicht gerade überschwängliche, eher nüchterne Freundschaft der beiden Männer sollte bis zu Luthers Tod 28 Jahre später anhalten. In ihrer Persönlichkeit waren sie denkbar verschieden: Luther der stürmische Kraftmensch, der gern mit dem Kopf durch die Wand wollte, hitzig, reizbar, cholerisch, in seinen Attacken oft maßlos übertreibend – Melanchthon vorsichtig, stets auf Ausgleich bedacht, klug abwägend, aber auch ängstlich und risikoscheu. Ihre Motivation jedoch war dieselbe: der Traum von einer geläuterten, zum Ursprung zurückgeführten Kirche und die Liebe zur Bibel, die wieder alleiniger Maßstab christlicher Lehre werden sollte.
Der Mönch Luther war freilich zu eigenständig und auch zu konservativ, um sich von den Humanisten vereinnahmen zu lassen. Während sich die Philosophen an den Hochschulen von der traditionellen Übermacht der Theologie zu befreien suchten, plädierte er ganz altmodisch für eine christliche Philosophie. Ich freilich glaube, daß ich dem Herrn diesen Gehorsam schulde, heftig gegen die Philosophie zu wettern und zur Hl. Schrift zu raten.[71] Mit den Humanisten verband ihn nun wieder der Kampf gegen die Abhängigkeit der Theologen von Aristoteles, diesem