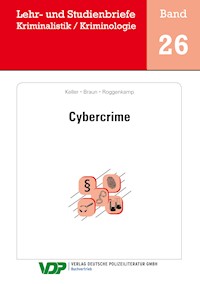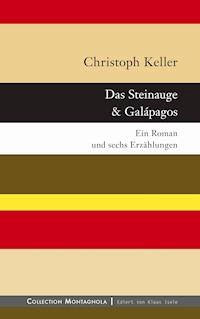Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Klimastreiks haben geschafft, was bislang noch kein politisches Gipfeltreffen erreicht hat: Die Klimakrise ist in den Köpfen angekommen. Zumindest in sehr vielen Köpfen. Ein Umdenken scheint möglicher denn je. Tatsächlich gibt es unzählige Wege, um nachhaltig, sozial, intelligent in die Zukunft zu schreiten. Wissenschaftler, Unternehmer und Aktivistinnen auf der ganzen Welt haben diesbezüglich schon ziemlich gute Ideen entwickelt. Dieses Buch führt uns dahin, wo diese Zukunft bereits heute sichtbar wird. Eine Reise an Orte, wo aus Luft Treibstoff gemacht wird, zu grünen Dächern über der Großstadt, zu Dörfern, die ihre Energie mehr als nur decken, zu Zementwerken, die aus Altbeton neuen Werkstoff machen. Ein Besuch auch bei Menschen, die sich einer anderen Denkweise verschrieben haben – dem Denken in Zyklen, in Kreisläufen, in komplexen, aber auch nachhaltigen Systemen. Dazu liefert es ein paar grundsätzliche Überlegungen zur Frage, wie wir in eine bessere, unverbrannte Zukunft gehen können. Morgen schon, wenn wir nur wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Keller
Benzin aus Luft
Eine Reisein die Klimazukunft
Reportagen und Essays
Für Mirjam und Olivia
Der Verlag dankt dem Kulturpark Zürich West für die finanzielle Unterstützung.
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2019 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
eISBN 978-3-85869-858-2
1. Auflage 2019
Inhalt
Vorwort
Verrückte Normalität
Teil I – Besichtigung der Katastrophen
Alle nur noch arme Seelen
Die geflutete Stadt
Schlammlawinen
Fatale Karbonblase
Teil II – Urbane Streifzüge
Auf den Dächern von London
Urbanes Kraftwerk
Schmid hat einen Plan
Die Stadt als Mine
Pilze im Quartier
Teil III – Andere Kreisläufe
Packen wir’s ein
Benzin aus Luft
Fisch aus Gemüse
Energie ist Reden
Überall Solardächer
Teil IV – Stolpern in der Gewinnmarge
Eine neue Bilanz
Das große Versprechen
Mit dem Wind
Häuser im Kreislauf
Teil V – Strategien
Mehr Gerechtigkeit
Was ein Gletscher kostet
Ende Blockade
Recht auf Leben
Anhang
Nachweise
Mit Blick auf die Speisekarte
Verrückte Normalität
»Immer mehr!«, wird uns von den Plakatwänden herab zugerufen, bei der Werbung für Hypotheken, für Autos, für Versicherungen. Immer mehr – es wird für uns ein Lebensplan entworfen, in dem es, wie selbstverständlich, immer aufwärts gehen soll. Easy investieren, das Auto gehört zum Leben, Fliegen sowieso, man muss überall gewesen sein – »been there, done that«. Auch im Kleinen sind die Versprechungen groß. Laufend neue Klamotten, das neueste Mobiltelefon, die schnellste Datenübertragung, bloß nicht abgehängt werden. Wenn Kinder kommen, braucht es einen SUV, ein Haus im Grünen, man steht dann im Stau. Doch jetzt, in Zeiten der Klimakrise, wird diese lange eingeübte Normalität brüchig.
Am Anfang war das Steak.
Es lag dann aber nicht auf meinem Teller, so, wie ich mir das gewünscht hatte, und daran war Anja schuld. Anja, die alles sehr genau liest, auch eine Speisekarte, und die beiläufig gesagt hatte, es sei schon seltsam. Seltsam, dass bei den Speisen in den allermeisten Restaurants nach den Vorspeisen zuerst die Fleischgerichte, manchmal auch der Fisch aufgeführt sei, aber erst an dritter Stelle »Vegetarisches«. Diese Abfolge auf der Speisekarte in vielen Restaurants, meinte Anja, sei Ausdruck einer bestimmten Normalität, die selbstverständlich davon ausgehe, dass pflanzliche Ernährung zuletzt kommt, als das Außergewöhnliche.
»Fleisch ist wie das Auto: Die Mehrheit hat eins, aber eigentlich ist es untragbar, und das Steak, das du bestellen willst, ist wie ein SUV – zu groß, zu schwer, zu belastend.«
Anja, muss man wissen, ist die gewissenhafteste Person, die ich kenne. Sie produziert praktisch keinen Abfall, fährt niemals Auto, ist Vegetarierin. Anja kennt auch die ökologischen Kennzahlen zu Produkten, zu Dienstleistungen, und so bereitete sie mich auch an jenem Abend im Restaurant auf ein Zahlengewitter vor.
»Willst du es wirklich wissen?«
»Heraus damit.«
»In Sachen CO2 variieren die Zahlen stark, aber du kannst davon ausgehen, dass in einem Kilo Steak zwischen 13 und 36 Kilogramm CO2 stecken, je nach Herkunft, je nach Transportart. Dazu kommt die benutzte Landfläche, allein rund 40 Quadratmeter für dieses eine Kilo, und sagenhafte 15’000 Liter Wasser.«
»Du vergisst die Futtermittel, und dass der Regenwald abgeholzt wird, um Soja für Rinder anzubauen.«
»Richtig.«
Ich bestellte Linsen an Balsamico, und Anja entschied sich für ein Tofugericht, und wir verbrachten einen Teil des Abends damit, uns über Zahlen zu unterhalten, Zahlen zu dem, was wir unserem Planeten so zumuten. Fast alles ist bekannt, errechnet, vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), von staatlichen Umweltagenturen, von Versicherungsgesellschaften, von statistischen Büros, von der Internationalen Energieagentur. Es gibt keine Ungewissheit, die Biodiversität schwindet rapide, die Gletscher schmelzen schneller, als die pessimistischen Prognosen der Glaziologen errechnet haben, der Meeresspiegel steigt, die Dürren nehmen zu, die Schweiz ist mit zwei Grad Erwärmung bereits in der Klimakrise gelandet. Und der »Earth Overshoot Day«, der Tag, an dem die Menschheit alle zur Verfügung stehenden Ressourcen für ein Jahr eigentlich aufgebraucht hat, rückt im Kalender immer weiter nach vorne, er fand für die Schweiz 2019 bereits am 7. Mai statt, für Deutschland sogar vier Tage früher; seit diesem Datum verbrauchen wir die Ressourcen einer zweiten Erde, bis Ende des Jahres werden es drei Erden sein. Letztmals, das wusste Anja, war das Verhältnis zwischen global zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem jährlichen Verbrauch im Jahr 1971 ausgeglichen. Von da an lief die Bilanz aus dem Ruder.
Irgendwann einmal zückte ich mein kleines schwarzes Ding, und wir schauten uns die Kurve der Konzentration an CO2 in der Atmosphäre an, die das Mauna Loa Obervatory auf Hawaii monatlich nachführt. Die Kurve stand bei knapp 415 Teilchen pro Million Lufteinheiten – noch nie in der Menschheitsgeschichte und zuvor war die Atmosphäre so gesättigt mit Treibhausgasen.
Anja sagte:
»Die Zeit der Mutmaßungen ist vorbei, die Zeit, als man sich noch fragte, kommt die Katastrophe oder kommt sie nicht. Heute wissen wir, dass sie kommt.
Und doch machen alle weiter, als wäre da nichts. Noch immer werden Pipelines verlegt, es wird in Ölfirmen investiert, es werden Kohlekraftwerke gebaut, als gäbe es kein Morgen. Die verkauften Autos werden größer, die Flugreisen billiger, der Onlinehandel boomt. Man bohrt nach Öl im Mittelmeer, man sucht Gas unter der Arktis, man fördert Schieferöl in Kanada, als sei nicht längst klar, dass ab sofort kein bisschen mehr CO2 in die Atmosphäre gelangen sollte.«
»Die Macht der Gewohnheit?«
»Oder ganz einfach Normalität?«
Normalität oder Normalisierung ist, wie der französische Philosoph Michel Foucault in vielen seiner Schriften erarbeitet hat, ein komplexer Vorgang, bei dem Menschen durch das Mittel der Sprache und durch die Macht von Institutionen zu einer bestimmten Lebensart »diszipliniert« werden. Diese Art von Disziplinierung findet in vielfältigen Diskursen statt, sie geht sowohl von der Werbung, von der Schule, von wissenschaftlichen Institutionen, aber auch von den Erzählungen aus, die die Produkte unserer Überflussgesellschaft umgeben. Normalisierung, darauf hat Michel Foucault hingewiesen, wird bestärkt und bestätigt durch die Praxis der Menschen, die wiederum die Macht dieser Normalitätsvorstellungen nachvollziehen und festigen; und Normalisierung zielt immer auf eine Grenzziehung hinaus: Diejenigen, die innerhalb der Norm sind, werden belohnt, die anderen, die außerhalb stehen, geraten unter Rechtfertigungsdruck.
Normalisierung oder Normalität sind, darauf hat die amerikanische Autorin Elisabeth C. Britt hingewiesen, die Produkte der Industrialisierung, der Standardisierung, der Messbarkeit. Sie sind »die Sprache des Ingenieurs«, die sich über die nunmehr zwei Jahrhunderte Industrialisierung herausgebildet hat, um sich darüber zu verständigen, welche Vorstellungen von Zukunft für alle begehrenswert sein könnten. Die Statistik wiederum lieferte die Daten und Vergleichsmöglichkeiten für eine Moderne, die zwar eine Pluralität von Lebensvorstellungen zuließ, in ihrem Kern aber imprägniert war und ist von Leistung, Fortschritt, Wachstum. Dass darin Spielarten abweichenden Verhaltens, auch dissidente Positionen bis hin zur fundamentalen Opposition vorkommen, ist kein Widerspruch; denn die Macht der Diskurse erstreckt sich, wenn sie denn ihren Namen verdienen wollen, auch über abwegige, nicht konforme Haltungen. Sie werden ins große Dispositiv der Normalität integriert, indem sie für »normal« erklärt (»Es ist normal, dass die Jugend rebelliert, sie hat das schon immer getan, jetzt gehen halt die Klimajugendlichen auf die Straße«) oder aber indem sie diskreditiert werden (»Die Jugendlichen, die sich fürs Klima einsetzen, haben keine Ahnung, man muss das den Experten überlassen«).
Die Normalität, in der wir leben und die sich täglich fortsetzt, durch unsere Kaufentscheide, durch die Reisepläne, die wir schmieden, durch unsere Essgewohnheiten, sie ist das Produkt eines gelernten, eingeübten, bisher auch durchaus erfolgreichen historischen Prozesses, der mit der Industrialisierung und mit dem Verbrennen von Kohle begann. Die Kohle war der Treibstoff der Industrialisierung, sie war das Substrat, auf dem sich eine zunächst schmale, aber mächtige Schicht der Bevölkerung ihren Reichtum aufbauen konnte (die andere Grundlage war die systematische Ausbeutung der Sklaven gewesen, und auch die industrielle Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter). Sie ermöglichte ein paar Wenigen damals schon, ein Leben ausschweifenden Verbrauchs zu führen; allein aus Gründen der damals real verfügbaren Ressourcen wäre diese Unverhältnismäßigkeit nicht verallgemeinerbar gewesen. Dennoch ist im Laufe der Geschichte – in einem »industriellen Fatalismus«, wie Ulrich Beck die Geschichte der Industrialisierung bezeichnet – praktisch genau das passiert, das bourgeoise Leitmotiv (mitsamt der Figur der Kleinfamilie) hat sich auf die Schicht der Kleinbürger, später auch der Angestellten, schließlich der Arbeiterinnen und Arbeiter übertragen; im sogenannten »Wirtschaftswunder« nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Norm von Fortschritt, Wachstum, Glück ihre reale Bestätigung. Was dem einen sein Buick, war dem anderen sein Volkswagen Käfer, und Staubsauger und Waschmaschine, das Steak auf dem Teller, die Bananen im Supermarkt und der Atomstrom aus der Steckdose waren nur einige jener wirkungsmächtigen Ikonen einer neu angebrochenen, scheinbar unerschöpflichen Modernität.
Darin sind wir gefangen, bis heute.
Die Verdrängungen, die wir uns in diesem Prozess geleistet haben, sind nicht unbeträchtlich. Sie umfassen die koloniale Ausbeutung der Länder des Südens ebenso wie die Frage, was geschieht, wenn sich diese Lebensform des »immer mehr« verallgemeinert, wenn auch die Völker Afrikas, die Völker Südostasiens, ganz China genauso um die Welt fliegen, im Internet shoppen und genauso viel Fleisch auf den Teller wollen wie wir. Und was, wenn sich alle Menschen oder auch nur alle Familien auf der Welt das Recht herausnehmen würden, ein »Familienauto« zu fahren? Die Unmöglichkeit, die Demokratisierung der eigenen »Wunschexplosionen« (so der Psychoanalytiker Mario Erdheim) zu reflektieren, ist die stärkste Verdrängungsleistung in diesem »kollektiven Unbewussten«. So stark war und ist diese Verdrängungsleistung, dass selbst lautstarke, überzeugende, wissenschaftlich fundierte Warnungen über die Zeit und die Jahre hindurch nicht gehört wurden: weder die Mahnschrift Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome 1972 noch der Brundtland-Bericht von 1987, auch nicht der dringliche, alarmierende Bericht des IPCC, der »Fourth Assessment Report« von 2007.
Nur: Wer trägt die Verantwortung für den Fortbestand dieser verrückten Normalität? Dafür, dass nach wie vor mehr Landebahnen gebaut werden für mehr Flugreisende, dafür, dass ungebrochen über den Ausbau der Autobahnen auf sechs Spuren diskutiert wird, dafür, dass Pensionskassen ungehindert in die Erdölindustrie investieren?
Eine weit verbreitete Haltung sieht die Verantwortung beim »Einzelnen«, der (oder die) sich am System »beteiligt« und »mitmacht«, und an ihnen, an den »Einzelnen« muss es liegen, wenn sich etwas ändern soll. Darin liegt zum einen die Suggestion, die gelebte Wirklichkeit sei nicht mehr als die Summe von Einzelentscheidungen und es ließe sich sozusagen durch ein »Abstimmen mit den Füßen« und entsprechende Konsumentscheidungen eine Wende herbeiführen; jeder und jede soll in Eigenverantwortung »bei sich selber anfangen« und möglichst Sparglühbirnen in die Stehlampen schrauben, beim Autofahren das Gaspedal dosiert bedienen und die Raumtemperatur auf 21 Grad begrenzen. Man tut hier so, als sei Normalität nicht ein komplexes, tradiertes Konstrukt, das über viele Kanäle, von der Pommes-Chips-Werbung über die Bewertung von Liegenschaften, von der Zulassungsstatistik für Personenwagen hin zu den Gewinnversprechen bei Derivaten, die Wahrnehmung, die Denkweise und die Perspektiven der Individuen formt. So kommt denn die Rede von der »Eigenverantwortung« nicht nur als leicht erkennbare ideologische Speerspitze gegen jede Form staatlicher Reglementierung daher (man wolle keinen »Ökototalitarismus«, warf der neue starke Mann der Schweizerischen Volkspartei, Roger Köppel, seinen Delegierten an den Kopf, und wie die SVP lullt die AfD ihre Wählerinnen und Wähler ein mit dem Versprechen: »Das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert«); sie liefert auch die Vorlage für jede Art von moralischen Einwürfen, wenn sich der oder die Bemühte für einmal nicht nach den eigenen Prinzipien verhält (»Am Freitag an die Klimademo, am Samstag mit Easyjet zur Party nach Berlin«).
Wenn die SVP, Hand in Hand mit anderen rechtsgerichteten Parteien in Europa, eine imaginierte Souveränität zur Maxime erklärt, dazu noch den »eigenverantwortlich handelnden Menschen« als Leitmotiv hervorhebt und »für mehr Markt« wirbt, gleichzeitig aber die unmittelbar drohende Klimakrise als »linksdiktatorische Verschwörung« abqualifiziert, dann tut die Partei nichts anderes, als der bestehenden Normalität das Wort zu reden. Nichts soll sich ändern, nichts. Alles soll so bleiben, vom Cervelat, der mit uruguayischem Rindsdarm umwickelt wird, hin zu den Subventionen für die Erdölwirtschaft, von der subventionierten, pestizidfixierten Landwirtschaft hin zur Zollbefreiung fürs Flugkerosin. Nur keine Wohlstandsverluste; lieber leugnen und abwiegeln als der drohenden Katastrophe ins Auge sehen.
Leider hat es sich noch nicht überall herumgesprochen, aber die Anzeichen mehren sich, dass die real gelebte Normalität an ihre Grenzen kommt.
Die trockenen, heißen Sommer, die sichtbar schwindenden Gletscher in den Alpen, die offenen Schrunden im Primärwald Neuguineas, pestizidverseuchte Böden, erodierende Strände, häufigere Stürme, ein Jetstream, der aus dem Takt gerät, Eisbären, die sich von Abfallhaufen ernähren – sie alle sind zu lesen als sehr konkrete Anzeichen der Klimakrise; und nun gehen auch noch die Klimajugendlichen gegen ihre eigenen Eltern auf die Straße, Bewegungen wie Extinction Rebellion demonstrieren für das nackte Recht auf Existenz, und eine einzelne Figur wie Greta Thunberg vermag Millionen zu mobilisieren. Die Botschaft »System change, not climate change«, die sie vermitteln, verweist auf einen Bruch mit der bestehenden Normalität, der neu ist und deutlich macht, dass die Rettung des Klimas nicht ohne drastische Veränderungen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Geflecht zu haben ist.
Eine neue, eine differente Normalität muss her.
Darauf hat Naomi Klein in ihrem Buch Die Entscheidung: Kapitalismus vs. Klima hingewiesen: dass der Markt den unbändigen Wunsch hat, frei und ungezügelt zu sein, und er darin nach den billigen, den verfügbaren Ressourcen greift und sie verwertet; sein schlimmster Feind ist die Regulierung, die Lenkung, die Begrenzung. Aber darum geht es in der Konsequenz: dass mit unmissverständlichen, drastischen Regulierungen eine Wende eingeleitet wird, weg aus der verrückten Normalität, hin zu einer Normalität, in der andere Grundsätze gelten. Nicht Verschwendung, sondern Kreisläufe, nicht die Subventionierung von fossilen Brennstoffen, sondern die Förderung erneuerbarer Energien, nicht die asoziale Besteuerung von Arbeit, sondern die scharfe, sozial gerechte Besteuerung von CO2, nicht Investitionen in Autoinfrastruktur, sondern in intelligente, flexible Verkehrsträger und in eine nachhaltige, weitsichtige Planung unserer Städte.
Die gute Nachricht lautet: Die Technologien für die neue, die andere Normalität, sind allesamt da. Die Wärmepumpe ebenso wie das Passivhochhaus, der Elektrobus ebenso wie das intelligente Fahrradleitsystem, die sehr preiswerten Solarpanels ebenso wie hocheffiziente Windräder. Wir haben die Modelle und Techniken für zirkuläre Anbaumethoden in städtischen Räumen, für Dachgärten und urbane Agrikultur, und die Landwirtschaft verfügte, wenn sie sich denn endlich von der toxischen Chemie verabschiedete, über hocheffiziente, ökologische Anbaumethoden. Und selbst für die Anwendungen, die noch auf Brennstoffe angewiesen sind (etwa Flugzeuge, Schiffe), gibt es Lösungen – schließlich sind wir in der Lage, aus Luft Benzin zu machen.
Die schlechte Nachricht ist die, dass wir in einem Zustand verharren, den die Psychologie als den »Normalitätsbias« bezeichnet, ein Phänomen, das sich im Vorfeld großer, drohender Katastrophen beobachten lässt und sehr häufig vorkommt. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Pompeij reagierten unter dem Normalitätsbias, als sie beim fatalen Ausbruch des Vesuvs stundenlang zuschauten, wie der Vulkan Feuer und Lava spuckte, statt schleunigst die Stadt zu evakuieren. Auch die Besatzung der Titanic ließ das Orchester einfach weiterspielen, nachdem das Kreuzfahrtschiff längst im Begriff war, abzusaufen. In Thailand blieben die Menschen beim Anrollen der riesigen Tsunamiwellen fasziniert am Strand stehen. Der Normalitätsbias, so vermuten klinische Psychologen, ist ein fataler Mechanismus im Gehirn, der dazu führt, dass wir im Angesicht der Katastrophe so tun, als wäre alles nach wie vor normal; er spielt auch eine Rolle bei drohenden politischen Umbrüchen, wenn Deportationen drohen, wenn Menschen erkennen sollten, dass sie an Leib und Leben, in ihrer Integrität unmittelbar gefährdet sind.
Angesichts der Klimakrise befinden wir uns in genau diesem Normalitätsbias.
Er wird verstärkt durch all die Stimmen, die uns darin bestätigen, dass es »schon nicht so schlimm kommt«. Dazu sind nicht nur die notorischen, von der fossilen Industrie bezahlten Lobbyisten zu zählen, die als »Klimaleugner« unterwegs sind und behaupten, die Klimakrise sei eine Falschmeldung. Zum Normalitätsbias tragen auch Medienberichte bei, die jedem Bericht über Klimafragen (die Zunahme von Stürmen, das Abschmelzen der Polkappen, die Wirkung einer Abgabe auf CO2) stets noch ein Quäntchen Zweifel mit einstreuen, dass es »vielleicht doch nicht so heftig« oder dass (etwa bei der Besteuerung von Flugreisen) der Effekt »vielleicht doch nicht so groß« sein wird. Jeden Zweifel darüber, dass die Krise real und bedrohlich ist und dass eigentlich sofort gehandelt werden müsste, nimmt das Gehirn dankbar auf und wandelt ihn in Normalität um; das gilt für die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger leider ebenso wie für die Gehirne von Politikerinnen und Politiker. Beruhigt fahren wir jeden Morgen unseren SUV aus der Garage, bestellen getrost das Heizöl für den kommenden Winter und legen den alarmierenden Flyer von Greenpeace zum Altpapier.
Was also tun?
In diesem Buch werden Geschichten erzählt, in Reportagen und Essays, die an dieser Schwelle ansetzen, dort, wo die Normalität kippt oder längst hätte kippen sollen: von einer verrückten Normalität in eine andere, neue, nachhaltige. Es sind Erzählungen aus dem Jetzt, die aber in eine Zukunft weisen, in eine Zukunft, zu der wir keine Alternative haben. Sie werden getragen von Menschen, die ich getroffen habe, die etwas versuchen, die in diesem Versuch auch manchmal scheitern; und es sind Erzählungen, die, wie das die US-amerikanische Professorin Donna Haraway in ihrem Aufsatz »Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene« formulierte, »gerade groß genug sind, um die Komplexitäten zu erfassen, und um die Enden so weit offen zu lassen, damit Lust auf alte und neue Inspirationen entsteht«.
Manche dieser Geschichten sind bereits vor zehn Jahren entstanden, sie wurden für den vorliegenden Band aktualisiert; an Aktualität haben sie nicht eingebüßt, leider. Denn in den letzten zehn Jahren ist die Menschheit, ist die Politik in den alten Mustern einer verrückten Normalität stecken geblieben. Viele der Protagonisten in den Reportagen sind Männer, vielerorts geht es um technische Fragen und Lösungen; aber hinter diesen technischen Ansätzen gibt es diese neue, diese andere Normalität, die wir alle brauchen und die in ihrer Dringlichkeit bezeichnenderweise von Frauen, nämlich von den Klimaseniorinnen, auf den Punkt gebracht wurde – es geht um eine Zukunft, in der uns die Technik und das Wirtschaften nicht an Leib und Leben bedrohen.
Anja, an jenem Abendessen, drehte die Speisekarte auf den Kopf und sagte:
»Jetzt ist es richtig, man muss die Dinge einfach anders betrachten.«
Der neueste Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change mit dem Titel »Global Warming of 1,5°’C« hat errechnet, dass es »außerordentlicher Anstrengungen bedarf«, um das Ziel einer Temperatursteigerung von maximal 1,5 Grad Celsius noch zu erreichen. Das Ziel, so das IPCC, sei zwar schwierig zu erreichen, aber nicht unmöglich, wie das viele Wissenschaftler mittlerweile glauben. Die Temperaturerhöhung der Atmosphäre auf 1,5 Grad zu begrenzen, bedeutet, dass die Emissionen an CO2 bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2017 um 49 Prozent gesenkt werden müssen, und allerspätestens 2050 müssen die Emissionen auf netto Null kommen. Das heißt, dass bis dahin bis zu 85 Prozent der weltweiten Energie aus erneuerbaren Energien stammen müssen, und es müssen massive Anstrengungen unternommen werden, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen.
Teil I
Besichtigung der Katastrophen
Beim Gletscher
Alle nur noch arme Seelen
Gletscher sind das größte Wasserreservoir der Alpen, und sie verschwinden. Bis 2100, so die Prognosen, werden alle Gletscher in den Alpen weggeschmolzen sein, von den größten werden ein paar Eisfelder übrigbleiben. So auch vom Aletschgletscher, dem mächtigsten Gletscher der Alpen. Dass er schwindet, hat nicht nur Auswirkungen auf den Tourismus, auf die Wasserversorgung, auf die Landschaft. Es kommt auch ein Stück alpiner Kultur abhanden. Gletscher sind das Gedächtnis vieler Jahrtausende.
Tags zuvor hatte ich im Hotel Belalp gefrühstückt, mit Blick auf die Gletscherzunge.
Sie sah schmal aus, weit entrückt, hinten im Tal, und der Gletscher selber mit seinen schwarzen Streifen ruhig. Noch immer mächtig, und doch ganz anders, als auf den Fotos im rundum verglasten Restaurant zu sehen. Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen der Gletscher bis fast ans Hotel heranreicht, eine hohe, breite Eismasse, die das Tal bis zu den Rändern auffüllt, man sieht Touristen mit breiten Hüten und weiten Kleidern, die in tiefer Kontemplation versunken sind. Aletschbord, so heißt der Felsvorsprung, auf dem das Hotel Belalp gebaut wurde.
Heute muss man wandern, um den Gletscher zu erreichen, den Aletschgletscher, den größten Gletscher der Alpen.
Ich machte mich auf die Suche nach ihm, wollte einen Weg finden, um ihn aus der Nähe zu sehen. Der Bergflanke entlang, auf einem gut ausgebauten, steilen Weg, die Treppenstufen hinab zur Üssers Aletschi, wo der Gletscher aber schon nicht mehr zu sehen war. Auch nach dem Aufstieg, durch Felsen und Geröllhalden hinauf über Oberaletsch und dann weiter zum schmalen Einschnitt mit dem tosenden Bach suchte ich den großen, den noch immer mächtigen Aletschgletscher vergebens. Fand mich aber dann zuunterst in diesem schroffen Seitental auf einer Brücke wieder, die den Blick freigab auf den Oberaletschgletscher, oder genauer: auf das, was von ihm übrig ist.
Das Eis zugedeckt mit einer dicken Geröllschicht, die Eisdecke dünn und brüchig, und wie aus einem Springbrunnen floss das helle, klare Wasser aus ihm heraus. Schäumendes Gletscherwasser, das tosend ins Tal strömt; man kann hier, auf dieser Brücke, zusehen, wie der Gletscher davonschmilzt. Nicht der Abfluss, den jeder Gletscher hat, sondern viel zu viel Wasser, als würden die Eismassen ausgepresst.
Ich stand lange auf Brücke, schaute den schäumenden Fluten zu und sah ein kahles, trockenes Tal, staubig und dürr. So würde es in einem oder zwei Jahrzehnten hier aussehen.
Den großen Aletschgletscher bekam ich dann nicht mehr zu sehen an diesem Tag, obwohl ich noch weiter wanderte, fast bis hinauf zur Tällihütte.
Am nächsten Tag versuche ich es von der anderen Seite, mit der Seilbahn von Mörel hinauf zur Riederalp. Wer an der Seilbahnstation aussteigt, hoch über dem Tal, findet sich in einem stillen Dorf wieder. Hier, auf der anderen Seite des Aletschwalds mit Blick zum Tal, sind im Herbst die Chalets geschlossen, die Gartenzwerge schlafen, die Fahnenstangen stehen flaggenlos, im einzigen Laden sind keine Kunden anzutreffen. Einzig oben auf dem Weg gibt es Wanderer. Die einen steigen hinauf zum Eggishorn, um von da aus zum Gletscher zu gelangen. Die anderen marschieren hoch zur Riederfurka, dann durch den Aletschwald über die neue, spektakuläre Hängebrücke hinüber zur Belalp.
Den alten Weg über den Gletscher gibt es nicht mehr.
Ich aber habe zunächst ein anderes Ziel. Die Villa Cassel steht an der Bergkante auf 2000 Meter über Meer und ist schon von weitem zu sehen. Sie beherbergt heute das Pro Natura Zentrum Aletsch, ein einzigartiges Dokumentationszentrum für das Jungfrau- und Aletschgebiet, ein Weltnaturerbe der UNESCO. Dort will ich herausfinden, was es bedeutet, wenn derjenige, der diese Landschaft ausmacht, sie prägt, sie über Jahrtausende bestimmt hat, langsam verschwindet. Ein Gletscher, der sich von der Jungfrauregion bis zum Aletschwald erstreckt, 22 Kilometer lang ist er noch, aber jeden Tag wird er kürzer, schmilzt dahin mit dramatischer Geschwindigkeit. Dieser mächtigste Gletscher der Alpen, gespiesen vom absterbenden Oberaletschgletscher und anderen kleineren Gletschern, wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts noch ein kümmerliches, geröllübersätes Eisfeld sein. Und das würde sich auch nicht ändern, selbst wenn die Menschheit morgen und von einem Tag auf den anderen keine Treibhausgase mehr ausstoßen würde. Zu diesem Befund kam der Glaziologe Matthias Huss von der ETH Zürich und der Universität Freiburg aufgrund neuester Studien; seine Prognose wurde im Sommer 2017 publiziert, sorgte ein paar Tage lang für Aufsehen, dann gab es wichtigere Ereignisse, über die zu berichten war.
Aber die Villa Cassel, mit ihrer Riegelfassade, den Türmchen und Spitzen, der ausladenden Terrasse, thront über der Riederfurka, als könnte ihr die Zeit nichts anhaben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hielt sich der Bankier Sir Ernest Cassel auf der Riederfurka auf und war vom Anblick des mächtigen Aletschgletschers so ergriffen, dass er beschloss, sich hier einen Zweitwohnsitz zu bauen. Ein Feriendomizil so nahe am Gletscher, dass bei Windstille sein Knarren, sein tiefes Rauschen, sein Brummen zu hören sein würde. Bald gingen in der Villa Cassel die Notabeln aus aller Welt ein und aus, Winston Churchill und andere, Lady Mountbatten residierte in der Villa, und jeden Morgen brachte ein Laufbursche frische Brötchen von Mörel über 1300 Meter den Berg hinauf, damit den Herrschaften beim Frühstück auf der Terrasse nichts fehlte, die Sonne im Gesicht und den Gletscher in Sichtweite.
Heute hat jemand anderer hier das Sagen. Elisabeth Karrer, stellvertretende Leiterin des Pro Natura Zentrums, ist Umweltnaturwissenschaftlerin. Sie begrüßt im einladenden Foyer, vor den Auslagen mit Prospekten für Exkursionen zum und rund um den Gletscher, sie lacht viel, während sie spricht, die kurzen, dunkelblonden Haare fallen ihr ins Gesicht. Wir setzen uns nach draußen an den massiven Tisch, es gibt Tee und Kuchen, und ich halte nach dem Gletscher Ausschau. Aber er ist nicht mehr zu sehen, zwischen den Tannen und Arven geht mein Blick über geschrundete Bergflanken, über Geröllfelder, über nackten Fels.
»Wo ist er?«, frage ich Elisabeth Karrer.
»Eine halbe Stunde talaufwärts, etwas mehr vielleicht, muss man schon gehen, um ihn zu sehen.«
»So viel?«
»Jedes Jahr ein paar Minuten mehr.«
Ich frage Elisabeth Karrer, was ihr diese Präsenz des Gletschers bedeute, was es für sie heißt, den Sommer über in seiner Nähe zu leben. Sie zögert kurz, sagt dann, dass der Gletscher ihr nah sei, man könne auch sagen »ein Familienmitglied«. Oder genauer »ein Freund, ein Vertrauter«, und jedes Mal, wenn sie zu Beginn der Saison hierher hinaufkomme, schaue sie nach, ob er noch da sei, »und ja, er ist noch da«.
»Wenn auch immer etwas weiter weg.«
»Das stimmt, und doch gibt mir seine Anwesenheit ein gutes Gefühl. Gletscher sind jahrtausendealt, das ist eine große Unendlichkeit. Während wir nur ganz kurz da sind, ich gerade mal achtunddreißig Jahre, und deshalb, vielleicht, bin ich ihm zugewachsen: weil er schon so lange da ist.«
»Jetzt verschwindet er langsam.«
»Ja, die Unendlichkeit der Gletscher wird allmählich zu einer Endlichkeit, das stimmt mich traurig.«
Der Gletscher schmilzt als Schmelzwasser davon, weil die mittleren Temperaturen im Alpenraum bereits zwei Grad über dem vorindustriellen Zeitalter liegen. Zwei Grad, weil die mittlere Konzentration an CO2 in der Atmosphäre von 280 Teilchen pro Million Partikel auf aktuell fast 420 gestiegen ist, weil diese Zunahme um 140 parts per million den Treibhauseffekt verursacht; das sind total 36 Milliarden Tonnen pro Jahr, die durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Erdgas zu viel in die Atmosphäre gelangen, den natürlichen Kreislauf von CO2belasten, die Erde in nie dagewesener Geschwindigkeit erwärmen.
Der Aletschgletscher und die großen und kleinen Gletscher in den Alpen und weltweit gehören zu den ersten Opfern dieser Erwärmung.
Dass der Aletschletscher sich zurückzieht, schrumpft, bringt für Elisabeth Karrer und das Pro Natura Zentrum Aletsch neue Herausforderungen. Sie und ihr Team müssen den Besucherinnen und Besuchern erklären, was da draußen vor dem Haus gerade passiert. Dass nichts mehr so ist, wie früher, weil die Hänge rutschen und abbrechen, man muss aufpassen, wenn man auf Wanderungen geht. Dass manches Gebäude heute auf unsicherem Grund steht, weil der Permafrost auftaut, der früher sicheren Halt gab. Dass der Gletscher schwindet und darum eines Tages die Suonen, die jahrhundertealten, kunstvollen Wasserkanäle versiegen werden. Gefährdet sind auch der Tourismus, die Existenz von Hoteliers, von Ferienwohnungsvermietern und Seilbahnen.
Früher konnte man von der Villa Cassel mehr oder weniger direkt zum Gletscher spazieren. Aber seit den Hangrutschungen, die sich an der Ostflanke des Gletschers ereignen, unterhalb der Moosfluh, ist das nicht mehr möglich. Auch hier taut der Permafrost auf, und wenn der Gletscher sich zurückbildet, werden auch die Flanken immer instabiler. »Jetzt«, sagt Elisabeth Karrer, »müssen wir von der Riederalp hinauf über die Moosfluh und von dort hinunter zum Gletscher.« Was früher ein Spaziergang war, ist heute eine Tagestour.
Bei den Gletschertouren, die Elisabeth Karrer organisiert, wird jetzt nicht mehr nur erklärt, dass der Gletscher immer im Fluss ist, langsam fließendes Eis. Man erläutert auch nicht mehr nur, woher die beiden schwarzen Streifen auf dem Gletscher stammen. Man muss auch erklären, wie die Klimaerwärmung vor sich geht, man spricht die Gründe an, warum sich die Gletscher zurückziehen. Die Frage, welche Rolle der Mensch dabei spielt, wird wichtiger denn je.
Elisabeth Karrer ist beeindruckt, wie schnell das alles ging. »Das Rutschgebiet unterhalb der Moosfluh war immer schon in Bewegung, seit vielen Jahrhunderten. Es stand deshalb auch unter Beobachtung, man hat Veränderungen von wenigen Millimetern festgestellt. Aber nun, innert zwei Wochen, waren es plötzlich siebzig Zentimeter, zack. Mittlerweile sind wir bei mehreren Zentimetern pro Tag. Es bricht also ab. Das ist schon beeindruckend, aber gleichzeitig muss ich sagen – das ist die Natur. Sie waltet, verändert, und jetzt reißt sie eben siebenhundertjährige Bäume mit sich.«
Wer still ist, kann es hören, draußen, vor dem Haus. Dann und wann ein Donnern, ein Grollen, abbrechende Felsen.
Der Aletschgletscher, immer öfter blankes Eis, nur noch selten liegt auch im Sommer eine Schneeschicht, er wird eines Tages aussehen wie der Oberaletschgletscher: nur noch Geröll, Felsen, darunter irgendwo noch Reste von Eis.
Wir gehen die Nordflanke der Riederalp entlang, in den Wald hinein. Der Aletschwald, früher Holzschlaggebiet für die Bauern in der Umgebung, ist dank Pro Natura unter Schutz gestellt und darf nur auf den markierten Wanderwegen betreten werden. Wir gehen dem Gletscher entgegen. Unterwegs bleibt Elisabeth Karrer immer wieder stehen. Sie macht auf Veränderungen aufmerksam, zeigt hinüber zu den Hanggletschern, die sich dramatisch zurückgezogen haben. Hanggletscher sind von der Erwärmung des Klimas als Erste betroffen, denn je kleiner die Gletscher, desto schneller schmelzen sie. Elisabeth Karrer zeigt auf die Seitenmoränen, die Schürfungen, die Furchen von früher, als die Hanggletscher noch groß waren und mächtig, der Driestgletscher und die anderen. Überall sind die Schürfungen in der Landschaft sichtbar, dort, wo einst die Zungen der kleineren Gletscher endeten.
Dann sind wir da, am Felsvorsprung, von dem aus man den Aletschgletscher endlich sieht. Zwischen den Bäumen hindurch, aber doch in seiner ganzen Breite, seiner Macht. Er strahlt eine Ruhe aus, eine Erhabenheit, als erzählte hier ein jahrmillionenaltes Wesen seine Geschichte, still, flüsternd.
Wir stehen für ein paar Minuten da, still.
Der Legende nach wurden die Toten, die zu Lebzeiten gesündigt haben, dazu verdammt, auf dem Gletscher auszuharren und langsam, qualvoll ins Eis einzusinken, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg. Ein langer, schmerzhafter zweiter Tod für die armen Seelen, und man höre ihr Geheul und Gejammer, erzählt Elisabeth Karrer, nicht nur dann, wenn der Gletscherwind pfeift.
»Aber was ist, wenn es den Gletscher einmal nicht mehr gibt, wo sollen all die armen Seelen hin?«, frage ich.
»Das wird dann schwierig«, sagt Elisabeth Karrer und lächelt dabei.
Mit dieser unbeantworteten Frage kehre ich zurück ins Tal, mit der Seilbahn hinunter nach Mörel, dann mit der Bahn nach Brig. Auch hier im Tal, wo die Herbstsonne warm an den Fassaden abstrahlt, dickrädrige, hoch gebaute Autos ihr Kohlendioxid in die Luft pusten, wo Betonmauern um die Wette wachsen, auch hier scheint er anwesend, der Gletscher. Besonders in Naters, das halb ein Dorf ist, halb ein Vorort von Brig. Hier befindet sich, in einem kristallförmigen, modernen Bau, das World Nature Forum, das Dokumentations- und Besucherzentrum des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, Informationszentrum und Ausstellung zugleich, und natürlich steht hier der Gletscher im Mittelpunkt.
Mario Gertschen, Informationsbeauftragter des World Nature Forums, hat ein offenes, zugewandtes Lächeln, er trägt Kurzbart, hat dunkle Augen. Er steht vor dem großen Relief im Eingangsbereich, das zeigt, wie weit sich der Gletscher erstreckt, und er gibt gleich zu verstehen, was das World Nature Forum will, nämlich erstens erklären, »was ein Weltnaturerbe ist, wieso gerade dieses Gebiet hier zum Weltnaturerbe ausgerufen wurde«, und zweitens, »warum es sich lohnt, sich für diese Gegend, diese Landschaft einzusetzen«.
Es lohne sich, sagt Mario Gertschen, weil das Aletschgebiet mehr sei als ein Gletscher, mehr als eine Landschaft. Es sei auch ein Kulturraum, mit den vielen Flurnamen, die beim Aufgang über die Treppe aufgeführt sind, Witi-Chummä, Sulzacher, Oberi Wildi, Schluuchfärrich, Bietschi, Ze Steinu und wie sie alle heißen, die dafür stehen, dass sich hier Kultur und Landschaft, Sprache und Klima, Brauchtum und Vegetation zu einem Ganzen verdichten.
Ein Modell zeigt den Aletschgletscher im Querschnitt. Noch immer ist er ganz oben am Konkordiaplatz über 900 Meter dick, ein gewaltiger Eiskoloss, der so leicht nicht davonschmilzt, denkt man sich. Geht man weiter durch die Ausstellung, wird aber vor allem sein Schwinden thematisiert. Schaubilder, interaktive Elemente, dreidimensionale Klimasimulationen, sie alle sollen den Besuchern nahebringen, dass der langsame Tod des Aletschgletschers weitreichende Auswirkungen haben wird. Weil die Gletscher im Wallis wichtige Wasserspender sind, unverzichtbar für die Landwirtschaft, und weil die Gletscher im Alpenraum auch die Flüsse speisen, sind sie für ganz Europa zentral. Weil das Schmelzen der Gletscher den Meeresspiegel anheben wird, dramatisch, und weil Bergstationen, die auf Permafrost gebaut sind, ins Rutschen kommen werden. Weil das alles kosten wird, alle die Schäden in der Landschaft, an der Infrastruktur.
Man kann im World Nature Forum in einem alten Wagen der Jungfraubahn virtuell hinauf zum Jungfraujoch fahren, mitten durch eine animierte Landschaft. In einer eindrücklichen Filmdokumentation kann der Wechsel der Jahreszeiten erlebt werden, hautnah. Man kann spielerisch ermitteln, wie groß unser Fußabdruck auf die Umwelt und aufs Klima ist.
Im besten Fall, sagt Mario Gertschen, komme die Besucherin oder der Besucher zur Einsicht, »dass wir die Naturkräfte überhaupt nicht im Griff haben« und dass so etwas wie Respekt geboten sei. Gut, wenn am Ende der Ausstellung klargeworden sei, dass gerade hier im Wallis der geringe Niederschlag, die steigenden Temperaturen, das fehlende Wasser existenziell seien. Und vielleicht erscheine manchem der Aletschgletscher als ein Opfer des Klimawandels, zugleich aber auch als ein Mahnmal dafür, dass etwas getan werden muss. Beides soll uns daran erinnern, sagt Mario Gertschen, »dass wir die Verantwortung für das gemeinsame Erbe übernehmen müssen«.
Die Frage, die mir auf den Lippen brennt, ich will sie Mario Gertschen noch stellen.
»Was ist mit den armen Seelen, die jetzt auf dem Gletscher langsam versinken, was wird mit ihnen, wenn der Gletscher nicht mehr ist?«
Mario Gertschen überlegt nicht lange und sagt:
»Wenn die Gletscher einmal nicht mehr sind, dann sind auch wir nur noch arme Seelen«.
Gletscher schwinden nicht nur in den Alpen, sondern überall auf der Welt, und die GlaziologInnen müssen ihre Prognosen immer wieder nach unten korrigieren; die Schmelze geht schneller, als die letzte Prognose eben gerade errechnet hat. Neueste Zahlen berechnen den jährlichen Verlust an Eis auf 335 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr, das Abschmelzen der Gletscher (außerhalb von Arktis und Antarktis) hat nicht nur schlimme Folgen für die Versorgung mit Trinkwasser, das geschmolzene Eis dieser Gletscher allein lässt den Meeresspiegel um dreißig Zentimeter steigen. Der Verlust der Gletscher ist kaum aufzuhalten, selbst wenn bis 2050 die weltweiten Treibhausgasemissionen auf netto Null sinken, denn insbesondere CO2 verbleibt bis zu tausend Jahre in der Atmosphäre; die Temperatur nehme dann nicht mehr ab, der Meeresspiegel steige weiterhin, sagt der Klimaforscher Reto Knutti von der ETH Zürich.
Am Meer
Die geflutete Stadt
Der Meeresspiegel steigt. Ein paar Millimeter jährlich, seit Beginn der Industrialisierung sind es etwa zwanzig Zentimeter. Das ist an manchen Orten kaum zu spüren, an anderen aber sind die Folgen dramatisch, nicht nur auf den Inseln der Südsee, die sich nur wenige Meter über dem Meeresspiegel erheben, sondern auch an der Küste Westafrikas. Dort frisst sich das Meer in atemberaubender Geschwindigkeit landeinwärts, das Wasser reißt ganze Dörfer mit sich, es bedroht auch die Stadt Saint-Louis. Aber weder die Stadtverwaltung noch der senegalesische Staat haben die Ressourcen, um etwas gegen den Küstenfraß zu tun.
»Das macht uns Angst, große Angst. Ich spreche hier vor allem vom Meer, und dass es immer näherkommt, und dass Saint-Louis eines Tages von der Karte Senegals verschwindet.«
Der Museumspädagoge und Künstler Ali Ouattara Kébé sitzt beim Centre Culturel Français an einem einfachen Holztisch, er betreut hier eine Ausstellung zur Klimaerwärmung. Ein paar einfache Schautafeln, ein paar Diagramme, sie sollen hier, in einem nüchternen, etwas kahlen Raum am Rande der Stadt Saint-Louis, Schülerinnen und Schüler auf die Gefahren der Klimaerwärmung aufmerksam machen. Draußen vor den abgedunkelten Fenstern fließt ruhig und träge der Fluss Senegal vorbei, auf den Straßen sind hier, im nördlichen Teil der Stadt, auf einer Insel mitten im Fluss gebaut, nur Wenige unterwegs. Das Meer, um das es auch in der Ausstellung geht, ist nicht zu sehen, es liegt hinter der schmalen Landzunge, die den Fluss vom Meer trennt, hinter den eng aneinandergebauten Häusern.
Ali Ouattara Kébé spricht aus, was in Saint-Louis viele denken. Dass die Stadt, die nur von einem schmalen Streifen Land, der Langue de Barbarie, vom tosenden Atlantik getrennt ist, bald einmal vom Meer geflutet werden könnte. Saint-Louis, die ehemalige Hauptstadt der französischen Kolonie Westafrika, einst stolze Kolonialstadt mit einem Wasserflughafen für die Postflugzeuge, die von Paris her weiterflogen übers Meer nach Brasilien, heute ein Magnet für Touristen, die durch die Straßen flanieren und sich an den Häusern im Kolonialstil erfreuen, die nach und nach renoviert werden. Saint-Louis, die Stadt mit einem berühmten Lycée, der Kaderschmiede für die Kolonialbeamten, die von den Franzosen unter den einheimischen westafrikanischen Männern rekrutiert wurden.
Auf der Brücke zwischen der kolonialen Stadt und dem Stadtteil Guet N’Dar:
Linker Hand liegen die Häuser der Altstadt mit ihren filigranen Balkonen, im Erdgeschoss Ladenflächen, Magazine, da und dort auch Paläste. Zwischendrin Ruinen, zerfallende Mauern, der alte Hafen; dort, wo früher die Lastschiffe anlegten, vom Oberlauf des Senegal herkommend, gibt es heute Bars, Restaurants, Tanzflächen, Galerien. Einzig der luxuriöse Flussdampfer Bou el Mogdad, mit dem Touristen den Senegal hinauffahren, in bequemen Kabinen, der ganze Stolz des Hotelbesitzers Jean-Jacques Bancal, legt noch ab und zu an den Hafenmauern an.
Von hier aus starten auch die Touristenreisen ins Landesinnere, ins zweitgrößte Vogelschutzgebiet der Welt an der Grenze zu Mauretanien; dieser Teil der Stadt lebt von den Besuchern, die sich in den Sumpfgebieten am Oberlauf die Pelikankolonien ansehen möchten, die Flamingos, die Krokodile und Warane, die sich träg am Ufer sonnen. Und wer will, kann sich auf dem Platz vor dem Hotel des Aviateurs ein Taxi nehmen, um sich flussabwärts zu einem der vielen luxuriösen Campements fahren lassen, Bungalowsiedlungen in stillen, stilvollen Arrangements, mit Blick aufs Wasser.
Anders rechter Hand, zum Meer hin: Dort liegt das lebendige, dicht besiedelte Guet N’Dar, es quillt förmlich über, in den Gassen ein Gewirr von Menschen, Eselskarren, Lastwagen, und in den Querstraßen die bunt bemalten Fischerboote, die Pirogen. Unter der Brücke hindurch kehren sie heim, einige nur halb, viele aber prall gefüllt mit dem Fischfang der vergangenen Nacht. Große Sardinen, Goldbrassen, Makrelen, Thunfische, manche Boote haben eine Nacht auf hoher See verbracht, andere eine Woche, viele noch länger. In Guet N’Dar dreht sich alles um die Fischerei.
Mokhtar Fall, das Gesicht gegerbt, tiefe Furchen unter den Augen, ledrige Hände, zeigt mir, wie die Pirogen gebaut sind. Wir befinden uns unten, am Flussufer, zwischen Fischerhütten, den Körben für den Fang, Plastikabfall und streunenden Hunden. Er erläutert, wie die Planken mit Werg und Teer abgedichtet werden, er zeigt die traditionellen Kästen, in denen der Fisch auf hoher See aufbewahrt wird, die Netze, die Leinen mit den Haken für den Thunfischfang. Mokhtar Fall kennt sich aus, er fährt auch mit sechzig Jahren noch immer zur See, er weiß genau, wie viele Pirogen es gibt in Saint-Louis, viertausendsechshundertachtzig. Fast alle liegen sie hier am Ufer des Flusses Senegal, wo auch die Kühllastwagen bereitstehen, um den Fisch ins Hinterland und bis nach Burkina Faso zu transportieren.
Aber viele Pirogen stehen auch mitten auf der Straße in Guet N’Dar, versperren die Gassen zum Meer hin.
Früher lagen sie am Strand, in mehreren Reihen, es gab viel Platz. Noch in den Siebzigerjahren, erzählt Mokhtar Fall, gab es eine Straße zwischen den Pirogen, die am Strand lagen, und den Häusern von Guet N’Dar. Und seine Großmutter habe ihm erzählt, dass sie als Kind eine halbe Stunde gehen musste, um von ihrem Haus bis zum Meer zu gelangen, so breit sei der Strand gewesen.
Wer heute im Quartier Guet N’Dar am Meer steht, sieht nur noch einen schmalen Streifen Strand, darauf ein paar kleine Pirogen. Nordwärts ist der Strand ganz verschwunden, die Wellen schlagen direkt an die Häuser, die behelfsmäßig und rasch errichteten Barrieren aus Holz bringen nichts. Nur zwei Monate sei es her, erzählt Mokhtar Fall, da habe die Stadtverwaltung ein paar hundert Bewohner im Quartier Gorum Mbathie umsiedeln müssen, hinüber ins Festland, weil ihre Häuser ins Meer zu stürzen drohten.
Um bis zu einen Meter pro Jahr, sagen Beobachter, sei das Meer vorangeschritten.
Die Fischer fahren mit ihrem Fang nun länger schon durch eine Öffnung, die vor Jahren in die Langue de Barbarie geschlagen wurde, sie legen am Fluss an statt, wie früher, am Strand. Die Öffnung entstand, weil man einen kleinen Kanal zwischen dem Fluss und dem Meer bauen wollte, als Abfluss im Fall eines Hochwassers. Doch aus dem kleinen Kanal, der einst nur vier Meter breit war, ist inzwischen eine Lücke von achtzehn Kilometern geworden, das Meer hat binnen Wochen ganze Dörfer einfach weggespült. Wo früher die Langue de Barbarie Fluss und Meer trennte, türmen sich heute die Wellen, und die Fischer riskieren Kopf und Kragen, um mit ihren schlanken Pirogen da durchzukommen. Sie haben keine andere Wahl.