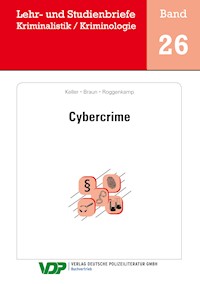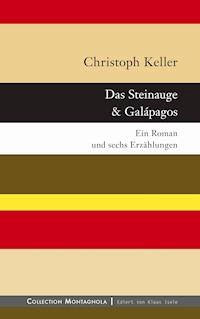19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit siebzehn Jahren versteckt sich Leo auf der Sandinsel in der Flensburger Förde. Nur im Oktober verlässt er sie, um seinen jährlichen Mord zu begehen. Er tötet Menschen, die der Welt Schaden zufügen und vom Elend anderer profitieren wie der Katastrophenkapitalist A. J. Hicks. Als Leo von seinem jüngsten Mord auf die Sandinsel zurückkehrt, erwartet ihn Thea. Sie ist die Tochter seines vierzehnten Mordopfers, eines Mannes, der einst dafür sorgte, dass der seltene blaue Sand von der Insel verschwand. Thea ist fest entschlossen, ihren Vater zu rächen. Doch je mehr sie in den Sog der magischen Sandinsel gerät, umso mehr kommt ihr Plan ins Wanken. Poetisch und mit viel Witz erzählt Christoph Keller von zwei Menschen, die angesichts der Klimakatastrophe Ungerechtigkeiten radikal bekämpfen und sich dabei ständig fragen: Muss man nicht töten, wer der Welt so viel Leid zufügt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Seit siebzehn Jahren versteckt sich Leo auf der Sandinsel in der Flensburger Förde. Nur im Oktober verlässt er sie, um seinen jährlichen Mord zu begehen. Er tötet Menschen, die der Welt Schaden zufügen und vom Elend anderer profitieren wie der Katastrophenkapitalist A.J. Hicks.
Als Leo von seinem jüngsten Mord auf die Sandinsel zurückkehrt, erwartet ihn Thea. Sie ist die Tochter seines vierzehnten Mordopfers, eines Mannes, der einst dafür sorgte, dass der seltene blaue Sand von der Insel verschwand. Thea ist fest entschlossen, ihren Vater zu rächen. Doch je mehr sie in den Sog der magischen Sandinsel gerät, umso mehr kommt ihr Plan ins Wanken.
Poetisch und mit viel Witz erzählt Christoph Keller von zwei Menschen, die angesichts der Klimakatastrophe Ungerechtigkeiten radikal bekämpfen und sich dabei ständig fragen: Muss man nicht töten, wer der Welt so viel Leid zufügt?
Foto Ayşe Yavaş
Christoph Keller, geboren 1963, ist der Autor zahlreicher preisgekrönter Romane, unter anderem «Der beste Tänzer», «Der Boden unter den Füssen» und «Jeder Krüppel ein Superheld». Zuletzt hat er im Limmat Verlag herausgegeben: «Und dann klingelst du bei mir. Geschichten in Leichter Sprache». Keller, der über zwanzig Jahre in New York gelebt hat und mit der amerikanischen Lyrikerin Jan Heller Levi verheiratet ist, schreibt auf Deutsch und Englisch. Er lebt in St.Gallen.
CHRISTOPH KELLER
BLAUER SAND
ROMAN
für Jan
But islands can only existIf we have loved in them.Derek Walcott, «Islands»
The avenging heroes are now being dreamt up and awaited.They are already feared by the pitiless and blessed by me and maybe you.John Berger, «Keeping a Rendezvous»
An island is one great eyegazing out, a beckoning lighthouse,searchlight, a wishbone compass,or counterweight to the stars.Yusef Komunyakaa, «Islands»
INHALT
ISLA MÁS A TIERRA DIE OCHSENINSEL
ANKUNFT
LIVS BUDE
DAS KRABBENRITUAL
KNALL
ÜBERFAHRT
DER BUNKER
SOPHIE CALLE
DIE ERZÄHLUNG DER SANDINSEL
ENDLICH SCHLAF
MANHATTAN GIBT ES NOCH
ISLA FANTASMA DIE SANDINSEL
I (12.–13. OKTOBER)
II (14.–17. OKTOBER)
III (22. OKTOBER)
TERRA
ANKUNFT
UTOPIA
NACHWEISE
ISLA MÁS A TIERRADIE OCHSENINSEL
ANKUNFT
Die Sandinsel ist die zweite und größte der vier Inseln, die den Fast-beim-Festland-Archipel bilden. Die kleinste heißt Ochseninsel, darauf befinde ich mich. Die Überfahrt auf die Sandinsel, die nur über die Ochseninsel zu erreichen ist, dauert achtzehn Minuten. Der Kutter fasst zweiundzwanzig Passagiere und fährt erst los, wenn diese Zahl erreicht ist und sich jemand bereit erklärt, das Steuer zu übernehmen. Die Fährfrau macht Liv schon lange nicht mehr.
Auf dem Kutter steht in ungelenken Buchstaben «Krake», was aber noch niemanden davon abgehalten hat, überzusetzen. Kaum jemand, der sich hier einfindet, dürfte wissen, dass ein Krake ein achtarmiger Tintenfisch mit drei Herzen ist, ein mit Saugnäpfen ausgestatteter Kopffüßler, dessen mythische Version mit sich in die Tiefe zieht, worauf sie Lust hat. Ich weiß es, ich habe mich auf diese Reise vorbereitet. Aber ich werde mich von keinem Kraken in die Tiefe ziehen lassen. Ich bin der Krake.
Wer auf die beiden anderen Inseln – die Seeräubermöweninsel und Juan-Fernández – will, muss sich seine Überfahrt vom Festland her selbst organisieren oder für das dänische Nationalparkprogramm arbeiten, zu dem der Archipel seit einigen Jahren gehört. Liv sagt, die Parkleute ließen sich nie auf ihrer Insel blicken. Ihre Bude dürfte eigentlich nicht in einem Nationalpark stehen, man habe aber ein Auge zugedrückt, weil sie schon da war, bevor es dem Nationalparkprogramm einfiel, sich die Inseln einzuverleiben. Auch, weil ihre Bude von nationaler Bedeutung sei. Auflage: Nichts dürfe angebaut, nichts verändert werden, nach Liv sei dann auch die Bude zu.
Das ist ihr recht. Was sich auf den anderen Inseln ereignet, bekommt sie auf der Ochseninsel nicht mit. Der Fast-beim-Festland-Archipel, «Nærfastlandsøhavet» auf Dänisch, ist das Stiefkind der dem Umweltministerium unterstellten Naturbehörde. Vieles von dem, was mir Liv erzählt, weiß ich bereits. Wenn sie abrupt schweigt, als wolle sie die nächsten Wörter nicht aus dem Mund fallen lassen, könnte ich ihren Satz weiterführen. Ich tue es nicht, es würde sie verletzen.
Die Inseln hüpfen vom Festland in die Flensburger Förde wie ein flach geworfener Stein. Von weit oben betrachtet könnte man sie für eine kleine Entenkarawane halten. Für mich sind sie Wolken.
Ein neuer Vulkan ist aufgebrochen …
Meine Insel scheint
eine Art Wolkenhalde zu sein. Alle übrig gebliebenen
Wolken der Hemisphäre sind eingetroffen und hängen
über den Kratern –
Diese Zeilen habe ich vor meiner Abreise in mein Notizbuch, in dem ich Gedichte sammle, eingetragen und bin jetzt überrascht, wie treffend sie sind.
Papa, dem die Zivilisation immer weniger zu bieten hatte und der mir schon früh beigebracht hat, unsinnige Regeln – seiner Meinung nach also die meisten – zu ignorieren, nahm mich manchmal auf eine seiner abenteuerlichen Reisen mit. Diese waren oft auf kleine Passagierflugzeuge mit spritfressenden Motoren angewiesen, und da hockte ich dann erstarrt und fasziniert, die Hände um die Knie geschlungen, in einem laut scheppernden geflügelten Vehikel. Aus Hunderten von Metern Höhe schaute ich sehnsüchtig auf das Blau des Wassers hinunter, aus dem die Inseln magisch auftauchten. Wolken, alle waren sie für mich Wolken! Immer wieder bat ich Papa, mit seinem Flugzeug kopfüber zu fliegen. Manchmal tat er es, und schon waren die Inseln wirklich Wolken.
Von oben habe ich die Inseln in ihrer wahren Gestalt gesehen. Die eine ist eine Kaulquappe, eine andere eine Schlange. Eine, Rapa Iti zum Beispiel, die zu Französisch-Polynesien gehört, ist ein Seepferd, die da eine Kröte, die gleich weiterhüpfen wird. Ich habe eine gesehen, die wie ein Fußabdruck daherkommt, ich kenne eine herz- und eine sichelförmige und eine – drei eigentlich (die malaysischen Inseln Manukan, Mamutik und Sulug) –, die das Smile-Emoji vorausgeahnt haben. Ich weiß um die Schönheiten der Inseln – wer nicht? –, aber auch um ihre Gefahren, vor denen sie uns so deutlich und so vergeblich warnen. Klippen schroff und steil wie die Schwarzbruderklippe der Sandinsel, Strudel, die ein wackeres Schiff mit der Gier eines Kraken versenken, Inseln, die sich zur Abschreckung ihr eigenes Klima geschaffen haben oder ein Nebelmeer bilden, in dem sie untertauchen. Die Sandinsel hat es mit blauen Sandstränden versucht und damit das Gegenteil erreicht, weil sie mit ihrem Wunder zu viele angelockt hat.
Die Ochseninsel misst nullkommaacht Quadratkilometer, ist zwei Kilometer lang und achthundert Meter breit. Der Mittelstreifen ist von einem lockeren Fichtenwald bewachsen, die Längsufer sind felsig und als Strände ungeeignet. Die Insel ist flach – an der höchsten Stelle zwölf Meter über Meer – und liegt so nah am Festland, dass man zu ihr hin waten könnte. Das ist aber nicht nötig, denn es gibt eine schmale Holzbrücke, die von Wanderern, Radfahrern und immer wieder Rudeln von Bikern benutzt wird.
Das Parkplatzproblem lösen diese, indem sie ihre kolossalen Motorräder zwischen den Bäumen parken, sodass sich zu Hochbetriebszeiten mehr Räder als Bäume auf der Insel befinden. So wird der Fichtenwald zum Räderwald, der im Licht dunkel funkelt, ein verwundetes Tier, das losröhrt, sobald ein Gast auftaucht. Liv ist überzeugt, dass es deshalb auf der Ochseninsel keine Vögel mehr gibt. (Ochsen gab es hier nie.) Schon lange hat sie kein Zwitschern mehr gehört. Sie vermisst es. Aber noch mehr würde sie ihre Bude vermissen, die auf die Biker angewiesen ist.
An Tag eins meiner Anwesenheit besuchte sie mich dreimal in meinem Zimmer. Der Aschenbecher, den ich sie zu entfernen bat, glitt ihr aus der Hand. Sie stolperte ohne Anlass und konnte sich gerade noch aufs Bett werfen. Als sie meinen Namen sagen wollte, brachte sie nur ein Schlucken zustande. Manchmal lacht sie laut heraus, auch wenn es nichts zu lachen gibt. Ich mag ihr Lachen.
Mich verwundert, wie viel, ruhig und traumlos ich hier schlafe. Etwas hat Liv klar gemacht, dass ich an meinem zweiten Tag in ihrer Bude nicht gestört werden wollte. Durch die dünnen Wände hörte ich ihre Schritte, bis mir die Vertrautheit, die sich einzustellen begann, gespenstisch wurde und ich mir die Ohren mit Watte zustopfte.
Tag drei, also heute, benutze ich, um mein Vorhaben Stufe für Stufe mit geschlossenen Augen zu visualisieren, wieder und wieder lasse ich die Bilder im Kopf ablaufen. Ich rufe meine Schwester von einem Wegwerfhandy an, das ich gleich danach zerstöre, und sage ihr, es sei alles in Ordnung, was es nicht ist. Ich lese in meinem Gedicht-Notizbuch:
Schaut, wie ich sitze
wie ein an Land gezogener Kahn.
Hier bin ich glücklich.
Ich schlendere zum Steg hinunter, schaue von der Ochseninsel aus zu, wie die Sandinsel ihren Anker lichtet und in die Dämmerung davontreibt.
Ein paar sesshafte Tage tun mir gut. Meine Hände sind ruhig, mein Herz ist es auch. Sogar meine Gedanken wirbeln weniger durcheinander.
Ich bin schon lange unterwegs, zu nomadisch selbst für meine Verhältnisse. Mit dem Schiff, der Eisenbahn, dem Rad, zu Fuß. Nirgendwo bleibe ich länger als einen Tag, höchstens zwei. Ich will von nichts eingeholt werden. Dabei habe ich, was ich auf meinem Körper tragen kann, meinen purpurnen Rucksack und die Kreditkarte, die mir Papa einst gegen meinen Willen auf meinen Namen ausgestellt hat. Ich benutze sie, man kann mich also aufspüren. Noch sucht man mich nicht. Erst wenn ich mein Vorhaben ausgeführt habe, werde ich die Kreditkarte zusammen mit meinem Reisepass und den anderen mich identifizierenden Dokumenten entsorgen. Ich werde verbrennen, was brennbar ist, zertrampeln, was meine Schuhsohlen vermögen. Die Chips, den Plastik und was von meinem Handy unzerstörbar ist, werde ich in die Strahlenschutzhülle packen, die ich zu diesem Zweck dabeihabe und durch die sich auch die gefräßigsten Fische nicht beißen können. Dann werde ich alles in der Förde versenken.
Die letzte Strecke meiner Reise bin ich auf einem Fahrrad gekommen, das ich in Flensburg gemietet habe. Über Feldwege bin ich geradelt, entlang dem Wasser, unter Bäumen hindurch, am wild blühenden Raps vorbei. Einmal gab ich dem Drang, gelb zu werden, nach. Ich warf das Rad an den Wegrand und rannte durch das Rapsfeld. Ich fuhr mit den Händen in die Luft, sang aus voller Kehle. Ich zog am Wasser vorbei, an mir zogen Kähne vorbei. Von Süderhaff waren es noch fünf Minuten bis zur Brücke, die mich auf die Ochseninsel brachte.
Autos sind auf der Ochseninsel nicht geduldet. Wer es dennoch wagt, in einem über die Brücke, die dafür nicht gebaut ist, auf die Insel vorzudringen, wird mit Schrot verjagt. Dieses Verbot gilt auch für die einzige Bewohnerin der Insel. Liv zieht alles, was sie braucht, wie ein Maultier auf einem Schlitten zu ihrer Bude. Es würde auch einfacher gehen, doch sie braucht dieses Bild von sich, die schleppende, von nichts und niemandem abhängige Frau. Mir sagt ein weniger machohafter Feminismus mehr zu.
Auf die Brücke, die Jens, ihr Budenpartner, kurz vor seinem Ableben «Livs Brücke» getauft hat, folgt ein ausgetretener Fußpfad, der sich durch den zerzausten Fichtenwald schlängelt und hinter Livs Bude endet. Für die eingeweihten Biker ist es Ehrensache, bei der Anreise in der rechten, bei der Abreise in der linken von Livs tiefen Kufenspuren zu fahren.
«Bude» ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck für das, was Liv aufgebaut und ein Vierteljahrhundert lang über Wasser gehalten hat.
Es ist ein Schmuckstück, habe ich ihr gleich bei meiner Ankunft gesagt.
Wir haben uns zur Begrüßung auf die Wange geküsst, wie gute Bekannte, obwohl sich herausstellte, dass diese schleimige Zeremonie weder zu ihrem noch zu meinem Charakter passt. Seither zerbreche ich mir den Kopf darüber, wer damit angefangen hat, ich oder sie. Beide taten wir etwas, das wir nicht wollten. Beide können wir nicht mehr damit aufhören. Warum? Genauso gut könnte ich mich fragen, welche Bedeutung das Blau ihres zu langen, unpraktischen Rocks hat. Tatsächlich verfing sich ihr linker Fuß in dessen Saum, sodass sie bereits bei unserer ersten Begegnung beinah gestürzt wäre. Dieses erste Mal konnte sie sich gerade noch an meinem Arm festhalten. Sie hielt ihn lange, ein bisschen zu fest. Immerhin hatte dieses Stolpern eine Ursache gehabt.
Eine Bude soll kein Schmuckstück sein, hat Liv erwidert. Außerdem wären die Biker nie gekommen, hieße sie «Livs Schmuckstück».
Ich lachte und legte meine Hand auf ihre Schulter. Schon online hat mich Liv fasziniert. Auf der Website ihrer Bude findet sich eine gute Auswahl von Ansichten, was einen erwartet, alle mit der stolzen, prallen Liv darauf. Liv Uland, eine sonnen- und windgegerbte siebenundfünfzigjährige Dänin mit finnischen Wurzeln. Alleinbesitzerin von Livs Bude, seit ihr Geschäftspartner Jens vor drei Jahren gestorben ist. Liv ist auch die Einzige, die für ihren Betrieb arbeitet. Sie organisiert von der Nahrungsbeschaffung bis zur Buchführung alles. Was sie an einem Arbeitstag nicht angeschleppt hat, gibt es an diesem Tag nicht, da kann es noch so lange auf der Speisekarte stehen. Was sie bis zum Ende des Jahres nicht geschafft hat, geschieht nicht mehr, und sei es die Steuerrechnung. Die Biker des Clubs Fünen kommen jeweils mit Proviant, Würsten, allerlei Dosen, Bier, für das sie in der Bude bezahlen, obwohl sie es selbst gebracht haben. Liv genießt in Dänemark einen Sonderstatus.
Livs Bude verfügt über eine Drinnenbar und eine Draußenbar. Liv hat sie so getauft. Die Draußenbar ist nicht bestuhlt oder betischt. Wer sitzen will, schnappt sich einen der Faltstühle, die hinter der Bude herumliegen, die meisten hocken sich mit ihrem Bier hin, spielen mit ihrer Zunge im Schaum, mit den Zehen im Sand. Wer unbedingt einen Tisch haben muss, holt sich einen der drei, die Liv hinter ihrer Bude deponiert hat.
Die bestuhlte Drinnenbar ist auch ein kleines Sandinselmuseum. Die Wände sind dicht behängt mit den Fundstücken, welche die Inselfahrer Liv von der Sandinsel zurückbringen, unter anderem Muscheln, ein kantiges Stück Wellblech, ein polierter goldener Sextant (in der Tat ein Museumsstück), ein Taschengeigerzähler, Schafsknochen, ein einziges Einmachglas mit dem legendären blauen Sand der Sandinsel, mehrere Exemplare der National Geographic-Ausgabe mit Nick Stahls Artikel, der für einen solchen Ansturm auf die Sandinsel gesorgt hat, dass von diesem blauen Sand nichts mehr übrig ist, Federn der indigenen Seeräubermöwen, ein Bronzespeerspitz, eine amerikanische Ehrenmedaille, ein Schildkrötenpanzer, eine Glock, Dynamitstangen, die englischsprachige Taschenbuchausgabe von John Bergers Keeping a Rendezvous, die Krallen eines Tiers, von dem niemand weiß, was es ist, vielleicht ein Insel-Yeti oder ein Archipel-Bigfoot.
Liv hat nie jemanden um ein Fundstück gebeten. Sie haben sich mit dem außer Kontrolle geratenen Ruhm der Sandinsel, der bald auch ihre Bude erfasst hat, von selbst eingestellt. Sie sind Eingeständnisse des schlechten Gewissens, das die Inselfahrerinnen beim Verlassen der Sandinsel befällt. Weil sie letztlich wegen eines Artikels, eines Fotos von einem Strand mit blauem Sand, das jemand im Internet gepostet hat, hier sind?
Schande über sie. Die ersten Monate des Ansturms auf die Sandinsel, also auch auf die Ochseninsel, waren unerträglich. Mehr und mehr Leute kamen, stürmten ihre Bude, stürmten den Kutter. Trampelten auf der Sandinsel einen Pfad, kletterten oder schwammen zu den schwer zugänglichen Stränden, füllten ihre Einmachgläser mit blauem Sand, ließen sich ihre Biergläser füllen. Beinah hätte Liv aufgegeben. Wohin wäre sie gegangen? Wem die Bude übergeben? Wer hätte die Inseln geschützt?
Mittlerweile sind neben den Bikern diese modernen kreuzfahrenden Plünderer ihre treuesten Gäste. Sie verbreiten die Kunde von Livs Bude weltweit. Immer wieder taucht sie in den Medien auf. Immer mehr kommen von immer weiter her. Sie wissen immer weniger, weshalb sie eigentlich kommen, doch kommen müssen sie, als hätten sie sich an den Fotos angesteckt.
Schuld an allem ist Nick Stahl, der Mann, der die Fotos von dem blauen Sand geschossen, der den Artikel über die Sandinsel geschrieben hat.
Nick Stahl, mein Vater.
Vom Bootssteg, über den Livs Bude auch verfügt, sehe ich in der Dunkelheit gerade noch die unwegsamen Umrisse der weiter westlich gelegenen Sandinsel. Sie ist umgeben von der Flensburger Förde. Jenseits davon befindet sich die ferne, auch bei Tag schwer erkennbare Linie des Strandbads von Glücksburg. Ich sehe das alles in der Dunkelheit vor mir, weil ich mir so viele Bilder angeschaut habe. Auch ich bin wegen eines Fotos hier. Eines, das ich machen will.
Morgen ist es so weit. Morgen setze ich über.
Über Nacht wird es stürmen, sagt Liv.
Was für ein schöner kleiner Satz: Ich setze über.
Der Kutter ist zu groß für den verlotterten Holzsteg. Das ist Livs Rache – oder vielmehr ihre Hoffnung, dass die Menschenschlange, die täglich hier anlandet, dereinst mitsamt dem Steg im Wasser versinkt, worauf der ganze Spuk wieder vorbei wäre.
Am Boot hänge ich mehr als am Steg, sagt sie.
Außerdem sinken Kraken nicht, entgegne ich.
Es sei denn, sie wollen es, sagt sie.
Und in die Tiefe reißen, was nicht hierhergehört, entgegne ich.
Wie ich ist auch Liv wählerisch in ihrer Menschenliebe. Die Bedingungen, damit wir andere zumindest ertragen, sind, dass sie wieder gehen, sich einander und unserem Planeten gegenüber anständig verhalten. Diese Kriterien erfüllen immer weniger. Das hat dazu geführt, dass wir beide schon lange lieber allein unterwegs sind. Ich bin zwanzig Jahre jünger als Liv, kann meine Bedürfnisse dank meines Nomadendaseins leicht abarbeiten. Bei Liv stelle ich ein Aufflackern fest, das ich auf meine Gegenwart zurückführe. Ich sehe, wie es sich einstellt, wenn ich auf sie zugehe, stelle mir vor, wie es erlischt, sobald ich ihr den Rücken zuwende.
In meinem Leben hatte ich Papa, eine gute (rein platonische) Beziehung, deren elendes Ende ich mitverschuldet habe, und ein paar kompensatorische Geschichten, von denen ich lieber schweige. Liv hatte Jens, ihren väterlichen Freund, den der Knochenkrebs geholt hat. Jetzt lieben wir beide hemmungslos in der Erinnerung, in dem Ideal, welches sie lebend nie verkörperten. So gesehen würden wir, trotz unserer unterschiedlichen Lebensläufe, zusammenpassen.
Liv aber, obwohl sie meine Gegenwart sucht, hat etwas anderes im Sinn. Sie hat Amyotrophe Lateralsklerose, also als, wie sie mir bei einem Bier auf meinem Zimmer fast fröhlich erzählt hat.
Daher rühren die Ungeschicklichkeiten, die du beobachtet hast, sagt sie und lacht laut heraus.
Ich bleibe stumm. Dieses Lachen gehört ihr allein.
Die bald schlimmer, viel schlimmer werden, fährt sie fort, mich auf eine Weise töten werden, für deren Grausamkeit sich die Natur schämen sollte. Gut so, eine weniger. Ich habe es verdient, lebe zwar selbst nachhaltig wie eine Neandertalerin, habe aber in meinen zweiundvierzig Jahren auf der Ochseninsel Millionen von Naturvergewaltigern angelockt.
Meine sündige Inselheilige, sage ich.
Intimer sind wir nicht geworden. Mehr will ich nicht, mehr kann ich nicht.
als, ihr grausam langsames, grausames Absterben ist es, was Liv die Menschen in solchen Scharen aushalten lässt. Was sie davon abhalten wird, es mir nachzutun, alle Stricke zum Festland zu kappen und plötzlich vaterseelenallein weiterzusegeln. Hätte ich als, wäre ich auch geblieben, wo ich war. Ich hätte nicht mit diesem Nomadisieren angefangen. Es gibt keine befriedigendere Form von Einsamkeit als eine tödliche Erkrankung. Wie lange sie noch selbständig auf der Insel bleiben kann, weiß sie nicht.
Ich habe vorgesorgt, sagt Liv.
Betreutes Wohnen auf dem Festland, sage ich.
Dynamit auf der Ochseninsel, sagt Liv.
LIVS BUDE
Bei Liv gibt es die besten Hotdogs der Welt. Sie gewann 2010 die dänische Hotdog-Meisterschaft, im selben Jahr, als Prinzessin Mary ihrer Bude einen Besuch abgestattet und damit kurz für weniger Biker, aber insgesamt viel mehr Inselfahrerinnen gesorgt hat. Im zweiten von Livs zwei Gästezimmern bin nun ich. Lange werde ich nicht bleiben, obwohl es mir recht wäre. Ich verlängere die Reservation meines Zimmers jeden Morgen um einen weiteren Tag, so dehnt sich meine Zeit noch intensiver als die pandemische. Ich werde es auch morgen tun, obwohl ich übersetzen will. Ich gebe es zu, ich zögere. Es macht mir weniger Sorgen, was aus mir werden wird, als was ich schon bin.
Ich denke an Liv, an ihre grausame Krankheit. Vor allem denke ich an die vielen Stunden meines Lebens, in denen ich mir wegen Kleinigkeiten die Zeit vergiftet habe. Katzenallergie, Bindehautentzündung, die hartnäckigen Hustenattacken, die mir meine späten Teenagerjahre zusätzlich erschwerten. Am meisten setzt mir meine Neurodermitis zu, entzündete Hautflächen, die plötzlich auftauchen, wie Feuer brennen und ebenso plötzlich wieder verschwinden. Überreaktionen eines modernen Körpers. Auch dass das Virus mich schließlich erwischt, gleich zu Beginn der siebzehnten Welle, mich physisch ausgelaugt hat wie die pralle Sonne einen Apfel, mich seelisch (ich glaube an die Seele) ausdörrte – das alles ist nicht mit dem zu vergleichen, was Liv durchmacht. Schon gar nicht mit dem, was noch auf sie zukommt.
Und besser
schaust du einer Inselfrau nicht ins Auge –
es sei denn, du magst es, überflüssig zu sein.
Das eine Fenster meines Zimmers geht auf den Wald hinaus. Fichtenstämme und Motorräder. Der Wald ist licht. Stets treffen die Scheinwerfer auf geparkte Motorräder, Chrom blitzt auf, jagt mir, stehe ich zu nah am Fenster, kleine Blitze wie Aale durch die Augen, die sogleich zu tränen anfangen. Mittlerweile erschreckt mich das nicht mehr. Ich habe mich daran gewöhnt, dass mich häufig eine meiner Unpässlichkeiten heimsucht.
Bei meinen Ärztinnen weiß ich im Voraus, was sie sagen werden. Die jüngeren sehen verlässlich die Schuld bei dem, was wir mit unserer Umwelt anstellen, die älteren, deren Kinder und Portfolios schon aus dem Gröbsten heraus sind, retten sich ins Genetische. Selten überrascht mich eine mit einer neutralen Diagnose.
An die unheilvolle Ruhe, die der Abwesenheit von Vogelgezwitscher geschuldet ist, kann ich mich nicht gewöhnen. Die gehört in einen Horrorstreifen, einen, den ich gern einmal wieder in einem dunkeln, halb leeren Kinosaal sehen würde. Hier aber herrscht die Dauerruhe vor dem Sturm. Doch wird es möglicherweise keinen Sturm geben. Nur die Ruhe davor. Und die Ahnung, dass dies schlimmer ist.
Das zweite Zimmer befindet sich auf der anderen Seite der Bude. Weil es keine gemeinsame Wand gibt, gibt es auch keine Verbindungstür. Ich frage mich, ob ich hören kann, was dort vor sich geht.
Hier ist alles, was ich in meinem Rucksack seit fünf Monaten mit mir herumtrage: ein zweites Set Kleider, zwei Zahnbürsten, zwei Kämme, ein bislang unangetastetes Makeup-Notfallset, Binden, eine Monatsration Wellbutrin, extrastarke Ambien, extrastarkes Klebband, eine Wasserflasche, eine Yogamatte, eine Regenhaut, Äpfel (die ich ersetze), ein Pfefferspray, Seile, eine Taucherbrille, ein zweites Paar Sneakers, Handschuhe, ein Set Mundmasken, Banknoten, ein paar Münzen, der alte Stechzirkel, den Papa mit auf seine Reisen genommen hat und den nun ich immer dabeihabe, mein Notizbuch, in das ich, seit ich vier Jahre alt bin, von Hand meine Lieblingsgedichte eintrage, Sophie Calles Buch L’Hôtel, mein ausgeschaltetes, jedoch stets aufgeladenes Smartphone plus Akkukabel, die erwähnte Strahlenschutzhülle, ein Selfiestick mit Stativ, ein Foto, das Papa, mich und meine ältere Schwester auf der Vulkaninsel Stromboli zeigt, Mamas letzter Brief, eine Packung Kaugummi, eine Packung Hustenbonbons. Am Boden des Rucksacks haben sich feine Kiesel und ein bisschen Sand angesammelt.
Erzähl mir von Cavour, sage ich.
Ich bin vom Steg zurück und setze mich zu Liv. Am Wasser habe ich gewartet, bis es dunkel geworden ist. Ich war auf Dunkelheit gefasst, nicht aber auf Finsternis, glänzt und glitzert doch auf dem Wasser immer etwas. Nicht an diesem Abend. Das ist umso erstaunlicher, da hinter mir Lichtquellen sind: Livs leuchtende Bude, Leuchter an den Wänden, Kerzen auf den Simsen, nervöse Touristentaschenlampen, im Wald ein verlorener Motorradscheinwerfer. Als erhebe sich vor dem Wasser eine Wand: zu keinem Kompromiss bereite Schwärze. Geleerte Welt, gerettete Welt. Die Insel, die ich auftauchen sah, ist wieder weg. Unterwegs. Hat alles Licht mitgenommen. Hat sie auch Cavour mitgenommen? Meine Finsternis, mein Fürst. Der meinem Leben das Licht genommen hat. Mir ist beim Gedanken, auch nur eine Nacht auf der Sandinsel zu verbringen, nicht geheuer. Keine Geräusche im Fichtenwald der Ochseninsel, kein Licht im Wasser um die Sandinsel.
Seinetwegen bist du hier, Thea, sagt sie.
Seinetwegen bin ich hier, Liv, sage ich.
Wir sitzen in der Drinnenbar. Hier sind wir allein unter Bikern, über unseren Köpfen ein zerbeultes Nebelhorn, das auch ein Inselfahrer angeschleppt hat. Es gelingt mir nicht, mir Cavour mit einem Nebelhorn vorzustellen. Obwohl Liv und ich erst zum zweiten Mal hier sitzen, ist es schon unser Tisch. Über unsere Bierkrüge hinweg sehen wir die borstigen Gesichter der Gäste, alles Männer. Es ist der Mitgliederabend des Biker-Clubs Vendsyssel-Thy. Fassrunde, bleichhäutige, exzessiv tätowierte Typen. Die Tätowierungen sind überraschend mädchenhaft. Nicht die Totenschädel, Rattengiftwarnungen, blutenden Äxte, die ich erwartet hätte. Vielmehr rote Röschen, Herzchen, Liebesfunken sprühende Fischweibchen. Zerbrechliche Wesen, diese Feierabendkrieger. Ich schließe sie in mein Herz, möchte sie näher kennenlernen, doch dazu wird es nicht kommen. Ich spucke in den Aschenbecher, Liv versteht mein widersprüchliches Signal. Wir flüstern nicht, reden aber beide unnötig leise. Mir ist nach Kriegsgeheul, nach einem Wikinger-Tattoo. Bislang habe ich mein Leben ohne Hautschmuck verbracht.
Ich weiß nichts von ihm, sagt Liv.
Ein angebissener Apfel zuckt aus ihrer Hand, rollt über den Tisch und fällt zu Boden. Sie versucht nicht mehr, den Vorfall zu verbergen. Ich versuche nicht mehr zu verbergen, dass ich es mitbekommen habe. Niemand bückt sich nach dem Apfel. Wir schauen uns an.
Nicht einmal, wie er aussieht?
Ich habe ihn nie gesehen, sagt Liv. Ihre Stimme zittert noch etwas, trotzdem sagt sie den Satz ungehemmt. Sie nimmt einen Schluck Bier. Das heißt, vielleicht habe ich ihn gesehen, da ich aber nicht weiß, wie er aussieht, kann ich das ja auch nicht wissen. Sie lacht laut heraus. Ich schaue mir meine Gäste an, denke, der könnte es sein, verwerfe den Gedanken aber jedes Mal, weil ich mir ihn besser vorstelle. Besser, nicht besser aussehend. Ich habe mich in ein Phantom verknallt.
Die ideale Beziehung, sage ich. Besser geht es nicht. Ein Phantomliebhaber auf einer Phantominsel. Du weißt aber, was er getan hat, Liv? Was er tut?
Ich stelle mir so manches vor, sagt Liv.
Gefällt dir, was du dir vorstellst?
Immer besser, erwidert sie und lacht wieder laut auf.
Für einen Augenblick ist Liv glücklich. Ich stöhne auf, unkontrolliert, als hätte ich selbst einen nervösen Tick.
Dein zweites Zimmer ist seines, richtig?, sage ich. Es steht immer für ihn zur Verfügung. Ich nehme an, er mischt sich hin und wieder als dreiundzwanzigster Passagier unter die Inselfahrer, setzt mit ihnen über, um eine Dusche zu nehmen und in einem anständigen Bett zu schlafen.
Liv lächelt. Meine Betten sind in der Tat anständig, doch ob du es mir nun glaubst oder nicht, er war noch nie in seinem Zimmer. Das hätte ich bemerkt. Nicht ein einziges Mal habe ich sein Laken gewechselt oder auch nur ein Haar im Abfluss gefunden. Das hättest du gern, für eine dna-Analyse.
Ich lache. Das Letzte, was ich von Leo Cavour will, ist eine dna-Analyse. Was ich will, ist sein aufgespießtes Herz. Seinen abgeschlagenen Kopf. Das Ende seiner Existenz. Ich weiß über ihn alles, was ich wissen muss. Wie er aussieht, weiß ich allerdings auch nicht. Ich rede mir ein, es nicht wissen zu wollen, aber ich bin natürlich neugierig. Ich weiß aber auch, dass es mir einfacher fallen wird, wenn er ein Phantom bleibt.
Hast du gehofft, sein Adressbuch zu finden?
Ich könnte seine Kontakte treffen, bevor ich ihn treffe.
Oder besser noch sein Tagebuch, das nicht nur seine Pläne enthüllt, sondern auch seine dunkle Seele preisgibt?