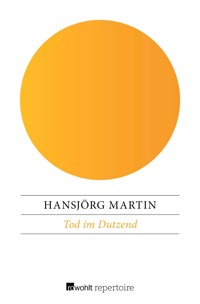9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hanisch ist – es muß gesagt werden – ein ganz großer Armleuchter; darüber sind sich alle einig. Der ganze Betrieb. Hanisch ist verbindlich, oberflächlich-entgegenkommend, aalglatt und eiskalt. Er legt Geheimakten an. Er ist allmächtig. Er ist der Personalchef. Daß ein Chef, vor allem ein Personalchef, unbeliebt ist, daß soll vorkommen. Aber daß er Todfeinde hat – im Wortsinn wohlgemerkt –, das ist wohl ziemlich selten. Hanisch hat es fertiggebracht, daß ihm drei Angestellte, aus sehr unterschiedlichen Gründen von Entlassung bedroht, ans Leben wollen – zwei gemeinsam und einer im Alleingang. Sie wissen nichts von beiderseitigen Plänen, aber die kreuzen sich in einem Punkt: Hanisch soll während des großen Betriebsausflugs sterben, inmitten von Jubel-Trubel-Heiterkeit auf dem Motorschiff, das die Firma für diesen Tag geschartert hat. Der Mann vom Betriebsrat ahnt nichts von alldem. Er will Hanisch nicht töten; er will ihn abschießen, indem er ihn unmöglich macht. Durch Zufall und Zähigkeit ist er dahintergekommen, daß auch der mächtige Personalchef eine Schwachstelle im Karrierepanzer hat – eine Stelle, auf die sozusagen wie bei weiland Siegfried ein Lindenblatt gefallen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Betriebsausflug ins Jenseits
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Hanisch ist – es muß gesagt werden – ein ganz großer Armleuchter; darüber sind sich alle einig. Der ganze Betrieb. Hanisch ist verbindlich, oberflächlich-entgegenkommend, aalglatt und eiskalt. Er legt Geheimakten an. Er ist allmächtig. Er ist der Personalchef.
Daß ein Chef, vor allem ein Personalchef, unbeliebt ist, daß soll vorkommen. Aber daß er Todfeinde hat – im Wortsinn wohlgemerkt –, das ist wohl ziemlich selten. Hanisch hat es fertiggebracht, daß ihm drei Angestellte, aus sehr unterschiedlichen Gründen von Entlassung bedroht, ans Leben wollen – zwei gemeinsam und einer im Alleingang. Sie wissen nichts von beiderseitigen Plänen, aber die kreuzen sich in einem Punkt: Hanisch soll während des großen Betriebsausflugs sterben, inmitten von Jubel-Trubel-Heiterkeit auf dem Motorschiff, das die Firma für diesen Tag geschartert hat.
Der Mann vom Betriebsrat ahnt nichts von alldem. Er will Hanisch nicht töten; er will ihn abschießen, indem er ihn unmöglich macht. Durch Zufall und Zähigkeit ist er dahintergekommen, daß auch der mächtige Personalchef eine Schwachstelle im Karrierepanzer hat – eine Stelle, auf die sozusagen wie bei weiland Siegfried ein Lindenblatt gefallen ist.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Karlheinz Hanisch:
ein vorbildlicher Personalchef und ein Armleuchter mit Eichenlaub und Schwertern.
Sabine Broesel:
Sekretärin eines vorbildlichen Personalchefs mit einer Aversion gegen vorbildliche Personalchefs.
Rolf Duggen:
ein Schlappier, der zu spät begreift, daß auch Kavaliersdelikte verheerende Folgen haben können.
Ilona Duggen:
eine – na, sagen wir – Dame, die Rat weiß und nichts anbrennen läßt.
Jupp Hagelstein:
ein Schmalspur-Cap-Hornier, der nicht anbrennen gelassen wird.
Dr. Franz Roberts:
ein untadeliger beau de jour und eine fragwürdige belle de nuit.
Frl. Dr. Hermine Damaschke:
eine couragierte Mittfünfzigerin, die sich nicht verschaukeln lassen will.
Jochen Wesemeyer:
ein Marxist, der die in einer Transvestitenshow gewonnenen Erkenntnisse nicht zu verwerten braucht.
Dies ist – hoffentlich! – ein Roman.
Der Autor weiß nichts Gegenteiliges;
er ist davon überzeugt, fiktive Charaktere
in einer fiktiven Handlung agieren
und reagieren zu lassen.
HjM
I Vorbereitungen zum Fest
1
«Ich bringe Sie um!» sagte Duggen.
Er stand vor dem Schreibtisch des Personalchefs, war blaß vor Erregung und sah den Sitzenden aus schmalgekniffenen Augen an.
«Wenn Sie mir daraus einen Strick drehen, Hanisch, bring ich Sie um!»
Hanisch erhob sich. Er war einen halben Kopf größer als der Vertriebsleiter. Er wartete zehn Sekunden, ob noch etwas käme, aber es kam nichts mehr. Nur die schweren, fast schnaufenden Atemzüge aus Duggens halboffenem Mund waren zu hören und das langsame Ticktack der dunklen Standuhr in dem altenglisch möblierten Büro, das durch seine Eleganz jeden überraschte, der es zum erstenmal betrat.
«Machen Sie sich nicht lächerlich!» sagte Hanisch mit einem Lächeln, das zwischen Mitleid und Hohn balancierte. «Umbringen! Ausgerechnet Sie … Und nun gehen Sie, ich habe zu tun.»
Er sah Duggen mit zurückgelegtem Kopf an, gespannt, ob der andere es wagen würde, noch etwas zu erwidern oder gar tätlich zu werden – dann wandte er sich ab, und das war wohl für Duggen das Schlimmste an dieser Begegnung: daß Hanisch ihm den Rücken zudrehte.
Denn das hieß: Du wagst es nicht, mich anzugreifen! Vor dir brauche ich keine Angst zu haben! Solchen wie dir kann man unbesorgt den Rücken zuwenden, wenn man sie auch noch so sehr gereizt, gekränkt, gedemütigt hat …
Duggen hielt den Atem an. Er fühlte einen Schweißtropfen hinterm Ohr den Hals hinabrinnen. Er spürte seine Fingernägel im Handballen. Er stöhnte, drehte auf dem Absatz um und ging hinaus.
Hanisch setzte sich wieder. Jetzt lächelte er anders. Es war ein Siegerlächeln, das sein glattes Gesicht mit den weichen Linien noch weicher machte.
Nur der schwarze Schnurrbart, den er wie Nietzsche trug – ohne besonders viel über Nietzsche zu wissen – verhalf dem Gesicht zu einer Kontur. Er schüttelte sich, womit das Siegerlächeln erlosch und abfiel, und drückte die Ruftaste seines imposanten, mit vielen Knöpfen und Schaltern und diversen Lämpchen ausgestatteten Tischtelefons.
Das Tischtelefon erlaubte ihm, mit Knopfdruck, ohne umständliches Wählen, jeden der sieben Abteilungsleiter des Unternehmens direkt anzurufen, auf Konferenz zu schalten, so daß er mit mehreren zugleich sprechen konnte, seine Gespräche mitzuschneiden, wenn er den Schalter Aufzeichnung betätigte, das Telefonat – wohin es auch immer ging und woher es auch immer kam – auf Zimmerlautstärke oder auf einen zweiten Hörer zu schalten … Und so weiter, und so weiter.
Daneben – oder besser: darüber hinaus – hatte die Anlage eine nicht zu unterschätzende psychologische Funktion. Außer der technischen Perfektion, der rationellen Arbeitserleichterung, stellte es eine Image-Stärkung hohen Grades dar. Männer mit solchen Telefon- und Sprechanlagen auf den Mahagonischreibtischen sind a priori ‹Führungskräfte› in den Augen ihrer Umwelt.
Hanisch, Vorname Karlheinz (in einem Wort, worauf er aus unerfindlichen Gründen großen Wert legte), Jahrgang 40, also bei Kriegsbeginn – in der Zeit der ersten großdeutschen Siege – gezeugt und vielleicht deshalb so dynamisch – Karlheinz Hanisch also war eine Führungskraft.
Es ist nicht besonders wichtig zu wissen, wie er es geworden war … Wahrscheinlich hatte ihm bei seiner steilen Karriere die Tatsache viel geholfen, daß sein Vater ein hoher Offizier gewesen war, Ritterkreuzträger und gläubigstrammer Gefolgsmann jener höchst fragwürdigen obersten Führungskraft, deren andere Gefolgsleute, soweit sie am Leben geblieben waren (was nicht unbedingt als Kunststück bezeichnet werden kann, denn sie saßen in der Mehrzahl auf gefahrlosen Posten), deren andere Gefolgsmänner also unterdessen in Wirtschaft, Politik und Industrie unseres schönen Landes längst wieder die Fäden zogen und natürlich gern den Sohn des unglücklicherweise gefallenen alten Kameraden protegierten.
Seit vier Jahren saß Hanisch auf dem Stuhl des Personalchefs der ESW – das heißt ELEKTRONISCHE STEUERGERÄTE WERKE, und es handelte sich um ein Unternehmen mit insgesamt 6000 Arbeitern und Angestellten – pardon: Angestellten und Arbeitern –, die in fünf verschiedenen Betrieben zwischen Ost-, Nord- und Bodensee hunderterlei Dinge entwickelten, ausprobierten und herstellten, die überall in der Welt gebraucht wurden. Das reichte vom simplen, aber dem Normalverbraucher dennoch unbegreiflichen Taschenrechner, einem Verkaufsschlager der ESW, bis zur vollständigen Computereinrichtung einer Weltraumsonde.
Daneben – nicht ausschließlich, aber aus Ertragsgründen sehr gern – bauten die ESW auch allerlei Rüstungsgerät oder bestückten die komplizierten Massenvernichtungswaffen mit jenen Apparaturen, die eine todsichere Wirkung dieser ‹Vorwärtsverteidigungs›-Mordinstrumente gewährleisten.
Da mischte sich in der Geschäftsführung kaufmännisches Kalkül mit nationaler Neigung und patriotischer Vergangenheit zu einer wunderschönen Erfolgsvoraussetzung – und die Bilanzen zeugten denn ja auch davon, daß die Mischung gewinnträchtig war, wovon letztlich auch die 6000 Arbeiter und Angestellten, pardon – Angestellten und Arbeiter – profitierten. Und der höchste unmittelbare Vorgesetzte dieser Sechstausend war Karlheinz Hanisch. Und dieser drückte in diesem Augenblick die Ruftaste seiner imposanten Schreibtischapparatur. Er drückte nur einmal.
Das löste in seinem geräumigen, aber einfach eingerichteten Vorzimmer einen einmaligen Schnarrton aus.
Bei diesem Schnarrton ließ Frau Sabine Broesel, Hanischs Sekretärin, die Kaffeetasse sinken, die sie gerade zum Mund hatte führen wollen, setzte sie ab, erhob sich, strich ihr Strickkleid (Modell, fliederfarben, 640DM) glatt, indem sie sich mit beiden Handflächen vom Brustansatz über Bauch, Hüften und Gesäß fuhr und sich gleichzeitig dabei reckte, und schritt nach einem kurzen, prüfenden Blick in den Spiegel über dem Aktenregal zu der gepolsterten Tür, die ins Chefzimmer führte.
Sie klopfte, obschon das unsinnig war, denn Hanisch konnte es drinnen gar nicht hören, öffnete und ging, Stenoblock und -stift in der Linken, hinein.
Gesetzt den Fall, Hanisch hätte die Ruftaste zweimal gedrückt, dann hätte es ein zweimaliges Schnarrzeichen gegeben, und nicht Frau Broesel, sondern Frau Schindler, die Stenotypistin würde ihre Kaffeetasse sofort abgestellt, ihr Kleid glattgestrichen und – ebenfalls mit Stift und Stenoblock – dem Befehl gefolgt sein.
Der einzige Unterschied (außer dem ein- oder zweimaligen Schnarrton) wäre gewesen, daß Frau Broesel mit einem gewissen Widerwillen in Hanischs Allerheiligstes ging – warum, davon wird noch die Rede sein –, indes Frau Schindler jedesmal wieder enttäuscht war, wenn die Schnarre nur einmal erklang und nicht sie verlangt wurde, während sie im anderen Fall beschwingt und mit erhöhtem Puls dem Ruf ihres Chefs gehorchte, den sie bewunderte, ja, anbetete, obschon er ihr nie einen Anlaß dafür gegeben hatte. Im Gegenteil – er hatte sich, da ihm ihre Schwärmerei nicht verborgen geblieben war, ihr gegenüber noch kühler und distanzierter verhalten, als Frau Broesel gegenüber.
Aber es war wahrscheinlich gerade das, was die Stenotypistin Petra Schindler so aufregend und bewunderungswürdig fand. Sie war ein im landläufigen Sinn hübsches Mädchen, wohlproportioniert, mit einer Neigung zur Molligkeit, Stupsnase und mehreren reizvollen Grübchen, gepflegt, gut angezogen und von jener Mischung aus Kleinmädchenschmollgehabe, Zwitscherkeckheit und Kinosentimentalität, die Männer sehr gern mögen, weil sie ihnen das Gefühl der Überlegenheit gibt, das die meisten brauchen.
Deshalb konnte sich Petra Schindler auch nicht über mangelnde Angebote aller Art beklagen. Es verging kein Tag, an dem sie nicht mehr oder minder deutlich zu hören oder zu spüren bekam, wie gern man mit ihr ausgehen, essen gehen, tanzen gehen, spazierengehen und selbstverständlich schlafen gehen würde. Sie war der Typ Frau, die als leichte Beute programmiert zu sein scheint in der Vorstellung des sogenannten stärkeren Geschlechts. Ein Typ, mit dem ‹was zu machen ist›, ein Betthase, eine Nebenbei-Gehe, auf Autositzen am Waldrand, in einem Stundenhotel oder gar auf einem Bürosessel leicht zu vernaschen.
Dutzende Nachbarn und Zufallsbekanntschaften, Kollegen und Vorgesetzte hatten das schon versucht, einigen war es auch schon gelungen. Es hatte eine Reihe böser Enttäuschungen in Petra Schindlers sechsundzwanzigjährigem Leben gegeben; sie behauptete gern von sich, sie kenne die Männer, aber sie kannte nur eine, zugegeben die weitaus verbreitetste.
Aus allen diesen Gründen war es eigentlich selbstverständlich und zwangsläufig, daß sie Hanisch anhimmelte. So ein kühler, korrekter Mann, noch dazu gutaussehend, vermögend, mächtig und zu allem Überfluß unverheiratet – und überhaupt … Sie träumte immer öfter von ihm, manchmal sogar dann, wenn sie in den Armen eines anderen lag. Was den anderen in erstauntes Entzücken versetzte, weil er glaubte, er sei der Urheber ihrer leidenschaftlichen Zärtlichkeit.
2
Hanisch saß hinter seinem Schreibtisch, richtete den Blick auf seine eintretende Sekretärin, ohne sie wirklich anzusehen, sagte: «Ein kurzes Diktat, Frau Broesel, bitte!»
Er wies mit dem Brieföffner, der die Form eines Stiletts hatte, aus Silber, kostbar und geschmacklos war, auf den Stuhl an der Seite.
Sabine Broesel setzte sich, den Stenoblock auf den hübschen Knien, den Stift gezückt, und wartete. Sie sah ihrem Chef an, daß er an den Formulierungen kaute, die er diktieren wollte.
Hanisch war noch nicht soweit. Es mußte was Wichtiges sein. Er gehörte zwar ohnehin nicht zu den flinkesten Formulierern – manchmal brauchte er eine halbe Stunde für einen Zwanzig-Zeilen-Brief, ganze Vormittage für den Entwurf einer Viertelstunden-Ansprache –, aber heute kam er offensichtlich noch schwerer als sonst zurecht. Und nun klingelte auch noch sein Telefon.
Das heißt, es klingelte nicht; es summte beinahe melodisch. Er beugte sich aus dem leise wippenden Ledersessel der Top-Manager-Klasse nach vorn und griff zum Hörer.
«Ja?» sagte er und horchte. «Wer? … Nein, ich bin nicht zu sprechen. In einer … äh … Sitzung oder … Oder so. Und bitte, in der nächsten Viertelstunde keine Gespräche reinstellen, Frau Schindler, ja!»
Er legte auf und griff wieder zum Brieföffner. Er ließ ihn auf der dunklen Schreibmappe rotieren, so daß in kurzen Abständen die Reflexe der Sonne von dem sich drehenden Silberding über sein Gesicht huschten. Dann lehnte er sich zurück in das leise knarrende Lederpolster und holte tief Luft:
«Ja – ein Memo, Frau Broesel. Ein PM, wie immer ohne Kopie und in den roten Ordner bitte.»
«Jawohl», sagte Sabine Broesel, nun doch gespannt, was da wohl kommen würde.
PM hieß Persönliches Memorandum. Es bedeutete, daß niemand das Notierte zu Gesicht bekommen durfte ohne Hanischs Wissen und Erlaubnis.
Der Personalchef liebte seine PM. Er diktierte zwei bis drei davon jede Woche. Der rote Leitzordner war schon fast voll.
‹Das ist meine Waffensammlung›, hatte er einmal in einem Anflug von Vertraulichkeit zu Sabine Broesel gesagt, und das war zweifellos richtig. Es gab kaum einen leitenden Angestellten, keinen Abteilungsleiter, nur wenige wirklich wichtige Leute im gesamten Unternehmen, über die Hanisch nicht irgendwas in dieser roten Mappe hatte, das ihnen schaden konnte, wenn es zur rechten Zeit auf den Tisch gelegt wurde. Selbst von einzelnen der über den Wolken thronenden, göttergleichen Geschäftsführern besaß Hanisch solche Dossiers.
Von den Arbeitern, die aktive Gewerkschafter waren, sowieso.
Die PM waren Notizen nach Gesprächen, in denen sich der Partner eine Blöße gegeben hatte. Es waren Gedächtnisprotokolle nach Konferenzen, bei denen Kontroversen zutage getreten waren. Es gab zwischen den roten Aktendeckeln Informationen über die Leistungen, die Meinungsäußerungen, den politischen Standort der Männer und Frauen wie der Damen und Herren, die Hanisch für bemerkenswert hielt. Es gab sogar Notizen über ganz intime Dinge.
Wilhelm Meinert, Labor III, hieß es da zum Beispiel, hat sein Verhältnis mit der Assistentin Claudia Lankwitz gelöst. Wahrscheinlich hat seine Frau ihm ein Ultimatum gestellt. Claudia Lankwitz bittet um Versetzung in den Betrieb IV. – Datum …
Oder: Frau Cheminski, Zentralbuchhaltung, vom 11.–25. Sept. 78 krank nach viertägiger Reise nach Amsterdam. Schwangerschaftsabbruch? Dr. Kannengießer, phys. Entw. 14, überzieht sein Gehaltskonto am 8. 9. um 3000DM. K. ist in den letzten Monaten mehrmals mit Frau Ch. gesehen worden …
Oder: Otto Holzhauer, Werkstatt 2, Betrieb 4, Mitglied des Gesamtbetriebsrats seit 74, Hausbau mit hoher Verschuldung (185000,–) … Und so weiter, und so weiter.
Sabine Broesel schrieb diese Notizen, die gelegentlich auch sehr umfangreich waren, auftragsgemäß ohne Kopie. Hanisch las sie durch, korrigierte hie und da etwas oder fügte mit seiner pingeligen, doch gut lesbaren Handschrift ein Wort oder eine Zeile hinzu und zeichnete sie mit dem Krakel ab, der KH heißen sollte und wie ein untergehendes Segelschiff aussah.
Sabine Broesel staunte stets von neuem, was Hanisch wußte, und sie war jedesmal, wenn er sie zum PM-Diktat holte, wieder perplex über das, was sie schreiben mußte. Vor allem blieb es ihr ein Rätsel, woher er und auf welchen Wegen er seine Kenntnisse bezog. Da mußte es ja eine Anzahl Spitzel in den verschiedenen Betrieben geben – ‹Informanten›, wie man das vornehmer nannte –, die ihm, wahrscheinlich über seinen Direktanschluß, alles an Klatsch und Tratsch zutrugen, was in den Betrieben kursierte.
Sie hätte gern gewußt, was das für Leute waren, wie er sie für sich gewann und ob er sie in irgendeiner Form honorierte.
Doch es gelang ihr nicht, das herauszufinden. Die Namen, Adressen und Rufnummern hatte Hanisch entweder im Kopf, oder, was wahrscheinlicher war, in seinem Notizbuch, einem handtellergroßen Büchlein mit rotledernem Einband, das er nie aus den Augen ließ oder gar aus der Hand gab.
Außerdem wunderte sich Sabine Broesel über das Vertrauen, das sie bei Hanisch genoß. Sie wunderte sich um so mehr, seit sie erkannt hatte, daß er die Fähigkeit besaß, Menschen zu durchschauen, mit Menschen umzugehen; besser: mit Menschen zu spielen.
Wie kam es, daß er sie nicht durchschaute? Wie war es zu erklären, daß er nicht spürte, was für ein Doppelspiel sie selbst spielte?
«Bitte, schreiben Sie!» sagte er jetzt, ließ den Brieföffner liegen und preßte die Fingerspitzen seiner gespreizten Hände vor dem Gesicht gegeneinander.
«Am … heutiges Datum … kommt Vertriebsleiter Rolf Duggen in mein Zimmer. Er ist nicht angemeldet. Sehr erregt. Er sagt, er habe gehört, daß ich mich bei der Speditionsfirma Pfeiffer und Köhler über die Bedingungen der Lieferungen erkundigt hätte, die sie für uns – speziell für den Bereich Fertigung L – ausführen. Er fragt, was mich das anginge. Das sei sein Ressort. Ich erkläre ihm, daß die von ihm geforderte Einstellung des Feinmechanikers Rolf Pfeiffer, zweiter Sohn des Spediteurs, mich berechtige, Erkundigungen einzuziehen. Ich erkläre weiter, daß diese Erkundigungen interessante Aufschlüsse über seine, Duggens, Tätigkeit zutage gefördert haben. Ehe er, bereits blaß vor Wut oder Angst, etwas erwidern kann, stelle ich ihm die Frage, ob es richtig sei, daß er einen fabrikneuen PKW – Mercedes 280SE – zum Vorzugspreis von 40 % des Listenpreises durch die Firma Grünberg, die dem Schwager des Spediteurs Pfeiffer gehört, bezogen habe. Ich frage ihn direkt, ob er solche Geschäfte mit seiner Stellung als Vertriebsleiter der ESW für vereinbar halte. Duggen droht mir daraufhin mit den Worten: ‹Wenn Sie das gegen mich verwenden, bringe ich Sie um!› und verläßt, als ich ihn zurechtweise, wortlos den Raum. – So, das wär’s, Frau Broesel. Wie immer ohne Kopie und mir zur Korrektur … Vielen Dank!»
Sabine Broesel erhob sich. «Darf ich Sie an die Rede erinnern, Herr Hanisch?» sagte sie.
«Welche Rede?» Hanisch sah sie an. Seine Stirn war unwillig gerunzelt. Er konnte es nicht leiden, ‹erinnert› zu werden.
«Sie haben dem Betriebsrat zugesagt, auf dem Schiff am Freitag die Begrüßungsansprache zu halten», sagte Sabine Broesel ungerührt. «Oder wollen Sie frei … Ich meine, ohne Konzept sprechen?»
Hanisch biß sich auf die Lippen. Sie wußte genau, daß er nicht frei sprechen konnte, wenn es länger als drei, vier Minuten sein mußte. Er ärgerte sich. Er sah sie prüfend an, um festzustellen, ob sie ihn verspottete … Ihr Gesicht war unbeweglich; sie lächelte nicht. Sie wartete ohne das mindeste Zeichen einer Kritik.
Eine hübsche Frau ist sie, dachte Hanisch und war überrascht, daß er das gerade jetzt feststellte. Hübsch und gescheit, aber nicht sehr feinfühlig – sonst hätte sie mich nicht so gefragt … Nein, es ist wohl keine Auflehnung; es ist einfach mangelnde Sensibilität …
«Ich rufe Sie», sagte er, «sobald ich weiß, was ich auf dem Schiff sage. Sie könnten mir bitte noch mal das Programm reingeben, das für den Ablauf des Betriebsausflugs festgelegt worden ist, ja!»
«Ja, Herr Hanisch», sagte Sabine Broesel.
«Danke!» sagte Hanisch.
Sie ging hinaus. Die Polstertür gab einen saugenden Pflopp-Laut von sich, als sie hinter ihr zufiel.
Hanisch zog sein Schlüsselbund aus der Tasche und schloß die mittlere Schreibtischschublade auf. Er nahm ein Stück Silberfolie heraus, drückte eine Tablette durch das Papier auf die Schreibtischmappe und steckte sie in den Mund. Es war eine leicht nach Pfefferminz schmeckende Magenberuhigungstablette, etwas Homöopathisches. Der leise klopfende Schmerz unter dem Rippenbogen meldete sich wieder. Hanisch lutschte die Tablette und glaubte auch bald, Erleichterung zu spüren. Er verschloß seine Schublade sorgfältig.
Niemand wußte von seinen Magenschmerzen. Niemand – außer seinem Arzt – sollte es wissen. Führungskräfte, meinte Karlheinz Hanisch, haben bestenfalls einen Herzinfarkt. Sonst sind sie gesund. Es schadet dem Ansehen, senkt den Marktwert und mindert die Autorität, wenn eine Führungskraft kränklich ist. Mal eine Grippe für drei, vier Tage – das macht nichts. Ein Bein oder Arm im Gips – nach einem Reitunfall etwa – ist auch nicht abträglich; im Gegenteil, das macht sich gut. Aber ein Magenleiden ist untunlich, eine Blasengeschichte noch mißlicher, weil dann leicht Lächerlichkeit hinzukommt, und ein Leberschaden ist ohnehin ausgeschlossen, da er sofort eine Neigung zum Alkohol signalisiert … Und wenn er zehnmal andere Ursachen hat.
So dachte Hanisch und hütete sich deshalb, über seine Magenbeschwerden auch nur ein Wort zu verlieren.
Er wäre außerordentlich beunruhigt gewesen, wenn er geahnt hätte, daß im Dossier, das über ihn im Stahlschrank Dr. Heinsohns, des obersten Unternehmensleiters, unter anderem die Bemerkung stand: Leichte Disposition zu nervösen Magenerkrankungen. Dr. Heinsohn hatte die Information von Hanischs Arzt, mit dem er in der gleichen Loge war. In bestimmten Bezirken bricht Bruderschaft – privilegierte Bruderschaft – auch Schweigepflicht. Das ist weithin unbekannt, aber Tatsache und nicht zu ändern.
Über alle anderen Bemerkungen in jenem Dossier, von dessen Existenz Hanisch nichts wußte, hätte er sich gewiß gefreut, denn da stand neben den sachlichen Daten (Geburtstag, Schulen, Abitur, kaufm. Lehre, Studium der Volkswirtschaft bis zum Diplom … usw.): Diszipliniert, nicht bestechlich, hohe Qualitäten als Personalchef, da Durchsetzungsvermögen und Geschick in der Behandlung von Mitarbeitern. Über Hanischs Privatleben stand nichts in dem Papier. Darüber war nichts bekannt. Und es gab dazu auch kaum etwas Bemerkenswertes, es sei denn, man hätte die betonte Kultivierung seines Junggesellenstatus’ als bemerkenswert angesehen.
Der Anfangvierziger, einsachtundsiebzig groß, vier Kilo zu schwer, glattgesichtig, schnauzbärtig, sehr gut angezogen, manikürt, gepflegt, diszipliniert, relativ selbstbewußt und -sicher, mit einer leichten Disposition zu Magenbeschwerden, Nichtraucher, Junggeselle, hochbezahlter Personalchef der ESW – Karlheinz (ohne Bindestrich) Hanisch stand jetzt, nach einem Blick auf die elegante Quarzuhr, aus seinem körpergerechten Leder-Schreibtischsessel auf, ging zur eingebauten Wandschranktür, hinter der sich ein Waschbecken verbarg, wusch sich ausgiebig und mit einer gewissen Lust und gut riechender spanischer Seife die Hände, die gar nicht schmutzig waren, fuhr mit dem Kamm durch seine Frisur, die nicht in Unordnung war, bürstete mit einer winzigen silbernen Bartbürste den Bart, den er wie Nietzsche trug – ohne besonders viel über Nietzsche zu wissen –, zupfte ein Fäserchen vom Revers seines gedeckten Kammgarnjackets und ging – nein, begab sich – zum Mittagessen ins Casino.
3
Das Casino der ESW hieß erst seit etwa zweieinhalb Jahren Casino. Vorher hatte es Kantine geheißen. Zu einer der ersten Taten des neuen Personalchefs Karlheinz Hanisch gehörte die Renovierung und der Umbau der Kantine, die bis dahin eine graue Massenabfütterungseinrichtung gewesen war. Neben seinem Volkswirtschaftsstudium hatte Hanisch nämlich als Gasthörer ein paar Vorlesungen Psychologie mitgenommen und gelernt, daß in Arbeits- und Aufenthaltsräumen helle Farben und gepflegte Atmosphäre leistungssteigernd wirken.
Er hatte es nicht allzu schwer gehabt, der Geschäftsleitung diese Binsenweisheit zu verkaufen und die Mittel für eine Verschönerung des Saales und der Nebenräume im Souterrain des Verwaltungsgebäudes bewilligt zu bekommen. Er war natürlich auch beim Betriebsrat nicht auf Schwierigkeiten gestoßen. Erst die Trennung des Speiseraums in einen großen für die Belegschaft und einen kleineren für die leitenden Angestellten hatte zu Ärgernissen geführt. Hanischs ganzes Verhandlungsgeschick war nötig gewesen, den Personalvertretern klarzumachen, daß die Abteilungsleiter und Ressortchefs nicht nur miteinander, sondern auch mit gelegentlichen Gästen beim Essen Dinge besprächen, die nicht unbedingt für jedermanns Ohren bestimmt seien … und daß schon deshalb eine Trennung der Speiseräume notwendig sei – die ja im übrigen keine Wertung darstelle, sondern nur eine Maßnahme des innerbetrieblichen … Na ja.
Der Betriebsrat hatte schließlich zugestimmt, als Hanisch erklärte, daß selbstverständlich auch den Betriebsratsvorsitzenden sowie den von der Arbeit freigestellten Mitgliedern die Benutzung des abgetrennten Raumes erlaubt sei, wenn sie es wünschten.
Zum Schluß, als der Umbau schon fertig und alles schön freundlich gestrichen und modern möbliert war, hatte es dann einen unerwartet stürmischen Streit um die Benennung gegeben.
Hanischs Vorschlag, die Kantine in Casino umzutaufen, war auf den erbitterten Widerstand des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Jochen Wesemeyer gestoßen.
‹Casino? Ich glaub, mein Schwein pfeift!› hatte Wesemeyer in der Sitzung gerufen. ‹Da denke ich gleich an so ’n Offiziersclub … Casino! Ist denn eine Kantine was Schlechtes?›
Hanisch hatte geschickt gekontert und das im Grunde nebensächliche Problem zum Gegenstand einer Umfrage unter den siebenhundert Mitarbeitern der Zentrale gemacht, die in der Kantine – oder im Casino – aßen.