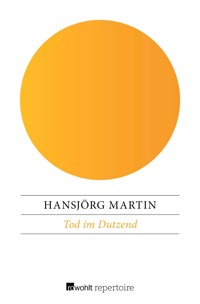9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Die lange, große Wut» – sechs Geschichten von Menschen, die aufgestauter Haß in eine Situation führt – und zwar zwangsläufig –, in der sie keinen Ausweg mehr sehen und nur noch zu einem Mittel greifen können: zum Mord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Die lange, große Wut
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Die lange, große Wut» – sechs Geschichten von Menschen, die aufgestauter Haß in eine Situation führt – und zwar zwangsläufig –, in der sie keinen Ausweg mehr sehen und nur noch zu einem Mittel greifen können: zum Mord.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Blut im Schuh
Ich muß beinah lachen, wenn ich daran denke, daß Marita de Orando selbst – ohne es zu wissen, natürlich – mich darauf gebracht hat, wie ich es machen muß, sie zu … ja, zu ermorden.
Jetzt, eine knappe Stunde vor der Vorstellung, vor ihrer letzten Vorstellung – alles ist vorbereitet – jetzt muß ich beinah lachen. Aber nur beinah. Richtig lachen kann ich nicht, kurz vor dem Mord.
Mord.
Niemand wird erkennen, daß es ein Mord ist. Keiner wird auf den Gedanken kommen, ihren Tod mit mir in Verbindung zu bringen. Aber ich kann trotzdem nicht lachen. Nicht mal triumphierend. Ich triumphiere ja auch gar nicht bei dem Gedanken an ihren Tod. Ich fühle mich nur sehr erleichtert, daß ich sie bald nicht mehr sehen muß. Es ist eine Erleichterung, wie nach einer schweren Arbeit. Aber lachen – nein, lachen kann ich nicht.
Dabei sieht mein Gesicht im Spiegel, hier in meinem Wohnwagen, aus, als ob ich lachte. Der nach oben gezogene, dünne, schwarze Randstrich um die breite, weiße Fläche, die ich immer von der Kinnspitze über beide Backen bis zu den Backenknochen schminke, der schwarze, dünne Randstrich gibt meiner Maske den betont lustigen Ausdruck. Und die drei pfenniggroßen, roten Tupfer – einer auf der Unter-, zwei auf der Oberlippe – lassen den Mund sogar dann lachend wirken, wenn ich die Mundwinkel nach unten ziehe. Und die senkrechten blauen Linien auf den weißgeschminkten Augendeckeln verstärken die Lachwirkung meines Gesichtes noch – von der zinnoberroten, ballrunden Lacknase, die ich immer zum Schluß vorbinde, ganz zu schweigen. Ein überaus fröhliches Clownsgesicht, jawohl.
Damit, wenn ich mich jetzt erinnere, hat das ganze Drama auch angefangen – mit meiner Clownmaske, ja … Das Drama; diese entsetzlichen Wochen, die heute mit dem Tod Marita de Orandos zu Ende gehen werden. Heute, jetzt, in ungefähr einer Stunde.
Und keiner wird drauf kommen, daß ich, Bimbo, der Clown mit dem lustigen Gesicht, der Mörder des Mädchens bin … Was heißt überhaupt ‹Mädchen›! Und was heißt Marita de Orando? Dieses böse, raffinierte, eiskalte Weibsstück heißt in Wirklichkeit Erika Schemmpe. Sie nennt sich nur Marita de Orando, was ich ihr nicht zum Vorwurf machen will und kann, denn in der Welt des Zirkus ist ein schlechtklingender Name ein Hindernis für eine Karriere.
Oder können Sie sich ein Zwei-mal-drei-Meter-Plakat vorstellen mit einem attraktiven Mädchen im hautengen Phantasiekostüm inmitten fauchender Tiger – und darunter die Schlagzeile: ERIKA SCHEMMPE IN IHRER SENSATIONELLEN RAUBTIERDRESSUR? Da klingt Marita de Orando wirklich besser und zugkräftiger, wie ja immer alles Ausländische für die Leute einen besonderen Reiz zu haben scheint. Das ist eine Binsenweisheit. Der Jongleur nennt sich auch Grazelli und heißt eigentlich Krause. Und der Messerwerfer mit seiner Frau sind das Ehepaar Scheibe aus Gelsenkirchen und nicht Valentin Georgiew und Partnerin …
Verdammt, ich kriege die senkrechten blauen Linien über den Augendeckeln heute nicht hin. Meine Hand zittert. Noch mal abwischen … So, und neues Weiß drauf … Jetzt geht’s. Ruhig, ruhig alter Bimbo – du brauchst nicht zu zittern! Es kann nichts schiefgehen … Gar nichts! Keiner hat gesehen, wie ich das hauchdünne Plastiktütchen mit dem frischen Blut in den Stiefel gesteckt habe. Und wenn die Tiger wirklich so reagieren, wie Marita es damals – nicht ahnend, was daraus für eine Waffe werden würde – erzählt hat, dann kann, dann muß es klappen. Ich zweifle nicht daran, daß die Tiger so auf das Blut reagieren. Vor allem der alte, Akbar oder Abkar, wie das Biest heißt, bei dem haben sich ja schon die Rückenhaare gesträubt, als der kleine Peter von Grazelli mal mit Nasenbluten am Käfiggitter entlanggelaufen ist … Das habe ich selbst gesehen. Es muß also nach menschlichem Ermessen funktionieren.
Es klopft.
«Ja?» rufe ich.
Benno ist draußen. Er steckt den Kopf durch die Wohnwagentür.
«In dreißig Minuten, Bimbo!»
«Okay», sage ich. «Ich bin okay!» – obschon das nicht stimmt; ich bin ziemlich durcheinander. Meine Hände zittern schon wieder … Ich werde mir noch einen Kaffee machen, bevor ich die Nase umbinde.
Der Kaffee hat mir gutgetan. Heiß, süß, mit viel Sahne – eine richtige Wohltat. Ich bin jetzt ganz ruhig.
Drüben aus dem Viermastzelt schmettert schon die Musik. Triumphmarsch aus ‹Aida› – in der Fassung unseres Kapellmeisters Herrmann Hoyer. Verdi würde sich im Grabe …
Wo ist eigentlich Akki?
Ich hätte den Jungen gern weggeschickt heute abend. Ins Kino oder sonstwohin. Damit er nicht miterlebt, wie Marita stirbt.
Aber da würde er, oder irgend jemand sonst, womöglich Verdacht schöpfen, wenn ich gerade heute abend versuchte, ihn wegzuschicken – mal ganz abgesehen davon, daß er sich mit seinen sechzehn Jahren nicht mehr so ohne weiteres wegschicken läßt.
Sicher wird es ein furchtbarer Schock für ihn sein. Aber ich weiß wahrhaftig nicht, was ich tun soll. Ich habe überlegt, ob ich es verschieben soll, bis Akki wieder im Internat ist. Das wären noch dreieinhalb Wochen. Sechs Wochen hat er insgesamt Ferien, seit gut vierzehn Tagen ist er hier. Dreieinhalb Wochen – nein, ausgeschlossen. In dieser Zeit hätte Marita den Jungen längst vernascht. Und wer weiß, ob dann der Schock nicht noch viel schlimmer für ihn wäre.
Ich bin mir sowieso nicht im klaren, wie weit sie schon mit ihm ist. Als ich gemerkt habe, daß sie scharf auf meinen Jungen ist, habe ich sie zur Rede stellen wollen. Ich bin in ihren Wohnwagen gegangen. Es ist mir wahnsinnig schwergefallen, hinzugehen, weil sie mich dadrin hat abfahren lassen, so gemein hat abfahren lassen, als ich Hornochse mir eingebildet habe, ich hätte Chancen bei ihr … Ich bin schließlich doch hingegangen. Aber sie hatte Besuch, und so ist nichts aus meiner Warnung geworden.
Sie hat einen der schönsten Wohnwagen, den ich je gesehen habe. Und ich habe schon viele gesehen in den vierunddreißig Jahren, die ich beim Zirkus arbeite … Die schönsten gab es bei den großen Star-Artisten in Amerika. Ho, das waren schon keine Wohnwagen mehr, das waren Villen auf Rädern. Doch der von Marita de Orando alias Erika Schemmpe ist auch nicht ohne. Ziemlich groß, mit hellem Holz, Birke oder Ahorn oder so was schön Gemasertem getäfelt; eine gemütliche Sitzecke hinter dem Paravent gleich links, zwei Sessel und eine kleine Couch. Dänische Möbel, glaub ich, auch so helles Holz und ganz buntgestreifte, grobleinene Bezüge und dieselben Vorhänge an den Fenstern … Sehr hübsch!
Auf dem Boden liegt ein Tigerfell.
Als sie mir damals, bei meinem ersten Besuch – heiliger Strohsack, habe ich da Herzklopfen gehabt! Wie ein Pennäler … Als sie mir da erzählte, daß dies das Fell ihres Lieblingstigers Sulla sei, den sie hatte erschießen lassen müssen, weil er plötzlich bösartig geworden war – da, als sie das erzählte, da hätte ich schon stutzig werden müssen.
Ein Mensch, der sich das Fell eines Tieres, das er gern gehabt hat, ins Zimmer legt und drauf rumläuft – also, der muß ein Gemüt haben wie ein Stück Kernseife. Das ist doch fast so, als ließe man sich zum Andenken irgendwas von der Frau präparieren, die man geliebt und verloren hat. Irrsinnig! Nicht auszudenken, ich hätte mir Evas wunderschöne Zöpfe oder eins ihrer niedlichen kleinen Ohren aufgehoben … Ich habe sie sehr geliebt. Ich habe fast durchgedreht, als sie starb vor sechs Jahren und mich mit Akki allein ließ. Aber ich wäre doch niemals auf den Gedanken gekommen, ihr wirklich einmalig schönes Haar, oder eins ihrer entzückenden Ohren oder …
Doch Marita, die von ihrem toten Tiger Sulla so spricht wie jemand von einem sehr geliebten, unersetzlichen Freund und Gefährten, Marita setzt ohne jede Hemmung ihre Füße – ihre hübschen, wenn auch relativ großen Füße – auf das präparierte Fell.
Aber ich habe den Widersinn nicht bemerkt. Ich hätte zu dem Zeitpunkt noch viel krasseren Widersinn nicht bemerkt, weil ich so hingerissen war von dem Mädchen, so völlig verzaubert von ihrem kupferroten Haar, ihrer biegsamen, schmalhüftigen Gestalt, ihren grünen Augen, ihrer dunklen Stimme … Sie hat mich jedoch bald darauf wieder zur Besinnung gebracht.
«Komm, Bimbo», hat sie gesagt, kühl, spöttisch, mit einem verächtlichen Lächeln, als ich nach zwei oder drei Wochen, in denen sie mich mit Blicken und Gesten hochgezwirbelt hatte, das Aas, bloß aus Lust an der Spielerei, und ich hab’s nicht kapiert … Als ich also versucht habe, sie zu küssen: «Komm, Bimbo», hat sie gesagt, obwohl sie genau wußte, daß ich den Clownnamen außerhalb der Vorstellung nicht gern höre und lieber mit meinem richtigen Namen Reinhard angeredet werde, wenn ich nicht im Kostüm bin, «mach dich nicht lächerlich! Wir sind nicht in der Manege, Alter! Du glaubst doch nicht, daß ich mit einem was anfange, der gut und gern mein Vater sein könnte, wie? Und schon gar nicht mit’m dummen August. Ich müßte ja immer an deine Pappnase denken und an deine weiten Hosen, wenn du zärtlich werden willst … Nee, du – bleib auf dem Teppich und mach kein so doofes Gesicht!»
So hat sie geredet, und ich stand da auf dem Fell des Tigers Sulla und ließ die Arme sinken, die ich nach ihr ausgestreckt hatte in ihrem Wohnwagen mit den hellen, hübschen Möbeln, und kam mir vor wie der letzte Dreck. Kaputt, alt, albern … Am Ende.
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie ich raus- und die paar Stufen runtergekommen bin. Es war an einem sehr warmen Nachmittag im Mai. Ich bin in meinem eigenen Wagen halbwegs wieder zu mir gekommen und habe mich vor den Spiegel gesetzt und angefangen zu schminken, obwohl noch zweieinhalb Stunden bis zum Beginn der Vorstellung waren.
In jener Vorstellung muß ich sehr gut gewesen sein. Die Leute haben neben den Bänken gesessen vor Lachen. Sogar die sture Frau des Direktors, die in jeder Vorstellung vorn links in der Loge sitzt und keine Miene verzieht, sogar die soll gelächelt haben, hat der Oberstallmeister gesagt. So gut muß ich gewesen sein.
Marita hat ein paar Tage danach mit Jean Bertinaux was angefangen, dem Untermann der französischen Flic-Flac-Gruppe. Das ist ein richtig netter, sehr hübscher, etwas einfältiger Bursche von Ende Zwanzig, mit blitzenden Zähnen im dunklen Gesicht und einer großartigen Athletenfigur. Er sagt nicht viel, aber dabei, wozu Marita ihn sich angelacht hat, braucht er auch nicht viel zu sagen. Sie könnte ihn auch kaum verstehen, wenn er was sagen würde, denn sie kann kein Französisch.
Nach Jean Bertinaux, der uns mit seiner Truppe sechs Wochen später verließ, weil sie ein Engagement in den Staaten hatten, war Miguel Mondrago dran, ein Katalane, der mit seinen sechs bildschönen Schimmeln auftritt und sehr gut Hohe Schule reitet.
Aber das war wohl nicht so ganz nach Maritas Geschmack, denn der elegante Kunstreiter ohrfeigte sie bereits am sechsten Tag ihrer Liaison in aller Öffentlichkeit, das heißt im Gang vor der Manege, als sie nach ihrem Auftritt dem kleinen Stallmeister Hugo einen Kuß gab, weil der ihr geholfen hatte, den widerborstigen Bari, einen jungen Tiger, in den Laufgang zu treiben.
Auf Baris Verschlagenheit und Widerspenstigkeit rechne ich bei dem geplanten Mord, den keiner als Mord erkennen wird.
Mit Marita de Orando ist der böse Geist im Ensemble eingezogen. Sie hat es in dem knappen halben Jahr, seit sie mit ihren Tigern bei uns auftritt, fertiggebracht, daß sich alte Freunde nicht mehr grüßen, daß es in einigen guten Ehen geknistert hat und die Ehe von Stepan Gyöngösty, dem ungarischen ‹starken Mann›, beinahe kaputtgegangen ist, weil seine Frau es nicht hat ertragen können, wie er hinter Marita her war. Marita hat erreicht, daß es da, wo bisher alles reibungslos lief, dauernd Zänkereien gibt – um die Probezeiten in der Manege, um die Reihenfolge der Auftritte, um die Standplätze der Wohnwagen, um Verladezeiten, um die Größe der Buchstaben, mit denen die Namen auf den Plakaten angekündigt werden – und so weiter, und so weiter.
Es ist nicht mehr auszuhalten.
Dabei ist sie, das muß man ihr lassen, bei ihrer Arbeit diszipliniert und fleißig; sie ist eine hervorragende Dompteuse. Wie sie mit ihren Tigern arbeitet, wie sie die Tiere dazu bringt, wirklich einmalige Dinge zu tun, das ist sehenswert, großartig und manchmal atemberaubend.
Die großen Katzen mit den unheimlich-schönen Gesichtern und drohend-geschmeidigen Bewegungen setzen sich auf Maritas leise Befehle nicht nur auf die ihnen zugewiesenen Podeste, sie machen nicht nur Männchen oder springen durch Reifen und was der üblichen albernen Späße mehr sind, die man immer wieder vorgesetzt kriegt … Nein, sie tragen zum Beispiel – und das habe ich noch nirgendwo anders erlebt – ihre Dompteuse zu zweit quer durch die Manege, indem sie ihre Arme zwischen die Zähne nehmen – einer rechts, einer links – und noch niemals haben sie ihr dabei auch nur die Haut geritzt! Oder die Nummer mit Bari: Das jüngste, wildeste und schönste der sieben Raubtiere greift mitten in der Dressur vollendet ‹naturgetreu› Marita an, springt sie an, knurrt tief in der Kehle, fletscht die Zähne und schlägt mit den Pranken nach ihr, als wolle es ihr gleich an die Gurgel – eine unglaublich aufregende Szene, weil sich die einstudierte Wildheit der großen Katze so erschreckend steigert, daß die Zuschauer vor Entsetzen den Atem anhalten oder gar schreien.
Marita spielt die ‹Dompteuse in Lebensgefahr› hinreißend. Sie reißt die Augen in Todesangst auf und zittert und sieht sich nach Rettung um – phantastisch!
Als wir uns das bei der Probe in der Manege zum erstenmal ansahen, haben wir es auch mit der Angst gekriegt. Wenn Wilhelm von Atten, unser Direktor, nicht lächelnd abgewinkt hätte, würden wir sicher versucht haben, Marita de Orando mit Stangen und Wasserschlauch und allem möglichen aus der Lebensgefahr zu befreien, in der sie sich gar nicht befand.
Auf dem Höhepunkt dieser Sensationsnummer zieht die anscheinend Angegriffene ‹in höchster Not› einen großen, silberbeschlagenen, mächtig dekorativen Trommelrevolver aus dem breiten Gürtel ihres Phantasiekostüms und ‹erschießt› den angreifenden Tiger, der sofort – es sieht aus wie mitten im Sprung – ‹tot› umfällt und regungslos im Sägemehl liegenbleibt.
Marita geht dann, schweratmend und erschüttert, auf die unbeweglich liegende Bestie zu und setzt ihr, während rundum auf den Podesten die anderen Tiger fauchen und mit den Pranken nach ihr schlagen, den golden verzierten Lederstiefel auf den Kopf … Da klingt immer schon, wie ein Erlösungsseufzer, Beifall auf, der sich gleich darauf, wenn Bari nun den Kopf hebt, aufsteht und seiner Herrin die Hand leckt, zum Jubelorkan steigert.
Ich habe meinen Plan, sie aus dem Wege zu räumen, auf diese Dressurnummer gegründet.
Sobald Marita de Orando, die gute Artistin, der böse Geist, das schlimmste Weibsstück, den Fuß im goldenen Stiefel auf Baris Kopf stellt, wird der Tiger den Geruch des frischen Blutes, der ihn und die anderen schon vorher aufgeregt haben muß, direkt vor der Nase haben. Und es müßte mit dem Teufel zugehen oder Maritas Berichte damals müßten alle falsch gewesen sein, wenn das Tier da nicht durchdreht und wirklich zubeißt und zuschlägt …
«Gefährlich?» hat sie seinerzeit auf meine Frage geantwortet. «Nein, nicht gefährlicher, eher weniger gefährlich als etwa Autofahren, weißt du! Solange du dafür sorgst, daß Motor und Getriebe, Reifen und Licht in Ordnung sind, solange du nicht auf ’ner regennassen oder vereisten, kurvenreichen Straße zu schnell fährst und solange du nüchtern und wach bleibst, kann dir nix – oder wenig – passieren. Es sei denn, ein andrer fährt verrückt. Du bist beim Autofahren ja auch quasi von außen gefährdet. Das entfällt bei meiner Arbeit, verstehst du? Solange ich dafür sorge, daß die Tiger gesund und zufrieden sind, solange ich sie richtig behandle und genau beobachte, solange ich nicht fahrlässig, nachlässig oder leichtsinnig mit ihnen umgehe, kann nix passieren. Die Gefahr von außen ist so gut wie ausgeschlossen, nicht wahr … Da müßte mir schon jemand richtig ans Leder wollen, müßte ihnen heimlich irgendwelche Aufputschmittel geben – was weiß ich, was es da gibt – oder er müßte ihnen das Futter entziehen, damit sie hungrig sind. Aber das geht nicht, weil ich sie selber füttere … Wenn mir einer Schwierigkeiten machen wollte – die Tiger wären ein schlechtes Mittel. Na ja, wenn einer auf den Gedanken käme, frisches Blut unter die Podeste zu schmieren oder sonstwie heimlich in die Manege zu schmuggeln vor unserer Nummer, frisches Ochsen- oder Pferdeblut, damit der Geruch sie reizt und unberechenbar macht … Ja, das wäre gefährlich. Aber wer sollte das tun? Und warum? Und wie sollte er es unauffällig machen? Nein, das ist nicht drin!»
Ich habe, noch ohne jeden Hintergedanken (denn ich war ja bis über beide Ohren verliebt und voller Hoffnung, sie zu erobern) – ich habe also gefragt, ob sie denn geschützt sei, wenn nun wirklich mal eins der Tiere sie angriffe. Denn das könne ja trotz aller Vorsicht mal passieren … Schließlich sind ja schon Dompteure von ihren Löwen, Tigern oder Bären getötet worden, auch wenn die Tiere sie seit Jahren kennen und sie mit ihnen immer ohne Zwischenfall gearbeitet haben.
«Nein», hat sie gesagt. «Falls wirklich mal einer durchdreht, gibt’s kaum eine Chance. Die einzige Möglichkeit ist, vorher zu spüren, zu erkennen und zu ergründen, warum das Tier sich anders verhält als sonst. Aber wenn da plötzlich mal bei einem was aushakt, wenn einer mich in einem Wahnsinnsanfall als Beute sieht – dann ist es mit ziemlicher Sicherheit vorbei. Tiger sind so schnell und so stark, da hilft keine Eisenstange mehr. Und Flucht wäre sinnlos – wohin sollte ich fliehen bei den Gittern rundum? Dann käme ich auch nicht mehr dazu, einen Revolver zu ziehen und gezielt zu schießen. Deshalb habe ich auch keinen bei mir – außer dem Spielzeugding mit den Platzpatronen für die Nummer mit Bari …»
Ich erinnere mich genau an das Gespräch. Es hat mich sehr beeindruckt damals. Ich habe Maritas Mut maßlos bewundert. Denn Mut gehört zweifellos auch dann noch dazu, wenn man die Tiere kennt, soweit man sie überhaupt jemals richtig kennt. Für Irrtümer gibt’s da Beispiele genug. Ich habe selbst erlebt, daß ein Dompteur, ein Belgier, von zwei Löwen angefallen und bös zugerichtet wurde, die er als sechs Wochen alte Tiere bekommen und mit der Flasche aufgezogen hatte. Er arbeitete schon sieben oder acht Jahre mit ihnen und glaubte, jede ihrer Regungen zu kennen … und dann, an einem sehr heißen Tag in der Nähe von Basel, fielen sie ihn in einer Nachmittagsvorstellung an und hätten ihn sicher getötet, wenn es ihm nicht gelungen wäre, schwerverwundet hinter einem der Podeste Schutz zu suchen, bis man sie aus der Manege getrieben hatte … Also, mich würden keine zehn Pferde zwischen die Tiger in das Rundgitter bringen.
Das habe ich Marita natürlich nicht gesagt. Ein Mann, der einer Dompteuse den Hof macht, kann nicht sagen, ich bin zwar bereit, dir die Sterne vom Himmel zu holen, dich auf Händen zu tragen, dich gegen alle Gefahren der Welt zu beschützen – aber laß mich in Ruhe mit deinen Viechern; ich krieg schon nasse Hände bei dem bloßen Gedanken, sie anfassen zu müssen … Kein Mann kann und würde so was sagen. Und ich bin sogar, wenn ich mich an meinen Zustand damals erinnere, gar nicht so sicher, ob ich nicht doch in die Manege gegangen wäre, wenn Marita es – als Beweis meiner Liebe oder so – gefordert hätte … So entsteht unter Umständen Heldentum … Ein absurder Gedanke. Und wenn man sich vorstellt, daß vielleicht auch, sagen wir, Achilles …
Da kommt jemand.
Ich höre es am Schritt: Akki. Er platzt zur Tür herein. Aufgeregt sagt er:
«Es ist gleich soweit, Papa!»
«Ja, ich weiß», sage ich. «Bin schon fertig.»
«Miguel hat seine Pferde schon im Vorzeit», sagt er.
«Wo bist du gewesen?» frage ich. «Hast du was gegessen?»
«Ich habe bei Marita gegessen», sagt er. «Nach dem Füttern … Sie hat mir erlaubt, ihr beim Füttern zu helfen.»
«Die Tiger?» frage ich. «Hast du keine Angst?»
«Aber nein, Papa.» Er lächelt.
Ich wende den Blick ab.
«Sie hat Eierkuchen gebacken», berichtet er.
«Ach ja, Eierkuchen», sage ich und muß mich räuspern, weil ich auf einmal heiser bin. «Hat’s geschmeckt?»
«Prima. Mit Himbeermarmelade …»
In der kleinen Pause, die jetzt entsteht, ist das Paul-Lincke-Potpourri zu hören, in dem unsere Kapelle schwelgt: Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmre …
«Marita hat gesagt, daß du …» zögert, bricht ab, ist plötzlich unsicher, lacht verlegen.
Ich erschrecke. «Was? Was hat Marita gesagt? Daß ich … Was?» Ich sehe ihn an.
Er ist ein außerordentlich hübscher Bursche, groß, fast einen halben Kopf größer als ich, mit langen, kastanienroten Locken – die gleiche Farbe wie das Haar seiner Mutter – und dunklen Augen, wie die meinen. Er ist breitschultrig für seine sechzehn Jahre – das kommt vom Schwimmen; er ist ein leidenschaftlicher Schwimmer – und schmalhüftig. Ich kann schon verstehen, daß Frauen – und besonders solche wie Marita de Orando – scharf auf so einen Jungen sind und sich die Finger danach lecken, ihm Anfängerunterricht zu geben.
Dagegen ist ja im Prinzip auch gar nichts zu sagen. Im Gegenteil: ich wollte, mir hätte in seinem Alter so eine attraktive und raffinierte Frau das horizontale Einmaleins beigebracht; mir wäre die schreckliche, von tausend dummen Ängsten begleitete Quälerei mit gleich mir unerfahrenen Mädchen in Hausfluren oder an Bahndämmen erspart geblieben. Aber ich will nicht, daß mein Junge ausgerechnet dieser Person in die Hände fällt, weil … ja – weil sie mich hat abblitzen lassen – aber auch, weil ich weiß, daß ihr jede Spur von Herz fehlt. Sie ist kalt wie eine Hundeschnauze.
Und ein kleines bißchen Herz sollte die Frau, bei der ein Junge die Liebe – oder richtiger: das Lieben – lernt, schon deshalb haben, damit sie nicht vergißt, ihn wenigstens zum Abschied zu streicheln, wenn sie ihm den Laufpaß gibt …
«Also?» frage ich, fast ängstlich, nach: «Sag schon, Akki: Was hat Marita an mir auszusetzen?»
«Auszusetzen? Nichts!» sagt er erstaunt. «Im Gegenteil. Sie hat gesagt, daß du der beste Clown bist, den sie seit Charlie Rivel gesehen hat!»
«Ach? Wie nett von ihr!» Jetzt bin ich an der Reihe, erstaunt zu sein. «Wie seid ihr denn darauf gekommen?»
«Sie hat mir Fotos gezeigt von ihren früheren Engagements – auch von Artisten, mit denen sie gearbeitet hat. Tolle Leute dabei, Papa! Die Torellis, weißt du, mit dem dreifachen Salto über dem Krokodilbecken und Johnny Jach, der einen Zeigefingerhandstand auf dem schwingenden Trapez konnte, und der Russe, Rotoffzeff oder so ähnlich, der mit einer Hand ein Hufeisen …»
«Ich weiß», sage ich. «Marita hat mit vielen berühmten Kollegen … eh, Kontakt gehabt.» Ich könnte mich auf die Zunge beißen – aber das ist nicht nötig. Akki versteht meine böse Zweideutigkeit nicht.
«Da waren auch Clowns dabei», sagt er. «Ein Schweizer – nein, nicht Grock, natürlich nicht … Ich hab den Namen vergessen.»
Draußen poltert Benno die Stufen herauf, klopft flüchtig und öffnet fast gleichzeitig: «Du bist dran, Bimbo!»
«Ich komme», sage ich, stülpe mir die Glatzenperücke über meine ohnehin schütteren Haare, verdecke mit einem Strich Teint den Übergang von Haut zu Nylongaze und stehe auf.
Benno ist schon wieder verschwunden. Durch die offengebliebene Wohnwagentür scheppert die Musik zu Miguels erstem Teil Hohe Schule.
«Gehst du in die Vorstellung?» frage ich Akki.
«Ja, sicher!»
«Willst … wolltest du dir nicht den schönen alten Beatles-Film ansehen, der hier gerade läuft? Yellow …»
«Yellow Submarine», ergänzt er. «Nein, heute nicht. Marita hat … Wir haben … Es gibt noch eine kleine Überraschung nachher, Papa!»
Weiß Gott, die gibt es, denke ich; armer Junge … Ich muß los. Wenn ich nicht sofort beim Rausgaloppieren der Pferde in der Manege bin, gibt’s Ärger mit dem Chef. Der kann Leerlauf auf den Tod nicht ausstehen. Recht hat er. Ein Zirkusprogramm ist nur dann richtig gut, wenn das Publikum nicht zum Luftholen kommt.
«So? Eine Überraschung?» frage ich, schon in der Tür. «Für mich?»
«Auch für dich!» Akki lacht.
Er hat links ein tiefes Grübchen, wenn er lacht.
Ich laufe ins Zelt, so schnell meine weiten, karierten Hosen und übergroßen Schuhe es erlauben.
Was für eine Überraschung? überlege ich und renne an den herauslaufenden Pferden vorbei in die Manege. Jetzt kann von Nachdenken keine Rede mehr sein.
Ich stolpere meinen komischen Stolperschritt in den hellen Kreis. Hinter den Scheinwerfern ahne ich die Menschenmenge mehr, als ich sie sehen kann. Es riecht nach Sägemehl, Pferdeschweiß – oh, der gute Geruch von Pferden! – und nach dem heißen Metall der Scheinwerfer. Das alles zusammen: Licht, Gerüche, das auf- und abschwellende Raunen der Menge, die ich mehr ahne als sehe und das gleich, wenn ich das erste Mal hinfalle, in ein Lachen mit kleinen Quietschern dazwischen übergehen wird – noch kein lauter Lacher, nur ein Ouvertüren-, ein Erwartungslachen – das alles zwingt mich zur Konzentration und ich vergesse, verdränge die Unruhe, die Sorge, den Haß.
Ich arbeite!