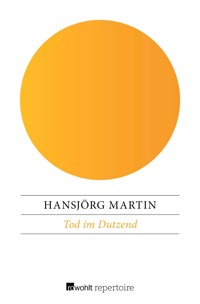9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer träumt nicht vom Aussteigen aus dem üblichen Alltagstrott. Robert, genannt Bobby, Fellgiebel hat eines Tages seinen wenig aufregenden Job als Schaufensterdekorateur aufgegeben und ist mit wenig Geld ohne feste Vorstellung nach Ibiza gefahren. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit schnell dahingepinselten Bildchen, die er an Touristen verkauft. Da er gut aussieht, fliegen die Frauen auf ihn. Doch als sich dann eine zu sehr an ihn klammert und Besitzansprüche geltend macht, flieht er nach Mallorca. Nun sitzt er auf dem Markt von Felanitx, bietet auch hier seine Bildchen an und wartet händeringend auf Kundschaft. Denn die Geschäfte gehen schlecht. Kein Wunder, daß er aufatmet, als Helma Umlauft, Fabrikantengattin aus Wuppertal, ihn anspricht, seine Kunstwerke begeistert lobt und kauft und erst recht an ihm Gefallen findet. Jetzt hat er einen ‹fetten Fisch› an der Angel, und Bobby ist entschlossen, seinen Charme und sein gutes Aussehen rücksichtslos einzusetzen. Doch er ahnt nicht, daß der ‹fette Fisch› sich als Brocken erweisen wird, an dem er sich verschluckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Heiße Steine
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wer träumt nicht vom Aussteigen aus dem üblichen Alltagstrott. Robert, genannt Bobby, Fellgiebel hat eines Tages seinen wenig aufregenden Job als Schaufensterdekorateur aufgegeben und ist mit wenig Geld ohne feste Vorstellung nach Ibiza gefahren. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit schnell dahingepinselten Bildchen, die er an Touristen verkauft. Da er gut aussieht, fliegen die Frauen auf ihn. Doch als sich dann eine zu sehr an ihn klammert und Besitzansprüche geltend macht, flieht er nach Mallorca.
Nun sitzt er auf dem Markt von Felanitx, bietet auch hier seine Bildchen an und wartet händeringend auf Kundschaft. Denn die Geschäfte gehen schlecht.
Kein Wunder, daß er aufatmet, als Helma Umlauft, Fabrikantengattin aus Wuppertal, ihn anspricht, seine Kunstwerke begeistert lobt und kauft und erst recht an ihm Gefallen findet.
Jetzt hat er einen ‹fetten Fisch› an der Angel, und Bobby ist entschlossen, seinen Charme und sein gutes Aussehen rücksichtslos einzusetzen.
Doch er ahnt nicht, daß der ‹fette Fisch› sich als Brocken erweisen wird, an dem er sich verschluckt.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Robert (Bobby) Fellgiebel
will das süße Leben und bekommt es auch – mit allen Folgen.
Helma Umlauft
hat ein Faible für gutaussehende Männer und das nötige Geld, um sie sich zu leisten.
Coronel Don Miguel Colomber, Conde de Serramitjana
hat viel Macht, doch was er will, bekommt er nicht.
Donna Hermione Colomber, Condesa de Serramitjana
sitzt in einem goldenen Käfig und versucht, sich darin einzurichten.
I
Als sie auf ihn zuging, ahnte sie nicht, daß es der Tod war, dem sie sich näherte.
Sie fühlte wohl ein leichtes Herzklopfen und das Frösteln, das sich vor Abenteuern aller Art meist einstellt: am Spieltisch, bei riskanten Geschäften, bei Reisen ohne festes Ziel und genaue Planung, bei Begegnungen mit aufregenden Leuten … aber an den Tod dachte sie nicht.
Der Mann hatte allerdings auch nicht die mindeste Aura von Gefahr oder Bedrohlichkeit, Tücke oder Täuschung. Er saß lässig auf einem dreibeinigen Feldstuhl hinter einem wackeligen Klapptisch im rötlichen Schatten eines schäbigen Sonnenschirms, rauchte, ließ die hellen Augen gelangweilt über die bunte Menge gleiten und hob seine langbewimperten Lider und den blondbeschopften Kopf nur, wenn jemand vor den Zeichnungen und Aquarellen stehenblieb, die er auf der Tischplatte ausgebreitet hatte.
Er sprach niemanden an, aber sein Lächeln zeigte, daß er nicht aus Scheu oder Bescheidenheit schwieg, sondern aus Selbstsicherheit, einer fast fatalistischen Selbstsicherheit, die nicht ohne Arroganz war; denn er wußte, daß er sehr gut aussah.
Er sah wirklich auffallend gut aus: braun gebrannt, was das weit offene weiße Baumwollhemd noch unterstrich; an einem dünnen Goldkettchen baumelte ein Kreuz vor dem haarlosen, muskulösen Brustkorb, aus dem breite Schultern und ein kräftiger Hals wuchsen. Darüber der gutgeschnittene, bartlose Kopf mit vollen Lippen vor blendend weißen Zähnen, die er enthüllte, wenn er die Oberlippe zum Lächeln hob, zu einem Siegerlächeln, das sensible Frauen wegen seiner Animalität vielleicht stutzig gemacht hätte.
Doch die Näherkommende war nicht sensibel. Sie schob sich durchs Gewühl auf ihn zu und dachte an Leben – jedenfalls an das, was ihr am Leben das Wichtigste war.
‹Ein Däne …?› dachte sie. ‹Aber nein, die sind nicht so drahtig. Für einen Schweden ist er auch beinahe zu männlich. Vielleicht ein Norweger …?›
Und sie ärgerte sich, daß sie nicht die hellblaue, durchbrochene Bluse angezogen hatte, bei deren Anblick die dunklen mallorquinischen Männer immer ihre Augen aufrissen.
Sie kramte in ihrem Wortschatz und sprach ihn, als sie seinen Klapptisch erreicht hatte, auf englisch an.
«Oh, what a surprise», sagte sie und war stolz, daß ihr das Wort für ‹Überraschung› eingefallen war, wies mit ihrer rundlichen Hand, an deren Gelenk drei dicke Goldringe klirrten, auf die Zeichnungen und Aquarelle und ließ zugleich die geflochtenen Henkel des Strohkorbs so von der Schulter gleiten, daß der Träger ihres ärmellosen Kleides mitrutschte und ihre hübsche runde Schulter freigab.
«You are the artist, Señor?»
Er stand auf. Sein Blick lief flink über die Fragende.
«Yes, Señora!» sagte er – und seine Stimme gab ihr den Rest, obschon er nur diese zwei Worte sagte, denn es war eine tiefe, dunkle Stimme, die wie das Knurren eines Löwen vor einem Beutestück klang.
Sie rang vier Sekunden nach Atem. Er bemerkte es instinktiv und sah sie so an, daß sie die Sonnenbrille schnell wieder aufsetzte, die sie bei ihrer Frage abgenommen hatte.
«Do you like the things … the pictures … die … äh … die kleinen … äh …»
Er brach ab. Sein Englisch war noch schlechter als das ihre. Aber er kam nicht dazu, sich zu korrigieren, denn sie stutzte und rief plötzlich:
«Oh! Das ist doch …! Nein so was! Ein Landsmann! Aber das freut mich aber doch riesig! Guten Tag!»
Er ergriff ihre ausgestreckte rundliche Hand.
«Guten Tag, ganz meinerseits!» und hielt die Hand jene zehn Sekunden länger, die in anderen Fällen auch schon über Schicksale entschieden haben.
‹Wunderbare Hände!› dachte sie, obwohl sie nur die eine spürte.
«Woher kommen Sie? Und wieso habe ich Sie noch nie hier gesehen?» fragte sie und betrachtete erst jetzt die ausgebreiteten kolorierten Federzeichnungen und Aquarelle.
Sie verstand nichts von Kunst, hätte aber die postkarten-, zum Teil doppelpostkartengroßen Landschaften auch dann reizend gefunden, wenn sie noch mittelmäßiger gewesen wären.
Es waren größtenteils keck hingestrichelte Hafenbilder, Konterfeis malerisch verfallener Fincas, Abbildungen weißer Villen im Ibizenko-Stil, mit Palmen, großen Kakteen und all den Zutaten, die Touristen schätzen.
Menschen und Tiere waren auf den Werken des Künstlers nicht zu sehen, denn die konnte er nicht und ließ sie deshalb lieber weg.
Die Wassermühlen in der Ebene um Palma waren natürlich mehrfach vertreten, die Eremitage San Salvador in Felanitx ebenfalls, die der Künstler allerdings nicht so ganz hingekriegt hatte, weil die Perspektive schwierig war – was seine, von der unerwarteten Entdeckung erhitzte Bewunderin und mit ziemlicher Sicherheit auch potentielle Kundin jedoch nicht bemerkte.
«Ich komme aus dem Hannoverschen», sagte er jetzt, «genauer, aus der Kleinstadt Seesen am Nordrand des Harzes. Aber ich bin schon seit Jahren hier.»
«Seit Jahren?» rief sie. «Und ich habe Sie nie getroffen?»
«Seit Jahren im Süden», korrigierte der Künstler. «Hier auf Mallorca bin ich erst seit vier Monaten und heute zum erstenmal auf dem Markt von Felanitx. Ich habe mich bisher immer dagegen gesträubt, meine … äh … meine Werke selbst … auf dem Markt … nun ja, Sie verstehen … aber das Leben ist teuer geworden, auch auf den Balearen … man muß zusehen …»
«O ja, Meister», flötete sie mit ernster Miene und großem Augenaufschlag, «ich weiß: Kunst geht nach Brot! Darf ich mir denn von Ihren wirklich entzückenden Bildern etwas aussuchen, Meister?»
Sie fand sich großartig und war überglücklich, den Titel ‹Meister› gefunden zu haben und sagte deshalb auch nach jedem dritten Satz ‹Meister› zu ihm.
Er seinerseits lächelte geschmeichelt, denn so hatte ihn noch nie jemand genannt.
«Aber bitte, gnädige Frau!» sagte er. «Suchen Sie sich das schönste aus!»
Sie nahm die große Sonnenbrille wieder ab und betrachtete die Bilder.
«Wunder- … wunderhübsch!» hauchte sie und genoß seine Blicke. «Nein, wirklich, eins wie das andere: wunderhübsch! Wie Sie den Charakter dieses Landes mit wenigen Strichen einzufangen verstehen, Meister! Das ist faszinierend! Ich habe mir immer gewünscht, so etwas zu können – aber ich bin völlig unbegabt, leider! Dieses hier hätte ich gern, bitte – da ist das ganze Mallorca drin!»
Sie zeigte auf eine bunte Ansicht des Hafens von Porto Petro.
«Ja und das hier, wenn Sie erlauben! Ach, der Himmel über den weißen Bungalows! Man riecht förmlich den Duft des Oleander! Und diese drei Zeichnungen von den Wassermühlen … Kann ich die auch noch haben, Meister?»
«Aber selbstverständlich, gnädige Frau!» sagte er, rechnete, daß mit dem Verkauf von fünf seiner Werke schon das Essen für die ganze nächste Woche zu finanzieren sei, inklusive mehrerer Flaschen vino de mesa – und beeilte sich, die ausgewählten Objekte sorgfältig zusammenzulegen.
‹Eine Glücksfee›, dachte er, ‹nicht mehr so ganz taufrisch – aber nicht unappetitlich. Ich würde ihr schon den Meister zeigen, wenn sie in meiner Lehre wäre, haha! Gute Figur immer noch. Sehr gepflegt. Teuer angezogen. Viele goldene Klunkern. Na ja, die paar Fältchen am Hals und unter den Augen … unter den hungrigen Augen … Da würde ich mich schon mal als Mahlzeit hergeben und –›
Sie unterbrach seine Gedanken mit einem erneuten Entzückensruf:
«Oh – da ist ja das Kloster, die Eremitage! Das hätte ich fast übersehen! San Salvador! Nicht zu verkennen! Verkaufen Sie mir das auch noch, Meister?»
«Liebend gern, Gnädigste!» rief er und legte das Aquarell mit der nicht ganz gelungenen Perspektive auf die anderen Bilder.
«Fällt es Ihnen nicht schwer, sich von Ihren Arbeiten zu trennen?» fragte sie. «Ich könnte mir denken, daß darin ja auch immer ein Stück von einem selbst ist … oder?»
«Sie haben ja so recht», erwiderte er und senkte die langen Wimpern über die hellen Augen, «aber das ist das Geschick aller kreativen Menschen, sich zu verströmen, verstehen Sie?»
Bei ‹verströmen› hatte er die Lider wieder gehoben und sah sie nun so an, daß ihr erneut, wenn auch nur für Sekundenbruchteile, die Luft wegblieb. Sie konnte es nicht verhindern: Röte lief ihr über die Wangen, und ihr Mund öffnete sich zu einem Seufzer. Doch dann fing sie sich, versuchte – zu spät – ihre Verwirrung zu kaschieren, bückte sich zum Korb, der, mit frischen Früchten gefüllt, neben ihr stand, kramte ihr Portemonnaie zwischen Aprikosen, Feigen und Zitronen heraus und fragte:
«Was bin ich Ihnen schuldig, Meister?»
Der schöne Mann zögerte.
‹Wenn ich ihr den Kram schenke›, hatte er überlegt, ‹dann ist das vielleicht ein Angelhaken, an dem der Goldfisch zappelt, und ich kann viel mehr absahnen als die paar tausend Peseten. Aber es ist ein Risiko, das ich mir eigentlich, nein, überhaupt nicht leisten kann. Die Miete für das miese Zimmer ist fällig. Ich hab heute keine zwei Mille gemacht. Das reicht hinten und vorne nicht. Benzin brauche ich und wenigstens zwei Näpfchen Kobaltblau für neue Bilder. Der verfluchte blaue Himmel hier … Und essen muß ich schließlich auch noch. Es ist unwahrscheinlich, daß Juanita mir länger auf Pump ihre öligen Tortillas gibt – vom Wein ganz zu schweigen … und – was nichts kostet, ist außerdem nichts wert. Nachher reagiert die Dulzinea plötzlich kühl mit «Danke schön» und «Adiós» – und rauscht ab und reibt sich das Fäustchen über meine Dusseligkeit … Oder ich ziehe ihr jetzt, wo sie ausgesucht hat, ohne nach Preisen zu fragen, das Fell über die Ohren – dann bin ich zwei, drei Wochen aus dem Schneider.›
Er verfiel auf eine beinahe salomonische Lösung des Problems:
«Wenn Sie nicht eine so ungewöhnliche Frau wären, Gnädigste, sondern nur irgend so eine Touristin, dann würde ich Ihnen jetzt den regulären Preis abverlangen – aber da ich meine Kinder –» er wies auf die ausgewählten Bilder – «da ich meine Kinder bei Ihnen in so guten Händen weiß und in so schönen Händen dazu, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen, bitte ich Sie, mir nur die Materialkosten zu ersetzen. Ich muß weiterarbeiten – und die Farben, das Papier …»
«Hören Sie auf!» unterbrach sie ihn. «Was soll das? Wollen Sie mich beschämen, Meister?»
«Aber nein, aber nicht doch!» Er hob beschwörend die Hände.
«Also dann bitte, was kosten die Bilder, die ich gern haben möchte? Ich möchte Sympathie oder … oder sonstige Gefühle aus geschäftlichen Dingen immer heraushalten! Der reguläre Preis also, bitte!»
Sie hatte laut und bestimmt gesprochen, und ihr Charme, den sie zweifellos besaß, war einer gewissen Härte gewichen, die ihn überraschte und beeindruckte.
«18500 für alle!» sagte er.
Sie lächelte – nicht herablassend, sondern eher mitleidig –, fischte aus der dicken Geldbörse vier Fünftausend-Peseten-Scheine, reichte sie ihm und sagte:
«Sie sind ein Schafskopf, Meister, Pardon! Sie verkaufen zu billig! Aber das ist Ihr Problem! Hier sind 20000. Für den Rest bitte ich Sie, meinen Korb an Ihrem Stand abstellen zu dürfen, bis der Markt geschlossen wird, und mir dann die sechs Bilder zum Auto zu bringen. Einverstanden?»
«Ja, danke vielmals, sehr gern!» murmelte er mit einer kleinen Verbeugung, die sie so rührend fand, daß sie ihn am liebsten – noch in allen Ehren und ganz mütterlich – geküßt hätte.
«Ich gehe zu meinem Architekten. Er wohnt oben hinter der Pfarrkirche, und ich muß mit ihm reden, dem Faulpelz. Dann komme ich zurück!»
Sie sah auf die elegante flache Armbanduhr aus Weißgold. «In einer guten halben Stunde, Meister!» fuhr sie fort und wollte sich schon abwenden, als sie innehielt:
«Übrigens, ich bin Frau Umlauft, Helma Umlauft!» – und ihm noch einmal die Hand reichte.
«Oh, Verzeihung», sagte er, nun doch echt verwirrt. «Ich heiße Robert Fellgiebel – Verzeihung, daß ich mich noch nicht eher –»
Sie lachte.
«Das ist ein komischer Name – ‹Fellgiebel› –, aber immer noch besser als meiner. Sagen Sie Helma zu mir, Meister!»
«Danke …» sagte er und wollte hinzufügen, daß seine Freunde ihn ‹Bobby› nannten, aber er kam nicht dazu, denn sie war schon gegangen. Er sah ihr nach, solange er die roten Haare mit dem türkisgrünen Kopftuch ausmachen konnte, schaute dann auf die vier Fünftausend-Peseten-Scheine in seiner Hand, schüttelte den Kopf und murmelte: «Na so was!» und verstaute das Geld behutsam in seiner Gesäßtasche, die er gut zuknöpfte. Dabei sah er sich um wie einer, der mit einem silbernen Leuchter unter dem Hemd heimlich aus einer Kirche schleicht.
20000 für die paar Kritzeleien und Farbtupfereien, für die er sonst bestenfalls 12000 gekriegt hätte … Trotzdem schade – der ganze Goldfisch an der Angel wäre wahrscheinlich lukrativer. Die Rotblonde schien Geld wie Heu zu haben. ‹Mein Architekt …› hatte sie gesagt. Wer kann schon ‹Mein Architekt› sagen? Vielleicht würde ja doch noch mehr daraus zu machen sein …
Bobby Fellgiebel zündete sich eine Zigarette an und nahm wieder Platz auf dem Feldstuhl unter dem schäbigen Sonnenschirm. Die Peseten knisterten, als er sich setzte. Ein französisches Touristenpaar – er klein, dick und rotgesichtig, sie groß, hager und von wächserner Hautfarbe – kaufte kurz darauf noch eins der Aquarelle für 2000 Peseten, wozu sie lange brauchten, weil die Dame das mit dem lilafarbenen Himmel (mit den letzten Resten des Kobalt-Farbnäpfchens gemalt) und der Mann ein anderes mit zwei Palmen vor grünem Himmel schöner fand. Sie einigten sich, wie es vorauszusehen gewesen war, auf den Geschmack der hageren Frau, und der Monsieur bezahlte achselzuckend, mit säuerlichem Lächeln, das zu seinem sonst rundum rosigen Gesicht paßte wie eine Sardelle auf eine Honigsemmel.
Bobby Fellgiebel lächelte nicht zurück. Er rollte die gekaufte lila Landschaft in einen Bogen Papier, nahm mit einem ernsten Nicken das Geld und setzte sich wieder.
Der Sonntagsmarkt von Felanitx war ein Erfolg für ihn. Wie gut, daß er Juanitas Rat befolgt hatte und von Cala d’Or heute früh herübergefahren war.
«Dort ist viel los!» hatte sie gesagt. «Du mußt zusehen, daß du deinen Tisch auf dem kleinen Platz neben der großen Pfarrkirche aufstellst, dort, wo die schmale Straße etwas bergan steigt. Das ist eine gute Stelle, Bobby, das wirst du sehen. Da ist der Eingang zur Markthalle, und da sind die Stände mit Schmuck und dahinter die mit den lebendigen Tieren, Hühnern und Enten und manchmal auch jungen Hunden. Probier es!»
Juanita hatte ihm das in ihrem holperigen Mischmasch aus Spanisch, den zwei Dutzend Worten Deutsch und drei Dutzend Worten Englisch gesagt, die sie kannte. Und da ihre Ratschläge immer gut gewesen waren, hatte er sich früh um sieben mit dem Klapptisch, den sie ihm geliehen hatte, seinem Feldstuhl und der Mappe voll Kunst auf den Weg gemacht und war mit seinem klapprigen Deux Cheveaux die achtzehn Kilometer über Calonge nach dem mittelalterlichen Städtchen am Fuße des Bergklosters San Salvador gefahren.
Er kannte die Straße. In dem Dörfchen Cas Concos, das etwas abseits auf halber Strecke lag, hatte er gleich in den ersten Wochen nach seiner Ankunft auf Mallorca bei einer Landkommune gewohnt und eine recht heftige Affäre mit einer strubbelhaarigen kleinen Französin gehabt, eine Geschichte, die fast blutig geendet hätte, weil einer der Aussteiger ältere Rechte auf die Frau geltend gemacht und ihm, Bobby, mit Mord und Totschlag gedroht hatte.
Das war nicht mehr komisch gewesen, zumal es sich auch nicht lohnte, für die Kleine in den Ring zu steigen – denn die war so sentimental und anhänglich gewesen, daß sich Bobby fast schon wie verheiratet vorgekommen war.
Ja, klar, das Persönchen war schon sehr niedlich – aber er konnte Frauen auf die Dauer nicht ausstehen, die – ganz gleich in welcher Sprache – von ‹ewiger Liebe› und ‹wir sind füreinander geschaffen› und ähnlichem Kokolores redeten. An einer ähnlichen Klebstoffauffassung seiner Partnerin war im Frühjahr sein Verhältnis mit einem dänischen Mädchen auf Ibiza gescheitert, und er hatte nach dramatischen Szenen die Insel schließlich verlassen müssen, obschon es ihm dort, finanziell gesehen, ganz gutgegangen war.
Die Flucht war letztlich wohl doch ein Segen. Mallorca war viel schöner als Ibiza, fand er – und wenn sich das Geschäft weiter so entwickelte wie heute hier auf dem Sonntagsmarkt von Felanitx, dann konnte er gewiß bald die enge, karge Bude über Juanitas Imbißstube in Cala d’Or gegen eine bessere Behausung tauschen, würde dem steten Bratfettgeruch entrinnen, der ihm auf die Nerven ging, und brauchte auch nicht mehr die fetten Arme der guten Juanita zu tätscheln, was ihm ziemlich zuwider war, zumal er auch dauernd aufpassen mußte, daß Carlos, Juanitas muffliger Mann, das Getätschel nicht bemerkte und vielleicht zu seiner Axt griff, die er als Zimmermann wahrscheinlich trefflich zu führen verstand.
Sicher würde er nicht mehr jeden Sonntag 25000 Peseten machen, denn nicht jedesmal war mit so einer reichen Deutschen zu rechnen, die hungrige Augen hatte und einen solchen Haufen Geld – aber wenn er hier sonntags zehn machte und auf den Mittwoch- und Samstag-Märkten von Santanyi noch mal vielleicht sechs und mit ein bißchen Glück an den anderen Tagen der Woche in den Touristenhotelkästen und Souvenirläden in Cala d’Or insgesamt auch noch mal 5000 bis 7000 Peseten, dann konnte er gut leben. Besser jedenfalls als jetzt. Dieses ständige Von-der-Hand-in-den-Mund war ihm außerordentlich lästig. Er hatte sich das auch einfacher vorgestellt, als er vor knapp drei Jahren seinen Job als Schaufensterdekorateur in Seesen kurzentschlossen hinwarf und mit dem Erlös vom Verkauf seiner paar Klamotten und seines Motorrades – alles in allem eben über 6000 Mark – ohne festes Ziel nach Ibiza gefahren war.
Aber das war ein Kapitel für sich: die Freiheit, die Sonne, der Wein, die Frauen … und nie genug Moneten … na ja. Dennoch bereute er seine Flucht aus der niedersächsischen Kleinstadt nicht. Er schüttelte sich auch jetzt, an diesem heißen Vormittag auf dem Markt von Felanitx, wenn er an jene Zeit zurückdachte.
Um ihn herum liefen, standen, redeten, riefen, gestikulierten die Mallorquiner.
Touristen, deutlich erkennbar an Gewandung und Gehabe, wanderten einzeln oder in Gruppen zwischen den Verkaufsständen, bestaunten die fast orientalische Fülle und Farbenpracht des Angebotenen, feilschten verbissen oder kauften blindlings und kamen sich – aus Unsicherheit – sehr überlegen vor.
Ein paar Lautsprecher plärrten gegeneinander an. Rock kämpfte gegen Flamenco, und dazu bellten, jaulten, winselten Hunde, gackerten Hühner, quiekten Ferkel. Aus der Markthalle wehten in Wellen Gerüche über den Platz: Fisch, Gewürze, Wein – und manchmal eine Welle Kaffeeduft oder der Geruch bratenden Fleisches.
Bobby Fellgiebel hatte Hunger. Seit der frischen ensaimada in der Bar gegenüber seinem Stand und zwei Tassen Kaffee mit Milch hatte er seit dem Morgen noch nichts zu sich genommen. Nachher, wenn er der Dame, dem Goldfisch, die Bilder ans Auto gebracht hatte, wollte er sich fürs erste ein Stück Zwiebelkuchen kaufen, dann über Santanyi zurückfahren, wo er an der einzigen Tankstelle im Umkreis Treibstoff kriegen konnte, und danach den kleinen Umweg in Richtung Porto Petro machen. Da gab es eine Gaststätte mitten auf dem Feld, sie hieß ‹El Campo›, und dort wollte er sich eine sopa mallorquin bestellen, ein frito oder vier Wachteln auf Weinkraut und zum Schluß eine tarta del Whisky, das Ganze mit einer Flasche rosado genießen und einen Kaffee hinterher. Er leckte sich die Lippen in der Aussicht auf das Essen und Trinken und freute sich auf die lange, wohlverdiente Siesta danach, drei Stunden Mittagsschlaf oder vier, um das ungewohnte Frühaufstehen auszugleichen.
Über den Markt schritten zwei ernstblickende Polizisten mit den schwarzen Lackhüten, deren Name Fellgiebel wieder nicht einfiel. Irgendwo schlug eine Turmuhr. Die Marktleute begannen einzupacken.
‹Hoffentlich quatscht sich die Tante nicht fest bei ihrem Architekten›, dachte Fellgiebel, während er ebenfalls anfing, seine Siebensachen zusammenzuräumen. ‹Sonst hocke ich hier bis sonstwann und kriege im El Campo nichts mehr. Denn die machen ja sicher ab drei Uhr die Küche bis zum Abend dicht … ›
Ganz unberechtigt war seine Befürchtung nicht, doch es war nicht der Architekt, bei dem Helma Umlauft die Zeit verplauderte. Dort war sie in zehn Minuten fertig gewesen. Sie hatte nur kurz und energisch geschimpft, hatte dem Erschrockenen mit Entzug des Auftrags gedroht, wenn er nicht endlich zu arbeiten anfing: «… das Gartenhaus soll stehen, wenn mein Gatte –» Sie sagte tatsächlich ‹mein Gatte› – «mein Gatte im Herbst herkommt! Und es sind nur noch zehn Wochen bis dahin. Ich will ihn damit überraschen. Ihr dauerndes ‹mañana!›, Señor Alzamora, geht mir auf den Wecker! Wenn in der kommenden Woche nicht angefangen wird, gebe ich den Bauauftrag an einen anderen, comprende?»
«Si si, Señora», hatte der Architekt beflissen nickend geantwortet, obwohl er durchaus nicht alles verstanden hatte, weil er Vokabeln wie ‹Gatte› und ‹Wecker› nicht kannte, und er hatte wortreich und mit großen Gesten beteuert, alles, alles käme in Ordnung.
Das war also in zehn Minuten erledigt gewesen. Doch dann hatte Helma Umlauft auf dem Rückweg zum Markt den Conde de Serramitjana, richtiger: Coronel Don Miguel Colomber, Conde de Serramitjana, getroffen, der mit seiner Frau Donna Hermione aus der Kirche kam. Und sie war natürlich nach der Begrüßung zu einem kleinen Plausch von zehn Minuten mit Donna Hermione Colomber, Condesa de Serramitjana, vor dem Geschäft stehengeblieben, in dem der alte Adelige, nach kurzer Entschuldigung bei den Damen, verschwunden war, um seinen Vorrat an besonderen Zigarillos zu ergänzen. Die Damen sprachen Deutsch miteinander, da die Condesa, eine geborene von Freysingen aus dem Nordhessischen, es sehr liebte, sich in ihrer Muttersprache zu unterhalten, wozu sie an der Seite des Conde, umgeben von spanischer und mallorquinischer Dienerschaft und – wenn überhaupt – meist nur in Gesellschaft spanischsprechender Oberklassedamen und -herren sehr selten Gelegenheit hatte.
Abgesehen von der Sprache, die Donna Hermione nach sechzehnjähriger Ehe mit Don Miguel selbstverständlich fließend sprach und wegen ihrer vokalreichen Schönheit sogar liebte – aber eben nicht so liebte wie die Sprache ihrer Jugend und Heimat –, abgesehen also davon waren die Themen und Probleme, die in Spanisch an der Tagesordnung waren, im tiefsten Grunde nicht ihre Themen und Probleme.
Mit dem Personal konnte sie nur über Dinge des Haushalts reden, über Essen, Trinken, Preise und Wetter. Mit den Gästen, die Don Miguel von seinen häufigen Reisen mitbrachte oder – mehr aus Pflicht als aus Neigung – alle zwei Monate auf die wunderschöne Finca einlud, drehten sich die Gespräche meist um Pferde, Autos, die Weltwirtschaftslage, die entsetzliche Politik der Sozialisten, diesen Wegbereitern des Bolschewismus, der Enteignung, Armut und Elend bedeutete, um Klatsch und Tratsch und – bestenfalls – um einen Film, der in Palma lief und den Hermione fast nie gesehen hatte, weil der Conde es nicht wünschte, daß sie allein in die Stadt fuhr – schon gar nicht abends.
Ihr Mann beherrschte zwar Deutsch – und zwar ebensogut wie Französisch und Englisch –, doch wenn er zu Hause war, lehnte er es ab, etwas anderes als Spanisch zu sprechen. Er hatte nur einmal in seinem großen, düsteren Haus Deutsch mit seiner Frau gesprochen, und sie dachte mit Schrecken daran. Das war im zweiten Jahr ihrer Ehe gewesen, im Verlauf des ersten großen Krachs, den sie miteinander gehabt hatten. Da war der damals schon über fünfzigjährige Mann ganz plötzlich aus dem Spanischen ins Deutsche gefallen, als sie sich gegen seine Herrschaftsallüren auflehnte, und hatte leise, zischend, mit schmalem Mund gesagt: «Hör sofort auf zu keifen, Weib, sonst stopf ich dir das Maul mit meiner Faust!» – Dabei hatte er sie aus kalt funkelnden Augen angesehen, und die Adern auf seiner weißen, hohen Stirn waren geschwollen.
Es war nicht die jähe Brutalität oder der überraschend ordinäre Ton gewesen, was sie so maßlos erschreckt hatte. Aber daß er ausgerechnet in ihrer Sprache so mit ihr redete … das war ihr in die Glieder gefahren wie ein Donnerschlag. Entsetzt hatte sie den Raum ohne ein Wort verlassen und in ihrem wunderschönen Himmelbett bis in die Morgenstunden geweint. Und es hatte Wochen gedauert, bis sie den Schock überwunden und – kapituliert hatte.
Die Kapitulation war ihre einzige Chance gewesen, und es schien, als habe sie sich damit abgefunden.
Wenn sie mit jemandem über ihr Leben auf der Finca Son Colomber sprach, sagte sie lächelnd, es sei ein wunderschön vergoldeter Käfig, eigentlich viel zu schön und zu groß, um als Käfig bezeichnet zu werden … Und ihr Lächeln war, wenn sie das sagte, so echt wie die Herzlichkeit hoher Diplomaten beim Empfang anderer hoher Diplomaten.
Hermione wäre niemals auf den Gedanken gekommen, sich bei irgendwem zu beklagen – und schon gar nicht bei Frauen wie Helma Umlauft, so gern sie auch mit ihr Deutsch plauderte.
Die beiden hatten sich vor zwei Jahren auf jener berühmten Party zum fünfundsiebzigsten Geburtstag Natascha Siroffnowas kennengelernt, zu der alles, was auf der Insel Rang und Namen besaß, eingeladen und auch gekommen war.
Natascha Siroffnowa, von den West- und Osteuropäern, für die aus den unterschiedlichsten Gründen Mallorca Zuflucht, zweite Heimat oder einfach nur Alterssitz geworden war, wurde Natascha – je nach Grad der Intimität – ‹Täubchen› oder ‹Generalin› genannt.
Natascha Siroffnowa war die dicke Witwe eines zu Lebzeiten noch dicker gewesenen weißrussischen Offiziers, der zwar seine ausgedehnten Güter in der Ukraine und damit die Illusion verloren hatte, als Mitglied der herrschenden Kaste zugleich ein höheres Wesen zu sein, der aber bei seiner Flucht außer einem Lastwagen Mobiliar, Gemälde und Hausrat, ein Köfferchen kostbarer Kleinodien gerettet und sich damit die Möglichkeit erhalten hatte, auf dem großen Fuße zu leben, auf dem er immer gelebt hatte.
Nach einem guten Dutzend guter Jahre in Paris gewann er die schmerzliche Erkenntnis, daß sich auch bei den französischen Domestiken der Bazillus ausbreitete, es gäbe ‹gleiches Recht für alle› – und das war Siroffs eingefleischter Gewohnheit, Befehle zu erteilen, außerordentlich hinderlich.
So sah er sich also gezwungen, nach einem neuen Domizil Ausschau zu halten. Hinzu kam eine Arthrose, an der die mit großer Leidenschaft und sogar ziemlich gut klavierspielende Natascha litt. Und so beschloß er – nach langer Suche – dem Rat eines alten Kameraden aus Petersburg zu folgen, erwarb für ein Ei an der Steilküste nordwestlich von Porto Petro ein paar tausend Quadratmeter Boden und baute darauf für ein Butterbrot ein Haus, nein, ein Chalet, das von außen spanisch aussah, innen jedoch auf den ersten Blick die ukrainische Herkunft des Besitzers verriet.