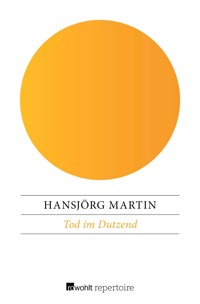9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Leo Klipp, Oberkommissar aus Hamburg und derzeit auf Dienstreise nach Frankfurt, steht auf der leeren Dorfstraße und kommt sich vor wie der Sheriff in ‹High Noon›. Es ist auch ein bißchen viel, was ihm zugestoßen ist: Erst hat kurz vor der Abfahrt Bad Hersfeld der Motor seines Wagens gestreikt – und so etwas passiert natürlich immer am Wochenende. Derart lahmgelegt, ist er im Dorfgasthof von Wehheim untergekommen und später auf einem Waldspaziergang von Wilderern zusammengeschlagen worden. Den einen Wilderer – den Sohn eines Großbauern – hat man nun erwischt, und das hat zur Folge, daß Klipp vom ganzen Dorf wie ein Aussätziger behandelt wird. Jetzt ist auch noch dem Wirt eingefallen, daß Klipps Zimmer ‹vorbestellt› war ... Klipp steht auf der Straße. Er beschließt, sich an den netten alten Professor zu wenden, der oben im früheren Pförtnerhaus des gräflichen Schlosses haust – nette alte Professoren wissen manchmal Rat. Nette alte Professoren haben aber auch gelegentlich junge, überaus nette Nichten ... Es wäre völlig abwegig, zu behaupten, Almuth Süßkind, genannt Undine, hätte den weiteren Verlauf der Ereignisse wissentlich oder unwissentlich beeinflußt. Der Wilderer wäre auch ohne sie aus dem Gewahrsam entflohen, die Bibliothek des Schlosses hätte auch ohne sie gebrannt, und mit der Ermordung der Gräfinmutter hat sie ganz gewiß nichts zu tun. Aber daß Leo Klipp bereits am nächsten Tag den Mörder stellen kann – das hat er dann, wenn schon auf recht indirekte Weise, auch ein wenig Undine zu verdanken. Einiges andere übrigens auch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Feuer auf mein Haupt
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Leo Klipp, Oberkommissar aus Hamburg und derzeit auf Dienstreise nach Frankfurt, steht auf der leeren Dorfstraße und kommt sich vor wie der Sheriff in ‹High Noon›.
Es ist auch ein bißchen viel, was ihm zugestoßen ist: Erst hat kurz vor der Abfahrt Bad Hersfeld der Motor seines Wagens gestreikt – und so etwas passiert natürlich immer am Wochenende. Derart lahmgelegt, ist er im Dorfgasthof von Wehheim untergekommen und später auf einem Waldspaziergang von Wilderern zusammengeschlagen worden. Den einen Wilderer – den Sohn eines Großbauern – hat man nun erwischt, und das hat zur Folge, daß Klipp vom ganzen Dorf wie ein Aussätziger behandelt wird. Jetzt ist auch noch dem Wirt eingefallen, daß Klipps Zimmer ‹vorbestellt› war ... Klipp steht auf der Straße. Er beschließt, sich an den netten alten Professor zu wenden, der oben im früheren Pförtnerhaus des gräflichen Schlosses haust – nette alte Professoren wissen manchmal Rat.
Nette alte Professoren haben aber auch gelegentlich junge, überaus nette Nichten ...
Es wäre völlig abwegig, zu behaupten, Almuth Süßkind, genannt Undine, hätte den weiteren Verlauf der Ereignisse wissentlich oder unwissentlich beeinflußt. Der Wilderer wäre auch ohne sie aus dem Gewahrsam entflohen, die Bibliothek des Schlosses hätte auch ohne sie gebrannt, und mit der Ermordung der Gräfinmutter hat sie ganz gewiß nichts zu tun. Aber daß Leo Klipp bereits am nächsten Tag den Mörder stellen kann – das hat er dann, wenn schon auf recht indirekte Weise, auch ein wenig Undine zu verdanken.
Einiges andere übrigens auch.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
GRAF BODO EDUARD HEINRICH-MARIA VON WALLENHAUSEN UND KARDINGEN
kommt selten dazu, mehr als «Ja, Mutti!» zu sagen.
DIE GRÄFINMUTTER
sagt alles übrige. Dann sagt sie gar nichts mehr.
HERMANN NIEDLING
schießt auf Hirsche und schlägt nach Bullen.
FORSTMEISTER AGRICOLA
trachtet beides zu verhindern.
PROFESSOR IMMENDORF
liebt Bücher und hinkt.
UNDINE ALIAS ALMUTH SÜSSKIND
liebt ebenfalls – jedoch nicht ausschließlich – Bücher.
UWE RUGEN
hat Sommersprossen und braucht eine Zwille.
HAUPTWACHTMEISTER ERICH RUGEN
hat dienstlich mit Schießpulver zu tun, jedoch dasselbe nicht erfunden.
OBERKOMMISSAR LEO KLIPP
wird infolge einer Autopanne und eines Schlags auf den Kopf sehr glücklich.
Es gibt Menschen – in der Mehrzahl männliche –, die können mit einem Büchsenöffner Fernsehgeräte oder Außenbordmotoren reparieren; sie setzen mit einer Haarnadel streikende Computer wieder in Gang, und wenn sie ein Auto anlassen, legen sie lauschend den Kopf schief und sagen nach zehn Sekunden: «Aha – die Nockenwelle!»
Ich bewundere solche Menschen maßlos, denn meine technischen Fähigkeiten entsprechen etwa dem Wissensstand eines Weihbischofs hinsichtlich der differenzierteren Stripteasetänzerinnenkünste in St. Pauli (wobei der Bischof schlechter dran ist als ich; für das, was ich nicht weiß, gibt es Werkstätten – aber nicht für das, was er nicht weiß).
An jenem Freitagnachmittag wäre es für mich besser gewesen, ich hätte mehr von Motoren verstanden. Dann wäre mir einiges an Lebensgefahr erspart geblieben. Auch die Platzwunde an der Stirn. Man sieht die Narbe heute noch. Allerdings hätte ich auch Almuth Süßkind nicht getroffen … Ja, sie hieß wirklich so, das ist keine Erfindung; und sie verdiente beide Namen wahrhaftig. Auf den reizenden Leib geschneidert waren sie ihr. Maß-Namen, gewissermaßen.
An jenem Freitagnachmittag im September also fuhr ich mit meinem mangelhaften Motorenverstand und meinem Volkswagen nach Süden, genauer nach Frankfurt, um dort – quasi auf Staatskosten – ein langes Wochenende zu machen: Ich mußte am Dienstag früh vor einem Frankfurter Schwurgericht als Zeuge in einem Prozeß auftreten.
Es war ein böser Prozeß. Totschlag stand in der Anklage – aber daraus konnte auch Mord werden, wenn die Beweiserhebung es ergab. Ich hatte den Angeklagten nach seiner Flucht in einer Hamburger Kneipe verhaftet. Er war ein armes Luder.
Was er mir, Rotz und Bier heulend, auf dem Weg ins Untersuchungsgefängnis erzählt hatte, war eine schlimme, graue, quälende Geschichte, angefüllt mit jener Bratkartoffel- und Kohldunstbösartigkeit zu kleiner Wohnungen, zu enger Horizonte. Eine Geschichte, wie sie schockweise auf dem Mistbeet dieser Gesellschaft wachsen, gedüngt mit verbogenen Ehrbegriffen, gegossen mit der fauligen Brühe täglicher Groschenblattmoral. Es war eine düstere, blutige Geschichte – auf ihre Art genauso düster, tragisch und blutig wie die Atriden-Story aus dem geschichtlichen Poesiealbum der Griechen; sie war nur nicht so erzählenswert für Dichter, weil es sich bei meinem Häftling um einen ungelernten Arbeiter handelte und nicht um ein Mitglied der Hocharistokratie.
Dienstag früh um neun hatte ich anzutanzen. Montag galt als Reisetag. Am Wochenende war ich dienstfrei – also hielt mich nichts und niemand davon ab, schon Freitag nachmittag meine Zahnbürste in den Kofferraum des Wagens zu legen und loszugondeln.
Es fing auch alles prima an. Das Wetter hatte ein müdes Spätsommerlächeln aufgesetzt. Ich kam über die Elbbrücken, ohne in Abgaswolken Schritt fahren zu müssen. Das Auto lief. Meine Gedanken liefen voraus.
Vielleicht, dachte ich, wäre es ganz lustig, eine der beiden (oder auch beide?) Damen zu besuchen, die in Frankfurt wohnten, wie ich wußte, und vor zwanzig Jahren kurz nacheinander meine große Liebe gewesen waren … Aber ich ließ den Gedanken fallen, noch ehe ich das Horster Autobahndreieck erreicht hatte; mir fiel die Begegnung in Köln ein, wo ich schon einmal versucht hatte, eine große Jugendliebe aufzuwärmen. Es war ganz entsetzlich gewesen. Das mit dem vielzitierten Zahn der Zeit mag eine alberne Redensart sein, aber daß er an Damen nagt – besonders an solchen, die man einmal geliebt hat –, das steht fest. (Er nagt auch an Herren, aber bei denen stört es mich nicht so.)
Die Lüneburger Heide hügelte links und rechts. Ich überlegte zum hundertstenmal, daß ich mir doch ein kleines Holzhäuschen am Waldrand kaufen sollte, um gelegentlich wieder einmal die Sonne aufgehen zu sehen … Aber dann wäre es reichlich kompliziert, mal ins Theater zu gehen … In die Oper komme ich zwar jetzt auch nie, obschon ich nur sieben Autominuten entfernt wohne, doch das Bewußtsein, ich könnte, wenn ich wollte, ist schon der halbe Kunstgenuß.
Bis weit hinter Hannover jonglierte ich mit Überlegungen, wie sich das verwirklichen ließe: Großstadtgewohnheit in Verbindung mit Landleben … Kurz vor Hildesheim gab ich es auf.
Mein Auto schnurrte um hundertzwanzig herum. Wenn es bergab ging, schlug die Tachonadel manchmal bis hundertdreißig aus. Die dicken Mercedesse überholten mich rauschend, und ich sann darüber nach, daß Reichtum nicht gut sein kann, solange er mit solcher Hast verbunden ist.
Wenn ich mal reich bin (was für einen Kriminaloberkommissar so naheliegend ist wie Bühnenruhm für eine Souffleuse), dann kaufe ich mir einen Dogcart und zwei Apfelschimmel dazu und nehme mir so viel Zeit für alles, daß auch das langsamste Auto noch zu schnell ist … Zum Flugplatz kann ich mir dann ja immer ein Taxi leisten.
Unter solchen unrealistischen Gedanken erreichte ich die Ausläufer des Harzes, grübelte bei einem der nächsten Abfahrtswegweiser vergeblich, wer die Dame gewesen war, deren Name mir einfiel: Roswitha von Gandersheim – Himmelherrgottnochmal, diese Halbbildung! – und fuhr an Göttingen vorbei, ohne daß mir, als Ausgleich, Heinrich Heine eingefallen wäre. (Er fiel mir erst auf Höhe Bad Wildungen ein … War Heine je in Bad Wildungen?)
Außerdem hatte ich Hunger. Dagegen kann man nichts tun als rauchen oder essen. Ich nahm mir vor, an der nächsten Raststätte was zu essen und Zigaretten zu kaufen.
Kurz vor Kassel fiel mir ein, daß ich vor zwei Jahren an der Ostsee ein Mädchen aus Frankfurt kennengelernt hatte. Das war damals so was wie Zündung auf den ersten Blick gewesen – bum –, und wir hatten erst wild und dann vornehm und schließlich ziemlich eng getanzt; ich hatte sie schließlich zwei Stunden lang den Viertelstundenweg zu ihrer Hotelpension nach Hause gebracht. Es war nichts Ernsthaftes geschehen. Ich hatte mit mehr Zeit gerechnet und wurde am Nachmittag des nächsten Tages aus dem Urlaub geholt wegen irgendeinem Ganoven, den ich schon mal verarztet hatte … Aber das Mädchen war reizend gewesen. Ingrid hieß sie. Aber der Nachname … Nee: Inge. Aber such mal einer eine Ingrid oder Inge in so einer Stadt! Die Adresse hatte ich natürlich auch vergessen. Vor lauter Nachdenkerei vergaß ich jetzt auch noch meinen Hunger, was für mich spricht: Das Geistige überwiegt noch in meinem Charakter. Ich rollte an der Raststätte Kassel vorbei.
Na schön, es gab noch mehr Raststellen. Bis zur nächsten würde ich’s ertragen …
Kruse hieß das Mädchen. Ingrid Kruse. Und Ingrid wohnte in Frankfurt-Seckbach … Na bitte! Das würde sich feststellen lassen. Wozu hat man schließlich seine kriminalistische Ausbildung?
Ungefähr fünfzig Kilometer weiter, kurz nach Homberg, klettert die Autobahn über den Exberg. Es ist eine kilometerlange Steigung. Wir waren noch nicht ganz oben, mein Auto und ich, da klapperte es plötzlich so komisch da hinten drin, wo der Motor ist. Und gleichzeitig leuchtete das Warnlämpchen am Tacho auf, das – soviel weiß ich – den Öldruck anzeigt.
Das Lämpchen hätte mich nicht weiter gestört; ich fand nur dieses impertinente Klappergeräusch sehr unangenehm und etwas beängstigend. Also lenkte ich die Klapperkiste auf einen Parkplatz, der da glücklicherweise war und auf dem bereits vier Automobilisten neben ihren Fahrzeugen standen und entweder die Landschaft bewunderten, sich die Beine vertraten oder ihren heißen Motoren Kühlung zufächelten. Ich ließ den Motor laufen, stieg aus, klappte die Haube hinten hoch … Es klang schaurig, aber ich sah nichts. Keine Metallteile flogen mir um die Ohren, keine Drahtspiralen sprangen aus dem Innern des Motors – nichts.
Ich schaltete die Zündung aus, gebärdete mich sehr sachkundig, indem ich mit einem Schraubenzieher, den ich in einer Art Werkzeugtasche gefunden hatte, ein bißchen an den Rädern, Scheiben und Schläuchen des Motors herumklopfte, und hoffte, daß eine Viertelstunde Abkühlung gewiß den Schaden beheben würde. Wenn ich nur wenigstens eine Zigarette gehabt hätte. Mein Hunger begann unsympathisch zu werden.
Ich stapfte eine Viertelstunde lang kreislauffördernd auf dem Parkplatz herum und sah den vorüberfahrenden Wagen nach, dem kleinen und großen, dem bezahlten und dem unbezahlten Wochenendverkehr; Männer, die heim zu Gattinnen oder weg von Gattinnen fuhren. Junge Paare, die ihrer ersten, und alte Paare, die ihrer Gewohnheitsumarmung entgegenrollten und dem ersten oder dem hundertsten Krach. Familien auf dem Weg zu Familien oder zu einsamen Großmüttern … Vielfältiges Schicksal auf gummibereiften Rädern.
Unter normalen Umständen hätte ich jetzt sicher ein wenig philosophiert; denn ich bin (falls das bisher nicht klargeworden sein sollte) ein eher innerlich veranlagter Mensch. Doch mir ging das Geschepper meines Autos nicht aus dem Sinn, also wurde es nichts mit der Philosophie. Nach fünfzehn Minuten stieg ich wieder ein und ließ den Motor an. Sofort böllerte er wieder infernalisch los.
Ein Mann in Kordhose und Pullover trat mit der Miene eines Beerdigungsunternehmers an das Fenster meines Autos heran und sagte: «Damit kommen Sie aber nicht mehr weit!»
«Was ist das denn?» fragte ich; nun kam es auf den technischen Offenbarungseid auch schon nicht mehr an.
«Da hat die Schmierung ausgesetzt, und nun ist entweder die Kurbelwelle hin oder …» Er überlegte. «Haben Sie Öl dabei?»
Ich verneinte beschämt.
«Warten Sie!»
Er ging zu seinem Mittelklassefahrzeug, fischte aus dem Kofferraum eine Büchse Öl und kam zurück. Ich stellte den Motor ab. Der Fremde handelte zielbewußt und schweigsam; er schraubte den Deckel ab, goß die dickflüssige, goldglänzende Fettigkeit in ein Loch, warf die leere Büchse in den Abfallkorb des Parkplatzes, wischte sich die Hände ab und nickte.
«So», sagte er, «bis zur nächsten Werkstatt geht’s ohne Kolbenfresser. Aber nicht weiter, klar?»
Ich bedankte mich herzlich, ließ noch ein paar technische Ratschläge über mich ergehen – der Mann konnte schließlich nicht wissen, daß er seine Perlen vor eine Sau warf –, bezahlte ihm das Öl und startete.
Das Geschepper war noch immer da, aber das rote Warnlämpchen brannte nicht mehr. Ich fuhr langsam den Berg hinauf, kuppelte oben aus und ließ mein krankes Auto rollen. Es rollte gemächlich mit langsam zunehmender Geschwindigkeit bergab, und ich geriet schon wieder so ins Träumen, daß ich fast die Autobahnabfahrt verpaßt hätte.
Der Ort, in den ich nun in sanfter Kurve hineinrollte, hieß Wehheim. Ich empfand es als unangenehm beziehungsreich (obgleich ich noch keine Ahnung hatte, wie beziehungsreich es werden sollte). Wehheim schien ein größeres Dorf zu sein. Es sah sehr viel hübscher aus, als sein Name klang. Die weißen Fachwerkhäuser scharten sich wie Küken um die Glucke um einen knubbeligen Berg, der von einem alten, sehr dekorativen Schloß gekrönt war. Ich fand das alles sehr reizend und idyllisch und romantisch, hatte jedoch im Augenblick keinen rechten Nerv für Heimatklänge und alte Schlösser, da mir eine Werkstatt viel wichtiger war.
Die Straße stieg nun wieder ein wenig an, und ich mußte einen Gang einlegen und Gas geben. Eine behäbige Bäuerin, die im Gemüsegarten neben ihrem Haus Salatköpfe abschnitt, riß erschrocken die Augen auf, als meine Mühle lospolterte, und zwei weiße Enten flüchteten flügelschlagend.
Vor einem gelben Klinkerbungalow, der in das Dorf paßte wie ein Goldzahn in den Mund eines Eskimos, standen zwei Männer in Lodenjoppen und redeten.
Ich hielt an und fragte, ob’s irgendwo eine Autowerkstatt gäbe. Sie sahen sich an.
«Schumm», sagte der eine.
«Oder Kniepel», sagte der andere.
«Nä, Kniepel nicht», sagte der erste, «bei der Einstellung …»
«Richtig», bestätigte der zweite und wandte sich zu mir: «Zweite Straße. Am Spritzenhaus links rein. Gleich auf der rechten Seite. Schlosserei Schumm.»
«Danke», sagte ich und fuhr los. Hoffentlich hatte Schumm die richtige Einstellung. Mein Volkswagen ist immerhin rot.
Die Schlosserei war früher mal eine Schmiede gewesen. Draußen in der Mauer saßen noch die eisernen Ringe, an denen damals die Pferde festgemacht worden waren. Im dunklen Hintergrund der verrußten Werkstatt stand ein mächtiger, erloschener Kamin, neben dem ein paar verstaubte, brüchige Lederblasebälge an der Wand hingen.
Es schlug sechs vom schindelgedeckten Kirchturm gegenüber, als ich ins Dunkel hinein «Guten Tag!» sagte.
An einem großen Ausguß wusch sich ein Mann mit Kernseife und Wurzelbürste die Hände. Der Seifenschaum war das einzig Helle an ihm. Haar, Gesicht, Overall, Stiefel bildeten eine Skala von Grau bis Schwarzbraun; nur das Weiße in seinen Augen, die er jetzt zu mir wandte, hatte noch eine Chance gegen den Seifenschaum.
«’n Abend!» korrigierte er mich knapp und beschäftigte sich weiter mit der Reinigung seiner Finger.
«Sind Sie Herr Schumm?» fragte ich.
«Nee.»
Eine Minute nach sechs, Freitag abends, konnte ich von einem offenbar Lohnabhängigen nicht viel mehr erwarten.
«Ist er da?» versuchte ich’s trotzdem.
«Hinten.» Der Lohnabhängige machte mir mit einer Bewegung seines dicken, seifenschaumverzierten Daumens klar, daß ich außen ums Haus gehen mußte, um den Gesuchten zu finden.
Ich ging zwischen einem Dutzend Autowracks in allen Stadien der Auflösung hindurch an der Seite der Werkstatt entlang und fand zu meiner Verblüffung hinter einem Wäldchen von dreimeterhohen Sonnenblumen einen kleinen dicken, weißhaarigen, dreckigen Mann in noch dreckigeren Arbeitsklamotten, der auf einem Schaukelpferd saß und schaukelte.
Das Schaukelpferd war kein gewöhnliches Schaukelpferd. Es war ein großes hölzernes Karussellpferd von barocken Formen, mit richtigen braunen Glasaugen und wundervoll bemalt: rosa, wo Karussellpferde rosa sein müssen, weiß, wo sie weiß, und schwarz, wo sie schwarz sein müssen.
Der kleine dicke Mann lachte, als ich näher kam. Keine Spur Verlegenheit. Reines Vergnügen.
«Guten Abend!» sagte ich, blieb stehen und sah zu, wie er schaukelte.
«Nich, daß Sie denken, ich hab vielleicht ’ne Meise», rief er fröhlich. «Nee … Ich muß das Roß probieren. Hab ihm neue … Na, Kufen, Schaukelkufen drunter montiert. Die Bälger reiten zu fünft drauf. Kein Wunder, bei so ’nem schönen Pferd, nich? Nun probier ich’s, ob’s mich trägt. Ich wiege fünfundachtzig Kilo … Wieviel wiegen Sie?»
«Knapp achtzig.»
«Kommen Sie her!» forderte er mich auf. «Setzen Sie sich hinten drauf … Ja, hinter den Sattel. Los, machen Sie schon. Mit dem Holz passiert nix. Das ist massiv Eiche. Und das Schaukelgestell hab ich selber konstruiert. Das muß uns beide tragen – dann können die Kinder zu sechst, wenn sie wollen … Los, steigen Sie auf!»
Also gut. Was sollte ich machen? Und warum eigentlich nicht? Es war bestimmt dreißig Jahre her, seit ich auf einem Schaukelpferd gesessen hatte – aber noch nie auf einem so schönen. Ich benutzte die Hinterhandhacke des trabenden Gauls und schwang mich auf den breiten Platz zwischen hölzernem Sattel und geschnitztem Schwanz. Es war ein bißchen schwierig, sich da festzuhalten, aber so wild würde der Ritt ja nicht werden.
Ehe er wieder Schwung holte, drehte sich der Dicke halb um und sagte über die Schulter: «Schumm, mein Name!»
«Klipp», erwiderte ich und ersetzte eine Verbeugung durch Kopfnicken.
«Aha», sagte Schumm. «Kann’s losgehn?»
«Los!» sagte ich.
Wir schaukelten. Nichts splitterte, nichts knackte – nur die Pflastersteine unter den eisernen Kufen knirschten.
«Hoho!» rief Schumm, «drei Zentner! Das kriegen sie nicht kaputt!» Er bremste den Schwung, stieg ab und tätschelte dem Holzgaul den Hals, als ob er gerade im Grand National als Sieger durchs Ziel gegangen wäre.
Ich war ebenfalls abgestiegen und stand rum, bis mir einfiel, weshalb ich eigentlich hier war. «Ich komme wegen meines Autos, Herr Schumm», sagte ich. «Es klappert so komisch …»
«Gucken wir uns mal an», meinte Schumm, gab dem Gaul noch einen Klaps aufs Hinterteil und watschelte vor mir her durch die Sonnenblumen und an den Autowracks vorbei zur Werkstatt.
Der Händewäscher hatte sich inzwischen den Oberkörper freigepellt und bearbeitete Hals und Schultern mit Seife und Bürste. Sein weißer Rücken wirkte vor dem rußigen Hintergrund seltsam gespenstisch.
«Lassen Sie ’n mal an!» befahl Schumm.
Ich gehorchte.
Er verzog das Gesicht und winkte mit beiden Händen ab. «Neuer Motor!»
«Du grüne Neune!» stöhnte ich und stieg aus.
Er fing an, mir zu erklären, was da kaputt war. Ich nickte mehrmals und hatte den Eindruck, er glaubte wirklich, ich verstünde, was er mir erklärte. Das Resultat war so:
«Ich kann frühestens Montag früh den Austauschmotor holen. Dann müssen wir ihn einbauen … Na ja – zwei bis drei Stunden. Also … Vor Montag nachmittag, bester Herr, können Sie mit dem Wagen nicht weiter!» Er kramte Zigaretten aus seiner Hosentasche, bemerkte meinen sehnsüchtigen Blick und bot mir eine an.
«Danke», sagte ich und wußte nicht, was ich tun sollte. Abgesehen von meinem gestörten Plan, ein langes, faules, vielleicht ein bißchen unkeusches Wochenende in Frankfurt zu verbringen – Inge Kruse hieß das Mädchen, nicht Ingrid –, abgesehen davon also hatte ich nicht so viele Tausender auf der hohen Kante, daß ich mir mal eben so einen neuen Motor leisten konnte, wie andere sich vielleicht ein paar Handschuhe leisten. «Was kostet das denn etwa?» fragte ich.
«Alles in allem ungefähr achthundert», sagte er.
«‹Ungefähr› ist wackelig», kritisierte ich. «Das können siebenhundertneunzig oder auch achthundertfünfundachtzig Mark sein. Ich zähle meine Hunderter noch, Herr Schumm.»
«Verstehe … Also gut – höchstens achthundertzwanzig. Zufrieden?»
«Zufrieden? Sie sind gut! Mal so eben einen knappen Tausender … Ist das wirklich nicht zu reparieren?»
«Nee!» Er schüttelte nachdenklich seinen weißhaarigen Kopf.
Ich kapitulierte. «Und was mach ich bis Montag?» fragte ich. «Kann man hier irgendwo wohnen?»
«Im Trocadero!» schrie der eingeseifte Halbnackte.
«Du hältst den Mund, Alwin!» schimpfte Schumm.
«Trocadero?» fragte ich.
«Unsinn», sagte der Meister; das ist so ’n … so ’n … Na ja, im Anbau des Gasthofs Zur Linde … Also nichts zum Wohnen!» Er war ärgerlich. «Quatschkopf!»
Ich hatte bei dem Wort ‹Trocadero› eine Assoziation von rotem Licht, Cancan, Champagnergläserklingen, Sünde in Plüsch und so weiter, konnte mir das aber zwischen Fachwerkhäusern, Misthaufen und Rübenfeldern schwer vorstellen. Vielleicht hatte ja auch der Wirt vom Linden-Trocadero nicht die richtige Einstellung.
«Gehen Sie mal zu meinem Schwager», sagte Schumm; «der hat oben drei Gästezimmer neu ausgebaut. Busemann, Arthur Busemann. Wildes Wässerchen.»
«Wildes …?» fragte ich vorsichtig. Bei Männern, die auf Schaukelpferden reiten, weiß man nie …
«Ja, Wildes Wässerchen!» bestätigte Schlossermeister Schumm. «So heißt das Gasthaus; drüben, oberhalb der Kirche, wo früher die Mühle war. Direkt am Bach. Deshalb Wildes Wässerchen. Sauber und preiswert. Sagen Sie, daß ich Sie schicke. Zu essen gibt’s da auch. Die Erna, was meine Schwester ist, kocht großartig.»
«Okay», sagte ich, denn mein Hunger hob bei diesem Thema neugierig seine neun Köpfe. Ich nahm meine Siebensachen aus dem Auto, schloß ab und gab Schumm den Schlüssel. «Wie wird das denn mit dem Bezahlen am Montag, Herr Schumm? Ich hab ja mein Vermögen nicht bar in der Westentasche. Kann ich Ihnen dann auch einen Scheck geben, oder wie?»
«Sicher», sagte er. «Was sind Sie denn von Beruf?»
«Beamter», erwiderte ich.
«Beamter?» Er schob verdutzt die Unterlippe vor. «So sehen Sie gar nicht aus!»
«Schönen Dank», sagte ich, hob mein Köfferchen, warf mir den Mantel über die Schulter und ging zum Wilden Wässerchen.
Arthur Busemann, der Wilde Wässerchen-Wirt, sah aus, als sei er soeben einem Kinderbilderbuch entsprungen. (Der Wirt vom Wilden Wässerchen rollt jeden Morgen Fässerchen, davon ist er so groß und schwer, zwei Zentner wiegt er und noch mehr …) Er stand, den Kragen des überdimensionalen weißen Hemdes offen, die Ärmel hochgekrempelt, so daß man den auf seinen linken Arm tätowierten Anker sah, den er sich in seiner Marinezeit als Erinnerung hatte anfertigen lassen – er stand also mit großem rotem Gesicht hinter der Theke und blickte mich, als ich die neu getäfelte, frisch bemalte Gaststube betrat, aus wasserhellen kleinen Augen an.