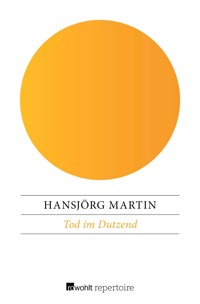9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Mein Blick fiel auf die Handtasche des Mädchens. Ich fingerte am Verschluß herum und fuhr zusammen, als er mit unerwartet lautem KLICK! aufsprang. In der Tasche roch es nach gutem Parfum, und es herrschte einige Unordnung. Zwischen allerlei Krimskrams lag ein kleiner Spiegel; er sah halb aus seiner Saffianhülle hervor. Ich wollte ihn ganz hineinschieben, aber es gelang nicht. Also zog ich ihn völlig heraus und schüttelte die Lederhülle. Ein zerknicktes Foto fiel heraus. Es zeigte einen jungen Mann in Wehrmachtsuniform. Auf der Rückseite stand: ‹Für Tamara. H. B.› Warum ich das Bild hastig einsteckte, ich hätte es in diesem Augenblick nicht zu begründen vermocht. Weil ich die Besitzerin dieser Handtasche tot im Zug aufgefunden hatte? Weil ich sicher war, ihr Gesicht irgendwo einmal gesehen zu haben? Ich wußte es selber nicht.» Es ist auch wirklich schwer einzusehen, warum sich ein junger Werbekaufmann völlig unaufgefordert in die Ermittlungen einschaltet, die der Tod einer Unbekannten auslöst. Er will auch schon aufgeben. Aber dann sieht es auf einmal aus wie Selbstmord. Er wird neugierig, fragt, stöbert – und schöpft Verdacht: Ist die junge Ausländerin etwa ermordet worden? Dann wäre die Aufklärung endgültig allein Sache der Polizei. Aber da kann er schon nicht mehr zurück, weil er sich zu weit vorgewagt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Kein Schnaps für Tamara
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Mein Blick fiel auf die Handtasche des Mädchens. Ich fingerte am Verschluß herum und fuhr zusammen, als er mit unerwartet lautem KLICK! aufsprang. In der Tasche roch es nach gutem Parfum, und es herrschte einige Unordnung. Zwischen allerlei Krimskrams lag ein kleiner Spiegel; er sah halb aus seiner Saffianhülle hervor. Ich wollte ihn ganz hineinschieben, aber es gelang nicht. Also zog ich ihn völlig heraus und schüttelte die Lederhülle.
Ein zerknicktes Foto fiel heraus. Es zeigte einen jungen Mann in Wehrmachtsuniform. Auf der Rückseite stand: ‹Für Tamara. H. B.›
Warum ich das Bild hastig einsteckte, ich hätte es in diesem Augenblick nicht zu begründen vermocht. Weil ich die Besitzerin dieser Handtasche tot im Zug aufgefunden hatte? Weil ich sicher war, ihr Gesicht irgendwo einmal gesehen zu haben? Ich wußte es selber nicht.»
Es ist auch wirklich schwer einzusehen, warum sich ein junger Werbekaufmann völlig unaufgefordert in die Ermittlungen einschaltet, die der Tod einer Unbekannten auslöst. Er will auch schon aufgeben. Aber dann sieht es auf einmal aus wie Selbstmord. Er wird neugierig, fragt, stöbert – und schöpft Verdacht: Ist die junge Ausländerin etwa ermordet worden? Dann wäre die Aufklärung endgültig allein Sache der Polizei. Aber da kann er schon nicht mehr zurück, weil er sich zu weit vorgewagt hat.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Tamara Maniouk
eine Tote zweiter Klasse.
Hans Obuch
ein Werbefachmann mit romantischen Regungen.
Kommissar Burwinkel
ein Beamter ohne romantische Regungen.
Krim. Ass. Müller
ein Beamter – Punkt.
Heidler
ein frommer Prokurist.
Roth
ein farbloser Kleinstadtjournalist mit hohem Blutalkoholgehalt.
Wilhelm Bricks
ein ungekrönter König.
Elvira Bricks
ein Untertan, der einen Fehler macht.
Udo Bricks
ein gutaussehender Schwachsinniger.
Hanno Bricks
ein armer Reicher.
Cora Stein
ein Pfauenauge.
Fabrizius
ein Maler, der an einem Porträt stirbt.
Karlchen
wider Erwarten ein schönes Mädchen.
Mowgli
wider Erwarten kein Frosch.
Diese Geschichte spielt in Norddeutschland im Jahre 1951.
Das war – zur Gedächtnisauffrischung soll es erwähnt werden – jene Zeit, in der es in unserem Land schon wieder alles gab: Butter, Kaffee, Zigaretten, Schlemmerlokale, Patrioten und Lokalpatrioten … nur, daß man sich noch nicht wieder so daran gewöhnt hatte.
Das heißt aber nicht, daß diese Geschichte nur damals passieren konnte. Sie könnte – mit unerheblichen Abweichungen – ebenso heute passieren, morgen und in abermals vierzehn Jahren.
Wedel/Holstein
im Herbst 1965
Hj M
AUF DEM WEGE ZUM BAHNHOF WAR mein Koffer viel schwerer als bei der Ankunft drei Tage zuvor, obwohl ich dasselbe drin hatte. Das kommt einem nach Fehlschlägen ja immer so vor. Jeder Weg wird weiter, jeder Koffer schwerer, wenn man von einem erfolglosen Unternehmen heimfährt.
Es war ein Spätnachmittag im Oktober. Das flache Land mit seinem ewigen Wind, der nach Torfrauch riecht und nach Salzwasser und Schlick, lag unter einem grauen Himmel, der zu meiner Laune paßte, wie extra dafür gemacht.
Der Zug wurde hier eingesetzt, war aber noch nicht im Bahnhof. Ich konnte die Wagen draußen auf einem Abstellgleis in der Dämmerung stehen sehen. Es war zu kalt und zu trist, um die halbe Stunde bis zur Abfahrt auf dem Bahnsteig auf und ab zu gehen, also setzte ich mich in dem muffigen Bahnhofsrestaurant auf eins der plüschbezogenen Sofas, direkt unter einen Stahlstich, der den glorreichen Untergang eines kaiserlichen Kriegsschiffes der Nachwelt überlieferte.
Ich bestellte mir bei dem Wirt, der nach Bratkartoffeln roch und nach Rheuma aussah, einen großen Korn. Der Korn ist das Beste in jener Gegend: Klar, sauber und süffig. Er schmeckt nach Sommer und Wiese und ein wenig nach Rauch und überhaupt so, daß ich den Bauern beinahe verstehen kann, der sich – so erzählt die Legende – davon zweihundert Flaschen gekauft, damit seinen Badezuber gefüllt und sich darin selbst ins Jenseits befördert haben soll.
Nur das Etikett auf den blaugrünen Flaschen wird mich zeitlebens stören, denn da ist groß der Name des Mannes zu lesen, bei dem ich in diesen drei Tagen nicht für fünf Pfennig Erfolg gehabt hatte, obwohl er Millionär ist. Dabei rechnete mein Chef damit, daß ich einen Halbmillionen-Auftrag mitbringen würde.
Der Name auf dem Etikett wird mich auch noch aus einem anderen Grunde zeitlebens stören. Er wird mir jedesmal ein kaltes Gruseln über den Rücken jagen … Aber das wußte ich noch nicht, als ich unter dem sinkenden Schlachtschiff saß und trotzig bei dem Bratkartoffelwirt den zweiten Doppelten bestellte.
Ganz allmählich besserte sich meine Stimmung. Ein mißglückter Auftragsbesuch war schließlich kein Beinbruch. Keiner hatte voraussehen können, daß ich der falsche Kontaktmann für diesen Kunden war. Erledigt. Die Konzentra-Agentur würde deswegen nicht Pleite machen.
Ich freute mich auf meine gemütliche Bude in Hamburg. Ich fing sogar an, mich auf den Kampf mit dem Chef zu freuen, der morgen vormittag zu bestehen sein würde, wenn ich Bericht erstatten mußte.
Mein Koffer war nicht mehr ganz so schwer, als ich über den Bahnsteig zum Zug ging, der jetzt zischend bereitstand. Es waren nur zwei oder drei Menschen auf dem Bahnsteig. Der Erste-Klasse-Wagen war völlig leer. Ich setzte mich in ein Raucherabteil. Den Mantel behielt ich an. Es war ziemlich kalt. Draußen gab’s noch Rufe, das Rattern eines Gepäckkarrens, ein Pfiff – dann fuhr der Zug an.
Ich wischte mit dem braunleinenen Fenstervorhang ein Guckloch auf die Scheibe, doch außer einzelnen vorbeihuschenden Lichtern – in der Nahe als Fenster verstreuter Bauernhäuser erkennbar – war nichts zu sehen als Schwärze. Die Heizung blieb kalt. Ich machte mir die Finger dreckig, als ich sie anfaßte. Zwei Stunden in diesem ungemütlichen Abteil zu frieren, hatte ich keine Lust, deshalb überwand ich meine Vier-Korn-Trägheit, hievte den Koffer aus dem Gepäcknetz und machte mich auf die Suche nach einem geheizten Wagen …
Das erste, was mir auffiel, war die Hand des Mädchens, das drei Wagen weiter vorn in einem Raucherabteil saß und zu schlafen schien. Wir waren etwa eine Viertelstunde unterwegs, und dieses Mädchen schlief, als schliefe es bereits seit Stunden. Na, vielleicht ist sie schon todmüde eingestiegen, dachte ich. Es gibt ja Leute, die sofort, wenn sie die Augen schließen, in tiefen Schlaf fallen.
Aber die Hand, die neben ihr auf dem Sitz lag, ganz weiß in dem bläulichen Licht – die Hand gefiel mir nicht. So schläft niemand, die Hand auf dem Handrücken liegend mit so krampfig gekrümmten Fingern.
Ich hatte das alles im Vorübergehen gesehen und gedacht. Erst zwei Abteile weiter setzte ich meinen Koffer ab und ging zurück. Mir wäre viel erspart geblieben, wenn ich nicht zurückgegangen wäre.
Ich schob die Tür auf und sagte: «Hallo!» – und noch mal, etwas lauter: «Hallo!» Das Mädchen rührte sich nicht. Ich trat ins Abteil und bückte mich, um das Gesicht der Schlafenden zu sehen, aber das gelang nicht, denn der Schatten, den das herabhängende Haar warf, tauchte das Gesicht ins Dunkel. Ein paar Sekunden war ich ratlos. Der Zug ratterte. Die Gestalt vor mir vibrierte im Rhythmus des Ratterns. Die Lokomotive pfiff – lang und heulend. Ich rief, um irgendwas zu tun, noch einmal: «Hallo!» Dann faßte ich das Mädchen an der Schulter und versuchte, es durch ein sanftes Rütteln zu wecken – nichts.
Schließlich überwand ich mich und griff nach der weißen Hand. Die Hand war sehr kalt. Behutsam strich ich dem Mädchen das Haar zurück, schob ihm Mittel- und Zeigefinger unters Kinn und hob den Kopf ein wenig an. Das Gesicht war noch weißer als die Hand. Die Augen waren geschlossen, am Lidrand des linken glitzerte eine Träne. Der Mund war offen. Ich hob mit dem Daumen meiner linken Hand vorsichtig eins der Augenlider und sah, was ich eigentlich von Anfang an gewußt hatte: Das Mädchen war tot.
Sie war älter, als ihre zarte Figur vermuten ließ, vielleicht schon Mitte bis Ende zwanzig. Zwei bittere Falten liefen von ihren Nasenflügeln an abwärts. Das Gesicht hast du doch schon mal gesehen, durchfuhr es mich. Aber ich wußte nicht, wo. Außerdem war ich viel zu sehr durcheinander, um richtig nachdenken zu können. Aber ich hatte das Gesicht schon gesehen.
Ich ließ ihren Kopf sinken. Die Haare fielen wieder herab – wie der Vorhang nach dem letzten Akt einer Tragödie.
Kalt war’s in dem verfluchten Zug.
Ich setzte mich der Toten gegenüber, um zu überlegen. Doch ich kam nicht dazu, denn der Zug fuhr mit kreischenden Bremsen in eine Station ein. Als er ruckend hielt, rutschte das Mädchen noch weiter in sich zusammen.
DER RAUM, IN DEM ICH SASS, ROCH NACH RUSS, Staub, Scheuerseife und kaltem Zigarrenrauch. Ich war durch eine Tür hereingekommen, an der DIENSTRÄUME – BETRETEN UNTERSAGT! stand. Welchen Dienst dieser Raum verrichtete oder welcher Dienst in ihm getan wurde, war mir vorerst unklar. Ein halbes Dutzend Schränke stand an den graugetünchten Wänden. Eine Deckenlampe mit grünem Schirm verbreitete geradesoviel Licht, daß man an der Rentabilität der Eisenbahn zu zweifeln begann. Auf einem Schreibtisch, der vor sechzig Jahren neu gewesen sein mochte, brannte eine ebenso trübe Schreibtischlampe und beleuchtete eine Thermosflasche, ein abgenutztes Stempelkissen, einen Aschenbecher aus Gußeisen, die untere Hälfte einer Muschel darstellend, einen flachen Stapel irgendwelcher Papiere, denen man den Gebrauch ansah – und die zierliche Handtasche des toten Mädchens.
Die Tote selbst hatten zwei Männer in Bahnpolizei-Uniform auf einer Tragbahre, sorgsam zugedeckt, in einen nebenan liegenden Dienstraum gebracht. Die Tür, die dahin führte, stand einen Spalt breit offen. Es war heller dort. Vielleicht, daß da ein Obereisenbahner oder Haupteisenbahner Dienst tat, während hier, wo ich saß und gehorsam wartete, nur ein Untereisenbahner beruflich beheimatet war und im Scheine der ihm zustehenden zwei 15-Watt-Beleuchtungskörper seine Pflicht erfüllte.
Stimmengemurmel drang von nebenan herüber. Alle paar Minuten guckte einer der Uniformträger durch den Türspalt zu mir herein. Ich kam mir vor, wie sich ein Marsmensch – falls es welche gibt – vorkommen wird, wenn er mal auf die Erde gerät. Irgendwas an mir mußte sehr seltsam sein. Oder sie waren nur böse, daß ich ausgerechnet ihnen die Tote gemeldet hatte. Und nun berieten sie nebenan, wie sie mich dafür strafen könnten – und deshalb guckte immer mal einer, damit ich nicht durch die Lappen ging.
Ich war nicht besonders ärgerlich, denn ich hatte ja gewußt, daß es Scherereien geben würde, als ich aus dem Abteilfenster dem Stationsvorsteher zurief, was los war. Natürlich war ich in Versuchung gewesen, das tote Mädchen sitzenzulassen, meinen Koffer zu nehmen und mich zu verdrücken. Aber sie hatte, auch in ihrem Tod, so etwas Hilfloses, eine so rührende, einsame, schutzsuchende Weiblichkeit, daß ich’s – so albern das klingt – einfach nicht übers Herz brachte, davonzulaufen und mich nicht um sie zu kümmern. Außerdem kannte ich ihr Gesicht irgendwoher. Es wollte mir nur nicht einfallen, woher, so sehr ich auch darüber nachdachte.
Draußen erklang das Tatütata eines Polizei- oder Feuerwehrwagens. Zwei Minuten später kamen vier Männer durch den Untereisenbahner-Dienstraum, denen man die Amtlichkeit ansah. Sie nahmen keine Notiz von mir. Der letzte stieß mit dem Foto-Stativ, das er schleppte, gegen einen der vielen alten Schränke.
Der Schrank knarrte, und knirschend öffnete sich seine Tür. Soweit es die Beleuchtung erlaubte, konnte ich viele merkwürdige Dinge sehen. Einzelne Handschuhe lagen in den Fächern, jeder mit einem Anhängeschildchen versehen, Frühstücksdosen aus Blech und Emaille, Geldbörsen, Brillen, eine Zahnprothese, einige Bücher, Regenschirme vieler Art, Größe und Farbe, Turnschuhe, Kleidungsstücke, Mützen, Hüte – Schwemmgut vom Menschenstrom. Ich saß also im Fundbüro.
Gerade wollte ich, um die Zeit zu überbrücken, mir irgendeine Geschichte ausmalen, irgendein Schicksal ausdenken, das in Verbindung mit dem verlorenen Gebiß stand – oder mit dem hellen Sommerhut dort im Schrank … da kamen zwei der amtlichen Herren in Zivil von nebenan. Sie kamen auf mich zu.
«Burwinkel», sagte der eine, ein Mann von etwa fünfzig mit einem breiten, vertrauenerweckenden Gesicht. Dazu machte er eine Andeutung von Gruß-Verbeugung.
Ich stand auf und sagte meinen Namen.
Der zweite Mann äußerte sich gar nicht. Er sah mich nur an. Ich mochte ihn nicht. Er war klein und gedrungen und – wie viele kleine Männer – zunächst mal ärgerlich auf mich, weil ich einsachtzig bin. Zudem hatte er ein Gesicht, dem man ansah, daß er brutal sein konnte, wenn es ohne Risiko für ihn war. Er hatte einen weichen, konturlosen Mund und ein Kinn, das eine Spur zu rund war.
«Behalten Sie bitte Platz», sagte der Mann namens Burwinkel. «Wir sind von der Kriminalpolizei. Man hat uns gerufen wegen der Toten, die Sie gefunden haben.»
«Ja», sagte ich, wartete eine kleine Weile und fuhr fort: «Und was kann ich für Sie tun?»
«Wenn Sie uns noch mal erzählen wollen, wie Sie die Tote fanden, bitte!»
Ich erzählte. Mir ging es dabei, wie es einem immer mit dem Erzählen außergewöhnlicher Erlebnisse geht. Mit jeder Wiederholung richtet man zwischen sich und dem Geschehnis eine neue Wand auf. Der Bericht wird farbiger – aber die Sache selbst wird blasser, verliert an Atmosphäre, an Spannung, an Wirklichkeit. Die Worte, Formulierungen, Sätze schaffen eine neue Wahrheit, die dem Ereignis zwar angemessen ist wie ein guter Schneideranzug – die aber die Haut verbirgt.
Als ich fertig war und meinen Worten noch nachlauschte, sagte der kleine Kriminalbeamte mit dem weichen Kinn:
«Kennen Sie die Tote?»
«Ja …» begann ich spontan, erschrak vor seinem plötzlich verkniffenen Blick, verhedderte mich und stotterte: «Oder vielmehr … eigentlich nein … Also nein. Nein!»
«Ja, was denn!» sagte er – und seine Stimme paßte zu meinem Eindruck von ihm: «Ja – oder nein?»
«Also – nein», sagte ich und sah den Dicken an, der Burwinkel hieß und ein klares Gesicht hatte.
«Aber wieso haben Sie dann erst …» Der Kleine ließ nicht locker.
«Nu lassen Sie’s gut sein, Müller», brummelte besänftigend der Dicke.
Müller, dachte ich, auch das noch! Der muß ja Komplexe haben!
«Ich halte das für wichtig», beharrte Müller hartnäckig. Ich fühlte, daß er im Geiste mit dem Fuß aufstampfte.
«Also gut …» Burwinkel ließ ergeben die Augenlider sinken.
«Wieso haben Sie erst ‹ja› gesagt?» fragte er mich. «Sie kennen die Frau doch nicht? Oder?»
Es reizte mich, diesen Müller auf die Palme zu bringen. «Doch», sagte ich. «Ich kenne sie – und ich kenne sie nicht.»
«Was soll das, Herr … Herr …» der Dicke suchte.
«Obuch», erinnerte ich ihn.
«… Herr Obuch?» fuhr er fort. «Wissen Sie, wie sie heißt?»
«Nein», sagte ich, «ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gesicht schon gesehen – aber ich kann mich nicht erinnern, wo das gewesen ist.»
«Das ist aber komisch!» bemerkte der kleine Müller bissig.
«Na ja», meinte Burwinkel, «sowas ist mir auch schon passiert … Was haben Sie denn in Endwarden gemacht?»
Ich sagte ihm, ohne auf Müller zu achten, daß ich als Mitarbeiter der Hamburger Werbe-Agentur Konzentra drei Tage lang mit der Firma Bricks – Bricks Korn – stets vorn! verhandelt hätte.
«Hatten Sie Erfolg?» warf Müller ein.
«Nein», gab ich zurück und war drauf und dran, ihm eine an den Hals zu hauen, weil er die Mundwinkel verzog, als ob er sagen wollte: ‹Kein Wunder!›
In diesem Augenblick ging die Betreten-verboten-Tür wieder auf, und ein großer Mann mit weißem Haar und randloser Brille kam herein.
«’n Abend, Kommissar!» rief er.
«Schön, daß Sie kommen, Doktor», sagte Burwinkel und gab ihm die Hand. Der Doktor nickte dem kleinen Müller beiläufig zu und sah mich an.
«Ist das der Patient?» fragte er.
«Nee!» Burwinkel lachte. «Der ist noch zu lebendig für uns. Nebenan, wenn ich bitten darf.»
Er ging, vom Arzt und von Müller gefolgt, auf die Nebenzimmertür zu und rief mir über die Schulter zu: «Warten Sie noch ’n Moment bitte!»
Ich nickte, setzte mich wieder auf den Stuhl neben dem klapprigen Schreibtisch und zündete mir eine Zigarette an. Sie hatten die Tür hinter sich zugemacht.
Mein Blick fiel auf die zierliche Handtasche des toten Mädchens. Ich angelte sie mir, fingerte an dem Verschluß herum und fuhr richtig ein bißchen zusammen, als er mit einem unerwartet lauten Klick! aufsprang. Die Tasche roch nach gutem Parfum, und es herrschte einige Unordnung. Aus dem Wirrwarr leuchtete mir ein vergoldetes Lippenstiftetui entgegen; da waren ein paar Geldscheine und einzelne Münzen, eine Packung französischer Zigaretten, Zündhölzer, Kämmchen, Taschentuch, ein leeres Fläschchen Nagellack, ein kleiner Spiegel … der Spiegel guckte aus einer schwarzen Saffianlederhülle heraus; ich wollte ihn richtig hineinstecken, aber da war irgendein Widerstand. Also zog ich ihn vollends heraus und schüttelte die Lederhülle.
Ein zerknicktes kleines Foto fiel heraus. Es zeigte einen jungen Mann in Wehrmachtsuniform. Hintendrauf stand: Für Tamara. H.B.
Warum ich das Bild hastig einsteckte, die Tasche zuschnappen ließ und sie auf den Tisch warf wie eine heiße Kartoffel – ich hätte es in diesem Augenblick nicht zu begründen vermocht. Weil ich die Besitzerin der Handtasche tot im Zug gefunden hatte? Weil ich immer sicherer war, ihr Gesicht irgendwo schon einmal gesehen zu haben? Ich wußte es selber nicht. Meschugge! wollte ich gerade denken, aber ich kam nicht mehr dazu. Burwinkel & Co. traten wieder ein.
«Tja, Herr Obuch», sagte Burwinkel, «ich glaube, wir sind soweit klar miteinander. Man wird Sie in absehbarer Zeit noch mal vernehmen, aber das kann in Hamburg geschehen. Was Sie vorhin den Kollegen von der Bahnpolizei zu Protokoll gegeben haben, ist ja wohl auch unterschrieben, nicht wahr?»
«Ja», sagte ich.
«Und Ihre Anschrift ist aufgenommen?» fragte Müller.
«Ja – natürlich!» sagte ich.
«Haben Sie sich ausgewiesen?» fragte er weiter.
«Ausgewiesen?» Ich schüttelte den Kopf.
«Darf ich Sie dann wohl mal um Ihren Personalausweis oder Ihren Paß bitten!» sagte er.
Den dicken Kommissar Burwinkel regte das auf. Er bohrte sich den Zeigefinger in die Backe, um nichts zu sagen. Er durfte – auch wenn er der Ranghöhere war – nichts sagen, denn Müller handelte gewiß vorschriftsmäßig und korrekt. Der würde es noch mal weit bringen – falls ihm nicht vorher einer, der weniger Selbstbeherrschung hatte als ich, den Schädel einschlug. Während er meinen Paß prüfte, fragte ich Burwinkel:
«Was ist denn mit dem Mädchen? Wissen Sie schon, woran sie gestorben ist?»
«Nicht genau», gab der Dicke zurück, froh, von dem peinlichen Benehmen seines Unterlings abgelenkt zu werden. «Der Doktor sagt, es sieht nach zuviel Schlaftabletten aus – Selbstmord vermutlich, wenn …»
«Darüber dürfen wir wohl dem Herrn Obuch im Augenblick keine Auskunft geben!» unterbrach Müller.
Burwinkel zuckte, als ob ihn eine Bremse gestochen hätte. «Tja …» sagte er. Dann gab er mir ostentativ die Hand.
«Gute Heimfahrt wünsch ich Ihnen … So was ist ja keine angenehme Unterbrechung. Aber Sie kriegen noch ’n Zug, der in Kiel Anschluß hat.»
«Danke schön, Herr Kommissar!» sagte ich, nahm von Müller meinen Paß zurück und erwiderte sein formelles Nicken mit einem Lächeln, auf dessen Gelingen ich stolz war, denn es fiel so spöttisch aus, daß Müller daran kauen würde wie an einem zu zähen Bissen Steak.
ALS ICH AUS DEM FUNDBÜRO-DIENSTRAUM mit meinem Koffer in die ebenso trübselige Schalterhalle des Kleinstadtbahnhofs trat, kam ein hagerer, ganz und gar grauer Mann auf mich zu. Sein Haar war grau, seine Augen waren groß und grau, seine Hautfarbe, sein Oberhemd, sein Anzug – alles war grau an ihm.
«Roth», sagte er, und ich war so verwirrt, daß ich «Wieso?» fragte.
«Ich heiße Roth», erklärte er. Es war kein schlechter Witz. Er hieß tatsächlich so. «Sie sind doch der Herr, der die Leiche gefunden hat, ja?»
«Ja», sagte ich und wartete, was nun kommen würde.
«Ich bin vom Endwardener Tageblatt», sagte er eifrig und sah mich von der Seite an, ob ich daran irgendeinen Makel finden würde. Ich nahm seine Eröffnung nur stumm zur Kenntnis. Mir wollte es immer noch nicht in den Kopf, daß ein so ausgesprochen grauer Mann ausgerechnet Roth hieß.
«Darf ich Sie vielleicht um ein paar Worte für unsere Leser bitten?» fragte er.
Ich nickte. Er fing an, mir leid zu tun. Er sah so nach Resignation aus, nach einer schlampigen Frau und fünf Kindern, die seine Ideale gebremst, überwuchert und vernichtet hatten, wie Unkraut ein Blumenbeet. Sicher soff er.
«Aber nicht hier», sagte ich. «Kommen Sie, ich lad Sie zu einem Schnaps ein. Gibt’s hier keinen Wartesaal?»
«Ja – ja, danke!» sagte er und schluckte. «Dort – gleich neben der Gepäckaufbewahrung …»
Wir gingen nebeneinander auf den Schnaps zu.
«Wissen Sie zufällig, wann noch ein Zug nach Kiel fährt?» fragte ich.
«Einundzwanzig-zehn», sagte er.
«Eine gute Stunde …» stellte ich seufzend fest und rechnete mir aus, daß ich vor zwei Uhr früh nicht zu Hause sein konnte. Vorausgesetzt, daß ich überhaupt noch Anschluß hatte.
Dieser Wartesaal war ein Zwillingsbruder des Wartesaales, in dem ich vor nunmehr anderthalb Stunden gesessen und meine Depressionen mit Korn fortgespült hatte. Es gab auch hier plüschbezogene Sofas und einen Wirt, der nach Rheuma aussah und nach Bratkartoffeln roch. Nur das künstlerische Moment war mehr alpin als maritim ausgerichtet.
Statt Bilder mit sinkenden Schlachtschiffen aus Deutschlands großer Zeit gab es handkoloriertes Alpenglühen, stramme Jägerburschen, wildzerklüfteten Fels erklimmend, und wunderbar naturgetreue Hirsche, die glutvollen Auges über die Bierhähne röhrten. Die nahrhaft aussehenden Sennerinnen auf dem einen Öldruck regten meinen Magennerv heftig an, und ich bestellte die Bratkartoffeln, nach denen der Wirt duftete, und Spiegeleier, zu denen mich der Anblick der untergehenden Sonne auf einem der Kunstwerke animierte.
Der griesegraue Herr Roth, zum Mitessen aufgefordert, winkte dankend ab – er habe schon. Aber die eiskalten doppelten Klaren, die der Wirt in beschlagenen Gläsern brachte, sah er so verliebt an, daß die Blicke der balzenden Seppeln auf den Gemälden dagegen wirkten, wie Ministrantenblicke bei der Wandlung.
Ich erzählte – nach dem ersten Glas, das zweite war schon bestellt – dem glücklichen Reporter eine schön ausgeschmückte Schauergeschichte für seine Gazette. Ehe ich damit fertig war, hatten wir den dritten Doppelten vor uns. Roth schrieb mit fliegendem Kugelschreiber alles, was ich sagte, in ein zerknautschtes Oktavheft. Seine grauen Wangen bekamen vor Korn und Eifer ein untergründiges Glühen.
Die Wirtstochter – das schloß ich aus der Familienähnlichkeit, denn sie war auch nicht schöner als der Alte – brachte mir meine Bratkartoffeln und die Spiegeleier. Ich bestellte noch ein Bier dazu. Für Roth auch eins. Sein Korn war schon verschwunden. Wenn er so schrieb, wie er soff, war er ein sehr flinker Reporter.
«Wohnen Sie hier?» fragte ich.
«Nein», sagte er, «in Endwarden.»
«So, in Endwarden … Aber woher wußten Sie von der Sache? Und wie sind Sie hergekommen?»
«Burwinkel, der Kriminalkommissar, ruft mich immer an, wenn was los ist. Und es sind ja nur fünfundzwanzig Kilometer. Das fahre ich in einer guten halben Stunde.»
«Aha», sagte ich. «Womit?»
«Mit dem Moped», erwiderte er. «Früher mußte ich mit dem Fahrrad los. Aber seit einem Jahr bezahlt mir der Verleger Kilometergeld. Davon kann ich das Moped halten.»
Ich stellte mir vor, wie er – mit drei Doppelten im Bauch – bei Nacht und Wind über die holprigen Landstraßen gondelte. Noch einen durfte ich, im Interesse seiner Kinder, nicht spendieren – obwohl Roth bis jetzt kaum was anzumerken war.
Als ob er meine Gedanken gelesen hätte, lächelte er plötzlich. Das Lächeln glitt über sein Gesicht, wie der tastende Scheinwerferstrahl eines Leuchtturms über unbewegte See im Nebel.
«Wenn Sie erlauben, Herr Obuch», sagte er, «lad ich Sie noch zu einem ein! Sie haben mir eine so gute Geschichte geliefert, da kann ich wenigstens zweihundert Zeilen draus machen. Das sind vierzig Mark – da ist schon ’ne Runde drin, nicht wahr!»
Eigentlich mochte ich ja keinen mehr, aber ich durfte ihn nicht kränken. Der Wirt brachte auf sein Zeichen die Gläser und nahm meinen abgegessenen Teller mit. Wir tranken schweigend. Vom Nebentisch stand ein junger Bursche auf, der dort mit einem verheult aussehenden Mädchen gesessen hatte, und ging mit wiegendem Breitwand-Color-Cowboy-Schritt zur Musikbox. Gleich darauf hörten wir die erschütternde Verkündung der Tatsache, daß Liebe in der Prärie was ganz Besonderes sei, denn die vergißt du nie … und so weiter. Mitgeteilt wurde das von einem Sänger, dessen Stimme mehr nach Schrebergarten als nach Prärie klang – von der Liebe ganz zu schweigen. Als der Sänger ausgeliebt hatte, opferte der Kleinstadtcowboy noch mal zwanzig Pfennig. Das Geräuschgerät knarrte und dann schnädderätängte ein Marsch los, der mich fast vom Sofa geworfen hätte. Preußens Gloria oder so was in der Preislage. Ich dachte gerade, daß die ewigen Werte unserer Kultur eben doch unvergänglich sind – da fiel mir etwas ein. Ich holte das Foto aus der Brusttasche, sah mir den schmucken Krieger an und wollte es Roth gerade zeigen, als er mich fragte:
«Was haben Sie denn in Endwarden gemacht?»
«Ich hab mit dem Korn-Bricks um eine halbe Million gerungen», sagte ich.
Roth blinzelte ungläubig, und ich erläuterte ihm meinen Schnack.
«Wenn wir uns eher kennengelernt hätten», sagte er, «hätt ich Ihnen vielleicht helfen können. Mein Schwager ist Prokurist bei Bricks.»
«Schade», sagte ich.
In zehn Minuten fuhr mein Zug. Die Stunde war mit Hilfe von Roth, Schnaps und Spiegeleiern schnell vergangen.
«Wenn mein Chef es nicht aufgibt und noch mal ’n Versuch macht», sagte ich, «dann kommen wir auf Ihr Angebot zurück. Herr Roth. Schönen Dank erst mal!»
«Die Bricks sind schwierige Leute», sagte er nachdenklich und spielte mit seinem leeren Kornglas.
«Weiß der Kuckuck, ja!» pflichtete ich bei. Dann schob ich ihm das kleine Foto hin. «Kennen Sie den zufällig?»
Er hielt es sich vor die grauen Augen, sah mich dann, ohne den Kopf zu bewegen an, und fragte:
«Steht der in irgendeinem Zusammenhang mit der Toten?»
«Ich weiß nicht», sagte ich vage.
Er gab mir das Foto zurück. «Nein …» Aber er sah mich dabei nicht mehr an. Er war ein miserabler Lügner. Und unvermittelt sagte er ganz leise:
«Seien Sie um Himmels willen vorsichtig, Herr Obuch!»
«Warum?» wollte ich wissen.