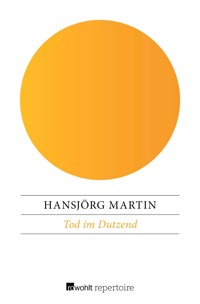9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ladicke ist tot: Jemand hat ihm eine Papierschere in den Hals gestoßen. Und jetzt stellt sich heraus, daß er nicht nur ein großer Weiberheld, sondern auch ein kleiner Heiratsschwindler gewesen ist. Im Nebenberuf, sozusagen – weil seine Passionen zu kostspielig waren für das Einkommen eines Warenhaus-Abteilungsleiters. Und jetzt liegt er also tot in seinem Büro. Oberkommissar Leo Klipp von der Hamburger Kripo findet in der umfänglichen Liebesbrief-Korrespondenz des Toten ein Schreiben, in dem nicht von Liebe die Rede ist: Unterlassen Sie in Zukunft jeden Versuch, sich mir wieder zu nähern! Ich empfinde das nach dem Geschehen als unverschämte Belästigung und werde mich bis zum Äußersten dagegen wehren. F. J. F. J., stellt sich rasch heraus, ist Franziska Jansen, die Substitutin in der Spielwarenabteilung. An ihrem Kostüm findet sich Blut von der Blutgruppe des Ermordeten – hat sie sich ‹bis zum Äußersten gewehrt›? Es findet sich auch eine Kollegin, die sich an einen Streit zwischen Ladicke und der Jansen erinnert. Nur Franziska findet sich nicht: Sie ist unmittelbar nach dem Mord nach Jugoslawien gereist – in den Urlaub. Oberkommissar Klipp fährt auch nach Jugoslawien. Als Urlauber getarnt, wohnt er im gleichen Hotel. Er flirtet mit der Verdächtigen, um sie unauffällig überwachen zu können. Er entdeckt manches, was für ihre Schuld spricht. Er sammelt emsig Beweismaterial. Und am Ende verliebt er sich in seine schöne Mörderin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Meine schöne Mörderin
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ladicke ist tot: Jemand hat ihm eine Papierschere in den Hals gestoßen. Und jetzt stellt sich heraus, daß er nicht nur ein großer Weiberheld, sondern auch ein kleiner Heiratsschwindler gewesen ist. Im Nebenberuf, sozusagen – weil seine Passionen zu kostspielig waren für das Einkommen eines Warenhaus-Abteilungsleiters. Und jetzt liegt er also tot in seinem Büro.
Oberkommissar Leo Klipp von der Hamburger Kripo findet in der umfänglichen Liebesbrief-Korrespondenz des Toten ein Schreiben, in dem nicht von Liebe die Rede ist:
Unterlassen Sie in Zukunft jeden Versuch, sich mir wieder zu nähern! Ich empfinde das nach dem Geschehen als unverschämte Belästigung und werde mich bis zum Äußersten dagegen wehren. F. J.
F. J., stellt sich rasch heraus, ist Franziska Jansen, die Substitutin in der Spielwarenabteilung. An ihrem Kostüm findet sich Blut von der Blutgruppe des Ermordeten – hat sie sich ‹bis zum Äußersten gewehrt›? Es findet sich auch eine Kollegin, die sich an einen Streit zwischen Ladicke und der Jansen erinnert. Nur Franziska findet sich nicht: Sie ist unmittelbar nach dem Mord nach Jugoslawien gereist – in den Urlaub.
Oberkommissar Klipp fährt auch nach Jugoslawien. Als Urlauber getarnt, wohnt er im gleichen Hotel. Er flirtet mit der Verdächtigen, um sie unauffällig überwachen zu können. Er entdeckt manches, was für ihre Schuld spricht. Er sammelt emsig Beweismaterial. Und am Ende verliebt er sich in seine schöne Mörderin.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Alfred Ladicke
bekommt Liebesbriefe, Aktfotos und schließlich eine Papierschere in den Hals.
Franziska Jansen
hat Streit mit ihm gehabt, Blut von seiner Blutgruppe am Ärmel und reist ins Ausland.
Gisela Zieroth
hat den Streit mitangesehen, reist gleichfalls ins Ausland und braucht keine Rückfahrkarte mehr.
Dr. Tüter
ist ein gewissenhafter Personalchef, aber ein Chef kann schließlich nicht alles wissen.
Erich Zieroth
ist vielseitiger, als es zunächst den Anschein hat, und entpuppt sich als lustiger Witwer.
Frau Fiebig
wird im entscheidenden Moment zur Hyäne, aber das hilft dann auch nichts mehr.
Stepanovic
zerstört, falls noch erforderlich, die Legende, derzufolge auf dem Balkan alle Beamten korrupt sind.
Oberkommissar Leo Klipp
gerät in Gefahr, die Legende zu zerstören, derzufolge deutsche Beamte immer korrekt sind.
Dies ist ein Roman; die hier geschilderten Ereignisse sind frei erfunden, und jede Ähnlichkeit oder Namensgleichheit mit realen Personen könnte nur auf einem Zufall beruhen.
1
Mein Wecker klingelte.
Ich ließ das außerordentlich hübsche Mädchen, von dem ich gerade träumte, sofort los und drückte dem rappelnden Teufelsding die Gurgel zu. Aber es klingelte weiter.
Ich brauchte acht Sekunden, um zu kapieren, daß es gar nicht der Wecker war, sondern das Telefon.
Halb fünf.
Ich stolperte aus dem Bett, stieß mit dem rechten großen Zeh an ein Stuhlbein, fluchte, erreichte hinkend und schimpfend den unbarmherzigen Apparat, hob ab und wollte «Klipp» sagen, aber es wurde ein Geräusch daraus, wie das Husten einer Kuh, morgens im Nebel, auf einer Weide hinterm Deich.
«Wer ist dort, bitte?» fragte eine muntere Männerstimme.
Ich räusperte mich in aller Ruhe, denn ich wußte nun schon, mit was für einem Anruf ich es zu tun hatte, und sagte dann, in fast bühnenreifem Wohllaut: «Hier spricht Klipp!»
«Schönen guten Morgen, Herr Oberkommissar», sagte die muntere Stimme, ohne die Schadenfreude verbergen zu können, die ihr Besitzer fühlte und weidlich auskostete. «Sie möchten bitte gleich ins Kaufhaus Weinheimer kommen.»
«So», sagte ich, «aber da ist noch geschlossen, nicht?»
«Es wird auch von Ihnen nicht erwartet, daß Sie dort was einkaufen …»
«Peter! Idiot!» schrie ich, denn ich hatte nun die Stimme erkannt. «Mußt du ausgerechnet mich …?»
«Tut mir leid, Leo», erwiderte er, und ich glaubte ihm davon keine Silbe, «aber es ist sonst keiner da, der so schnell am Tatort sein könnte. Dein Pech, daß du bloß zehn Minuten entfernt wohnst, tut mir leid!»
«Lüg nicht so schamlos!» sagte ich. Aber sein Argument leuchtete mir ein. «Was ist los?»
«Die Kaufhausputzfrauen haben einen völlig toten Herrn in einem der Büros gefunden. Sie haben den Pförtner gerufen. Der Pförtner hat die Polente gerufen. Die Herren Kollegen vom Peterwagen 13 haben das Präsidium angerufen. Das Präsidium hat bei mir hier oben angerufen, denn ich habe Nachtdienst. Ich rufe dich an – also …»
«Die amtlich vorgeschriebene Kettenreaktion, klar!» sagte ich. «Na, dann wollen wir mal. Weißt du noch was, was ich wissen muß?»
«Nee», sagte Peter, «nur was ich schon gesagt habe. Ach ja, erstochen worden ist der Herr.»
«Feiner Tod, wenn’s der Täter kann!» sagte ich.
«Zyniker!» sagte Peter.
«Soll ich früh um halb fünf vielleicht Romantiker sein?» fragte ich zurück.
«Morgenstund ist aller Laster Anfang», blödelte Peter.
«Bart!» sagte ich und legte auf.
Bis mein Kaffeewasser kochte, rasierte ich mich, schüttete mir ein paar Hände voll kaltes Wasser ins Gesicht und dachte, indem ich – immer noch hinkend – meine Siebensachen zusammensuchte, zum zweitausenddreihundertfünfunddreißigstenmal darüber nach, ob ich nicht doch besser etwas anderes geworden wäre.
Nächtliche Anrufe wären mir als Arzt allerdings auch nicht erspart geblieben, und Bäcker müssen jeden Morgen um halb drei oder noch früher aufstehen, als Fernfahrer kommt man überhaupt nicht ins Bett, und als Gastwirt erst, wenn die Schlafenszeit eigentlich vorbei ist. Vielleicht hätte ich ja doch Kommunalbeamter werden sollen, Vorsteher eines mittleren Katasteramtes. Herr Amtsvorsteher Klipp … Hilfe!
Ich trank meinen Kaffee, aß mit geringem Appetit meinen Toast und machte mich auf die Socken, ohne das Berufsproblem gelöst zu haben. Zehn Minuten vor fünf fuhr ich an der Straßenfront des Kaufhauses Weinheimer entlang, die trotz der frühen Montagmorgenstunde schon hell erleuchtet war, und bog in die schmale Gasse ein, die zum Nebeneingang und zum Verwaltungstrakt führt.
Vor dem Tor stand der Peterwagen 13, dahinter ein großer Mercedes in Repräsentationsschwarz, hinter diesem parkte ich meinen bundesrepublikanischen Muli, grau, bescheiden, zuverlässig und strapazierfähig.
Ich ging auf das Tor zu, öffnete die kleine Tür im Tor und trat in die zugige Durchfahrt. Aus einem Glasgehäuse linker Hand kam ein schrumpliges Männlein heraus, das für die Pförtnermontur, die es trug, einige Nummern zu klein und schmalbrüstig war. Auch das Köpfchen paßte nicht unter die Schirmmütze mit den silbernen gekreuzten Schlüsseln vorn dran. Man hatte den Eindruck, daß nur die Ohren ein Verschwinden des Kopfes verhinderten.
«Sie wünschen bitte?» fragte das Männchen und setzte eine wichtige Miene auf.
«Kriminalpolizei», sagte ich.
Das ist das Zauberwort, das «Sesam öffne dich», vor dem sich alle Gesichter verändern, vor dem – mehr oder weniger schnell – alle Türen aufgehen, vor dem Gespräche verstummen, Großspurige kleinkariert und Bärenstarke kükenschwach werden.
Auch das Männchen unter dem Mützenschirm gab sein wichtiges Blicken auf, verwandelte sich im Handumdrehen in einen beflissenen Bürger und lispelte: «O ja! Jawoll! Sie werden bereits erwartet! Der Chef ist auch schon oben!»
«Welcher Chef?» wollte ich wissen.
«Herr Strackmeier, der Besitzer des Kaufhauses Weinheimer», erklärte das Männchen.
«Donnerwetter», staunte ich, «so früh? Na, dann wollen wir mal. Wo muß ich lang?»
«Gleich hier, den Gang», dienerte das Männchen, «rechts, und da ist der Fahrstuhl, bitte, sechster Stock, Sie müssen ihn selbst bedienen, bitte! Es ist noch niemand da … und ich darf nicht weg hier … oder soll ich telefonieren, daß Sie vielleicht jemand von oben …?»
«Nee», sagte ich, «danke schön, ich werd ja wohl noch alleine auf’n Fahrstuhlknopf drücken können, wie?»
«Aber sicher», lispelte das Männchen erschrocken, als hätte es Angst, mich gekränkt zu haben, «es ist ganz einfach …»
«Danke!» sagte ich und ging den beschriebenen Gang entlang und fand die Fahrstuhltür und drückte auf den Rufknopf, denn der Lift war gerade ganz oben, und wartete.
Es roch nach Warenhaus. Klar. Wonach hätte es sonst riechen sollen? Auf der Wand war eine Art Schwarzes Brett angeschraubt mit allerlei Bekanntmachungen. Die Tischtennisgruppe trainierte ab sofort freitags nach Geschäftsschluß, stand da angeschlagen. Der Betriebsarzt war dienstags und donnerstags im Hause. Personaleinkäufe über 300DM im Monat bedurften einer Sondergenehmigung des Personalchefs, soweit es sich nicht um Möbel handelte. Ein Kursus in erster Hilfe wurde veranstaltet von …
Da war mein Fahrstuhl. Ich stieg ein und drückte auf den Knopf mit der sechs. Der Fahrstuhl stieg so geschwind, daß mein Magen noch im Erdgeschoß war, als sich mein Körper schon im dritten Stock befand. Spielwaren, Möbel, Glas und Porzellan. Glücklicherweise wurde das im sechsten Stock durch scharfes Bremsen ausgeglichen, so daß wir zusammen aussteigen konnten, mein Magen, mein Körper und ich.
Das Pförtnermännchen hatte wohl mein Eintreffen telefonisch gemeldet, denn als ich den Fahrstuhl verließ, kamen drei Herren den Gang entlang auf mich zu, wie ein Empfangskomitee. Fehlten nur die Zylinder. Vornweg marschierte ein Glatzköpfiger mit englisch gestutztem Schnurrbart und randloser Brille, in einem sehr gut geschnittenen, dezent-grauen Zweireiher. Das war Herr Strackmeier. Der pflaumengroße Brillant an seinem rechten Mittelfinger verriet es.
«Strackmeier», sagte Herr Strackmeier und hielt mir seine Hand entgegen, die sich warm und feucht anfaßte. Na ja, Morde sind auch für Warenhausbosse nichts unbedingt Alltägliches. «Ihre Dienststelle hat Sie bereits angekündigt, Herr Oberkommissar», fuhr er fort, «es ist eine schreckliche …»
«Klipp», sagte ich, «lassen Sie den Titel bitte, Herr Strackmeier, er ist zungenbrecherisch.»
«Danke», sagte er, «sehr freundlich, Herr … Herr …»
«Klipp», half ich, «wie Klipp-Klapp oder Klippfisch.»
Strackmeier lächelte, was einen eleganten Goldzahn oben links ans Tages-, Pardon, Neonlicht brachte, und stellte mir die zwei anderen Herren vor, die stumm-devot im Hintergrund gestanden hatten.
Der eine war jung, hatte einen dümmlich-blasierten Ausdruck und war Strackmeiers Sohn. Der andere war in den Vierzigern, rotblond und der Personalchef mit dem schönen Namen Tüter. Dr. Tüter.
Die zwei sahen im Gegensatz zu ihrem Vater und Vorgesetzten recht unausgeschlafen aus. Der Sohn hatte einige dekorative Rasierschnitte am Kinn.
«Wie kommt es, daß Sie alle schon hier sind?» fragte ich.
«Der Pförtner hat mich – gemäß seinen Anweisungen – gleichzeitig mit der Polizei benachrichtigt», erläuterte Strackmeier senior. «Das war vor –» er sah nach der Armbanduhr – «vor fünfundvierzig Minuten, kurz nach Entdeckung der … des Toten. Ich wohne nur eine Viertelstunde entfernt, und Herrn Dr. Tüter, der am Wege wohnt, habe ich dann gleich mitgenommen.»
«Ach so», sagte ich. Es ärgerte mich ein bißchen, nicht vor den dreien hier gewesen zu sein. Aber die Peterwagen-Polizisten hatten ja bestimmt aufgepaßt, daß keiner an den Tatort kam. «Tja», sagte ich, «dann wollen wir mal!» Es fiel mir selbst auf, daß ich mich wiederholte.
«Bitte sehr!» sagte Strackmeier und wies nach hinten. Ich ging. Hinter mir versank der Fahrstuhl, gerade als ich mich umdrehte. Hier in der Büroetage roch es nicht nach Warenhaus, sondern nach Essen: kaltem Bratenfett, Kartoffeln, Kohl. Das kam daher, daß ein Teil des sechsten Stockwerks als Personalkantine diente. Das Empfangskomitee und ich wanderten schweigend den Gang entlang, bogen links in einen Nebengang ein und trafen dort auf einen Wachtmeister in Uniform, der vor einer Tür stand und gemütlich die Hand an die Mütze legte, als ich auf ihn zutrat und ihm, wie es das Reglement vorschreibt, meine Hundemarke zeigte.
Ich bat die drei Kaufhausleute, zu warten, und betrat mit dem Polizisten das Zimmer. An der Tür war ein Schildchen: Abteilung E, Ladicke, Bornemann, Kurz.
Der Raum, in den wir kamen, war ein Schreibzimmer mit Regalen voll Ordnern, zwei Schreibtischen, zwei Schreibmaschinentischen und zwei Türen – eine links, eine rechts. Beide waren offen. Vor der linken saß ein zweiter Polizist. Er stand auf und legte sehr zackig die Hand an die Mütze. Durch die rechte Tür konnte ich zwei Frauen in grauen Kitteln sitzen sehen, die mich ängstlich anstarrten.
Die beiden Polizisten wiesen gleichzeitig auf das linke Zimmer. Ich ging hinein. Im Schein einer scheußlich kalten Neonbeleuchtung lag der Tote zwischen Schreibtischstuhl und Schreibtisch. Er mußte sich im Fallen gedreht haben. Seine Augen starrten in die grelle Lampe. Neben seinem Kopf war ein großer, in den Teppich gesickerter, getrockneter Blutfleck. Mittendrin blinkte eine Papierschere. Der Tote hatte kein Jackett an. Sein Hemd war von der Stichwunde am Hals über den Kragen und quer über Schulter und Bauch blutgetränkt. Es roch dick nach Verwesung, und mir wurde für einen Augenblick flau.
«Machen Sie das Fenster auf!» sagte ich zu dem Polizisten, der neben mir stand.
«Ja, gerne!» sagte der und beeilte sich, meinem Befehl Folge zu leisten, während ich um den Toten herumging und mir einen ersten Eindruck zu verschaffen versuchte, wie das wohl vor sich gegangen sein mochte. Außer dem verschobenen Teppich unter dem Schreibtischstuhl war keine Unordnung im Zimmer. Es gab nicht die geringsten Anzeichen für einen Kampf. Opfer und Mörder mußten sich demnach gut gekannt haben.
Ich angelte meine Zigaretten aus der Tasche und bot den zwei Polizisten die Schachtel an. Sie griffen dankbar zu. Wir gingen alle drei in das Schreibzimmer und zündeten dort die Stäbchen an.
«Ist irgend jemand außer den Putzfrauen und Ihnen da drin gewesen heute morgen?» fragte ich.
«Aber nein», sagte der ältere Polizist mit leiser Entrüstung, «seit wir da sind keine Seele!»
Ich ging zum Schreibzimmerfenster und machte das ebenfalls auf, denn es roch auch hier nach Blut und Tod. Gegenüber war eine Brandmauer, auf deren schmutzigem Grau die frühen Sonnenstrahlen des Augusttages vergeblich Sommerstimmung zu zaubern versuchten.
Auf dem Gang draußen wurden Stimmen und Schritte hörbar. Es klopfte. Der jüngere Polizist öffnete. Der Fotograf war da, der Polizeiarzt, die Kollegen von der Spurensicherung – zusammen drängten sechs Mann herein. Ich sah zwischendurch die Gesichter der Warenhausleute auf dem Gang. Der Junior Strackmeier rauchte Zigarre. Der Zigarrenrauch verwischte seine blassen, verschwiemelten Gesichtszüge mit den roten Rasiermesserkratzern, so daß ich einen Augenblick das Gefühl hatte, Strackmeier junior stünde hinter Mattglas …
Wir drückten uns ringsum die Hände … daß sechs Männer so viele Hände haben, und so verschiedene Händedrücke!
Der Fotograf sagte: «Wo ist das Modell?»
«Nebenan», erwiderte der ältere Polizist.
«Riechst du es nicht?» fragte einer der Spurenleute.
Es begann die übliche wortlose, aber geräuschvolle Geschäftigkeit, nachdem der Fotograf seine vier, fünf Blitzlichtaufnahmen gemacht hatte. Bis dahin standen wir herum und dachten alle wahrscheinlich das gleiche: Wie schön ein Bett gerade in den frühen Morgenstunden ist, wie lange es noch dauern würde, bis wieder Freitag abend wäre – und so weiter. Eine Weile später klopfte es wieder. Herr Dr. Tüter brachte sich und die Herren Strackmeier in Erinnerung.
«Ja, gewiß», sagte ich, «wir haben Sie nicht vergessen! Aber es wird das beste sein, Sie warten in einem Ihrer Büros, ich komme dann schon.»
Jemand hatte die Tür zum rechten Zimmer zugemacht, in dem die beiden grauen Frauen saßen. Ich ging zu ihnen, nannte meinen Namen und bat sie, mir zu erzählen, wie sie den Toten gefunden hatten. Die eine sprudelte gleich drauflos. Sie hätte schon so eine Ahnung gehabt, daß heute was passieren würde.
«Soll mir bloß einer sagen, daß die Horoskope nich stimmen!» sagte sie mit ernstem Gesicht. «Lesen Sie heute mal die Zeitung, Herr Kriminalpolizist! Ich bin Krebs! Da steht ‹Aufregung im Beruf!› … na? wer sagt’s denn?»
Ich dämpfte sie vorsichtig und riet ihr, sich ihre Erfahrungen mit den Sternen für die Presseleute aufzuheben, die daraus möglicherweise eine Schlagzeile machen könnten. Als hätte ich den Teufel an die Wand gemalt, klopfte es, und der jüngere Wachtmeister steckte den Kopf durch die Tür: «Draußen sind vier Reporter, Herr Oberkommissar!» sagte er.
«Sollen ein kleines bißchen warten», ordnete ich an, «wir wissen noch nix! Sie sagen auch kein Wort, Wachtmeister, klar! Und auch Ihr Kollege …»
«Selbstverständlich», sagte der Polizist und verschwand.
Die Krebsfrau rutschte aufgeregt auf ihrem Stuhl hin und her. «Kommt dann auch mein Bild in die Zeitung?» fragte sie.
«Sicher!» sagte ich.
«Ach du meine Güte!» stöhnte sie. Aber es war eher ein Begeisterungsstöhnen als Entsetzen.
Der Inbegriff aller Schrebergärtner- und Putzfrauenträume würde in Erfüllung gehen: sie kam in die Zeitung. «Frau Pohlschmidt fand die Leiche!»
Alle würden sie darauf ansprechen. Alle: die Milchfrau, die Schlachtersfrau, der Gasmann, der Busschaffner – sicher sogar die alte Ziege von oben, die sonst immer tat, als wäre sie was Besseres, dabei war ihr Mann auch bloß Verkäufer, wenn auch in einer Handlung, wo Bilder verkauft wurden, aber na, der würde sie’s zeigen.
Ich unterbrach den Höhenflug ihrer Gedanken und zwang sie zu einem Kurzbericht ohne Sternengeflimmer und Titelseitenruhm. Es war nichts Besonderes. Sie hatte mit ihrem Hauptschlüssel geöffnet. Ja, die Tür war verschlossen gewesen. Nein, es steckte kein Schlüssel. Es roch so komisch, als sie reinkam. Sie wollte erst mal alle Fenster aufmachen, und als sie im linken Zimmer Licht machte, da lag Ladicke.
«Ladicke?» fragte ich. Ich hörte den Namen zum erstenmal, obschon es eine gute Viertelstunde her war, daß ich den toten Herrn in Augenschein genommen hatte.
«Na ja, die Leiche!» sagte die Krebsfrau.
Die Leiche war also Herr Ladicke; nun wußte ich es. Alfred Ladicke, Abteilungsleiter a.D. oder i.R. – je nach Wunsch. Seiner Dienstobliegenheiten hatte man ihn jedenfalls mittels einer Papierschere jählings enthoben …
Die zukünftige Tagesberühmtheit Emma Pohlschmidt hatte natürlich erst einmal geschrien. Daraufhin war die zweite Dame, den Besen in der Hand, herbeigeeilt. Sie hatte nicht geschrien, sondern, nach einem Blick auf die Bescherung, die schreckstarre Frau Pohlschmidt aus dem Zimmer gezogen, die Tür zugeknallt und – erstaunlich logisch handelnd – vom Schreibzimmertelefon aus den Pförtner angerufen. Der war, zusammen mit dem Aufseher über die Putzfrauengarde, in drei Minuten oben gewesen. Beide Männer hatten durch die Tür den Toten besichtigt und nach kurzer Beratung die Polizei und ihren obersten Chef angerufen. Weitere fünf Minuten später waren die zwei Peterwagenmänner da, sperrten das Mordzimmer ab und schickten Aufseher und Pförtner wieder an die Arbeit. Das war’s. Die zweite, klügere Putzfrau, eine junge, schmächtige Person mit einem resignierten Ausdruck, als sei sie an einen Säufer verheiratet, fing jetzt an zu heulen. Unter den Tränen quollen die harten grauen Linien ihres Gesichts ein wenig auf und machten sie fast hübsch. Sie sagte nicht viel außer «Jaja» und «Neinnein» und «So war das». Im übrigen nickte sie und sah mich ängstlich an. Als ich den beiden Zigaretten anbot, nahm sie eine, während ein flüchtiges Lächeln um ihren Mund spielte, und rauchte in tiefen Zügen. Die andere, die Krebsfrau, lehnte indigniert ab. Sie konnte es nicht erwarten, zu den Reportern zu kommen. Ich machte ihr das Vergnügen, indem ich sie beide hinausließ auf den Gang. Dort stand Strackmeier junior mit Dr. Tüter zwischen den laut redenden Zeitungsleuten, von denen zwei Sonnenbrillen trugen, obwohl der Gang nicht sonderlich hell war.
Als ich mit den zwei Putzfrauen auftauchte, ließen die vier Reporter den jungen Strackmeier und Dr. Tüter stehen wie schales Bier und fingen an, Fragen abzuschießen.
«Haben Sie schon einen Verdacht, Kommissar?» rief der eine.
Ich kannte ihn. Er vertrat die Revolverzeitung mit der größten Auflage.
«Ja», sagte ich, «ich glaube, es war Ihr Chefredakteur. Der Tote soll sich Ihr Blatt zum Einwickeln seiner schmutzigen Wäsche gekauft haben. Also ein Racheakt, wahrscheinlich.»
Die drei anderen grinsten; ich würde den Spott bestimmt heimgezahlt kriegen. Aber das kratzte mich nicht.
Dr. Tüter trat händeringend zu uns. «Ist es nicht zu verhindern, Herr Klipp, daß unser Haus genannt wird, bitte?» fragte er.
«Wenden Sie sich an Ihre Rechtsanwälte», riet ich ihm und wandte mich wieder an die Reporter: «Hier sind die beiden Frauen, die den Toten heute früh gefunden haben», sagte ich zu den Reportern und wandte mich der Zimmertür wieder zu.
«Gefunden habe ICH ihn als erste!» hörte ich die Krebsfrau noch laut sagen. Sie sagte es so, daß ich ihr Foto schon auf der Titelseite sah. Zweispaltig.
Drinnen lief alles den gut geölten Gang der Routinemaschinerie. Der erstochene Ladicke lag zwar noch immer auf dem Rücken, aber irgend jemand hatte ihm die toten Augen geschlossen, sie starrten nicht mehr ins grelle Neongeflimmer. Der Arzt kam auf mich zu.
«Er ist schon anderthalb oder zwei Tage tot», sagte er, «mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Die Pathologen müssen ihn erst in Augenschein und auseinandernehmen, ehe Sie genau erfahren können, wann er umgebracht wurde, Herr Klipp!»
«Klar», sagte ich, «danke, Herr Doktor. Aber daß er ermordet wurde, steht Ihrer Meinung nach fest? Selbstmord ist wohl ausgeschlossen?»
«Ausgeschlossen», sagte er. «Ich habe zwar schon die tollsten Sachen erlebt – aber daß sich einer halb von hinten mit einer Schere die Halsschlagader durchsticht, das ist unmöglich!»
Ich bedankte mich nochmals. Er fragte, ob er den Abtransport der Leiche schon veranlassen könne. Ich fragte die Leute von der Spurensicherung. Sie nickten. Der Arzt verabschiedete sich. Der Fotograf packte seine Apparate ein und ging ebenfalls. Beide – das sah ich, als sich die Tür öffnete – wurden draußen sofort von den Reportern umringt. Ich sah, wie der Arzt den Kopf schüttelte und abwinkend die Hand hob und wie der Fotograf ein geheimnisvolles Gesicht machte und, ebenfalls kopfschüttelnd, zum Fahrstuhl ging. Der Polizist schloß die offengebliebene Tür.
Ich ging nochmals um den Toten herum, hockte mich neben ihn und sah ihn an. «Irgendwas gefunden?» fragte ich die Spurensucher.
«Nichts!» sagte der eine, der gerade mit seinem grauen Puder die Schreibtischplatte einstäubte, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen.
«Haufen Abdrücke!» fuhr er fort. «Aber anscheinend alle vom Opfer. An der Schreibtischschublade und am Kalender sind ein paar andere. Aber das kann eine Sekretärin gewesen sein.»
«Die Schere?» fragte ich.
«Nicht die Bohne!» sagte er.
«Und in den Taschen?»
«Das übliche», gab ein anderer der Männer einsilbig Auskunft.
«Bis auf die Fotos …» ergänzte der dritte.
«Fotos?» fragte ich.
«Nun ja – er hat ’ne Menge Mädchenbilder in der Brieftasche. Alle Sorten. Älter, jünger – auch ’n paar nackichte …»
«Darf ich mal sehen?» sagte ich.
«So früh am Morgen?» frozzelte der eine.
«Morgenstunde ist aller Laster Anfang», zitierte ich meinen Kollegen Peter und erwartete eigentlich, daß einer der Spurenleute «Uff» sagen würde oder – wie ich vorhin – «Bart». Keiner sagte was. Sie wagten es wohl nicht, denn alle vier hatten vor kürzerer oder längerer Zeit in meinem Unterricht auf der Polizeifachschule gesessen und meinen erhabenen Lehren gelauscht, die ich dort zweimal wöchentlich verzapfte.
Einer reichte mir von dem säuberlich geordneten Stapel, den sie aus Ladickes Tascheninhalt gebaut hatten, eine Brieftasche. Feines, weiches Leder. Ziemlich neu.
«Wo trug er die?» fragte ich.
«Im Jackett. Das hing dort hinter dem Vorhang.»
Die Brieftasche enthielt neben der Mitgliedskarte eines Automobilklubs, dem Paß und einem Ausweis, der das Betreten und Verlassen des Kaufhauses auch außerhalb der Dienststunden gestattete, zwölf Mädchen- und Frauenfotos. Alle Größen und – wirklich – alle Sorten. Als ich sie, über die Breite der Skala erstaunt, durchblätterte und mit wachsendem Interesse die Widmungen auf den Porträt-, Brust-, Ganz- und Aktfotos las, grinsten mich die Spurenspezialisten erwartungsvoll an. Das war aber auch eine seltene Sammlung! Unter dem einen Aktfoto, das eine so voluminöse Dame reifen Alters zeigte, daß die Aufnahme besser in Breit- statt in Hochformat gemacht worden wäre – unter diesem Bauch- und Busenbild stand zum Beispiel: «Für Alfred, meinen Schwan, von seiner Leda!»
Auch Bildung kann Geschmackssache sein.
Alfred, der nun ausgeschwant hatte, war auch sonst nicht wählerisch gewesen.
«Für schöne Stunden der Zweisamkeit» hatte ihm ein ältliches Mädchen mit Silberblick – so silbern, daß der Betrachter vor Schreck oxydierte – ihr Brustbild verehrt, obschon sie eine ausgesprochene Flachländerin war. «Freddy, meinem Teddy, zur Erinnerung an die Balgereien am Ostseestrand» war ein Foto beschriftet, das eine pickelige Endzwanzigerin im Badedress mit dem Sexappeal einer Eskimogroßmutter zeigte. Und so ging’s weiter.
Eines der Bilder war ohne Widmung. Es zeigte einen Mädchenkopf im Profil, der zwischen den Ledas und Strandnixen wie ein Pfirsich in einer Kartoffelkiste wirkte. Ich drehte das Bild um und um, aber kein Buchstabe verriet, wofür Ladicke es von dem zauberhaften Geschöpf erhalten hatte.
Ich sah mir den Toten noch mal näher an. Nikotinfinger. Ein Durchschnittsgesicht, hübsch, glatt, etwas brutaler Mund, lange, dunkle, seidige Wimpern. Er trug ein Maßoberhemd, in seinem Jackett war das Zeichen eines der besten Schneider Hamburgs. Ich blätterte in den Papieren. Alfred Ladicke, Abteilungsleiter, vierunddreißig, unverheiratet, wohnhaft in Hamburg 13, Mittelweg – feines Viertel.
Alfred Ladicke, der Casanova aus Pöseldorf.
«Kein Schlüssel?» fragte ich.
«Doch», sagte einer der Männer, «Auto- und Wohnungsschlüssel, dort auf dem Schreibtisch, in dem Lederetui.»
«Wie lange haben Sie noch zu tun?» fragte ich nach einem Blick auf meine Uhr. Es war kurz vor sechs.
«Gute Stunde!» sagte der eine.
«Gut», sagte ich. «Ich fahre mal in die Wohnung des Herrn. Notieren Sie auf Ihrer Liste, daß ich die zwölf Fotos eingesteckt habe … vielleicht ist eine für mich dabei.»
«Die Leda!» feixte einer.
«Genau!» sagte ich. «Meine stille Leidenschaft und Sehnsucht so was, schon von Kindesbeinen an!»
An der Tür wandte ich mich um. «Aber einer von Ihnen bleibt bitte hier, bis ich wieder da bin!»
«Okay», sagten alle vier fast gleichzeitig.
Auf dem Gang standen noch immer die Reporter um die zwei Putzfrauen herum. Sie drehten mir die Gesichter zu, als ich herauskam.
«Kein Kommentar», sagte ich, «tut mir leid. Die Personalien des Toten können Sie haben, wenn Sie wollen.» Und ich gab sie ihnen, obschon sie die auch im Büro Dr. Tüters gekriegt hätten. Es war ein Trostbonbon an Stelle einer Information. Bei der jungen Putzfrau mit dem verhärmten Gesicht erkundigte ich mich nach den Chefgemächern.
Strackmeier stand aus einem Rehledersessel auf, als ich nach kurzem Klopfen in seinen Thronsaal trat. Der Junior stand am Fenster und rauchte bereits wieder oder immer noch Zigarre.
«Haben Sie schon jemanden im Verdacht?» fragte der junge Mann herablassend.
«Es wird wohl das tapfere Schneiderlein gewesen sein», sagte ich, was naturgemäß auf Unverständnis stieß, da sie ja nichts von der scharfen Schere wußten. Ich sagte, daß ich für etwa zwei Stunden wegführe und bat, niemanden in die Räume der Ladicke-Abteilung zu lassen.
«Unser Personal kommt erst acht Uhr fünfzehn», sagte Strackmeier.
«Bis dahin bin ich wieder da», verkündete ich, machte einen kleinen Diener und ging, um weiteren blöden Fragen zu entgehen, schnell davon.
Das Haus am Mittelweg war eines der alten Gründerzeithäuser, in denen man aus vier Zehn-Zimmer-Wohnungen zehn Vier-Zimmer-Wohnungen gemacht hat, weil das rentabler ist und weil die höhere Bürgerschicht, die früher hier zu Hause war, sich heute in Bungalows, 20 Kilometer außerhalb der Stadt, vornehm fühlt.
Ladicke wohnte im zweiten Stock. Der Fahrstuhl funktionierte nicht. Ich kletterte die breite Treppe hinauf, die von schön gedrechseltem Geländer flankiert war, und bewunderte die künstlerischen Treppenhaus-Wandgemälde, Motive aus dem griechischen Sagenschatz – prompt, zwischen erstem und zweitem Stock, auch eine Leda.
Obgleich diese gemalte Leda kein Meisterwerk war, hätte ich sie dem fotografierten Nackedeipudding aus Ladickes Brieftasche ohne langes Überlegen vorgezogen. Zunächst mal jedoch zog ich die Schlüsseltasche, die dem Toten gehörte, probierte an der großen Flurtür mit den Jugendstilornamenten, welcher Schlüssel paßte. Als ich die Tür gerade auf hatte, wurde unten Milchflaschengeklapper laut, und ich beeilte mich, um nicht unbegründetes Mißtrauen zu erregen. Der Flur war dunkel und wurde, als ich den Lichtschalter fand und betätigte, auch nicht sehr viel heller, denn über jede der drei Wandleuchten war ein dunkelrot bespanntes Schirmchen gestülpt, so daß ich mich eher im Entree eines Striptease-Lokals als in einer Wohnung zu befinden glaubte.
Das erste Zimmer, das ich öffnete, war ein schmaler langer Schlauch, in dem ein Bett mit abgezogenem Bettzeug stand, ein leerer Kleiderschrank und ein alter, ebenfalls leerer sogenannter Sekretär aus Eiche. Daneben lehnten ein zusammengeklappter Sonnenschirm und ein Liegestuhl. Eine Blocktür führte auf einen kleinen Balkon, der zur Gartenseite hinausging und von grüngestrichenen Blumenkästen mit blühenden Geranien eingerahmt war. Sonst gab’s da nichts zu sehen.
Das zweite Zimmer, in das ich vom Flur aus kam, war fast leer. Ein Tisch stand in der Mitte, rundherum sechs Stühle, ein Teewagen, eine schmale Anrichte, in der einige Teile Geschirr standen, ein Blumenständer mit ein paar kümmerlichen Kakteen am Fenster. An der einen Wand hing ein riesiger Druck nach einem niederländischen Freß-Stilleben, hübsch gerahmt. Der tote Hase im Vordergrund des Bildes sah mir zu, wie ich herumschnüffelte. Die Einrichtung des dritten Zimmers bestand vor allem aus einer quadratischen Couch von enormen Ausmaßen, die mit orangenem Wollflausch überdeckt war. Die frühen Sonnenstrahlen spielten auf dieser Couch Ringelreihen, und ich mußte für einen Moment die Augen schließen, so leuchtete das Orange. Der Fußboden war mit graphitfarbenem Spannteppich belegt, ein paar gemütlich aussehende Sessel standen herum, eine Musiktruhe, echt Rokoko imitiert, und eine Bücherwand vervollständigte das Interieur. Über der Couch hing – so groß hatte ich’s noch nie gesehen – das Oberteil einer nackten Negerin aus Ton oder Plastik, gegenüber der Bücherwand prangte ein mächtiges Original-Ölgemälde in goldenem Barockrahmen, aufgewühlte See darstellend, «von Kalckreuth» unterschrieben.