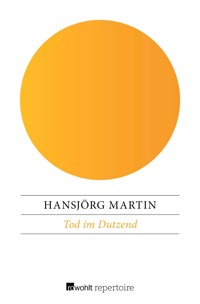9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hansjörg Martins Roman ist ein nur zu wahrer Krimi: In der Seester Marsch will ein großer Chemie-Konzern auf dreißig Hektar Ackerland ein Werk errichten, angeblich um – unter Berücksichtigung aller Umweltauflagen – Medikamente herzustellen. Die finanziellen Angebote für das Land sind so großzügig bemessen, daß die Bauern gerne auf das Angebot einsteigen. Erst als sich nach dem Bau der Fabrik die ersten schädlichen Umwelteinwirkungen bemerkbar machen – die Fische sterben, die Apfelernte muß wegen des hohen Cadmiumgehalts vernichtet werden –, regt sich Widerstand gegen das Werk. Unter der Führung von Elisabeth, der Tochter des Bürgermeisters, widersetzen sich die Bürger der rücksichtslosen Politik des Konzerns. Als dann auch noch bekannt wird, daß der Konzern Versuche für chemische Waffen macht, werden auch die Medien für die Bürgerinitiative gewonnen. Der Roman besticht durch die genauen Recherchen, seine atmosphärischen Milieuschilderungen und die packende Erzählweise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Gegen den Wind
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Hansjörg Martins Roman ist ein nur zu wahrer Krimi: In der Seester Marsch will ein großer Chemie-Konzern auf dreißig Hektar Ackerland ein Werk errichten, angeblich um – unter Berücksichtigung aller Umweltauflagen – Medikamente herzustellen. Die finanziellen Angebote für das Land sind so großzügig bemessen, daß die Bauern gerne auf das Angebot einsteigen. Erst als nach dem Bau der Fabrik sich die ersten schädlichen Umwelteinwirkungen bemerkbar machen – die Fische sterben, die Apfelernte muß wegen des hohen Cadmiumgehalts vernichtet werden –, regt sich Widerstand gegen das Werk. Unter der Führung von Elisabeth, der Tochter des Bürgermeisters, widersetzen sich die Bürger der rücksichtslosen Politik des Konzerns. Als dann auch noch bekannt wird, daß der Konzern Versuche für chemische Waffen macht, werden auch die Medien für die Bürgerinitiative gewonnen.
Der Roman besticht durch die genauen Recherchen, seine atmosphärischen Milieuschilderungen und die packende Erzählweise.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
I
Das Auto hatte nichts Besonderes an sich. Es war ein Wagen der oberen Mittelklasse, hellblau – ›cölinblau‹ lautete die genaue Farbbezeichnung des Herstellers –, gut gepflegt, ein seriöses, unauffälliges Fahrzeug. Das polizeiliche Kennzeichen war K-UH 341, worüber die drei Dreizehnjährigen, die gerade aus der Schule kamen, sich totlachen wollten.
»Möchtet ihr in einem Auto fahren, auf dem ›Kuh‹ steht?« fragte der eine die beiden anderen Jungen.
»Nee, nicht für Kuchen!«
Die drei kicherten und schlenderten weiter, denn außer dem Kennzeichen war wirklich nichts Besonderes an dem Auto.
»Wenn ich zu Hause erzähle, vor der ›Linde‹ parkt ’ne blaue Kuh«, sagte der eine noch mit einem Blick über die Schulter, »dann motzt mich mein Alter bestimmt wieder an. Der hat überhaupt keinen Nerv für Humor …«
In der Gaststube des Gasthofes »Zur Linde« saßen nur zwei Männer, nein, Herren bei Bier und Bauernfrühstück. Das Bier, ein hiesiges Pilsener vom Faß, war gut. Das Bauernfrühstück war sogar vortrefflich. Die Bratkartoffeln, das untergerührte Ei, die Wurst-, Speck- und Fleischstücke, die knackige saure Gurke – alles ausgezeichnet gewürzt und zubereitet, vielleicht eine Nuance zu fett, aber sehr wohlschmeckend. »Wenn wir hier länger bleiben, kriege ich wieder ’nen Rettungsring um die Hüfte«, sagte der eine, ein ziemlich molliger Herr, und wischte sich den Mund ab.
»Ich hab’ da keine Sorgen«, sagte der andere. »Ich kann essen, was mir schmeckt.«
»Beneidenswert!« meinte der Mollige, betrachtete seinen Tischnachbarn voll wehmütiger Bewunderung, griff nach der Gabel, die er schon beiseite gelegt hatte, obwohl auf seinem Teller noch ein Rest war – aß aber dann doch nichts mehr, seufzte, trank sein Bier aus und sah sich um.
Die Gaststube hatte jene Ausstrahlung von Gemütlichkeit, die manche Männer brauchen, um ihre Arbeit, ihre Ehe, ihre sonstigen Unerträglichkeiten wenigstens zeitweise zu vergessen: dunkle Täfelung bis zu einer Konsole, auf der Zinngeschirr stand; ein paar ausgestopfte Vögel; ein halbes Dutzend bunte Bierkrüge und ein Buddelschiff. Darüber Deckenbalken, an denen über jedem der sieben Tische schöne alte Petroleumlampen hingen, die zwar mit elektrischem Licht bestückt, aber immer noch sehr dekorativ waren. Tische und Stühle aus dunklem Holz – nur die Tischplatten hell, naturbelassen, sauber gescheuert, mit Pfeffer-und-Salz-Gedecken aus braunem Steingut darauf und Bast-Sets an jedem Platz. Über den drei Türen hingen drei Geweihe. Ein mächtiger Kronzehner über dem Eingang, ein Gabelachter über der Tür, die neben dem Tresen zur Küche führte, und ein sechssprossiger Löffler über der Tür zu den Toiletten. Auf dem Schanktisch prangte eine bunte Zapfsäule aus Majolika. Darüber hingen Gläser aller Größen an einem Gestell.
Dahinter stand ein hohes Regal mit Spiegeln, auf dessen gläsernen Borden etwa fünfzig verschiedene Likör- und Schnapsflaschen paradierten. Die Täfelung ringsum war mit Sprüchen behängt, die – in schnörkeliger Schrift von Künstlerhand – Weisheiten aller Art verkündeten.
Das ging von »Humor ist, wenn man trotzdem lacht« bis »Saufst, stirbst, saufst net, stirbst a« – was nur dem Inhalt nach, aber nicht vom Dialekt her in die »Linde« paßte. Bayrisches blieb, bei aller Tiefe des Sinngehaltes, fremd in der Atmosphäre aus Katenrauchschinkenduft, kaltem Korn und der kargen Kameraderie des Landstriches hinter den Deichen, in dem das Dorf lag, dessen Mittelpunkt der Gasthof »Zur Linde« bildete.
Nun hatte auch der zweite Herr seine Mahlzeit beendet. Er unterdrückte – eben weil er ein Herr war, in Nadelstreifenkammgarn und mit passender Krawatte – einen Rülpser, zündete sich umständlich, fast feierlich eine Zigarre an und holte sich mit der Zungenspitze die Speisereste aus den Zähnen. Sein glattes Gesicht wurde dabei zur komischen Grimasse, doch das wußte er nicht, sonst hätte er es gewiß gelassen – und sein Gefährte bemerkte es nicht, weil er gedankenvoll die Wandsprüche studierte. Sonst hätte er gelacht. Oder wahrscheinlich doch nicht, denn der Grimassenschneider war schließlich sein Vorgesetzter. Auf jeden Fall würde er Mühe gehabt haben, sich das Lachen zu verbeißen.
»Wir sollten mal fragen, ob sie Zimmer frei haben«, meinte der Vorgesetzte. »Das Dorf liegt genau in der Mitte des Gebietes. Wir könnten von hier aus vorgehen und bräuchten nicht morgens und abends von und nach Neustadt oder sonstwohin zu fahren. Außerdem sind abendliche Kneipen sowieso die besten Informationsquellen, die es gibt. Wollen Sie mal bitte nachsehen, wo die Wirtin ist?«
»Ja«, sagte der Mollige, stand auf, ging am Tresen vorbei zu der Tür unter dem achtsprossigen Gablergeweih und klopfte.
Da sich nichts rührte, klopfte er ein zweites Mal, diesmal heftiger, und als noch immer nichts geschah, öffnete er die Tür und rief: »Frau Wirtin! Hallo, Frau Wirtin!«
»Ja, komm ja schon!« antwortete die Stimme der Wirtin von irgendwoher, und gleich darauf kam sie in die Gaststube und trat an den Tisch.
Sie war Mitte Vierzig, etwa einssechzig groß und nicht sehr viel weniger breit, was durch ihre karierte Kittelschürze noch unterstrichen wurde, hatte rote Backen und erstaunlich hellblaue Augen, vor denen sie kurioserweise eine hochmodische Brille trug, eine mit straßverzierter Umrandung und wild gebogenen Bügeln, die allerdings so schief saß, daß es aussah, als fiele sie bei der nächsten Kopfbewegung herunter.
»Ja, die Herren?« fragte sie schweratmend. »Wollen Sie bezahlen? Oder möchten Sie noch einen Kaffee? Hat es denn gut geschmeckt?«
»Ja – alles drei!« erwiderte der Hagere im Nadelstreifen. »Vielen Dank, Frau Wirtin, es hat sehr gut geschmeckt. Wenn alle Bauern hier in der Gegend so gute Bauernfrühstücke verdrücken, ist die Landwirtschaft gesund, hahaha!« Er lachte über seinen Scherz, wie Vertreter lachen.
Die Wirtin hielt die Herren auch für Vertreter. Sie machte sich keine Gedanken über die Branche, in der sie reisten. Es mußte eine florierende Branche sein – so, wie die zwei aussahen und auftraten. Sie lächelte höflich und nickte. Ihre Brille wackelte, fiel aber nicht herab.
»Ja, und einen Kaffee hätte ich auch gern«, fuhr der Hagere fort. »Sie auch?« wandte er sich an seinen Kollegen.
»Ja, ich bitte auch!« sagte der Mollige. »Und bezahlen möchten wir ebenfalls«, fügte er hinzu.
»Ja … und noch eine Frage«, sagte der Hagere. »Sie haben doch Fremdenzimmer, nicht wahr?«
»Fünf«, sagte die Wirtin, »drei Doppel und zwei Einzel, mit fließend warm und kalt Wasser. Drei sogar mit Dusche.« Sie witterte eine unerwartete Einnahme und strahlte die Herren an. »Bis auf das eine Doppelzimmer sind alle frei«, verkündete sie. »Jetzt im Februar ist es immer ruhig. Wie lange wollen Sie denn bleiben?«
»Eine Woche vielleicht«, sagte der Hagere. »Erst mal eine Woche. Wir haben hier aber sicher noch länger zu tun. Doch ich würde mir die Zimmer zunächst ganz gerne anschauen, wenn Sie erlauben … nicht, daß ich besonders anspruchsvoll wäre oder gar mißtrauisch, Frau Wirtin, nein, nein, wer so gut kocht, ist meines Vertrauens sicher, hahaha! Aber …« Er brach ab, weil er den Faden verloren hatte.
»Ja, natürlich«, sagte die Wirtin. »Sofort oder erst den Kaffee?«
»Ach, gehen wir doch gleich«, meinte der Hagere und erhob sich auch schon.
»Ich hole schnell die Schlüssel«, sagte die Wirtin. Sie war etwas irritiert, daß die Herren nicht nach dem Preis gefragt hatten. Das mußte wirklich eine sehr gutgehende Branche sein, in der die tätig waren.
Auch der Mollige war inzwischen aufgestanden. Die Wirtin lief hinter den Tresen, griff die Schlüssel vom Schlüsselbrett und lief voraus zur Tür, über der das mächtige Kronzehnergeweih hing, und bat die beiden, ihr zu folgen.
»Hier bitte!« sagte sie. »Die Zimmer sind oben. Sie werden kalt sein. Das Heizöl ist zu teuer geworden, drum stellen wir immer ab, wenn sie nicht benutzt werden. Aber wenn ich die Heizkörper andrehe, dauert’s keine halbe Stunde …« Sie ging hinaus.
Die zwei folgten ihr.
»Nehmen Sie Ihre Aktentasche besser mit, Herr Schobes«, sagte der Hagere halblaut über die Schulter zu seinem Kollegen. »Es wäre nicht gut, wenn ein Unbefugter darin herumstöberte. Vorzeitiges Bekanntwerden unserer Pläne könnte unter Umständen Millionen kosten …«
»Ja, natürlich, aber gewiß doch!« pflichtete der eifrig bei und klemmte sich die schmale, lederne Kollegmappe unter den Arm.
Sie war leicht für den Millionenwert, der in ihr steckte …
Eine gute Viertelstunde später saßen die Herren wieder in der Gaststube. Die Wirtin hatte das Geschirr abgeräumt und ihnen Kaffee gebracht, der köstlich duftete. Sie hatte drei Löffel mehr als sonst in den Filteraufsatz gegeben und richtige Sahne dazugestellt. So gute Gäste mußten bei Laune gehalten werden. Was für ein Glück, daß sie gerade in der vorigen Woche die vorgeschriebenen Mietpreisschilder aus den Schranktüren der Zimmer entfernt hatte. Da war noch der Preis vom letzten Jahr draufgewesen. So konnte sie, als die Herren bejahend nickten, ohne langes Überlegen 8DM mehr verlangen. 33 mit Frühstück und 2DM Heizungszuschlag pro Tag. Sie rechnete … Sieben mal fünfunddreißig mal zwei – das gab fast 500DM mitten in der toten Jahreszeit. Und vielleicht würden die zwei sogar noch länger bleiben. Oskar würde sich freuen. Was die wohl so lange in Heetel wollten? Es gab hier doch nichts zu verdienen bei den eineinhalb Dutzend Apfelbauern und schon gar nichts bei den paar Fischern am Fluß. Aber das ging sie nichts an. 500DM – das waren gut und gern 400DM netto, auch wenn sie ein ganz großes Frühstück machte, mit Eiern und Schinken, Käse und Marmelade. Vielleicht sogar zwei Sorten Marmelade. Vielleicht sogar die selbsteingemachte Brombeer … Nein, daran sollte es nicht fehlen!
Und jeden Abend wollte sie ihnen einen Teller mit Äpfeln auf die Nachttische stellen. Eine Graureinette und einen Holsteiner Cox, von der guten Sorte, die Hauke Janssen zog.
Aus der Gaststube klang Löffelgeklirr. Einer der Herren klopfte an seine Kaffeetasse. Die Wirtin lief hinüber.
»Der Kaffee war wirklich prima, Frau Wirtin«, sagte der Mollige. »Vielen Dank. Nun müssen wir aber an die Arbeit. Wer ist denn hier im Ort der Bürgermeister und wo wohnt er?«
»Bürgermeister?« fragte die Wirtin verdutzt.
»Ja, Bürgermeister«, wiederholte jetzt der Hagere betont geduldig, »den wollen wir aufsuchen.«
»Unser Bürgermeister ist Johann Früchtenicht«, sagte die Wirtin, die es immer noch nicht fassen konnte, daß die Herren zum Bürgermeister wollten. Was verkauft man denn einem Bürgermeister? Oder waren das vielleicht gar keine Vertreter? Waren das etwa irgendwelche Regierungsbeamte? Inspektoren – oder wie das hieß. Hatte der dicke Früchtenicht vielleicht irgendwelchen Dreck am Stecken? Zuzutrauen wäre ihm das schon … Oder? Da war doch im vorigen Sommer mal die Rede von einem leichten Mädchen gewesen, mit dem ihn jemand in Hamburg gesehen haben wollte … Wie, wenn da jetzt ein Nachspiel kam? Dann waren die beiden Herren unter Umständen gar von der Kriminalpolizei?
Nein – Beamte waren das bestimmt nicht. Die Wirtin kannte Beamte. Die hätten sofort nach dem Zimmerpreis gefragt, noch vor der Besichtigung, und die hätten bestimmt gefeilscht, weil ihre Spesensätze nicht so hoch waren. Oder hatte Früchtenicht heimliche Schulden? Alimente nicht bezahlt oder so was? Dann waren das Gläubiger? Rechtsanwälte? Nein, Rechtsanwälte würden keine Woche brauchen …
Sie war so in Gedanken versunken und in ihre Spekulationen versponnen, daß der Hagere noch mal nachfragen mußte: »Wo finden wir denn, bitte, Ihren Bürgermeister, Herrn Früchtenicht?«
»Ach so«, rief sie erschrocken. »Ja, ja: die Kopfsteinpflasterstraße links hinter der Kirche bis zum Ende. Der letzte Hof. So ein großes grünes Tor. Gar nicht zu verfehlen!«
»Danke«, sagte der Hagere. »Wie sollen wir es denn mit der Bezahlung halten? Am besten jeden Abend alles zusammen?«
»Wie Sie wollen«, sagte die Wirtin. »Abends ist einfacher als jedes Mal extra.«
»Dann bringen wir unser Gepäck nach oben und fahren anschließend los«, erklärte der Mollige.
»Die Zimmer lassen sich doch abschließen, oder?« fragte der Hagere.
»Aber natürlich«, erwiderte die Wirtin. »Außerdem wird in Heetel nicht gestohlen!« Sie wandte sich schon ab, als ihr noch was einfiel. »Soll ich für Sie wohl bei Johann Früchtenicht anrufen, damit Sie nicht umsonst …?«
»Nein, danke«, gab der Hagere lächelnd zurück. »Das ist nicht nötig. Außerdem haben wir ja Zeit.«
Sie verließen die Gaststube, holten ihre teuer aussehenden Koffer aus dem blauen Auto und brachten sie nach oben in die Zimmer.
Die Wirtin vergewisserte sich, daß sie nicht im Treppenhaus waren, und lief ans Telefon. Sie wußte die Rufnummer des Bürgermeisters auswendig, denn Hilde Früchtenicht, seine Frau, war ihre beste Freundin. »Paß eben auf, Hilde«, flüsterte sie in die Sprechmuschel, nachdem sich die Bürgermeisterin gemeldet hatte, »da kommen gleich zwei Herren zu euch. Die wollen mit Johann reden. Irgendwas Geheimnisvolles. Ich weiß gar nicht, was. Sie sind bei uns abgestiegen. Elegante Herren. Bleiben eine ganze Woche, nur daß du eben Bescheid weißt, hörst du?! Laß dir aber nicht anmerken, daß ich es dir gesagt habe. Und erzähl mir, was die wollten, ja? Ich werd’ nicht gescheit aus den beiden. Wie? Nein, Vertreter sind es glaube ich nicht, Hilde. Jedenfalls keine gewöhnlichen. Also … bis nachher!« Sie legte auf und guckte aus dem Küchenfenster den zwei rätselhaften Gästen nach, die in ihr unauffälliges Auto stiegen und die Dorfstraße hinab auf die Kirche zufuhren.
Trotz der Freude über die unerhoffte Einnahme war ihr nicht ganz wohl. Aber das wollte sie ihrem Mann nicht sagen, wenn er nachher vom Markt aus der Kreisstadt heimkam. Er konnte Spökenkiekerei nicht ausstehen.
»Du bist eine verdrehte alte Wachtel, Emma!« würde er sagen – oder irgend so was Grobes, und würde sie auslachen. Das Ausgelachtwerden war dabei fast noch kränkender als jede Beschimpfung.
Sie stellte das Geschirr in die Spülmaschine. »Hoffentlich geht das alles gut«, sagte sie halblaut zu sich selbst und seufzte.
Elisabeth Früchtenicht saß in ihrem Zimmer und lernte. Sie saß mit untergeschlagenen Beinen auf dem Flokati-Teppich vor ihrer Schlafcouch, hatte rundum Bücher, Zettel, Kugelschreiber und Lesezeichen verstreut und las, notierte, blätterte und – stöhnte.
Sie war – nicht nur im landläufigen Sinne, sondern auch für Verehrer aparter Schönheit – ein sehr attraktives Mädchen. Ihr langes blondes Haar, das bei bestimmtem Licht rötlich schimmerte, ihre großen, schräggeschnittenen, dunkelblauen Augen, ihre hübsche Nase, über deren Rücken ein Sommersprossengesprengsel lief, ihr ein ganz klein wenig zu großer Mund, ihr ein ganz klein wenig zu langer Hals und ihre zierlich-biegsame Figur machten Männer jeden Alters für den Augenblick ihres Auftretens atemlos und lösten bei Bauarbeitern, Lkw-Fahrern und Halbstarken bewundernde Pfiffe und gelegentliche Zurufe aus. Elisabeth hatte sich daran gewöhnt, sie genoß die Bewunderung sogar, aber sie reagierte darauf mit einer abweisend-schnippischen Kopfbewegung, bei der ihr meist eine Haarsträhne in die Stirn fiel, die sie mit leichter, graziöser Handbewegung zurückstrich. Dabei lächelte sie.
Jetzt lächelte sie nicht. Ihr Gesicht spiegelte Verbissenheit. Frau Dr. Nagel hatte für morgen eine Klassenarbeit in Chemie angekündigt. Chemie war Elisabeths bestgehaßtes Schulfach. Sie stand auf einer sehr wackeligen Vier und durfte die Arbeit auf keinen Fall verhauen, wenn sie nicht auf eine Fünf abrutschen und damit ihr Abitur gefährden wollte.
Die Walküre, so hieß die Nagel am Goethe-Gymnasium in Olders ihrer wallenden Gewänder, ihres voluminösen Busens und ihres ausgeprägten, ein bißchen klirrenden Mezzosoprans wegen, hatte Elisabeth auf dem Kieker. Zum einen, weil das Mädchen mit seinem Desinteresse für das Fach Chemie nie hinter dem Berg gehalten hatte – und zum anderen, weil Elisabeth Oberstudiendirektor Bergs erklärte Lieblingsschülerin war.
Frau Dr. Nagel aber verehrte ihrerseits den ledigen Leiter der Lehranstalt so heftig, daß sie auf die hübsche Bürgermeisterstochter eifersüchtig war.
Elisabeth ahnte davon nichts. Sie nutzte die Bevorzugung, die der Direktor als Deutschlehrer der Klasse ihr angedeihen ließ, kühl aus und flirtete mit dem Mittfünfziger, ohne sich ganz im klaren darüber zu sein, wie grausam das war, und ohne zu wissen, daß sie sich damit die Doktorin Nagel zur Feindin machte.
Weitab von solchen Überlegungen hockte Elisabeth vor der Couch ihres Zimmers, das sie ihre »Kemenate« nannte, und murmelte mißmutig: »… aus den Grundstoffen Kohle, Kalkstein, Luft und Wasser werden die eigentlichen Ausgangsstoffe gewonnen: Acetylen, Formaldehyd, Phenol und Harnstoff. Diese werden dann der Polymerisation von Thermoplasten …«, sie wiederholte mit gerunzelten Brauen »Polymerisation von Thermoplasten …«, zischte »Scheiße!«, nahm sich Zettel und Bleistift vom griffnahen Schreibtisch, notierte das schwierige Wort und las laut weiter »… und der Polykondensation von Duromeren und Thermoplasten verwendet.«
Sie stöhnte und begann, den Satz über die Herstellung der Kunstharze zu wiederholen, die ihr so gleichgültig war wie der vorgestrige Fußballsieg des Rasensportclubs Heetel gegen den Vfl Seesterfleth. Oder das Problem, ob der Beitritt Spaniens zur EG die Gemüsepreise beeinflussen würde, beides Fragen, die vorhin, beim Essen, von ihrem Vater aufgeworfen worden waren.
Vor den beiden kleinen Sprossenfenstern des schrägwandigen Zimmers dehnte sich das flache Land unter einem hohen, gleichförmig grauen Himmel. Die kahlen, kurzstämmigen Apfelbäume standen schwarz im Schnee. Ein paar Krähen kreisten quarrend um die Masten der Stromleitung, die sich in weiten Bogen am Horizont verlor. Hinter dem Kuschelwäldchen am Fluß stieg Rauch auf.
Elisabeth schaute wieder auf den Text. »Aminoplaste …«, las sie gequält und unterdrückte mühsam den Wunsch, das Buch in die Ecke zu schmeißen, wegzulaufen, sich den gefütterten Parka anzuziehen und in den Stall zu gehen, Kautur, ihren Island-Wallach, zu satteln und über die Felder zu reiten.
Später, dachte sie, schrieb das Wort »Aminoplaste« auf ihren Zettel, biß die Zähne zusammen und lernte weiter.
In der guten Stube des fast zweihundert Jahre alten Bauernhofes lag Bürgermeister Johann Früchtenicht auf dem Sofa und las das Tageblatt, das den schönen Namen Marschen-Bote trug und in einer Auflage von 6500 Stück die Bevölkerung zwischen Olders und Endwarden an sechs Wochentagen mit Nachrichten versorgte.
Der Mantel des Marschen-Boten, also die zwei ersten Seiten sowie die Sportberichte und das Feuilleton – soweit dieser Teil des Blattes den Namen Feuilleton verdiente – kamen zwar in Matern aus Neustadt, aber das Lokale und die Anzeigen wurden in Olders geschrieben, gesetzt und gedruckt.
Außer dem Marschen-Boten gab es keine Tageszeitung in den Dörfern.
Einer der drei Lehrer in Heetel hatte zwar befremdlicherweise eine großstädtische Tageszeitung abonniert, noch dazu eine dem Vernehmen nach links-liberale, aber die traf immer mit ein- bis zweitägiger Verspätung ein … Der Lehrer würde sich das abgewöhnen müssen, wenn er hier länger bleiben wollte. Seine schulterlangen Haare und seine eigenartige Auffassung von Kindererziehung schmälerten seine diesbezüglichen Aussichten ohnehin. Leute, die Kindern beizubringen versuchten, daß Christus nicht nur Gottes Sohn, sondern auch ein Revolutionär gewesen sei, solche Leute waren in den Marschen-Dörfern nicht gern gesehen.
Pastor Wenk hatte gerade vorige Woche mit dem Bürgermeister beraten, wie da Abhilfe geschaffen werden könne. Man würde Mittel und Wege finden. Der Oberschulrat war schließlich ein guter Mann. Er hatte vernünftige Ansichten. In der gleichen Partei wie der Bürgermeister war er auch.
Na also …
Die Stunde nach dem Mittagessen liebte Johann Früchtenicht sehr. Er liebte das alte, lederbezogene Kanapee, auf dem schon sein Vater immer in den Mittagsstunden gelegen und den Marschen-Boten gelesen hatte. Er liebte die ganze »gute Stube« mit den Wolken-Stores vor den drei hohen Fenstern, den Eichenmöbeln mit ihrem Schnitzwerk an Türen und Kanten, das riesengroße dunkle Stilleben über dem Vertiko, das, dunkelgolden gerahmt, eine üppig gedeckte Tafel darstellte, auf der ein toter Hase und zwei ebenso tote Fasane zwischen Obst, Flaschen und Krügen lagen – und er liebte die Geruchsmischung aus Tabakrauch, Kaffee, Sauberkeit und Wohlstand.
Wie alle Räume im Erdgeschoß des Hofes war auch die gute Stube sehr hoch. Wenn Johann Früchtenicht seine Zeitung sinken ließ und den Blick – nachdem er die Brille beiseite gelegt oder auf die Stirn geschoben hatte – zur Decke schweifen ließ, freute er sich jedesmal über die Stukkatur. Mäanderkante mit Weinlaub und Puttenköpfen an allen vier Ecken des Zimmers. Er hatte sie gegen den Widerstand seiner Frau Hilde vor vier Jahren für teures Geld renovieren lassen. Das war kein Kunstverständnis gewesen, sondern eingefleischte Abneigung gegen jede Form von Modernisierung, die nicht nötig war.
Manchmal schlief Johann Früchtenicht mittags auch ein, aber das geschah höchstens nach einer langen Gemeinderatsitzung am Abend zuvor, die gelegentlich in der »Linde« fortgesetzt wurde und dort in Bier und Korn mündete, denn früh um fünf war zwar nicht für den Bürgermeister, aber für den Obstbauern Früchtenicht die Nacht immer zu Ende. Bei 15000 Apfelbäumen auf rund 20 Hektar Land kann keiner bis in die Puppen schlafen.
An diesem Tag im Februar nickte der Bürgermeister nicht ein. Er hatte sich beim Mittagessen wieder einmal über seine Tochter Elisabeth geärgert. Das Mädchen sagte Sachen, die Johann Früchtenichts Adrenalinspiegel so anhoben, daß er lange brauchte, sich zu beruhigen. Woher sie so was bloß hatte?
»Mußt dich nicht über die spanischen Apfelsinenbauern aufregen, Papa«, hatte sie heute geäußert. »Ihr werdet schon miteinander klarkommen in der EG, glaub’ ich. Was hast du seinerzeit über die Holländer gemosert und über die Franzosen – und zum Schluß hat ja doch die Kasse gestimmt. Da blechen eben die Verbraucher ein bißchen mehr, oder es wird wieder mal ’ne Ernte ins Meer gekippt oder verbrannt, damit die Preise nicht fallen. Das kommt schon in Ordnung für die Unternehmer, so lange wir dieses wunderschön beknackte Wirtschaftssystem haben … und was die kleinen Leute machen, Papa, ist euch doch sowieso piepe, nicht wahr?!«
»Aber du lebst ganz gut in dem System, mien Deern«, hatte Johann Früchtenicht gekontert. »Reitpferd und Mofa und höhere Schule und schicke Sachen, wie? Oder gefällt dir die neue pelzgefütterte Lederjacke nicht? 650DM. Davon lebt eine Hilfsarbeiterfamilie mit drei Kindern zwei Wochen.«
»Okay! Das ist ja haargenau, was ich sage, Papa!« Elisabeth hatte ihn lächelnd angesehen, war dann aber ganz ernst geworden. »Ich glaube, wir denken bloß einen Tick weiter als ihr. Wenn die dünne Schicht von Absahnern nicht so raffig wäre, könnten alle Leute im Winter pelzgefütterte Jacken anziehen. Ich hab’ mich erkundigt. Fünfunddreißig Prozent sahnt der Pelzhändler an so ’ner Jacke ab, dreißig Prozent der Hersteller. Zwanzig Prozent kostet das Material, fünfzehn Prozent kriegt der, der sie geschneidert und zwei Tage daran malocht hat. Findest du das in Ordnung?«
»Das ist aber eine blöde, primitive Rechnerei!« hatte Johann Früchtenicht – schon eine Phonstärke lauter – gesagt, und Elisabeth war drauf und dran gewesen, ebenfalls lauter zu werden.
Doch da hatte Hilde Früchtenicht das Wort ergriffen. »Jetzt ist Schluß!« hatte sie gerufen. »Immer und ewig diese ekelhafte Streiterei um Politik! Noch dazu beim Essen! Wenn das nicht ein für allemal aufhört, streike ich. Denkt ihr denn, ich stelle mich stundenlang in die Küche, damit ihr vor lauter Diskutieren nicht mal mehr merkt, was ihr auf dem Teller habt? Diskutiere du auf dem Schulhof, Elisabeth – und du im Gemeinderat, Johann –, aber nicht am Eßtisch, zum Kuckuck! So. Basta! Kein Wort höre ich, ob euch die Krautwickel geschmeckt haben – aber ›Wirtschaftssystem‹, ›Verdienstspanne‹ und … und … und … Ich will das nicht mehr. Kapiert?«
Sie hatte Mann und Tochter böse angeblickt – dann aber, als die beiden verdutzt über ihren Ausbruch zwinkerten, plötzlich gelächelt und gefragt: »Es gibt Griesflammerie zum Nachtisch. Möchtest du Himbeersaft dazu, Johann? Und du, Elisabeth?«
Da hatten sie alle gelacht und einträchtig die Nachspeise gelöffelt.
Trotzdem ging dem Bürgermeister das Gespräch nicht aus dem Kopf. Woher seine Tochter nur solche Ideen hatte?
Er würde sich doch mal die Oberschule in Olders ansehen müssen – und die Lehrer … beschloß er auf seinem Sofa.
Die »in … indok …« – ihm fiel das Fremdwort nicht ein, das er vor kurzem gelesen hatte –, die beeinflußten die Kinder ja offensichtlich in unerhörter Weise.
Die Haustürglocke im Flur schellte. Früchtenicht sah zur Standuhr. Halb zwei. Er hörte die Stimme seiner Frau und eine Männerstimme.
Hilde steckte den Kopf durch die Tür. »Du schläfst nicht?« fragte sie.
»Nein«, sagte Früchtenicht. »Wer ist denn da?«
»Zwei Herren«, sagte sie, »Emma hat sie mir vorhin schon telefonisch angekündigt. Sie wollen dich sprechen und fragen, ob dir das jetzt paßt.«
»Um wen handelt es sich denn, Hilde?«
»Ich weiß nicht, ich hab’ die noch nie gesehen.«
»Führ sie ins Büro, ich komme gleich«, sagte Früchtenicht und erhob sich.
Der Rücken tat ihm wieder weh. Vielleicht sollte er doch mal eine Kur machen. Dr. Schmieder riet schon seit zwei Jahren dazu.
Quatsch – eine Kur! Mit achtundfünfzig noch solche Fisimatenten. Das war was für Beamte und andere Nichtstuer. Wenn es schlimmer wurde, würde er mal wieder ein Katzenfell um die Hüfte binden oder sich von Hilde mit Bienengiftsalbe einreiben lassen. Das hatte bisher immer geholfen.
Er strich sich das dichte, eisengraue, kurzgeschnittene Haar glatt, zog – leise ächzend – die Schnürstiefel an, fuhr ins Jackett und machte sich auf den Weg in sein Büro.
Der schmale, hohe, einfenstrige Raum, den der Bürgermeister als Büro bezeichnete, lag am Ende des steingefliesten Flures gegenüber der großen Küche, in der die Früchtenichts wochentags auch aßen. Er war früher ein Vorratsraum gewesen, in dem die Schinken und Würste gehangen, Regale mit Eingemachtem gestanden hatten und Säcke mit Mehl, Grütze, Zucker aufbewahrt worden waren.
Als Früchtenicht vor acht Jahren Bürgermeister geworden war, hatte er seiner Frau direkt an der Wohnküche einen neuen Vorratsraum angebaut, mit einer Kühlkammer und Gefriertruhen und allen Erleichterungen, die der Fortschritt der Technik so mit sich gebracht hatte.
Er behauptete zwar in mürrischen Stunden, daß die Würste früher besser geschmeckt hätten und daß der tiefgefrorene Schweinebraten nicht zu vergleichen wäre mit dem Pökelfleisch in der guten alten Zeit – aber im großen und ganzen sah er schon ein, daß es heutzutage leichter und unterm Strich auch billiger war, Vorräte zu halten.
Außerdem hatte er nun sein Büro, das er genaugenommen gar nicht brauchte, das er aber zur Tabuzone erklärt hatte und in das er sich unter dem Vorwand, arbeiten zu müssen, oft und gern zurückzog.
Über die eine Wand des Raumes erstreckte sich ein hohes Bücherregal, in dem Leitzordner standen und – kaum gelesene – Fachzeitschriften über Obstbau, jahrgangsweise gebunden. An der anderen Wand hingen Landkarten, Statistiken und Meßtischblätter.
Das eine Meßtischblatt zeigte – hellgrün schraffiert – die Liegenschaften Früchtenichts, und auf einem zweiten war die Gemarkung Heetel, also des Bürgermeisters »Machtbereich«, rot umrandet.
Außerdem hingen noch ein Bismarck-Bild da und ein Foto des amtierenden Bundespräsidenten.
Der sehr schöne alte Schreibsekretär nahm die Hälfte der rechten Wand ein, und daneben befanden sich ein Rauchtisch mit gehämmerter Messingplatte und zwei Stühle mit Armlehnen, deren rissige Ledersitze Hilde Früchtenicht mittels flacher Kissen, die mit Blumen bestickt waren, kaschiert hatte.
Auf der Fensterbank stand eine Blattpflanze, der es schwerfiel, am Leben zu bleiben, denn es kam zuwenig Licht durch die Scheiben, weil draußen im Hof eine riesige Rotbuche wuchs, die auch im Winter die spärliche Sonne aussperrte. Früchtenichts Zigarrenqualm tat ein übriges, dem mickrigen Gewächs das Dasein zu vermiesen.
In dieses Büro hatte die Frau Bürgermeisterin die Fremden geführt und ihnen die beiden Stühle angeboten. »Mein Mann kommt sofort!« sagte sie und verließ den Raum. Sie schloß die Tür nicht hinter sich – man konnte ja nie wissen.
Der Hagere stand auf und trat vor die Meßtischblätter an der Wand. »Ganz stolzer Besitz«, sagte er halblaut. »Das sind bestimmt fast zwei Dutzend Hektar allein im Osten. Und das Stück am Fluß, das hier umrandet ist, gehört ihm wohl auch noch. Das sind etwa acht oder zehn Hektar. Das wäre ein guter Anfang.«
»Ja«, pflichtete Schobes ihm bei.
»Dann würden die Abwasserleitungen nicht viel kosten«, meinte der Hagere. »Aber mit dem Stück allein können wir nichts werden, wenn es nicht gelingt, rechts und links – vor allem hier, nach Süden – wenigstens dreißig bis vierzig Hektar dazuzukriegen … Na ja, wir werden sehen!«
Er hörte die sich nähernden Schritte des Bürgermeisters auf den Steinfliesen und setzte sich schnell.
»Tag«, sagte der Bürgermeister, nannte seinen Namen und fragte: »Was kann ich für Sie tun, meine Herren?«
Der Hagere stellte sich und den Molligen vor. »Fehrenthal«, sagte er und wies dann auf seinen Begleiter. »Und dies ist Herr Schobes, mein Mitarbeiter.«
»Tag«, wiederholte Früchtenicht.
Sie gaben sich die Hand. Der Herr namens Fehrenthal ließ den Blick flink über den Bürgermeister gleiten, der noch einen halben Kopf größer war als er und sehr massig wirkte. Früchtenicht setzte sich in seinen Schreibtischstuhl und forderte die zwei mit ausholender Handbewegung auf, sich ebenfalls niederzulassen. »Also … worum geht es?« wollte er wissen, denn er war ein Mann, der lange Vorreden nicht liebte und gern gleich zur Sache kam.
»Wir kommen von der ITG«, sagte Fehrenthal, »von der Internationalen Treuhandgesellschaft, und wir haben den Auftrag, uns in Ihrer Gegend nach einem großen Gelände umzusehen, auf dem ein internationaler Konzern sich ansiedeln könnte.«
Früchtenicht hob den Kopf. »Industrie?«
»Jawohl, ein weltbekanntes Unternehmen«, bestätigte Fehrenthal. Er gab seinen Worten einen Klang, als verkünde er den Anbruch einer neuen – natürlich besseren – Epoche. Doch Früchtenicht hatte seine erste Überraschung überwunden und tat das beste, was er in einem solchen Fall tun konnte: er schwieg.
Die Herren Fehrenthal und Schobes hatten Fragen erwartet, aber der Bürgermeister stellte keine. Er saß mit dem Rücken zum Fenster, so daß sie sein Gesicht nur undeutlich erkennen konnten, und nutzte diesen Vorteil.
Kommen lassen, dachte er, ich hab’ Zeit.
Es dauerte siebzehn lange Sekunden, bis der Hagere wieder sprach. Er mußte sich räuspern. Unsicherheit saß ihm in der Kehle. Auf jede andere Reaktion war er gefaßt gewesen und vorbereitet. Entsetzte Ablehnung, neugierige Fragen, nachdenkliche Zweifel – darauf hätte er eine Antwort, dagegen hätte er Argumente gehabt – aber die steinerne Schweigsamkeit des Gegenübers im Gegenlicht war neu und verunsicherte ihn.
Das Projekt, das er vorzubereiten übernommen hatte, war nicht sein erster Auftrag dieser Art. Er hatte mit Bauern im Badischen und mit Großgrundbesitzern am Niederrhein verhandelt, hatte Schlauköpfe, Schlitzohren und Schwarzseher zur Hergabe ihrer Felder und Fluren überreden können, aber einem Bürgermeister und Obstzüchter aus der Marsch an der Küste war er im Rahmen seiner Tätigkeit für die ITG noch nicht begegnet. Ich hätte mich besser informieren müssen über die Leute hier, dachte er ärgerlich, das scheinen schwierige Typen zu sein … Schobes, der Mollige an seiner Seite, sprang ihm auch nicht bei.
Also räusperte sich Fehrenthal und sagte: »Das Industrieunternehmen, Herr Bürgermeister, für das wir hier – oder anderswo im Küstenraum – Gelände zu suchen und zu kaufen beauftragt sind, gehört der chemischen Branche an. Für die Errichtung eines Zweigwerkes – die Zentrale, das Hauptwerk, liegt bei Köln – werden fürs erste etwa einhundertzwanzig bis einhundertfünfzig Hektar Land gebraucht. Wir kommen nicht von ungefähr gerade hierher – denn die Infrastruktur Ihrer Gegend, also der wirtschaftlich-organisatorische Unterbau –«
»Ich weiß, was Infrastruktur heißt«, unterbrach ihn Früchtenicht trocken.
»Ach ja …, ja natürlich, ich vergaß …«, sagte Fehrenthal verwirrt, »entschuldigen Sie bitte …!«
»Schon gut«, brummte der Bürgermeister.
»Also, wir haben Erkundigungen eingeholt. Die Arbeitslosenquote liegt hier über dem Bundesdurchschnitt. Durch die nicht gerade günstige Verkehrslage – dünnes Straßennetz, kaum Bahnverbindungen et cetera – ist mit einer großartigen Industrialisierung kaum zu rechnen. Der Markt für die Erzeugnisse des Landes ist, nun ja, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, infolge der EG …«
»Beschissen!« warf Früchtenicht ein.
»Ja«, sagte Fehrenthal nickend. Er war erleichtert, daß Anfänge eines Konsens sich zu zeigen schienen. »Ja … und aus all den erwähnten Gründen glauben wir, es sei im gegenseitigen Interesse, diesen – äh – Mißständen abzuhelfen, indem die Errichtung eines Werkes, das etwa zweieinhalb- bis dreitausend Arbeitnehmer in Lohn und Brot … äh …«
Früchtenicht hustete dröhnend und stoppte damit den Redefluß des Hageren. »Mein Großvater, Gottlieb Früchtenicht«, sagte er langsam, »war ein sehr frommer Mann …« Er hielt inne, holte aus seinem Sekretär eine Zigarrenkiste, bot den zwei Herren keine an, wählte sich aber gemächlich eine aus, schnitt sie behutsam an, setzte sie in Brand, tat ein paar paffende Züge, schaute dem Rauch nach und sprach endlich weiter. »Und der hatte immer, das weiß ich noch genau, für jede Situation einen Spruch auf Lager.«
Wieder machte er eine Pause, blies zwei wundervoll gleichmäßige Ringe, die sich in der zuglosen Luft nur langsam auflösten, – und weidete sich an den erstaunten Gesichtern der Herren, die nicht wußten, worauf das hinaus sollte.
Dann fuhr er fort: »Das klingt ja alles ganz schön, meine Herren, Arbeitsplätze und so weiter, aber Sie haben ›Chemie‹ gesagt. Und da würde mein Großvater bestimmt seinen Spruch vom Stapel gelassen haben … ›Das heißt, den Teufel mit Beelzebub austreiben!‹ – Wollen Sie das? Wollen Sie ein kleineres Übel durch ein größeres beseitigen?«
»Ich weiß, ich weiß, worauf Sie abzielen!« sagte Fehrenthal eifrig. Er kam jetzt in sein Fahrwasser. Seine Unsicherheit schwand. Er lächelte. Es war aber beileibe kein spöttisches oder herablassendes Lächeln, das er aufsetzte. Dazu war er viel zu gescheit. Er lächelte verständnisvoll, fast väterlich, obwohl er sicher beinahe Früchtenichts Sohn hätte sein können. »Sie denken an eine mögliche Belastung der Umwelt, Herr Bürgermeister. Aber das wird nicht der Fall sein, denn die geplante Produktion hat einen umweltfreundlichen Charakter. Es sollen Medikamente hergestellt werden, die der Menschheit zugute kommen. Ich gebe Ihnen gegenüber gerne zu, daß auch mir jeder Baum, der gefällt werden muß, weh tut, daß mich jedes Stück Land, das zubetoniert werden muß, schmerzt, gewissermaßen … Aber, überlegen Sie doch mal, Herr Bürgermeister: Was nutzen einem Bäume, deren Früchte sich nicht verkaufen lassen, weil andere ihr Obst billiger anbieten – und was fängt man mit Land an, von dem man nicht satt werden kann?«
»Sie hätten Wanderprediger werden sollen, Herr … äh …?«
»Fehrenthal«, half Fehrenthal.
»Herr Fehrenthal«, sagte Früchtenicht. »Oder Politiker. Sie verstehen es! Und sicher haben Sie in mancher Beziehung sogar recht – aber die Leute hier hängen an ihrem Land, sie lieben ihre Apfelbäume, so schwer das für Städter auch zu verstehen sein mag. Ich habe gerade im letzten Herbst gesehen, wie der alte Siemsen, der seine Graureinetten neben meinen Boskop stehen hat, vor der Ernte die Reihen entlanggegangen ist und mal hier einen Baumstamm und dort mal einen seiner schönen Äpfel gestreichelt hat. Der gibt keinen Quadratmeter her, mein Bester, auch nicht für Medikamente, die – wie haben Sie gesagt – die ›der Menschheit zugute kommen‹.« Früchtenicht schüttelte den Kopf, richtete sich auf und schlug plötzlich einen sachlich-amtlichen Ton an. »Haben Sie sich denn schon bei den Behörden umgetan? Beim Kreis, bei der Landesregierung? Zu so einem Vorhaben gehören schließlich neue Flächennutzungspläne, Genehmigungen … und was weiß ich!«
Fehrenthal nickte seinem Begleiter zu. Schobes öffnete die lederne Kollegmappe und entnahm ihr nach kurzem Suchen zwei Blätter.
»Wenn Sie sich das mal bitte ansehen würden, Herr Bürgermeister!« sagte er und reichte die Papiere Früchtenicht über den Rauchtisch.
›Hiermit wird bestätigt‹, las der Bürgermeister unter dem amtlichen Regierungsbriefkopf, ›daß der Herr Minister des Inneren über das Vorhaben der ITG, betreffend Industrieansiedlung im Kreis Olders/Endwarden, informiert ist. Es wird gebeten, den Herren Fehrenthal und Schobes bei ihrer Arbeit behilflich zu sein und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Gezeichnet‹ – unleserlich – ›Ministerialrat.‹
Ein ähnlich lautender Text stand auf dem Briefbogen der Kreisverwaltung. Die Unterschrift war Früchtenicht bekannt. Sie stammte vom Oberkreisdirektor Mayer höchstpersönlich. »Sieh mal einer an, der Mayer«, sagte Früchtenicht grinsend. »Ein Sozi und klüngelt, wenn’s drauf ankommt, mit den Grünen. Und dann befürwortet er so ein Projekt?!«
»Bei den Sozialdemokraten gibt es ja auch gelegentlich ganz weitblickende, vernünftige Leute«, warf Fehrenthal ein, der aus des Bürgermeisters Bemerkung folgerichtig auf dessen politische Gesinnung geschlossen hatte.
»Ja … gelegentlich«, sagte der Bürgermeister. Er stand auf und fragte: »Trinken Sie einen Kaffee mit?« Als die Herren dankend bejahten, rief er auf den Flur:. »Hilde – machst du uns bitte einen Kaffee?«
Sie redeten eine Weile Belangloses, vom Wetter, vom Dorfwirtshaus, in dem die Herren abgestiegen waren, von einer Bonner Skandalgeschichte.
Dann war das Eis gebrochen.
Als der Kaffee kam, meinte Früchtenicht: »Aus Ihren Plänen wird wohl so leicht doch nix werden, wie ich das sehe. Eher geben die Kühe Cognac! Apropos – wollen Sie einen?«
»Bevor ich mich schlagen lasse!« sagte Fehrenthal.
»Aber wirklich nur einen, Herr Bürgermeister«, fügte Schobes hinzu. »Ich muß schließlich fahren – und mein Führerschein ist so wichtig für mich wie der Gürtel an meiner Hose.«
Sie lachten. Früchtenicht goß drei Gläser voll. »Also dann Prost!« sagte er.
»Auf gute Zusammenarbeit, Herr Bürgermeister!« sagte Fehrenthal feierlich.
»Nana …, nicht so fix mit die jungen Pferde!« sagte der Bürgermeister, ohne zu lachen. »Ich bin ja nur einer von elfen. Unser Gemeinderat ist das Entscheidungsgremium. Und um den überzeugen zu können, müßte ich selbst erst richtig überzeugt sein, daß wir nicht, wenn wir Ihre Pillenfabrik hierher holen, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, wie mein Großvater immer zu sagen pflegte …«
Jemand, der nichts von Landwirtschaft verstand, würde den alten Hof, auf dem Gesine Heinrichs, die Schwester des Bürgermeisters, lebte, wahrscheinlich als malerisch bezeichnet haben. Aber der Kenner sah schon beim Näherkommen, daß die scheinbare Romantik eine erste Folge beginnender Verwahrlosung war.
Das Strohdach auf dem Stall war grün vor Moos und an der Nordseite ausgefranst wie eine zertretene Fußmatte. Die hohe Weißdornhecke vor dem Gemüsegarten war seit langem nicht gestutzt worden und an drei, vier Stellen ausgefroren und löcherig. Zwischen dem Kopfsteinpflaster wuchs an den Hausmauern entlang Unkraut, das jetzt im Winter braun, verdorrt und fast noch schlimmer aussah als im Sommer. In einem Schuppenfenster waren die Scheiben zerbrochen und mit Säcken zugestopft worden. Das Tor zur Remise hing schief in den Angeln. Die drei Sandsteinstufen, die ins Wohnhaus führten, waren abgetreten und an den Rändern weggebrochen. Die schöne alte Haustür hätte dringend einen neuen Anstrich gebraucht, und zudem waren zwei ihrer fünf sechseckigen Buntglasscheiben gesprungen.
Sogar das Geschepper der Zugglocke klang rostig.
Fehrenthal hatte die Glocke in Bewegung gesetzt und zitierte jetzt im Geiste, während er wartete, da er ja ein Mann von Bildung war, höchst überflüssigerweise: »Noch eine einz’ge Säule zeugt von verschwundener Pracht …« Das fand er witzig.
Es dauerte nach dem Geschepper eine ganze Weile, bis im Haus Schritte zu hören waren und die Haustür geöffnet wurde. Das faltige Gesicht einer kleinen, weißhaarigen Frau erschien in dem doppelt handbreiten Türspalt.
Fehrenthal zwinkerte verblüfft. So alt hatte er sich des Bürgermeisters Schwester nicht vorgestellt.
»Ja …?« sagte die alte Frau.
»Habe ich die Ehre mit Frau Heinrichs?« fragte Fehrenthal zurück.
»Was wollen Sie denn?« fragte die Alte. »Außerdem bin ich nicht Frau Heinrichs. Wer sind Sie denn?«
»Mein Name ist Fehrenthal«, erklärte der Besucher. »Ist Frau Heinrichs denn nicht anwesend?«
»Doch, das ist sie. Aber ich muß sie erst fragen«, meinte die Frau, schaute Fehrenthal fünf Sekunden lang prüfend an, entschloß sich, ihn nicht für einen Räuber zu halten, und machte die Tür weiter auf. »Kommen Sie mal besser rein, es wird sonst kalt!«, sagte sie und ging einen Schritt beiseite.
Fehrenthal trat ein.
»Warten Sie mal eben hier!« erklärte die Alte, machte hinter ihm die Haustür zu, ließ ihn im dämmerigen Flur stehen und schlurfte davon.
Es roch nach Moder, Mottenkugeln, Kernseife, Kaffee und leiser Resignation im Hause. Der Flur war ziemlich breit. Zwei mächtige alte Schränke standen auf beiden Seiten. Auf dem einen waren Pappkartons gestapelt, auf dem anderen standen Steinkrüge. Rechter Hand hing ein sehr dunkles Ölbild. Außer einem hellen Segel konnte Fehrenthal nichts darauf erkennen. Auf einer Truhe neben dem linken Schrank kauerte bewegungslos eine graue Katze und sah ihn aus bernsteingelben Augen aufmerksam an.
Der Katzenblick verursachte bei Fehrenthal plötzliches Unbehagen. Ihn fröstelte.
Hinter einer der Türen, die von dem langen Flur abgingen, schlug eine Standuhr viermal. Fehrenthal sah auf seine Armbanduhr. Es war schon zehn Minuten nach vier. Die Standuhr ging nach. Hinten im Flur knarrte eine Tür wie in einem Hitchcock-Film. Fehrenthal schalt sich eine Memme, weil er für einen Augenblick dachte, es wäre vielleicht doch besser gewesen, Schobes mitzunehmen. Aber es war ja seine Idee, allein zu Früchtenichts verwitweter Schwester zu gehen. Möglicherweise hatte ein einzelner Mann leichteres Spiel, wenn er es verstand, die richtigen Register zu ziehen. Und Fehrenthal war überzeugt, daß er das konnte.
Er brauchte nur an das ältliche Fräulein von Perchau zu denken, der er mit Charme und Süßholzgeraspel, mit Handküssen und Blumen, mit tiefen Blicken und einem Gedichtband von Rainer Maria Rilke innerhalb einer Woche die fünfundvierzig Hektar Land abgeschwatzt hatte, von deren Erwerb die Errichtung der Papierfabrik südlich Stuttgarts abgehangen hatte. Das Fräulein schrieb ihm noch heute, immerhin eineinhalb Jahre später, Briefe auf hellblauem, leicht parfümiertem Papier. Er beantwortete sie nie, ohne deshalb die Spur eines schlechten Gewissens zu haben. Schließlich hatte er der Dame nicht die Ehe versprochen, und wenn sie sich Hoffnungen auf mehr als nur Blicke und Handküsse gemacht hatte, war das ihr Problem. Ihn schauderte bei dem Gedanken, denn die welke Komteß war alles andere als eine Schönheit. Fehrenthals Geschmack auf diesem Gebiet lag in einer ganz anderen Richtung.
Im Flur wurde eine Tür geöffnet und eine Lampe angeknipst. »Ach, du lieber Himmel!« rief Gesine Heinrichs und kam auf ihn zu. »Sie stehen hier im Dunkeln! Verzeihung, das ahnte ich nicht. Paula, meine Hilfe, ist ein Schaf. Sie hätte Sie ruhig in die Bibliothek führen können.« Sie gab ihm die Hand. »Schön’n guten Tag. Treten Sie näher!« sagte sie und drückte die Tür zu einem großen Zimmer auf, schaltete einen Kronleuchter ein, von dessen sieben Birnen nur vier brannten, und fuhr, ehe er ein Wort sagen konnte, fort: »Mein Bruder hat mir gesagt, daß Sie umhergehen, um Land aufzukaufen. Wollen Sie nicht ablegen?«