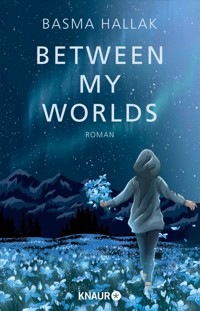
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kalima und Nói
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Atemberaubende Natur Islands, eine verlorene Berliner Fotografin und eine viel zu intensive Liebe, mit der niemand rechnet. Humorvoll, dramatisch, und schmerzhaft intensiv. Nachdem die erste Ausstellung der Berliner Fotografin Kalima in einem gigantischen Shitstorm endet, flieht sie nach Island. Mit sich im Gepäck: ihre Verlorenheit, ihre panische Angst vor Ablehnung, die sie seit einer Ewigkeit quält, und ihr Island-Bildband, den sie schon ein halbes Leben lang mit sich herumträgt. Als sie auf Nói trifft, den Jungen mit dem Faible für Blumen, spürt sie sofort eine tiefe Verbundenheit. Nói führt vorübergehend das Lokal seiner Eltern, und Kalima überredet ihn, sie einzustellen. Er bezahlt sie mit Touren zu Islands Naturwundern, bei denen die beiden sich näherkommen. Doch zwischen den Seiten von Kalimas Bildband lauern die Dämonen ihrer Vergangenheit. Und die stehen nicht nur ihrer Liebe im Weg, sondern auch ihrem Leben. Between My Worlds ist der Auftakt einer bewegenden Romance-Dilogie von Own-Voice-Autorin und Buchbloggerin Basma Hallak vor der inspirierenden Kulisse Islands zwischen verlorenen Lichtern, dunklen Stränden und einer herzzerreißenden Liebe. Weiter geht es im Abschlussband Between Your Memories. Einer muslimischen Protagonistin begegnen auf ihrem Weg zu kultureller Selbstfindung Alltagsrassismus und Misogynie, aber auch wunderbare Menschen, atemberaubende Natur und vor allem die ganz große Liebe. Romantisch, bewegend und ein Buch, das man so schnell nicht vergisst. Perfekt für alle Fans von Mehwish Sohail, Mounia Jayawanth und Lilly Lucas Eine Auswahl an den in diesem Buch vorkommenden Tropes: - Soft Grumpy x broken Sunshine - Strangers to friends to lovers - He falls first and so much harder - Forced proximity - Opposite attraction - Dual POV - Smalltown boy meets big city girl - Arabic repWir wünschen ein schönes Leseerlebnis! »Ich liebe Basmas Humor und ihre Art, wichtige Themen unfassbar gut und gefühlvoll zu verpacken! Wir brauchen solche Geschichten – so romantisch, so witzig und vor allem: so unfassbar schön!« Kim Nina Ocker, Spiegel-Bestsellerautorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Ähnliche
Basma Hallak
Between My Worlds
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Nachdem die erste Ausstellung der Berliner Fotografin Kalima in einem gigantischen Shitstorm endet, flieht sie nach Island. Mit sich im Gepäck: ihre Verlorenheit, ihre panische Angst vor Ablehnung, die sie schon seit einer Ewigkeit quält, und ihr Island-Bildband, den sie schon ein halbes Leben lang mit sich herumträgt. Als sie auf Nói trifft, den Jungen mit dem Faible für Blumen, der vorübergehend das Lokal seiner Eltern führt, spürt sie sofort eine tiefe Verbundenheit. Sie überredet ihn, sie einzustellen und sie mit Touren zu Islands Naturwundern zu bezahlen, bei denen die beiden sich näherkommen. Doch die Dämonen ihrer Vergangenheit, die zwischen den Seiten ihres Bildbandes lauern, stehen nicht nur ihrer Liebe im Weg, sondern auch ihrem Leben.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Content Notes – Hinweis
Widmung
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Danksagung
Nachwort
Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Für meinen Baba,
der nicht aufhören konnte, Geschichten
über das Leben,
das Lächeln meiner Mama und
unsere Heimat zu erzählen.
Ich wünschte,
du wärst da, damit du sehen könntest,
wie ich diese erzähle.
Ich wünschte, du wärst da,
damit ich dich bei meiner Erzählung lächeln sehen könnte.
قصتك
I am from there.
I am from here.
But I am neither there nor here.
I have two names which meet and part …
I have two languages, but I have long forgotten
which is the language of my dreams.
Mahmoud Darwish
Kapitel 1
Der Boden der Tatsachen ist ein wirklich ungemütlicher Ort
Der verurteilende Blick des Drogenspürhundes spricht Bände. Ich senke den Kopf, starre auf meine dreckig weißen Sneaker, die in einer halbkreisförmigen Pfütze Schmutzwasser versinken, und bete dafür, dass er sich ein anderes Opfer sucht. Dürfte nicht allzu schwer sein, weil ein Berliner Flughafenhund doch wirklich ungewöhnlichere Dinge gesehen haben muss als eine Zweiundzwanzigjährige, die um sieben Uhr morgens beim Security-Check einen Schoko-Eisbecher herunterschlingt. Andererseits, für wen hält er sich? Flughäfen sind doch schließlich die vorurteilsfreisten Orte der Menschheitsgeschichte. Grauzonen, in denen alles erlaubt ist: faltenfreie Businessanzüge, ausgebleichte Jogginghosen, Koffeindosen um Mitternacht oder fettige Burger zum Frühstück – alles legitim und nicht so wirklich der Rede wert. Und dennoch … Würde die Flughalle nicht aus allen Nähten platzen und wäre ich nicht sowieso schon dabei, etwas Lebensveränderndes zu tun – aufgrund von Verurteilungen anderer –, würde ich mit Sicherheit versuchen, ihm dieses sehr skurrile Bild zu erklären. Ich würde mich zu ihm beugen und so was sagen wie: Weißt du, Kumpel, ich habe einige zweifelhafte Entscheidungen getroffen, die meine Welt ins Ungleichgewicht gebracht haben, und dachte, ein Becher Eis, den ich auf dem Weg in mein selbst gewähltes Exil vor mich hin mampfe, während ich gedankenverloren und überdramatisch aus dem kleinen Fenster des Flugzeugs starre, könnte mein selbst verschuldetes Leid verringern. Und, na ja, würde ich fortfahren, irgendwie habe ich mich darauf verlassen, dass ich einen Eisbecher problemlos durch die Sicherheitskontrolle bekomme, weil man ja auch davon spricht, dass man Eis »isst«.
Tja. Überflüssig zu erwähnen, dass meine Theorie erhebliche Lücken aufweist.
»Entweda du isst dit jetzt auf oder dit landet im Müll«, wiederholt der Mitarbeiter, der nicht mal so tut, als würde er mich bemitleiden. Auf dem Namensschild, das mit einer Sicherheitsnadel an sein blaues, ungebügeltes Hemd gepinnt ist, steht Dirk.
»Würde es was bringen, wenn ich Ihnen sage, dass ich Ihre Frisur echt voll cool finde?«, lüge ich hoffnungsvoll und schenke ihm mein Guter Mensch-Lächeln, das ich speziell für Eltern meiner Freunde konzipiert habe. Nach allem, was ich die letzten Tage ertragen habe, wäre es vermutlich ein Kinderspiel, mich bettelnd auf den Boden zu bekommen. Aber es ist Winter und der Boden voll von wässrig dreckigen Fußabdrücken, also vielleicht habe ich doch noch so etwas wie Selbstachtung.
»Nee du, dit würd nich mal wat bringen, wenn du mir die Frise verpasst hättest.«
Ich überlege einige Augenblicke, einfach weiterzuschleimen. Ich könnte ihn einen Ehrenmann nennen – wie mein großer Bruder Jalal, wenn er irgendwen überzeugen will, ihm etwas umsonst zu geben –, oder ich mache ihm irgendein erlogenes Kompliment zu seinem Körperbau, wie meine beste Freundin Sanju, wenn sie einen Mann an der Tankstelle bequatscht, damit sie sich beim Ölwechsel nicht die Hände schmutzig machen muss. Oder ich greife zum altbewährten Trick alter weißer Männer, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollen – klassische Bestechung. Aber bei seinem Blick verwerfe ich Option A, B und C. Er macht mit seiner ganzen Person deutlich, dass es ihn nicht juckt, was ich zu sagen habe, und durch rote Centmünzen hat sich wahrscheinlich noch niemand erbarmt, irgendwelche Regeln zu lockern. Ich presse die Lippen zusammen, greife nach dem weißen Plastiklöffel, der neben dem Eisbecher in der roten Tüte liegt, und reiße die Packung theatralisch auf. Nur weil Dirk sich spontan als Verräter entpuppt hat, ändert es nichts daran, dass ich zu geizig bin, diesen überteuerten Eisbecher, der gottlose sieben Euro gekostet hat, wegzuschmeißen. Jalal, der wie fast jeder in Neukölln alles in Dönerpreise umrechnet, würde sagen, dass das zwei Döner sind – also vor der Inflation. Jetzt ist es wahrscheinlich nur noch ein halber. Die fett blinkende rote Digitaluhr über Dirks Kopf verkündet, dass mir vielleicht noch zwanzig Minuten bis zum Boarding bleiben, also schaufele ich das süße Zeug in mich hinein. Die Kälte frisst sich durch meine Zähne und in den Schädel. Menschen, die Eis irgendwann als Genussmittel deklariert haben, würden jetzt mit Sicherheit missbilligend den Kopf schütteln – ähnlich wie der Hund –, doch darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich muss mich dreimal stoppen, nicht Hirnfrost zu brüllen und meine Fingerspitzen auf meine Schläfen zu pressen, aber ich halte mich in letzter Sekunde zurück. Dieser Becher wird mit Sicherheit nicht die Sache sein, an der ich heute – dem Tag, an dem ich mutig genug für diesen längst überfälligen Schritt bin – scheitere. Mein neues, mutigeres Ich ist eine krassere Version von mir, die niemals aufgibt und keine Gefangenen macht. Möglicherweise bereut sie das Ganze in einigen Stunden wegen ihrer winzigen Laktoseintoleranz, aber sonst ist sie knallhart und gönnt Dirk diesen Sieg nicht.
Mit dem schadenfrohsten Lächeln, das meine müden Wangen zustande bringen, werfe ich einige Minuten später den durchgeweichten, aber leeren Becher in den Abfalleimer vor ihm, der beinahe überquillt von halb vollen Wasser- und Deoflaschen. Doch meine Mundwinkel fallen herab, als ich sehe, dass er viel zu sehr damit beschäftigt ist, seinen bunten Irokesen in der spiegelnden Oberfläche des Scanners zu betrachten, statt mich für mein Durchhaltevermögen zu loben. Oder mich für die Zeitverschwendung zu verfluchen. Ich bin trotzdem irgendwie angepisst, dass sich das Ganze ohne seine Bestätigung weniger wie ein Sieg anfühlt. Sanju würde jetzt wahrscheinlich genervt die Augen verdrehen und so was sagen wie: So viel dazu, deine Erfolgserlebnisse nicht mehr von anderen abhängig zu machen. Aber na ja, so was lässt sich leicht sagen als erfolgreicher reicher Mensch mit Anfang zwanzig. Ihr Leben ist es schließlich auch nicht, das sich in den letzten Tagen von durchschnittlich in absolut beschissen verwandelt hat. Ich wende mich ab, weil ich die vorwurfsvollen Blicke der wartenden Personen hinter mir, die meine peinliche Trotznummer miterlebt haben, im Rücken spüre.
»Hat et sich denn jelohnt?«
Dirk zeigt auf den übergroßen braunen Fleck auf meinem weißen, langärmligen Jerseyshirt.
Fantastisch. Absolut großartig.
Doch statt eines Fluches schenke ich ihm ein so breites Grinsen.
»Absolut. Beste Entscheidung meines Lebens«, sage ich komplett unironisch, was er mit einer hochgezogenen Augenbraue quittiert. Mein vermutlich leicht grün angelaufenes Gesicht entlarvt meine offensichtliche Lüge sowieso. Chocolate Fudge Brownie hat es schon einige Male geschafft, meine Laune zu retten, wie nach Klausuren, die ich in den Sand gesetzt habe, oder während meiner dramatischen Liebeskummersessions wegen einer Kurzzeitschwärmerei circa alle zwei Wochen. Aber gerade hat es mich mein physisches Wohlbefinden – das psychische war sowieso bereits im Arsch – gekostet. Mir ist kotzübel. Aber ich werde einen Teufel tun, ihn das wissen zu lassen.
Beruhigend, dass ein bisschen deines Stolzes noch da ist.
Meine innere Stimme hat sich in der letzten Woche von einer leicht sarkastischen zu einer tief zynischen Vorzimmerdame mit schmallippigem Lächeln verwandelt.
Ich greife nach einer der grauen Plastikkisten und fülle sie mit meinen elektronischen Habseligkeiten: Handy, Powerbank, Laptop und zum Schluss die Kamera, die ich normalerweise immer um den Hals trage. Doch gerade erfasst mich bei dem Gedanken eine Übelkeit, die nichts mit dem Eis-Eklat zu tun hat.
Fachmännisch zieht Dirk die Kiste zu sich und nimmt den Laptop aus der Tasche. »Wer soll dit sein?«, fragt er mit Blick auf die Sticker, die fein säuberlich auf dem Laptop kleben. »Sieht’n bisschen aus wie Dieter Bohln zu Modern-Talking-Zeten. Kennste den? Scheri Scheri Ledi?«
Beim Sprechen lösen sich Spucktropfen und verteilen sich auf dem grauen Metall des MacBooks. Ich starre ihn an, ein bisschen angesäuert über den Speichelangriff und den peinlichen Ohrwurm, auf den ich hätte verzichten können.
»Das ist Harry Styles.«
Statt sich von meinem erbosten Tonfall beeinflussen zu lassen, zuckt er bloß mit den Schultern. Die audacity.
»Haste noch irgendwas Spitzes dabei, das als Waffe durchgehen könnte?«, fährt er stattdessen fort und wirft einen gelangweilten Blick über meine restlichen Sachen.
»Sie meinen, außer meinem Killer-Humor?«
Meine Mundwinkel heben sich praktisch von allein, was eine ziemlich milde Reaktion dafür ist, wie witzig das gerade war.
Dirk verharrt in der Bewegung und taxiert mich mit einem Wie peinlich willst du das Ganze für alle Beteiligten noch machen-Blick, bevor er sich kopfschüttelnd wieder der Arbeit auf dem Fließband widmet.
Offensichtlich scheint es ihn nicht zu interessieren, dass ich gerade dabei bin, einen der vielen Tiefpunkte meines Lebens mit Humor zu kompensieren. Zugegebenermaßen nimmt dieser mittlerweile aber auch erschreckende Dad-Jokes-Züge an, also kann ich es ihm nicht mal verübeln. Ein kleiner anerkennender Lacher hätte trotzdem gutgetan.
»Nächste.« Die monotone Stimme der kleinen blonden Mitarbeiterin auf der anderen Seite des Metallbogens reißt mich aus meinen Gedanken.
Als ich Dirk einen letzten Blick zuwerfe, steckt er mit den Händen bereits bis zu den Ellbogen in einem fremden Kulturbeutel. Die Mitarbeiterin tippt ungeduldig mit dem Fuß auf der Stelle, als stehe sie einige Minuten vor ihrem Feierabend. Sie hat tiefe Augenringe und einen verschmierten Eyeliner, der auf eine aufregende Nacht schließen lässt. Mit Sicherheit aufregender als meine, in der ich auf Zehenspitzen durch die Wohnung getapst bin, um meine noch feuchten Klamotten vom Wäscheständer zu fischen, ohne meine Familie zu wecken. Die klamme Wäsche liegt jetzt zusammengepfercht in meinem Handgepäckkoffer, der in dem Moment ohne kritische Beobachtung der Mitarbeitenden am anderen Ende des Bandes ankommt und auf mich wartet. Glücklicherweise. Wenn sie darauf bestehen würden, ihn zu öffnen, hätte ich ihn nie wieder zubekommen, ohne einen dieser überdramatischen Wrestling-Sprünge ausführen zu müssen.
Ich versuche den Blickkontakt der wartenden Mitarbeitenden zu ignorieren, zupfe am breiten Bund meiner Leggings, halte den Atem an. Vorsorglich trage ich einen bügelfreien BH, der meinen Brüsten nicht den nötigen Halt gibt, und auch sonst keinerlei Metall am Körper. Selbst das silberne Schmetterlingspiercing – eine Jugendsünde, zu der mich Sanju überredet hat – habe ich mir eben auf der Toilette in einem aufwendigen Akt aus dem Bauchnabel gepopelt. Und auch die Stecknadeln, mit denen ich sonst mein Tuch befestige, befinden sich in einem kleinen Plastikdöschen in der Innentasche meines Rucksacks. Es fühlt sich dadurch so an, als könnte jeder Windstoß mir den kobaltblauen Chiffonstoff vom Kopf befördern, doch glücklicherweise trage ich darunter noch ein eng anliegendes Bonne. Das blickdichte schwarze Untertuch ist fest unter meinem straffen Zopf zusammengebunden und bedeckt meine Haare vollständig. Ich gebe mich betont gelangweilt, laufe durch den breiten Rahmen des Detektors, während die Mitarbeiterin ihre Augen nicht vom oberen Ende des Magnetbogens abwendet. Die nächsten Sekunden werden entscheiden, wie sie als Nächstes verfahren und wie demütigend die ganze Nummer anschließend für mich wohl wird.
Kein Piepen, kein aufblinkendes Licht. Meine Knie werden vor Erleichterung weich. Ich atme geräuschvoll aus, was alles andere als unverdächtig wirkt. Als der misstrauische Blick der Frau mich trifft, versuche ich, nicht nervös aufzulachen. Stattdessen lächle ich sie so breit an, dass meine Mundwinkel zu reißen drohen. So breit, wie es mir anerzogen wurde. Dann verschränke ich die Arme vor der Brust und laufe zum Band. Für eine zusätzliche total zufällige Kontrolle habe ich weder Zeit noch Lust. Ich habe bereits einen Lebensvorrat an Erinnerungen von zufällig ausgewählten Überprüfungen, die ich in der Vergangenheit schon über mich ergehen lassen musste. Manchmal ist es nur ein kleines Abtasten nach einer höflichen Ankündigung. Manchmal ist es mehr. So … viel mehr. Erniedrigende Momente, die ich anschließend wie kleine Souvenirs in den Urlaub mitnehme und aus ihm zurückbringe. Winzige kratzige Andenken, die dazu bestimmt sind, für immer wie Desinfektionsmittel auf einer offenen Wunde zu brennen. Ein bisschen lodernd, ein bisschen brennend, zwar auszuhalten, aber einprägsam und zusätzlich … für immer mit einem exklusiven Ehrenplatz in meinem Hinterkopf.
Die graue Kiste bahnt sich ihren Weg über das Fließband, mein deutscher Pass gut sichtbar platziert, was auch der Mitarbeiterin aufzufallen scheint, die im gleichen Moment das unübersehbare Interesse verliert. Ich wische mir die feucht gewordenen Hände an den Leggings trocken.
Die nächste Kiste, in dem mein senfgelber Rucksack mit dem winzigen Ansteckpin in Form einer aufgeschnittenen Wassermelone steckt, ist noch nicht ganz bei mir angekommen, da quetsche ich mein Zeug wieder hinein. Es ist wahnsinnig schwer, weil der große Bildband, den ich immer mit mir rumtrage, fast den ganzen Platz einnimmt. Aber meine Angst, dass sie es sich anders überlegen, ist größer. Mit ein bisschen Gewalt und ein paar verzweifelten Gebeten schließe ich den Reißverschluss, werfe mir den Rucksack über die Schulter, greife nach Jacke und Handgepäckkoffer und renne los. Beim Anblick der farblosen Flughafengänge, die ein riesiges schwarzes Loch in die Berliner Kasse gerissen haben, schießt mir ein abgedroschener Spruch über verschwendete Steuergelder durch den Kopf, dabei habe ich noch nie lang genug gearbeitet, um überhaupt steuerpflichtig zu sein. Als ich an einer kleinen Gruppe Polizisten vorbeikomme, die genervt aussehend an ihren Energiedosen nippen, drossle ich mein Tempo sofort und presse mir den Pass gut sichtbar und betont lässig an die Brust. Vermutlich interessieren sie sich gar nicht für mich, aber Gewohnheiten lassen sich bekanntlich schwer abschütteln – und ich muss daran denken, wie viele verschiedene Reaktionen diese Uniform in Menschen hervorruft. Für die einen bedeutet sie Sicherheit, der Freund und Helfer, und für andere ist es nichts als eine sinnbildliche, traumafixierte Angst. Und für wieder andere neuerdings nichts anderes als Thirst-Trap-Edits auf TikTok.
Wilde Zeiten, in denen wir leben.
Die vielen Wegweiser führen mich weg von dem Gate für die Langstreckenflüge,mitten durch das riesige Duty Free. Die viel zu laute Musik, Gesprächsfetzen unbekannter Sprachen und ekelerregend starkes Parfüm lenken mich für eine Sekunde so sehr ab, dass ich nur knapp einen Zusammenstoß mit einer Junggesellengruppe verhindere, die unbekümmert in der Gegend stehend den ganzen Weg versperrt. Sie tragen zusammengehörige rote Hoodies mit der Beschriftung Morgen geht’s in den selbst erwählten Knast, was ich charmant, romantisch und so gar nicht fremdschamerregend finde. Nicht.
Sechs qualvolle Minuten später stehe ich atemlos am richtigen Gate. Schweißperlen stehen mir auf der Oberlippe und entfernen vermutlich gerade die letzten gut gemeinten Concealerspuren. Doch zu meiner Überraschung erwartet mich keine lange Personenschlange oder allgemeiner Flughafentrubel, obwohl das Flugzeug laut Ticket in genau siebzehn Minuten abheben sollte. Stattdessen sitzen die Passagiere ruhig und auf ihre Handys schauend auf den Plätzen, schlürfen gemütlich an ihren Sechs-Euro-Kaffees und kauen an den labbrigen Croissants vom Vortag. Meine Augen scannen die riesige Anzeigetafel inmitten der Halle, bis ich besagten Flug finde, unmittelbar zwischen London und Amsterdam und mit der rot leuchtenden Anmerkung: delayed. Verspätet.
Ich atme langsam durch die Nase ein und durch den Mund aus, um das penetrante Stechen zu vertreiben, das meine Lunge attackiert. Meine einzig sportliche Betätigung im Alltag sind ausgefallene U-Bahn-Rolltreppen. Mit einer Fitnessklubmitgliedschaft wäre ich vielleicht um einiges fitter – und mit Sicherheit in kürzester Zeit sehr viel besser darin, eine Ausrede zu finden, um mich vor körperlicher Betätigung zu drücken. Ich habe jetzt nicht direkt was gegen Sport – nur noch weniger was gegen rumliegen und Chips essen.
Während ich noch an der gleichen Stelle stehe, befördert die Tabelle meinen Flug prompt an das Ende der Liste und zerstört meine Hoffnung, dass es sich vielleicht nur um eine kleine Verspätung handeln könnte. Nur mit Mühe und einem festen Biss auf die Zunge kann ich einen lautstarken Fluch oder einen dramatischen Ausbruch unterdrücken. Sanju spricht diese Seite meinem pathetischen alten Ego zu. Sie hat sie vor Jahren Dralima getauft – eine Verschmelzung von Kalima und Drama, weil ich womöglich gelegentlich dazu neige, etwas theatralisch auf gewisse Situationen zu reagieren. So wie jetzt. Hätte der Flughafen die Freundlichkeit besessen, mich etwas früher über die Verspätung aufzuklären und das Gate für Kurzstreckenflüge nicht an das gefühlt andere Ende von Berlin zu verbannen, wäre ich gar nicht erst gezwungen gewesen, herzurennen. Oder das halbe Kilo Eiscreme zu exen.
Wirklich eine Frechheit, dass der Flughafen nicht auf die Befindlichkeiten einer Person, die vor ein paar Stunden in einer wohlüberlegten Übersprungshandlung ihr Ticket bei einer Billig-Airline gekauft hat, Rücksicht nimmt, keift meine innere Stimme zurück.
Ich kneife die Lippen zusammen und versuche, jemanden – irgendjemanden – anzusprechen, der mir versichert, dass das Ganze nicht dazu führen wird, dass ich meine Anschlussflüge verpasse. Aber die auffällig unauffälligen Blicke der Umstehenden in meine Richtung, während die Durchsage, sein Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen zu lassen, ertönt, bringt meine Haut zum Jucken und zwingt mich zur Kapitulation. Hier einen Mitarbeiter aufzutreiben ist wahrscheinlich ähnlich hoffnungslos wie in einem Baumarkt, in dem nie jemand für die Abteilung zuständig ist.
Statt mir einen der rar gesäten Sitzplätze zwischen den nörgelnden Kleinkindern und Personen, die noch nie was von Kopfhörern gehört haben, zu angeln, laufe ich geradewegs auf die verglaste Front zu und setze mich im Schneidersitz ganz nah davor. Der Sonnenaufgang ist eine chaotische Überlagerung verschiedener Rot- und Blautöne, die die Landebahn verfärben und meine Augen schwer werden lassen. Ich spüre das vertraute Kribbeln in meinen Fingerspitzen, als hätte es die letzten Tage nicht gegeben, und das Bedürfnis, meine Kamera auf den Horizont zu richten, wird übermenschlich. Ohne dem verräterischen Bedürfnis nachzugehen, starre ich mir in der leicht beschlagenen Scheibe entgegen und spüre die seltsame Mischung aus Vorfreude, Nervenkitzel und Aufregung, die von der Umgebung ausgeht, wie abgestandenen Speichel in meinem Mund. Urlauber, die sich ein paar Tage Abenteuer und Entspannung gönnen. Studierende, die ein lebensveränderndes Auslandsjahr antreten oder ähnlich pathetisches Zeug. Ich strahle mit Sicherheit nicht halb so viel Euphorie aus. Wieso auch? Ich liebe diese Stadt – eigentlich. Mein ausgeprägter Heimatstadtpatriotismus ist kitschig und manchmal wirklich krass peinlich. Das ist mir spätestens dann klar geworden, als ich begonnen habe, ganz unironisch Sprüche von überteuerten Postkarten zu zitieren, wie Berlin ist keine Stadt, sondern ein Lebensgefühl. Das hat mir schon ein paar sehr befremdliche Blicke eingebracht. Primär von mir selbst.
Ich ziehe meine Beine an die Brust und krame mein Handy aus dem Rucksack. Schon beim ersten Blick auf das Display muss ich dem Drang widerstehen, es sofort wieder verschwinden zu lassen. Aber es ist längst zu spät, denn die Nachrichten sind bereits überall, und egal, wo ich bin, ich kann ihnen nicht entkommen. Am liebsten würde ich das Handy entsorgen oder das Social-Media-Detox machen, das Sanju mir aufdrängen will. Aber … irgendwie hat die Katastrophe durch ihr Drängen seinen Lauf genommen. Und jetzt, in diesem Moment, fühlt sich Nichthinsehen so viel schlimmer an, als es tatsächlich zu tun.
Tinydoubledee245
So flach und gehaltvoll wie ein Toastbrot. Hab bei dem Namen jetzt auch nichts anderes erwartet, aber das Level an Oberflächlichkeit ist schon fast fremdschamerregend.
SenfmitEi_67
Typisch »Großstadtfotografin« halt. Heutzutage nennt sich auch jeder Fotograf, der ein gut belichtetes Selfie hinbekommt. Habe bei der Generation schon Angst um meine Rente!
Modelmagnet_69
Keine Ahnung, wieso man sie wichtig genug findet, um sie überhaupt zum Thema zu machen, aber vielleicht wäre die Fotografin besser vor der Kamera aufgehoben. Hübsch anzusehen ist sie ja ;) Ps: Meld dich bei mir, wenn du mal ein anderes Gerät in den Händen haben willst.
Karen1965
Armes Deutschland! Das passiert, wenn man jemandem ohne Talent eine Plattform gibt, nur um die Ausländerquote zu erfüllen. Diese andauernde gezwungene Diversität. War schon bei Topmodel ein einziger Albtraum. Wenn ihr dabei sein wollt, seid doch bitte auch gut genug. Wenn nicht, es gibt ja noch EUER Land dafür ;)
Meine Hand krallt sich schmerzhaft um das Plastik, hinter meinen Augen beginnt es zu brennen. Innerhalb weniger Sekunden ist mein Hals verstopft und staubtrocken, als müsste ich einen Fellball auswürgen, um wieder ungehindert Zugang zu Sauerstoff zu erhalten. Mein Puls schießt alarmierend in die Höhe, und winzige schwarze Punkte trüben meine Sicht. Seit diese Kommentare ihren Weg unter meine Instagrambeiträge, in meine Privatnachrichten und in mein E-Mail-Postfach gefunden haben, leben sie hinter meiner Stirn. Hunderte Stimmen, die mir zu jedem Zeitpunkt zuschreien, wie scheiße ich bin. Und ich tue nichts, als zuzusehen, wie sich ihre Beleidigungen in meine verdammte Existenz brennen. Den Rest der Zeit verbringe ich anschließend damit, mich auffällig oft zu fragen, wann ich in diese seltsame Abwärtsspirale geraten bin. Am Anfang ging es schließlich nur um die mangelnde Qualität meiner Fotos – bis es einen Wimpernschlag später um mein Aussehen, meine Herkunft und meine Erziehung ging. Es ist so schlimm geworden, dass ich die ganzen Nachrichten in Kategorien einteilen musste, um das Ganze zu überstehen.
Kategorie 1: Es zwickt ein wenig. Teilweise konstruktiv, teilweise beleidigend.
Kategorie 2: Gemein und kein bisschen konstruktiv. Am besten nicht mehr als drei an einem Tag lesen – und auf keinen Fall auf leeren Magen.
Kategorie 3: Schlimm. Viel zu schlimm. Am besten im hintersten Teil meines Kopfes vergraben, dort, wo die ganzen anderen Dinge, die mich sonst panisch werden lassen, ihre letzte Ruhe gefunden haben.
In meinem flauen Magen sammelt sich ein Knoten in der Größe eines Medizinballs, der mir ganz klar rät, das beschissene Handy aus der Hand zu legen.
Jetzt. Sofort.
Ich wische mir mit dem Handrücken die Verzweiflungstränen aus dem Gesicht und presse meine Finger fest auf den länglichen Knopf an der Seite meines Handys, bevor ich es wieder in der Tasche verschwinden lasse. Wenn das Flugzeug irgendwann auftaucht, muss ich es sowieso wieder einschalten, weil mein Boardingpass sich in der Apple Wallet befindet. Aber so lange kann ich versuchen, mich mental stabiler zu fühlen als eine Salzstange. Ich zähle bis fünf, bis zehn, dann bis zwanzig, und dann immer weiter.
Als ich ein paar Minuten später überfordert und noch immer vollgepackt durch die schwere Toilettentür stolpere, lässt mich die ekelhafte Mischung aus Schweiß und Bodyspray beinahe würgen. Ich blende die wartenden Personen für die Toilettenkabinen aus und haste ans Ende des breiten Gangs vor einen der sauber geschrubbten Spiegel. Das grelle Licht des LED-Balkens sticht mir in die Augen, lässt meine Haut fahl aussehen und verwandelt meine Lippen in einen blutleeren Strich. Wobei es vermutlich falsch wäre, allein dem Licht die Schuld zu geben. Die Tage im Fotolabor und die schlaflosen Nächte haben mich blass werden lassen. Wäre ich etwas attraktiver und eine Neuinszenierung von Twilight in Sicht, würde ich einen guten, wenn auch talentlosen Vampir abgeben.
Ich ziehe Papiertücher aus dem halb vollen Spender neben dem Spiegel, befeuchte sie mit Wasser aus dem Hahn und wische mir die fleckigen Schminkreste vom Gesicht. Beim Anblick meiner geröteten Augenlider wird mir noch einmal schmerzlich bewusst, dass ich die letzten drei Nächte nichts anderes getan habe, als
mich selbst zu bemitleiden,
deprimiert aus dem Fenster zu schauen,
von Zeit zu Zeit auf meine Hände zu starren, auf der Suche nach einem zusätzlichen Finger, denn das würde bedeuten, ich hätte diese katastrophale Entwicklung der Ereignisse bloß geträumt.
Ich lasse warmes Wasser über meine mit Henna bemalten Hände laufen. Eid al-Adha ist erst wenige Tage her, und die Farbe schimmert mittlerweile dunkelorange. Eigentlich ist das Fest kein Anlass, sich die Hände bemalen zu lassen. Aber nachdem sich die Familie meiner Mutter nach Jahren zum Feiern zusammengefunden hat, konnte ich meiner Cousine den Wunsch, sich an meinen Händen auszutoben, nicht abschlagen. Selbstverständlich haben es sich meine Verwandten nicht nehmen lassen, die Art der Zusammenkunft zu nutzen, um sich über meine mehr oder weniger zweifelhaften Lebensentscheidungen auszutauschen, angefangen bei der Wahl meines Berufes. Zugegeben, einen künstlerischen Beruf in einer Ärztefamilie anzustreben bedeutet, sich ein Dauerticket für die Hall-of-enttäuschte-Blicke zu sichern. Mittlerweile habe ich mich an die passiv-aggressiven Andeutungen, die zusammengepressten Lippen und das ewige Belächeltwerden gewöhnt. Mir tut es irgendwie mehr weh, zu wissen, dass Mama auch ein Dauerticket hat. Jemanden zu heiraten, der kein Arzt ist, und eine Tochter mit ihm zu zeugen, die einen ähnlich abtrünnigen und noch dazu vollkommen erfolglosen Weg eingeschlagen hat, verjährt nicht. Egal, wie viele Jahre, Kilometer und Schmerz zwischen Anfang und Endprodukt liegen.
Ich schüttle den Kopf, um die aufkommenden deprimierenden Gedanken zu verscheuchen, und atme so tief durch, dass sich der räudige Geruch von billigem Toilettenreiniger auf meine Zunge legt. Dann drehe ich den Wasserhahn auf und halte meinen Mund unter den kühlen Strahl, der schmeckt, als würde er direkt aus einer Chlorpfütze kommen. Als ich anschließend meinem Blick im Spiegel begegne, schaffe ich es, einen Mundwinkel zu heben. Das Lächeln ist unsicher, zittrig, aber der schwere Bildband im Rucksack und das, was er verheißt, verursachen ein hoffnungsvolles Trommeln in meiner Brust. Ich fische das Stecknadeldöschen aus meinem Kulturbeutel und beginne, mir das Tuch festzustecken, weil sich nichts mehr an mir instabil anfühlen soll. Nie wieder.
heute
Hey, Baba,
Erinnerst du dich noch an meinen letzten Brief, in dem ich dir von meinem Uniabschluss erzählt habe und dass ich mich jetzt ganz offiziell Fotografin nennen darf? Dass ich jetzt, trotz der ganzen Selbstzweifel, bereit bin, etwas Höheres anzustreben? Endlich an mich zu glauben und dieses ganze Selbstverwirklichungszeug? Nun, irgendwie war ich seltsam optimistisch, viel zu idealistisch und grenzenlos naiv. Deshalb ist es vielleicht ein wenig witzig und doppelt so tragisch, wenn man bedenkt, was ich gerade im Begriff bin zu tun. Aber lass mich damit anfangen: Beim Versuch, die Karriereleiter zu erklimmen, bin ich abgerutscht und habe mir das Rückgrat gebrochen. Es war ein harter Bruch, der mir die Luft aus der Lunge gepresst und Knochensplitter in jeden vorhandenen Fetzen meines Seins gegraben hat. Dadurch wird mein Durchbruch noch auf sich warten lassen. Und ich weiß nicht, wie lang. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, in welchem Bett ich heute Abend liegen werde (und ich wünschte echt, das wäre nur halb so abenteuerlustig gemeint wie bei Menschen, die das vor einer Partynacht sagen). Aber alles zu erklären wäre kompliziert, Baba. Es lässt sich am besten zusammenfassen, wenn ich dir sage, dass ich gerade im Begriff bin, etwas zu tun, von dem ich noch nicht weiß, ob es die lächerlichste oder die mutigste meiner sonst so ziemlich irrationalen Entscheidungen ist.
Es gibt ja so ein paar monumentale Regeln, die Eltern ihren Kindern oder Ratgeber ihren Lesern predigen. Immer und immer wieder, Generation für Generation, Auflage für Auflage.
• Geh niemals hungrig einkaufen, denn du läufst Gefahr, den kompletten Supermarkt leer zu kaufen.
• Hüte dich davor, bei Übermüdung irgendeine Investition zu tätigen, die dir ein Teleshoppingkanal empfiehlt.
Und dann noch:
• Triff keine – und wirklich keine – lebensverändernde Entscheidung aus einer Emotion heraus. (Und damit sind nicht nur tränenreiche Nachrichten mitten in der Nacht an einen Ex-Freund gemeint.)
Ich weiß das im Prinzip alles. Und als ich mir, nachdem ich den Blick an meine Zimmerdecke nicht mehr ertragen habe, den Laptop geschnappt und das Erstbeste gebucht habe, das mich meinem Ziel möglicherweise näher bringen könnte, wusste ich das auch. Sogar als ich meine Klamotten von den Kleiderbügeln gerissen und mein Make-up in den Kulturbeutel gestopft habe, war es mir bewusst. Aber es hat kein Weg daran vorbeigeführt. Ich musste es tun, bevor ich mich daran erinnere, wieso ich mich vorher nicht getraut habe. Wieso ich mich so sehr davor gefürchtet habe, die Großstadt, in die du vor Ewigkeiten geflüchtet bist, um mir ein Zuhause zu bieten, hinter mir zu lassen. Ich will mir gar nicht vorstellen, mit wie viel Ängsten und Risiken deine vergangenen Entscheidungen verbunden waren, doch das ändert nichts daran, dass ich es tun muss. Denn in dem sehr tiefen Loch, in das ich vor einigen Tagen gefallen bin, ist mir klar geworden, dass diese Stadt, unser Zuhause, eine Safe-Space-Blase ist, weit weg von deiner Heimat, aber nah genug an unseresgleichen. Wir leben und lieben hier in Gegenden, die manche mit einem angewiderten Naserümpfen Araberstraße oder kleines Istanbul nennen. Winzige autonome Gebiete, in denen wir ohne Verurteilungen existieren dürfen. In denen wir uns seltener … schützen müssen – bis wir uns an den Rand dieser Blase bewegen. Am Rand der Blase sind wir die Einzigen mit einem orientalischen Namen, werden für zufällige Kontrollen an Flughäfen, Bahnhöfen oder bei Konzerten ausgewählt, oder Menschen sind überrascht von unseren Deutschkenntnissen. Dinge, die unsere Brust eng werden lassen, bis wir wieder ins Innere flüchten. Doch trotzdem – oder gerade dadurch – habe ich es geschafft, mich in dieser Blase zu verlieren. Ich bin ausgedünnt, als hätte jemand mich mit zu viel Wasser angerührt – und jetzt bin ich nichts als ein blasser Großstadtklecks auf einer noch blasseren Leinwand. Ich glaube, es ist ein Paradoxon, dass ich mich an einem Ort, der es mir ermöglichen sollte, komplett im Frieden mit mir selbst zu sein, verloren habe.
Ist es dann weit hergeholt, wenn ich versuche, das Problem auf die gleiche Art zu lösen? Diese Stadt verlasse, um zu lernen, hier zu sein? Denn genau das möchte ich. Das alles ist kein drastischer Ich lasse mein Leben hinter mir und komme nie wieder-Neuanfang. Es ist nur ein verzweifelter Versuch, die ganze Misere, in die ich mich hineinmanövriert habe, wieder auszubessern, auch wenn das einen Ort fordert, der mir nur halb so viel Sicherheit gibt. Der kein Safe-Place für Menschen wie mich ist. In dem meine Herkunft unter die Dreiprozentgrenze mit anderen Minderheiten fällt. Der mir Angst macht. Aber, keine Ahnung, Baba, um ehrlich zu sein, ist Angst mittlerweile mein treuer Begleiter. Ein ungebetener Gast, dem man jedes Mal aufs Neue die Tür öffnet. Und dann schaut man mit glasigen Augen dabei zu, wie er sich an den eigenen Gefühlen nährt, Gedanken zertrampelt und an den Innenraum des Herzens kratzt, während man bloß danebensteht und Ausreden für das vermeintlich schlechte Verhalten dieses Angst-Gastes sucht.
Nur will ich keine Angst mehr haben, Baba. Ich will meinen Angst-Gast vertreiben. Und deshalb tue ich jetzt das Gleiche wie du.
Riskieren.
Ich liebe dich.
Kalima
Kapitel 2
Sich auf andere zu verlassen bringt dir nichts als Trust Issues
»Wie konntest du mir das antun?«
Ihre großen Augen sind weit aufgerissen und die Stimme so schrill, dass ich mir die Hände auf die Ohren pressen will. Selbst Vinur, der friedlich auf seinem Kissen vor dem Kamin schläft, hebt mit gequältem Gesichtsausdruck den Kopf. Wenn er könnte, würde er sich mit den Pfoten die Ohren zuhalten.
»Bitte, hör mir zu, es ist nicht so, wie du denkst«, sage ich in einem so gelangweilten Tonfall, dass sie verärgert die Stirn runzelt.
»Schweig!«
Ich beiße mir in die Unterlippe und unterdrücke ein Auflachen wegen der melodramatischen Nummer, als sie im nächsten Moment ausholt und mich ohrfeigt. Perplex fasse ich mir an die heiße Wange und spüre die geballte Aufmerksamkeit des vollen Lokals auf uns.
»Alter, Freya.«
Ich starre meine kleine Schwester mit mahlendem Kiefer an und werfe die drei zusammengehefteten Blätter mit der Schauspielszene auf den Tresen vor mir, neben mein umgedrehtes aufgeschlagenes Buch, in dem ich gerade während meiner zehnminütigen Pause gelesen habe, weil ich mich für die zehn abgearbeiteten Post-its – zehn Punkte meiner nie endenden To-do-Liste – belohnen wollte. Anstatt zumindest ein bisschen Reue zu empfinden oder wenigstens zerknirscht auszusehen, kämpft Freya dagegen an, nicht loszulachen.
»Es tut mir leid, ich war gerade total in der Szene.« Dann verliert sie den Kampf gegen sich selbst und lacht lauthals los.
»Und deshalb ist es okay, mich zu schlagen?«, zische ich. Ist ja nicht so, dass ich dank ihr den vierten Tag in Folge eine Doppelschicht schiebe, weil sie beschlossen hat, nicht arbeiten zu können. Serien gucken und Nägel lackieren und das Stalken irgendwelcher Promis, die in der Nähe Urlaub machen, ist nämlich viel wichtiger. So viel dazu, dass man sich bei einem Familienbetrieb immer aufeinander verlassen kann.
»Was bist du nur für ein Vorbild für das Kind?«, frage ich und zeige auf Oli, der so vertieft in seinen Zeichenblock ist, dass er nicht einmal mitbekommen würde, wenn ich krankenhausreif geschlagen werden würde.
»Jetzt stell dich mal nicht so an. Er kann sich ein Beispiel an mir nehmen, dass ich mich bereits vollkommen auf eine Rolle einlassen kann. Laut Madame Sinclair brauchen einige Schauspieler dazu Jahre.«
»Madame Sinclair«, ich mache mit meinen Fingern Anführungszeichen in die Luft, die hoffentlich ausdrücken, was ich von diesem albernen Namen halte, »betreibt nebenbei noch eine Online-Metzgerei – bei der ich mir nicht mal sicher bin, ob das legal ist. Ich würde mich nicht auf ihr Urteil verlassen. Hätte sie Ahnung von irgendwas, hätte sie andere Lebensentscheidungen getroffen.«
»Du gönnst mir das einfach nicht, weil …«
Ich bringe sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und schenke meine Aufmerksamkeit einem der Männer aus der Touristengruppe, die vor knapp zwei Stunden einen der größeren Tische auf der Fensterseite des Lokals besetzt hat, und der nun vor dem Tresen steht.
»Hi, können wir vielleicht noch …« Er sieht auf die Tafel über mir, auf denen unsere selbst gemachten Cocktails und Shakes stehen. »… drei Blue-Vanilla-Shakes haben?«
»Ja klar, kommt sofort!«
»Oh, und ist die Küche noch auf? Wir hätten gerne noch …« Er dreht sich um und zählt seine Gruppe durch. »… fünf Burger, einen ohne Zwiebeln, einen mit extra viel Zwiebeln, einen mit veganer Mayo.«
Ich greife nach den Papieren der Theaterszene und notiere mir die Extrawünsche der Bestellung, um mir die Peinlichkeit zu ersparen, noch mal nachfragen zu müssen. »Vegane Mayo? Wir haben hier aber leider keinen veganen Burger. Nur Rind.«
»Oh ja, normaler Burger, aber bitte mit veganer Mayo.«
Ich nicke, als würde ich verstehen, dabei verstehe ich nichts. Gar nichts. Aber eine Sache, die einem in die Gastro-Wiege gelegt wird, ist der Hinweis, nicht zu viele Fragen zu stellen. Die Antworten führen bloß zu mehr Fragen.
»Bekommt ihr.« Ich nicke ihm zu, und er reckt mir einen Daumen entgegen wie ein peinlicher Sportlehrer.
Dann wende ich mich wieder Freya zu, die angesäuert das von mir beschriebene Szenenpapier betrachtet. »Das ist mein Skript, das kannst du nicht vollschreiben.«
»Hätte ich mich darauf verlassen sollen, dass du krasse Schauspielerin dir die Bestellung merkst?«
Bevor sie zu einer Antwort ausholen kann, angle ich eine der Küchenschürzen hinter mir vom Haken und halte sie ihr hin. »Ich mache die Burger, du die Shakes.«
»Ich habe heute frei.«
Nein. Ich hab heute frei. Ich hätte genau jetzt in meinem Gewächshaus sitzen und die Ruhe vor dir genießen können. Aber ich bin hier.
»Du hast gesagt, du hast was Wichtiges vor, deshalb übernehme ich seit vier Tagen deine Schichten.«
»Habe ich doch auch.« Sie ignoriert die Schürze, die immer noch vor ihr schwebt, und zückt ihr Handy. Dann hält sie mir das Display vor die Nase. »Ashton Kutcher hat getwittert, dass er heute Nacht in Dalvík Wale beobachten geht.«
Ich schenke dem Handy vor mir keine Beachtung, weil sie schon den ganzen Tag von nichts anderem spricht. »Juckt mich nicht. Der Typ hat mit Sicherheit keine Lust auf Groupies, die sich vor ihrer Schicht drücken.«
»Ruf doch Roman an, wenn du Hilfe brauchst.«
»Roman hat heute frei, und ich rufe ihn jetzt mit Sicherheit nicht an, nur weil du keinen Bock hast zu arbeiten.« Ich presse ihr die Schürze gegen den Bauch und gehe an ihr vorbei. Obwohl ich ihr Gejammere bis in die Küche höre und das ganz sicherlich nicht gut fürs Geschäft ist, ignoriere ich es einfach. Als würde ich nicht woanders sein oder was anderes tun wollen. Ich nehme mir was von dem Hackfleisch, schneide Gemüse, bevor ich die vegane Mayo aus dem Vorratsschrank hole. Als ich mit den fertig angerichteten Tellern wieder aus der Küche komme, steht Freya immer noch an derselben Stelle und tippt auf ihrem Handy herum. Ich stelle die Teller auf dem Tresen ab. »Kannst du die Burger einmal bonieren?«
Sie verdreht stöhnend die Augen, als würde ich die Welt von ihr verlangen, und läuft zur Kasse am Ende der Theke. Wenigstens diskutiert sie nicht mehr rum. Wie sie ihrem ungerechtfertigten Frust Luft macht, juckt mich nicht. Hauptsache, sie tut es schweigend.
Ich laufe um den Tresen herum, vorbei an den voll besetzten Tischen mit neuen Gästen, die Freya bisher ignoriert hat, und reiche den Männern ihr Essen. Dann räume ich leeres Geschirr von Tischen, nehme neue Bestellungen auf und leiere die Speisekarte, die laminiert an jedem unserer Tische festgeklebt ist, zweimal herunter.
Wir verfallen in unseren Arbeitstrott, bereiten Milchshakes zu, schmelzen Käse über Nachos, wärmen Kuchen auf, mixen Cocktails und füllen Salzstangen in kleine Gläser, die wir den Gästen irgendwann kostenfrei auf die Tische stellen, um eine vollgereiherte Toilette zu vermeiden.
Eine halbe Stunde später ist der Laden zwar kein Stück leerer, doch die Tische sind alle versorgt. Ich ignoriere Freyas leises Fluchen, als Magnús sich auf den Barhocker neben Oli schiebt. Freya und Magnús haben seit einigen Monaten offensichtlich ein Problem miteinander, auch wenn ich nicht genau verstehe, welches. Ich würde fragen, aber es interessiert mich wirklich nicht.
»Hat der Typ kein Zuhause?«, raunt sie mir zu, doch laut genug, um von ihm gehört zu werden.
Magnús mustert mich, der Nasenring ähnlich glänzend wie seine Augen. »Der Laden heißt buchstäblich Heima, und wäre ich heute nicht so gut drauf, wäre ich echt beleidigt, Freya.« Seine Stimme geht in ein Lallen über, was den abwesenden Blick erklärt. Dabei hat er recht. Das Heima ist der wahr gewordene Traum meines Vaters. Ein Zuhause, in dem jeder seine Sorgen zusammen mit seiner Jacke an der Tür abgibt. Für die Authentizität lag in meiner Kindheit sogar mal Teppich aus, und die Leute durften ohne Schuhe rumlaufen. Der wurde aber kurze Zeit später wieder entfernt, als klar wurde, dass der Geruch von Schweißfüßen nicht gut fürs Geschäft ist.
Freya verlässt augenverdrehend die Theke, setzt sich an einen der gerade frei gewordenen Tische in der Nähe einer dartspielenden Freundesgruppe und breitet ihre zerknitterten Blätter auf dem Holztisch vor sich auf. Möglicherweise – mit ganz viel Glück – findet sie jemand anderen, der sich von ihr schlagen lässt. Ich greife nach dem Geschirrtuch und fange an, Gläser abzutrocknen, während ich Magnús ansehe. »Wieso bist du betrunken?«
Er zuckt mit den Schultern. »Meine Eltern hatten Leute für die Besichtigung des Ladens da, also haben sie mich rausgeschmissen. Und Tomas feiert gerade eine Party bei uns zu Hause, also haben sie mich da auch rausgeschmissen.«
Ich schlucke und versuche, gelassen auf seine Worte zu reagieren. Seit Monaten versuchen seine Eltern, den Schmuckladen, den sie von seinem Großvater vererbt bekommen haben, zu verkaufen, obwohl sie das Geld nicht brauchen. Sie ignorieren wie gewohnt die Tatsache, dass es der einzige Ort auf der Welt ist, den Magnús über alles liebt. Nirgends verbringt er mehr Zeit als in den vier Wänden und der darunterliegenden Werkstatt, um neuen Schmuck zu designen und herzustellen.
»Du weißt, wie traurig das klingt, oder?«
Er verzieht das Gesicht. »Was meinst du?«
»Dass du von der Party deines siebzehnjährigen Bruders geflogen bist. Das ist traurig.«
Ganz davon abgesehen, dass es schon traurig ist, als Vierundzwanzigjähriger auf der Party des kleinen Bruders aufzutauchen. Aber so ist die Geschwisterdynamik zwischen Magnús und Tomas schon immer gewesen. Obwohl Magnús beinahe sechs Jahre älter ist als sein kleiner Bruder, hatte dieser immer die Nase vorn. Kapitän der Eishockeymannschaft, beliebtester Junge der Schule, Lieblingskind der Eltern … während für Mágnus nur die Brotkrumen übrig geblieben sind. Jeder weiß, wieso es so ist, aber keiner traut sich, es auszusprechen.
»Deshalb bin ich ja jetzt hier, damit mein allerbester Freund mir endlich mal seine Aufmerksamkeit schenkt.« Er beginnt zu grinsen, als er seine Hand ganz selbstverständlich nach dem Nachoteller, den ich gerade anrichte, ausstreckt, doch ich schlage sie rechtzeitig weg.
»Der ist für die Gäste. Wenn du Nachos willst, bestell sie und …« Ich mache eine Pause und schaue ihm ins Gesicht. »… bezahl sie.«
»Ich habe hier noch nie was gezahlt, und ich fange jetzt mit Sicherheit nicht damit an. Im Gegensatz zu dir halte ich an unseren Traditionen fest.« Ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, greift er mit seiner Hand nach dem Teller und schiebt sich demonstrativ eine Handvoll in den Mund. Ich beobachte mit hochgezogenen Augenbrauen, wie er sich an den trockenen Chips verschluckt.
»W-A-S-S-E-R.« Im Punkt theatralische Performance steht er Freya in nichts nach. Ich reiche ihm wortlos ein Glas, das er an sich reißt. »Das war knapp. Das wäre wirklich schlecht für den Tourismus in unserem schönen Ort, wenn rauskommt, dass jemand an euren Nachos gestorben ist.«
»Keine Sorge. Ich würde einen Weg finden, deinen Tod zu vertuschen.«
»Danke, bester Freund seit fast zwanzig Jahren.« Er streckt den Arm aus und deutet auf das dünne schwarze Armband, das ich ihm mit vier im Kindergarten gebastelt habe und das neben seinem anderen Schmuck kaum auffällt. Zu meiner Verteidigung – ich wusste damals nicht, dass mich das anscheinend zu einer lebenslangen Loyalität verpflichtet.
»Bitte vergib mir.«
»Ich bin ja kein Unmensch. Ich werde dir vergeben, wenn du mir einen Gefallen tust.« Wie erwartet, ignoriert er den Sarkasmus in meiner Stimme gekonnt.
»Gib mir ’ne Sekunde.« Ich nehme den heißen Teller mit den Nachos mithilfe eines Geschirrtuchs aus der Mikrowelle, hole die Guacamole aus dem Kühlschrank und bringe sie an den Tisch von Olis Müttern, Bürgermeisterin Klaud und Anna. Dabei versuche ich gekonnt die immer gleichen Fragen zum Gesundheitszustand meiner Mutter, die immer mit einer Lobpreisung an mich enden, zu entgehen.
Schuld in ihrer hässlichsten Form frisst sich mit jedem ihrer Worte in mein Gewissen. Was würden sie wohl denken, wenn sie wüssten, dass ich vieles, aber nicht der aufopferungsvolle Sohn bin, für den sie mich halten? Dass ich die ganze unnötige Aufmerksamkeit und die gut gemeinten Aufläufe, die alle regelmäßig vorbeibringen und meinen Kühlschrank regelmäßig verstopfen, nicht verdiene? Dass ich die Rolle des verantwortungsbewussten, guten Sohnes, der das Geschäft seiner Eltern führt, nur spiele, damit ich das viel zu dunkle Gefühl endlich aus meinem Körper bekomme? Nur weiß ich, dass es niemals verschwinden wird, weil ich an einem Ort lebe, der mich jeden halben Meter mit der Sache konfrontiert.
Vor der Sache mit meiner Mutter hätte ich das nicht getan. Bevor die Sache passiert ist, hätte es mich nicht gekümmert, jedem ein gutes Gefühl geben zu müssen. Ich hatte meine Bücher, ich hatte mein Gewächshaus. Ich hatte ein Leben, das mir gehört hat.
Ich hasse den People Pleaser, in den ich mich verwandelt habe.
Ich laufe zurück an die Theke, an der Magnús mich aufgeregt erwartet.
»Also, zurück zu deiner Wiedergutmachung. Erinnerst du dich noch, als dieses Mädchen aus Holmánes nur was mit mir angefangen hat, damit sie ihren Freund eifersüchtig machen konnte?«, fragt er.
»Ob ich mich erinnere? Seit es passiert ist, redest du von nichts anderem.«
Dabei ist die ganze Sache schon fast zehn Jahre her. Da es in Vallarheiði und Umgebung keine Schule gibt, waren wir gezwungen, mit vielen anderen Kindern aus den Nachbarstädten zur Schule zu gehen, was Spielenachmittage und Dating ziemlich erschwert hat. Andererseits läuft man seinem Ex-Partner dann auch nicht zwangsläufig ständig über den Weg.
»Erinnerst du dich auch daran, wie du mir versprochen hast, dir etwas zu überlegen, damit wir uns rächen?«
»Ob ich mich erinnere? Seit es passiert ist, redest du von nichts anderem«, wiederhole ich. »Und ich war bloß beschäftigt, ernsthaft, aber ich bin wirklich noch am Überlegen.« Bis gerade eben hatte ich es anscheinend erfolgreich zehn Jahre verdrängt.
Er macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ich glaube dir kein Wort, aber ich vergebe dir, wenn du mir bei meinem Plan hilfst.«
Skeptisch halte ich inne. »Was für ein Plan?«
»Also, wie du weißt, ist sie Cheerleaderin bei dem Kindurs…«
»Nein, das wusste ich nicht. Woher sollte ich das wissen?«, unterbreche ich ihn.
»JEDENFALLS«, übergeht er meinen Einwand einfach. »Ist sie letzten Monat rausgeflogen bei denen, und deshalb habe ich mir überlegt, wir klauen ein Schaf und setzen es auf ihre Terrasse.«
Er macht eine Pause und starrt mich mit leuchtenden Augen an.
»Du willst, dass wir ein Schaf klauen, um ihr das Tier auf die Terrasse zu setzen?«, fasse ich zusammen. Ich verstehe die Grundfeste des Plans schon. Sie mit dem Tier vor ihrer Haustür zu konfrontieren, nach dem ihr ehemaliges Team benannt wurde, ist mit Sicherheit … kreativ.
»Ja! Das Tier wird sie mit ihrem Scheitern konfrontieren. Und dann wird sie sich daran erinnern, dass das andere Beste in ihrem Leben – die Beziehung zu mir – auch wegen ihr gescheitert ist.«
»Ist das dein Ernst?«, frage ich zurück und kneife mir mit der rechten Hand in den Nasenrücken.
»Alter, der Plan ist genial! Wer kommt denn auf so was?«
»Das ist eine gute Frage, Alter. Wer kommt auf so was?«, erwidere ich spöttisch und widme meine Aufmerksamkeit einem Gast, der zum Zahlen an den Tresen gekommen ist.
Anschließend laufe ich zum Tisch und hole das dreckige Geschirr, um es abzuspülen. Magnús lässt mich nicht aus den Augen. Vermutlich aus Angst, meinen euphorischen Ausbruch zu verpassen.
»Kannst du nicht einmal nicht den Erwachsenen spielen?«
Jetzt kann ich mir ein genervtes Seufzen nicht verkneifen und verdrehe die Augen. »Ich bin sicher, ich war nie kindisch genug für deine komischen tierquälerischen Pläne.«
»Wenn du es nicht mit mir durchziehst, muss ich mir jemand anderen dafür suchen.« Er macht eine dramatische Pause und mustert mich ernst. Na ja, zumindest versucht er es. Ich weiß nicht genau, wie viel er getrunken hat, aber sein Blick ist nach wie vor glasig und unfokussiert. »Und das willst du doch nicht.«
Ich presse die Lippen fest zusammen. Jetzt loszulachen würde niemandem was bringen. »Ich sag dir was«, flüstere ich und beuge mich zu ihm vor. »Wenn du es schaffst, jemanden dazu zu bringen, das mit dir durchzuziehen, bekommt ihr beide für den Rest eures Lebens jede Mahlzeit hier umsonst.«
»Ich brauche da schon einen größeren Anreiz … Ich habe es schon tausendmal gesagt und werde es auch noch hundertmal wiederholen: Ich werde hier sowieso nie was zahlen.« Es ist bemerkenswert, wie offensichtlich er sein Schnorrertum verteidigt.
»Dann nerv doch Roman. Der hat heute frei. Wahrscheinlich sitzt er in der Backstube oder ist beim Snowboarden. Der hat bestimmt Zeit.«
Magnús plustert die Wangen auf, als würde es um ein schwieriges Thema gehen. »Maggie ist seit ein paar Tagen wieder in der …«
»Scheiße«, rutscht es mir heraus. Wenn Maggie wieder in Vallarheiði ist …
»Er sitzt bloß zu Hause und starrt aus dem Fenster«, sagt er, angelt sich den Tequila und füllt diesen selbstständig in sein Glas, bevor er die Flüssigkeit seinen Rachen runterschickt. Das ist vermutlich Magnús’ Art, empathisch auf Romans beschissene Situation zu reagieren.
»Ruf ihn an und sag ihm, dass er vorbeikommen soll.« Roman neigt zu selbstzerstörerischem Verhalten, wenn er traurig ist. Vor allem, wenn er traurig ist und Maggie sich wieder in unmittelbarer Nähe befindet. Mein Blick fliegt zu Oli, der friedlich am Strohhalm seines Trinkpäckchens zieht.
Magnús schüttelt den Kopf. »Er will in Ruhe gelassen werden.«
Ich will gerade zu einer Antwort ansetzen, als Freya mit Helgi, der Betreiberin des einzigen Bed & Breakfasts, im Schlepptau dazukommt. Helgis weißblonde Haare stehen zu Berge, und sie versinkt beinahe in ihrem blassgelben Bademantel. Als Kind habe ich sie immer für eine gute Fee gehalten, mit den hellen blauen Augen und der Erdbeermarmelade, die sie fast wöchentlich vorbeigebracht hat. Das hat sich geändert, als ich begriffen habe, dass die gute Fee eine helfende Instanz sein sollte, nicht andersherum.
»Ich brauche deine Hilfe, Nói«, ist das Erste, was sie sagt.
Ihr aufgelöster Zustand bereitet mir keine großen Sorgen. Es ist schwer, Helgi mal nicht aufgelöst anzutreffen. Die Terrasse ist verschneit – aufgelöst.
Das Internet ist ausgefallen – aufgelöst.
Das Amazon-Paket verspätet sich um einen Tag – richtig aufgelöst.
Manchmal – nein, eigentlich eher immer – überrascht es mich, dass sie der Meinung ist, die Selbstständigkeit wäre wirklich das Richtige für sie. Das B&B ist eine Institution in Vallarheiði und die erste Anlaufstelle für Alleinreisende und Pärchen, die selten etwas mit den lauten, teilweise feierwütigen Touristen zu tun haben, die das Heima täglich beehren und sich oft zu überteuerten Preisen im Snjór-Resort auf der anderen Seite des Heiði-skógurs einmieten.
»Was’n los?«, nuschelt Magnús undeutlich.
Helgi fährt sich durch das Haar, setzt mehrmals zum Sprechen an, nur um sich direkt wieder zu unterbrechen. Wie ich sagte, richtig aufgelöst. Ich hoffe, sie tut ihrer Herzgesundheit auf andere Weise was Gutes.
»Aron ist vom Dach gefallen«, sagt Freya an ihrer Stelle.
»Was?«, rufen Magnús und ich synchron.
Helgi macht eine beschwichtigende Geste mit den Händen, als würden wir zu heftig darauf reagieren, dass ihr Mann vom Dach gefallen ist. Ein ungewöhnlicher Anblick. »Er ist unverletzt, aber er klagt über Kopfschmerzen, und ich fahre ihn jetzt ins Krankenhaus nach Akureyri.«
Da Vallarheiði ein winziger Ort ist, haben wir kein eigenes Krankenhaus. Normalerweise kümmert sich der Dorfarzt um derartige Belange, aber der ist über das Wochenende auf einem Seminar im Nachbarort.
»Möchtest du, dass ich ihn fahre?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein. Wir haben einen Gast, der vom Flughafen abgeholt werden müsste.«
Ich schaue auf die kleine Plastikarmbanduhr an meinem Handgelenk. Kurz nach zehn. Nachdem ich eine Wette gegen Oli verloren habe, trägt er jetzt meine silberne Ingersoll-Herrenuhr, die fast so groß ist wie er, während ich seine kleine blaue Uhr mit den winzigen Wolken, die mir beinahe das Blut abdrückt, trage.
»Seit wann holt ihr Gäste vom Flughafen ab?«, fragt Freya verwirrt. Sie schiebt sich neben Magnús auf den Barhocker und schlägt die Beine übereinander.
»Das hatten wir gar nicht vor. Wäre sie wie geplant am frühen Nachmittag angekommen, hätte sie den Bus nehmen können, aber jetzt … Der fährt doch nur bis sechs.« Helgi holt das Smartphone aus der Tasche ihres Bademantels. »Sie hat mir heute früh schon geschrieben, dass ihr Flug sich um mehrere Stunden verspätet, und hat mich den Tag über auf dem Laufenden gehalten. Das arme Ding war ganz aufgelöst.«
Freya und ich tauschen unauffällig einen Blick. Wenn Helgi findet, dass jemand wirklich aufgelöst ist, dann muss die Person einen halben Nervenzusammenbruch erlitten haben. Ihre eigenen Ausbrüche ordnet sie als einbisschen durcheinander ein.
»Ich muss mit ihm ins Krankenhaus. Er klagt über Kopfschmerzen. Im Internet … da stehen wirklich schlimme Dinge.«
»In Ordnung, wir holen sie ab«, sage ich und ziehe langsam ihre Hand, die sie in meinen Pullover gekrallt hat – um mir unmissverständlich klarzumachen, wie ernst die Angelegenheit ist –, von meinem Brustkorb. Es ist besser, direkt zuzustimmen, bevor sie mit ihrer Google-Ferndiagnose beginnt.
»Wann landet sie?«
»Das ist sie bereits vor einer halben Stunde.«
Ich reiße die Augen auf. »Wir brauchen zum Flughafen doch schon fast vierzig Minuten … wie lange soll sie denn noch warten …«
»Ich weiß, ich war so beschäftigt, mit Aron zu diskutieren, dass ich die Zeit vollkommen vergessen habe. Ich habe ihr bereits einige Nachrichten geschrieben, aber die gehen nicht durch.«
Wenig überraschend. Das Gebiet rund um den Flughafen ist so was wie ein blinder Fleck, der von Mobilfunkmasten vergessen wurde, was ziemlich ironisch ist, wenn man bedenkt, dass in keinem anderen Lebensbereich der Funkverkehr wohl öfter benutzt wird. Und trotzdem ist die einzige Möglichkeit, dort zu telefonieren, ein altes räudiges Münztelefon. Dazu bräuchte man aber isländische Münzen, und die Wechselbude am Flughafen ist um diese Zeit mit Sicherheit nicht mehr geöffnet.
Ich schmiede bereits einen Plan. Alles mit der Ruhe. Ich brauche nur einen kühlen Kopf, dann passt das schon. »Okay. Du fährst Aron jetzt ins Krankenhaus. Wir kümmern uns um den Rest.«
Ich drehe mich zu Freya, die im selben Moment beide Hände hebt. »Ich fahre jetzt mit Sicherheit nicht vierzig Minuten zum Flughafen.«
Mein Plan fällt in sich zusammen. »Du wolltest vorhin noch fast zwei Stunden nach Dalvík fahren, wo liegt der Unterschied?«
»Der Unterschied ist«, sie richtet sich auf dem Hocker auf, »dass am Flughafen kein Ashton Kutcher auf mich wartet.«
»Freya.« Meine Stimme ähnelt einem Knurren.
»Ist Ashton Kutscher nicht schuld daran, das Two and a half men gescheitert ist?«, fragt Mágnus verwirrt.
»Two and a half men ist gescheitert, weil es absolut frauenverachtend und sexistisch ist und Charlie Sheen der vielleicht böseste Mensch auf der Welt«, erinnert Freya freimütig und verdreht die Augen, als sie meinen ernsten Blick bemerkt. »Meinetwegen. Ich bleibe hier, du fährst zum Flughafen.«
»Du machst doch nichts anderes, als die Gäste zu ignorieren. Vermutlich wirst du die Leute auf die Straße setzen, sobald ich einen Fuß aus der Tür gemacht habe.«
Vielleicht sollte ich Roman anrufen. Die Arbeit würde ihn möglicherweise ablenken. Vielleicht wäre es aber nicht schlau, ihn mit einem unbegrenzten Zugang zu Alkohol allein zu lassen.
Freya springt vom Hocker. Der lange blonde Pferdeschwanz peitscht um ihr Gesicht, das sich zu einer süffisanten Grimasse verzieht. »Dann wirst du mir wohl vertrauen müssen.«
Klar, nichts einfacher als das.
Kapitel 3
Von Menschen, Mäusen und Verzweiflungstaten
Der milde Nachmittag, an dem Island mich hätte empfangen sollen, hat sich in eine eisige Nacht verwandelt. Aus der vorerst kleinen Verzögerung im Betriebsablauf wurden vierzig, siebzig, neunzig und schließlich zweihundert Minuten Verspätung, die den letzten Nagel in den Sarg meiner ohnehin lausigen Organisation gehämmert haben. Deshalb war es wenig überraschend, dass ich keinen meiner zahlreichen Anschlussflüge erreicht habe und nun fast fünfzehn Stunden später auf den kalten Stufen eines verwaisten Provinzflughafens hocke.
Und das seit einer geschlagenen Stunde.
Aber immer noch besser als im Inneren des Flughafens …
Ich starte das dritte Bibi-Blocksberg-Hörspiel – die einzig annehmbare Unterhaltung in der gruseligen Umgebung –, ziehe die Knie enger an meine Brust und presse die Lippen fest zusammen. Ganz davon abgesehen, dass der Flughafen anscheinend kein Interesse daran hat, seinen Gästen ein komfortables Ankommen zu ermöglichen – es gibt nicht mal einen lieblos aufgefüllten Snackautomaten –, wurde der Ort hier mit Sicherheit nicht wegen seiner zentralen Lage ausgewählt. Ich sitze buchstäblich mitten im Nirgendwo und stecke damit bis zu den Knien in der Scheiße.
Kein Handyempfang, ein ausgestorbener, WLAN-freier Flughafen im Rücken und eine einsetzende Panik in der Brust. Zusätzlich bin ich am Erfrieren, und langsam bekomme ich es wirklich mit der Angst zu tun. Zu Hause in Neukölln fühle ich mich nie so, weil dauerbelebte Straßen selten Anlass dazu geben. Egal, ob Nachmittag oder Morgengrauen, immer sind ein paar Hundert Menschen im Umkreis, die einem in stiller Übereinkunft Gesellschaft leisten. Ganz davon abgesehen, dass ich zu jeder Zeit ein Shawarma-Sandwich mit extra viel Knoblauchdip ohne Aufpreis bekomme, wenn ich nur traurig genug aussehe.
Mein grummelnder Magen erinnert mich daran, wie sehr mir das jetzt schon fehlt. Meine letzte Mahlzeit war ein reduzierter Proteinriegel aus dem Duty-Free, der die Konsistenz eines Backsteins hatte. Seitdem sind Stunden vergangen, aber der Brocken dümpelt wahrscheinlich immer noch unzersetzt in meiner Magensäure.
Auf dem beleuchteten Fahrplan, der einzigen Lichtquelle in dieser Dunkelheit, steht in greller roter Schrift, dass die nächsten acht Stunden kein Bus in die Nähe dieses Flughafens kommen wird. Sollte mich theoretisch auch nicht interessieren, schließlich warte ich auf Aron, den Mann der Inhaberin des B&B, meines neuen Teilzeitzuhauses, der mich, wie sie mir versichert hat, »mit Freuden abholen kommen« würde.
Eine Schneeflocke schmilzt auf meiner Stirn und läuft mir als dünner Tropfen über die gerötete Nase. Es sollte mir Sorgen machen, dass sich mein Gesicht abgestorben anfühlt, aber gerade muss ich mich primär dafür hassen, auf eine Betrugsmasche reingefallen zu sein. Bestimmt existiert Helgis B&B nicht einmal. Dabei habe ich alle nötigen Informationen überprüft, die mich Catfish gelehrt hat. Impressum, authentische Kundenbewertungen … Ich habe sogar die Facebookseite gestalkt und ein Familienbild von der vermeintlichen Helgi mit ihrem – ich vermute – Ehemann Aron gesehen. Beide mit dampfenden Tassen in den Händen, in kitschigen Weihnachtspullovern und mit einem dreckig gelben Häuschen im Rücken. Das Motiv hatte was aus einer anderen Zeit – so ein Foto, das man in einer tausendfach geknickten Version aus nostalgischen Gründen in seinem Geldbeutel aufbewahrt. Wie konnte ich darauf nur reinfallen? Wahrscheinlich ist das die Kunst der Betrüger, alles harmonisch und sympathisch wirken zu lassen, dabei hätte doch gerade ich misstrauisch werden müssen. Ganz ehrlich, wer bitte hat denn noch Facebook? Gott, jetzt darf ich mich in Zukunft nicht mal erhaben fühlen, wenn ich mir diese Heiratsschwindler-Dokus auf YouTube ansehe, in denen Frauen ihrem supermuskulösen Freund im Ausland Geld schicken, weil seine American Express gesperrt ist.
Ich ziehe den Reißverschluss meiner viel zu dünnen Jacke höher und schrumpfe noch mehr in mich zusammen. Ich werde auf diesen Stufen erfrieren, weil es mir wichtiger war, wie ein Teddybär auszusehen, statt diese Jacke auf ihre Funktionalität zu testen.
Der Lachanfall, der sich schon seit Stunden in meinem Bauch sammelt, bahnt sich einen Weg durch meine Luftröhre. Dann entschlüpft er meinen Lippen, steigert sich, bis mein Bauch schmerzt und mir heiße Verzweiflungstränen über die Wangen laufen.
Ich bin so am Arsch. Trotz meiner anhaltenden Lethargie habe ich es geschafft, den virtuellen Shitstorm auf mein gesamtes Leben zu erweitern. Würde mich nicht wundern, wenn statt Schneeflocken plötzlich Fäkalien vom Himmel rieseln. Ich lache lauter, und für einen kurzen Moment sind meine abgehackten Laute das Einzige, was die betäubende Stille durchbricht, bis ein dunkelgraues Auto auf den ausgestorbenen Parkplatz fährt. Die Reifen mit dicken Ketten eingewickelt, wie ich es sonst nur aus Filmen kenne. Zehn Meter von mir entfernt bleibt es stehen. Meine deprimierenden Gedanken verpuffen und machen meiner grenzenlosen Erleichterung Platz. Innerhalb eines Wimpernschlags werden die Verzweiflungs- zu Freudentränen.
Es ist ein winziges Trostpflaster auf einer viel zu großen Wunde, dass ich doch zu schlau für einen Betrug bin. Jetzt bin ich nur noch halb so doll am Arsch.
Der Fahrer stellt den Motor ab, die Lichter des Autos erlöschen, und ich greife nach dem Geländer, um meinen vereisten Körper hochzuziehen, als meine Hoffnung in derselben Sekunde zerschlagen wird. Obwohl ich nur ein einziges Bild von Vermutlich-Aron gesehen habe, weiß ich mit Sicherheit, dass es sich bei dem Kerl, der gerade aus dem Auto steigt, nicht um meinen Abholservice handeln kann. Lange Beine, die in einer dunklen Jeans stecken, ein blauer Wintermantel, den er sich bis zum Kinn hochzieht, bevor er sich die Kapuze über die blonden Locken stülpt. Ich sinke zurück. Enttäuschung legt sich wie ein pelziger Mantel auf meine angeschlagene Lunge.
Jetzt ist es endgültig, amtlich und nachweislich. Ich. bin. am. Arsch.
Der Fremde hält auf den Eingang – und damit auf mich – zu, und ich unterdrücke einen frustrierten Aufschrei. Als ich an den Rand des Treppengeländers rücke, um dem Typen den Eingang zum ausgestorbenen Flughafen zu erleichtern, manövriere ich meinen Hintern in eine riesige Pfütze. Sofort spüre ich, wie meine Leggings bis auf die Baumwollunterwäsche durchweicht.
Großartig. Ich kann die kommende Blasenentzündung kaum erwarten. Wäre lautes Wimmern die angemessene Reaktion einer erwachsenen Person in dieser Situation? Und wenn nein, macht es überhaupt einen Unterschied?
Die Schritte werden lauter, und ich ziehe mir die Kapuze noch tiefer ins Gesicht. Dann unterbreche ich das Hörspiel, weil ich Bibis weinerlichen Monolog zur Rettung des Pferdehofs nicht mehr ertrage. Sie sollte lieber Geld für mich





























