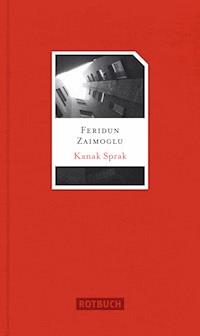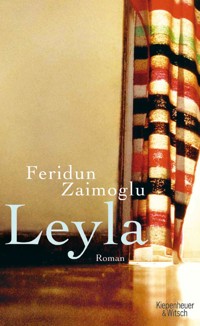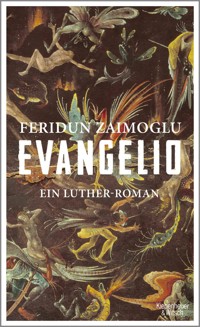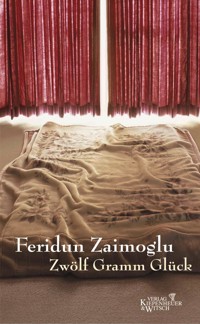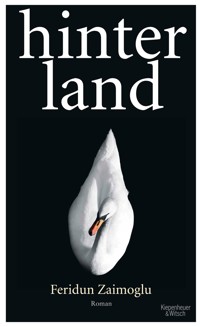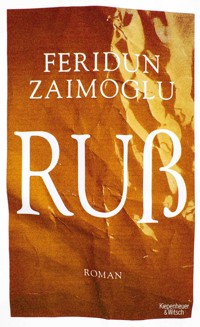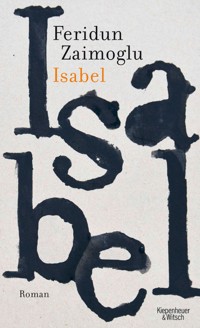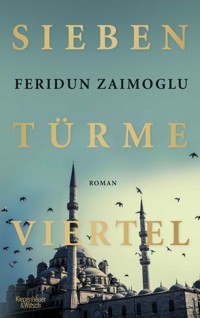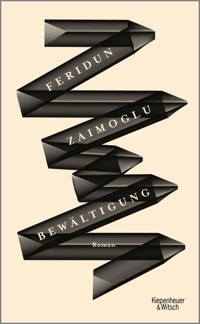
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein virtuoser Künstlerroman über die Gefahren der Obsession und die Grenzen der literarischenBewältigung. Feridun Zaimoglu erzählt die Geschichte eines Autors, der sich vornimmt, Adolf Hitler zum Protagonisten seines neuen Buches zu machen. Was als normale Recherche beginnt, entwickelt sich schnell zu einer zerstörerischen Besessenheit. Die Reise an Hitlers Schauplätze – von den Bayreuther Festspielen über München bis zum Obersalzberg – wird zu einem surrealen Fiebertraum, der den Autor immer tiefer in die Gedankenwelt seines Protagonisten hineinzieht. Gleichzeitig ist es eine Reise zurück in seine eigene Vergangenheit, in die Stadt Dachau Mitte der 1980er Jahre, wo er unweit des ersten von den Nationalsozialisten errichteten KZs zur Schule ging. In Kiel, an seiner Schreibmaschine, versucht er verzweifelt, seine Figur literarisch zu entfesseln und zugleich zu bannen – und verliert dabei Schritt für Schritt die Kontrolle über sein Projekt und sich selbst. »Bewältigung« ist ein eindringlicher Roman über die schmale Grenze zwischen künstlerischer Besessenheit und selbstzerstörerischer Obsession, über die Herausforderungen der Aufarbeitung und die Frage, ob es Stoffe gibt, die sich der literarischen Bewältigung entziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Ähnliche
Feridun Zaimoglu
Bewältigung
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Feridun Zaimoglu
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
I
Er will begreifen. Der Autor sitzt in einer Ecke des Hotelfoyers, bleich und müde, er hat das Mineralwasser verschüttet, er reibt die nassen Ärmel heimlich unter dem Tisch an seiner Hose. Er will nicht auffallen, er hält still. Er beschaut die Festspielbesucher. Männer im Smoking. Frauen in Cocktailkleidern und Hosenanzügen. Eine Dame trägt eine Seidenstola, die aussieht wie ein Brautschal. Die Unterarmtaschen schwenken sachte und streifen leicht die Roben. Eine schöne Gesellschaft, diese Menschen sind ihm fremd. Ein Mann setzt sich auf einen Kaffeehausstuhl aus Bugholz, er atmet durch den Mund, es ist ihm feierlich zumute. Der Autor macht es ihm nach, er riecht beim Einatmen durch den offenen Mund seine eigene Schleimhaut. Die Erregtheit bekommt ihm nicht. Wird der Mann, der im gegenüberliegenden Winkel sitzt, später im Festsaal vor Ergriffenheit immer wieder nass aufseufzen? Das Festspielhaus ist keine Unterhaltungsstätte, Bayreuth ist nicht irgendeine deutsche Stadt. Er ermahnt sich: Man muss nach einer Vollständigkeit der wichtigsten Sachen streben. Was denkt er da? Er muss ruhig sein wie ein guter Bürger, der sein Gewissen nicht mit Scheußlichkeiten belastet. Draußen ein flackernder Schein zwischen den Wolken, und als die pneumatischen Türen sich öffnen, weht ein leichter Wind herein. Die Männer im Smoking, die Frauen in Abendgarderobe, sie streben zu den Limousinen, die sie zum Festspielhügel verbringen werden. Welches Stück wird gegeben? Tannhäuser? Lohengrin? Parsifal? Er weiß es nicht. Er will begreifen. Er fängt an, es fängt hier an, er hat sich den Kopf kaputt gelesen, das reicht noch lange nicht, er muss in Bayreuth beginnen. Also steht er auf, die plötzliche Stille ist nicht auszuhalten. Er nimmt sich vor, auf leise Laute zu achten. Der oberste Mantelknopf ist halb im Loch, er knöpft sich zu, er geht los. Der Faltplan der Innenstadt steckt in der Tasche, er möchte nicht gleich als Tourist erkannt werden. Er denkt an die festlich gekleideten Damen: Das sind Frauen, die in eine höhere Ordnung aufgestiegen sind. Es war an keinem Stoffzipfel eines Kleides Schmutz zu sehen. Keine unter ihnen, die man für eine Ungeeignete hielte. Man hört sie nicht atmen, sie leben leise. Bei der Frau mit der Seidenstola verteilte sich am Spann, unter der Nylonstrumpfhose, aufgebackenes Fußpuder. Das ist eine schöne Nachlässigkeit. All diese Einzelheiten wird er weiterhin bemerken müssen. Er knüllt den Stadtplan in der Tasche. Kalt bleiben. Er geht die Einkaufsstraße hinauf, die eher einem großen, langen Marktplatz ähnelt. Am Springbrunnen bespritzen kreischende Kinder einander mit Wasser, die Mütter stehen lauernd abseits. Ein Mädchen jagt eine Raubmöwe am Boden, bis sie auffliegt. Wo kommt die Möwe her? Der Autor prägt sich alles ein, ein Luftzug streift ihn an der Schläfe, er duckt sich weg. Fast wäre eine tieffliegende Taube gegen seinen Kopf geprallt. Was wollen diese Tiere?
Er verlässt die Einkaufsstraße. Nach kurzer Zeit erreicht er das Haus Wahnfried. Eine Villa aus Sandsteinquadern, das Haus des Komponisten Richard Wagner. Stille. Keine Kinder, keine Mütter, keine Männer mit Knotenstock, die mit der Spitze ihres Wanderstabs zwischen den Steinen stochern. Er liest die Inschrift auf der Vorderfassade: »Hier wo mein Wähnen Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt.« In den Tagebüchern von Cosima, der Frau von Richard Wagner, hat der Autor gelesen, dass ihr Mann von dem hessischen Städtchen Wanfried in der Seele berührt worden sei. Deshalb habe er das Haus Wahnfried genannt, nur der Sinnige könne es verstehen. Dem Autor ist das Hochragende in diesen Worten widerwärtig. Die Kleinstadt liegt bei Eschwege, bis Eisenach sind es knapp dreißig Kilometer, er wird nicht hinfahren. Als er das erste Mal auf das Wort stieß, dachte er an ein Irrenhaus. Er hat sich vorgenommen, zunächst das hohe Haus zu betreten, doch er gibt dem Drang nach und läuft um das Gebäude herum zu Wagners Grabstelle. Der Autor, der ein Buch über Hitler schreiben will, steht an der Grabplatte und empfindet nichts. Hier also ruht der große Deutsche, dessen Größe von anderen großen Deutschen bezeugt wurde. Hier also steht er und starrt auf ein Gebinde aus welken Trauerblumen mit zerfranster Schleife. Kurz wähnt er sich an einem Grabmal eines unbekannten Soldaten. Er schaut sich vergeblich nach Feuerschalen um. Was fühlte Hitler, als er hier stand? Er erzählte oft von seinem Herzbeben unter dem Eindruck der Musik des Meisters: Mit zwölf Jahren hat er in Linz als erste Oper Wagners Lohengrin gehört, drei Jahre später folgte die Oper Rienzi, am 5. Mai 1906 – er wusste es auf den Tag genau – sah er in der Wiener Staatsoper Tristan und Isolde, Operndirektor war damals Gustav Mahler. Ein Jude.
Der Autor schlägt sein Notizbuch auf und liest, unruhig an der Grabplatte auf- und abgehend, seine Notizen; Hitler war am 17. September 1923 zu einem kurzen Arbeitsbesuch in Bayreuth gewesen, nach ein paar Stunden war er allerdings abgereist. Zwei Wochen später fand er sich zum »Deutschen Tag«, den die Nationalsozialisten und stramme Deutschnationale feierlich begingen, wieder in der Stadt ein. Er logierte im Hotel Anker. Winifred Wagner, die Frau von Richard Wagners einzigem Sohn und Erben Siegfried Wagner, lud ihn in die Villa Wahnfried ein. Natürlich nahm Hitler die Einladung an … Der Autor klappt das Notizbuch zu.
Was nützen ihm diese Angaben? Eine Einzelheit fällt ihm ein: Der Mann ließ gelegentlich die Nilpferdpeitsche schnalzen, die ihm eine vermögende Dame geschenkt hatte. Oft klopfte er sich damit auch gegen die Wade. Der Autor notiert: ›H. bezeichnet Wagner als den größten Deutschen, der je gelebt habe. Auch Wagner wirkte die Massenverzückung…‹ Der Autor notiert: ›Siegfried Wagner führt H. zum Grab seines Vaters. H. beugt den Kopf. Für den Sohn soll es so aussehen, als halte er stumme Zwiesprache mit dem Meister. H. bekommt vor Rührung eine nasse Nase. Es raschelt hinter den Büschen, ein kleines Tier, ein Vogel, eine Ratte. Ein Windstoß lässt H. die Rockschöße aufflattern. Was soll er tun? Ein Gebet aufsagen? Nein. Der Österreicher ist ein abtrünniger Katholik. Kein Gebet, nicht einmal das Vaterunser. H. schreckt zusammen, als Siegfried spricht.‹ Der Autor geht im Geiste das weitere Gespräch durch. Was sagt also Siegfried? Er sagt: »Hast du das Gewisper gehört?« Er duzt den Österreicher, der Österreicher aber siezt ihn. »Nein«, sagt H., »da ist nichts.« Wie weiter?
Richard Wagners Gemahlin, die Witwe Cosima, lässt sich nicht nur vom Hausgesinde als hohe Dame anreden. Es geht das Gerücht, dass sie das Blätterrauschen für die Stimme ihres Mannes hält. Öffnete man das Grab, fände man nur Haar und Knochen. Wohin ist wohl seine Seele entschwunden? Mit dieser Frage könnte der als exzentrisch geltende Siegfried H. überrumpeln. Wünscht er es wirklich, die Gebeine seines Vaters zu sehen? Hitler, der sich zeit seines Lebens den Anschein von Mannbarkeit gab, war ein bemerkenswert schlechter Darsteller. Und doch hat man ihm eine hohe Glaubwürdigkeit attestiert. Was sieht der Opernkomponist Siegfried in dem Operettendesperado Adolf? Einen Draufschläger? Eine soldatische Natur? Einen sonderbaren Artisten aus dem Ausland? Und was sieht der Österreicher in dem Sohn des deutschen Genies? Der Wagnererbe trägt einen Gürtel, den er sich auf den langen dicken Pullover oberhalb der Nabellinie geschnallt hat. Es ist überliefert, dass Siegfried Hitler bei der ersten Begegnung Folgendes zugerufen haben soll: »Du bist ein Mordskerl! Für dich lass ich mich vierteilen!« Ein böses Gerücht? Tatsächlich handelt es sich bei der Wagnersippe um einen Clan von überspannten, recht verhaltensauffälligen Personen. Der Österreicher, der auf seinem Deutschsein bestand, hat sich wohl über diese Menschen gewundert. Der Autor überlegt – in welchen Worten könnte H. sich insgeheim über sie auslassen? Er klappt hastig das Notizbuch auf und schreibt: ›Sind Richard Wagners Erbverwalter deutsche Menschen? Cosima, eine französische Vierteljüdin. Winifred, englisch, eingedeutscht, sie hat dem Erben Siegfried Stammhalter geboren. Siegfried hat sich tunlichst von der Front ferngehalten, ein Fantast, im Fleisch und in den Knochen weich, mit einer zweifelhaften geschlechtlichen Neigung…‹ Lesen sich diese Sätze nicht wie Dienstvermerke in der Personalakte? Es schaudert dem Autor vor all diesen Possenreißern, die von Erfüllung und Erlösung schwätzten. Die eine große Sorgfalt darauf verwandten, dass man Ordnung halte. Ein Brötchen, eine Wurst oder eine Klappstulle, mit daumendickem Schmalz bestrichen, mehr will doch der einfache Deutsche nicht – er muss auflachen, jetzt ist er unter die Volkskundler gegangen, jetzt will er auch noch das geheimste Innere des Volkes ergründen. Die hohe Dame Cosima, Siegfried, Winifred – sie stehen alle unter dem Bann des Mannes Hitler. Sie reden schlecht über die Juden. Sind sie denn dumm? Sind sie denn aus der Welt gefallen? Das ist ihre Welt: Sie sprechen vom Hochgesang, sie sprechen vom Weihelied, und sie reden über den Missklang der »jüdischen Neutöner«. Der Führer, der die Kanaillen zu nationaler Gesinnung bekehren möchte, wird bei seinem ersten Besuch in der Villa erkennen: Er muss sich diese Abkömmlinge des deutschen Geistesriesen Wagner nicht erst geneigt machen.
Der Autor weicht zur Seite, weil versprengte Touristen am Grab Aufstellung nehmen. Er enthält sich einer Abscheubekundung. Warum ist er angewidert? Weil ein Mann aus der Gruppe die gestreckten Finger an die Schläfe anlegt. Ein Zivilist erweist den militärischen Gruß. Die anderen Zivilisten lachen nicht, sie versteinern auf der Stelle. Eine Frau starrt ihn böse an. Soll er eine vaterländische Hymne anstimmen? Er würde am liebsten seinen grundlosen Kummer zerlachen. Er wendet sich ab, er geht zurück, er betritt das Haus. Es kommt keine große Weihe über ihn. In den Regalschränken wird die Originalbibliothek Richard Wagners konserviert. Der Autor hat gelesen, dass Cosima nach dem Tod ihres Gemahls die Nutzung der meisten Möbel untersagt habe. Der Sessel, auf dem Wagner der Große jeden Abend Platz nahm, habe der heilige Stuhl geheißen. Fast ist er versucht, die Wände abzuklopfen, weil er fürchtet, dass sich ein Sicherheitsbeamter hinter einer Tapetentür versteckt. Es riecht nach alter Welt. Das ist Unsinn, er bildet es sich nur ein. Er sieht vor seinen Augen schwarze Flecken, die sich wie in einer Schneekugel bewegen, sie driften beim Schweben und sinken. Der Autor leidet an der Glaskörpertrübung. Er kann die Flecken nicht wegblinzeln. Also dreht er den Büchern in den Schränken den Rücken zu und verlässt das Haus.
Wie weiter? Was muss geschehen, auf dem Papier, in seiner Geschichte über Hitler? Was tut der Österreicher nach seinem Besuch am Grab? Er nimmt die Einladung zum Abendessen an. Das Dienstmädchen bittet zu Tisch, es nehmen Platz die hohe Dame, Siegfried, Winnifred und der Mann Hitler. Cosimas goldene Busennadel blinkt im dämmrigen Licht. Der Österreicher hat vor seinem Auftritt in der Villa sein Nasenbärtchen ordentlich gebürstet. Es kommt zur ersten leichten Verstimmung, als H. seinen Rotwein süßt und geräuschvoll trinkt. H. bemerkt es, seine Wangen brennen vor Scham. Was könnte ihn verstimmen? Was wird serviert? Gebackene Schwarzwurzeln auf Spinat, es zieht ihm an den Zähnen beim Essen. Der hochgerutschte Hanswurst zu Gast beim deutschen Bürgertum. Es wird sich zwanglos unterhalten. Worüber? Die Menschen am Tisch kauen sorgfältig, und sie reden über die Not und darüber, dass sie der Gnade bedürftig seien. Man liebt in diesem Haus das Palaver, man führt in diesem Erbauungskreis das große Wort. Und natürlich kommen alle Tischgenossen zischend auf das zu sprechen, was sie beben lässt, was sie eint: die Juden. Cosima tupft mit der perlweinfarbenen Serviette die kleinen niedlichen Spuckebläschen von den Mundwinkeln und ruft so laut, dass das Dienstmädchen vor Schreck zusammenzuckt: »Fluch ihnen, Halunken sind es, die ihr Brötchen in Blut tunken!« … Ja, so wird es gehen, der Autor schreibt es schnell im Stehen hin. Und was macht Hitler? Er macht das, worauf er sich am besten versteht: Er macht Hitlerei. Was könnte er, der schmatzende Schwätzer im deutschesten aller deutschen Horte, sagen? Der Autor schreibt: »Es wird der Tag kommen, dass wir die Sache gerade ziehen.« Genug davon, genug. Das sind verdorbene Worte. Der Autor hat das Gefühl, als habe ihm ein fremder Mann zwischen die Seiten seines Notizhefts gespuckt.
Es muss verschwinden, was sichtbar ist. Die Gegenwart muss verschwimmen. Der Autor muss zurückfinden zu den letzten Tagen im September des Jahres 1923. Hitler in Bayreuth. Was sah er? Wie in allen deutschen Städten dieser Zeit sah er die versehrten Soldaten des Großen Krieges. Er sah die Kriegszitterer: die verschütteten Soldaten, die man ausgegraben hatte. Sie glichen Greisen mit Gemütsleiden. Sie waren vaterländisch gesinnten Bürgern ein Gräuel, die sie nicht auf den Gehsteigen dulden wollten. Sie erinnerten die Patrioten an den verlorenen Krieg. Die Kriegsversehrten bewegten sich auf Rollbrettern, auf sogenannten Krüppelschlitten, durch die Straßen, sie verkauften lackierte Hemdsknöpfe. Der Bürger verwahrte sich gegen das Gebettel an der Haustür. Derselbe Bürger schrie aus vollem Hals Hitlers Knüppelgarden ein Heil zu. Das muss der Autor sehen. Er entfernt sich über den Park hinter der Villa, er verläuft sich, weil er den falschen Weg um das Schloss herum einschlägt. In einer Osteria in einer belebten Seitenstraße findet er einen freien Außenplatz. Auf beiden Tafeln des Aufstellers hat man mit bunter Kreide jeweils eine XXL-Pizza gezeichnet. Er bestellt eine Pizza, er erschrickt, als sie serviert wird: Sie ist so groß wie ein Vierzehn-Zoll-Rad, sie hängt über den Tellerrand, die Serviette saugt sich mit Fett voll. Er isst nicht alles auf: Er hat mitbekommen, wie zwei junge Burschen am Nebentisch eine Wette abgeschlossen haben; der Junge mit dem hellen Oberlippenflaum hat fünf Euro daraufgesetzt, dass er bis auf den Rand alles verschlingt. Der Autor starrt auf den zerlaufenen und geronnenen Käse der Pizzazunge, er denkt an Richard Wagner, und er erinnert sich an eine Stelle aus seinem Aufsatz über das Judentum in der Musik; er kann es auswendig aufsagen: »Ob der Verfall unserer Cultur durch eine gewaltsame Auswerfung des zersetzenden Elementes aufgehalten werden könne, vermag ich nicht zu beurtheilen, weil hierzu Kräfte gehören müssten, deren Vorhandensein mir unbekannt ist.« Sah sich Hitler am Grab seines heiß geliebten Meisters als die Verkörperung eben dieser Kräfte? Der Mann war gottlos, und doch könnte er an der Grabplatte leise ein Bittgebet sprechen, er könnte seine tote Mutter um eine Fürsprache im Himmel anflehen. Das wäre äußerst … sonderbar. Das zeugte von einem abnormen Verhalten. Und doch wäre es nicht abwegig, es sähe dem Österreicher ähnlich, seine Mutter selig an einem weihevollen Ort anzurufen. Der Autor bestellt einen Kaffee, er schreibt auf, wie Hitler in seinem Kopf zu seiner Mutter spricht:
»Mutter. Bitte den Himmel darum, dass er mich schützt.
Dass er mich kampftüchtig erhält.
Dass ich nicht von spärlichen Vorräten leben muss.
Dass ich dem Unheil entwetze wie das Kind dem Mitternachtsspuk.
Dass ich nicht weich werde.
Dass ich weiterhin mit vortrefflichem Erfolg die Arbeit tu.
Dass sich die Getreuen nicht von mir abwenden.
Dass kein Weib meine Hochgefühle missachtet.
Dass mich kein Jude mit seinem giftigen Blick lähmt.
Dass ein Licht leuchte über meinem Haupt.
Dass mir nicht Männer von geringer Brauchbarkeit zulaufen.
Dass ich nicht umkomme durch ein Loch in der Luftröhre.
Dass mein Banner ausgerollt wird, dass es flattert im Wind über dem Reichstag.
Dass ich nicht bei dem Geruch von frisch gemolkener Milch an dich denken muss, Mutter.
Dass das Brausen in meinen Ohren vergeht.
Dass ich nicht aus der Welt falle.
Dass ich nicht mondsüchtig und verloren über die Felder stolpere.
Dass ich wie ein Tatmensch deutsch und innig empfinde.
Dass mir die Nebel nicht meine Träume streifen.
Dass das brave und blinde Volk mich emporträgt, höher und höher hinauf zum höchsten Amt.
Dass die Fliegen geschwächt über den Boden kriechen, damit ich das kleine Geviech unter dem Gewicht meines starken rechten Fußes zermalmen kann.
Dass ich die großen Fleischfliegen zerreiben kann zwischen den flachen Händen, als würde ich Brotkügelchen drehen.
Dass ich im Geiste deine Knochen zähle, Mutter, und dass ich auf die rechte Zahl komme.
Dass sich mein Siegeswille festige.
Dass es bald als Lächerlichkeit gelte, von dem Glauben an mich abzuweichen.
Dass Deutschland reiche, so weit die deutsche Zunge klingt.
Dass mir im Traum nicht erscheint mein Herr Vater, der Salz auf den Handteller streut, es sollen ihm die Handteller nicht glänzen …«
Der Autor hält inne, das ist ihm alles eine Peinlichkeit, er denkt: ›Ich kann doch nicht diesen Kerl ein Bittgebet sprechen lassen!‹ Wieso nicht? Der Mann war ein Mensch. Ein hochstaplerisch veranlagtes Menschenschwein, aber er war ein Mensch. Der kam nicht als dunkle Gewitterwolke über die Deutschen. Soll man jetzt für den Kerl Mitgefühl empfinden? Er will in seinem Buch kein Schreckbild zeichnen, keine Erscheinung zum Fürchten. Wieso nicht? Man soll sich nicht ergötzen können, man soll ihn aushalten müssen in all seiner Fadheit. Echt muss der Kerl geraten, dass der Bürger nicht nur Knopfaugen bekommt. Der Hass soll sich verdoppeln. Große Worte. Der Autor kippt den Kaffeebecher und schlürft den Bodensatz. Er bezahlt die Rechnung, die Kellnerin rauscht davon – hat er sie mit drei Euro Trinkgeld verprellt? Er überlässt seinen Platz einem Mann mit Sonnenbrille, der eine zweite Sonnenbrille ins Haar geschoben hat. Der Autor kehrt zurück zum Hofgarten. Wenn der Wind in die Blätter fährt, wenn die Wipfel sich sachte wiegen, sprechen die Bäume. Es schabt ihm leicht an den Herzrippen. Er wird sich von der Schwäche erholen. Er schaut hoch: ein silberner Schein am Himmel. Er bewegt sich in den Schatten der Bäume. Er liest eine Hausinschrift: Gott belagere uns mit Engeln. Zwei Männer haben sich breitbeinig hingestellt, um im hohen Strahl zu pinkeln. Er kennt eine Feministin, die leise heranschleicht, um Stehpinkler in den Schwitzkasten zu nehmen. Es ist erstaunlich: Der Autor hat an diesem Tag bislang keinen einzigen Bettler getroffen – ist das ein Zufall? Gibt es in dieser Stadt keine harten Säufer, die den Passanten den Pappbecher vorhalten?
Was hat er vergessen? Soll er sich noch einmal umsehen in der Villa? Es gibt keinen Grund dafür. Bevor der Österreicher der Wagnersippe seinen ersten Besuch abstattete, hat er sich zu dem siechen Engländer Houston Stewart Chamberlain begeben. Nicht zu verwechseln mit dem englischen Außenminister Chamberlain, der 1938 mit Hitler das Münchner Abkommen verhandelte. Es ist der spätere Schwiegersohn Wagners und Verfasser rassistischer Schriften.
Der Autor hat auf dem Flohmarkt Chamberlains Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts in zwei Bänden erstanden. Mist in höchster Potenz. Man kann den Mann nur von Herzen verachten. Er verstand sich als sogenannter Idealist arischer Auffassung. In seinem Werk stimmt er ein hohles Getön an, bis zum Übelwerden kämpfte sich der Autor durch den Überfluss an wahrer Bosheit, und er verstand, dass hier ein Mann Wissen ausbreitet, das er aus halb verstandenen Büchern erlesen hat. Chamberlain schlägt vor, dass die germanische Rasse durch gezielte Rückzüchtung zu ihrer wahren Größe zurückfinden werde. Hitler war begeistert.
Wie hat sich die Begegnung von Hitler und Chamberlain zugetragen? Der Autor ist sicher, dass beide Männer ein Maskengesicht aufgesetzt haben. Der Österreicher verbot sich vor dem Engländer einen wilden Hassausbruch. Es herrschte keine weihevolle Stimmung. Es kamen zwei Menschen zusammen, die eine Menschzertrümmerung erträumten. Sie waren zu jedem Massenmord bereit. Der Mann war bettlägerig, er litt an einer ominösen Nervenkrankheit, er verrottete bei lebendigem Leibe. Der Autor versucht, es sich vorzustellen: Chamberlain lag unter einer Decke mit Plüschtroddeln, reglos, hilflos und aber tückisch. Hat er ein Hurra auf den Münchner Mussolini ausgebracht? Nein. Er liegt darnieder wie eine Leiche mit einem atmenden Gesicht. Ein halbtoter alter Mann, den die brausenden Vögel in den Bäumen schrecken. Was will er? Hochgefühl und Gemetzel. Was will Hitler? Dass sich Mann wie Frau dem Zwang der Zucht füge, dass sich der Volkszorn blutig entlade. Das nennen sie beide vaterländische Gesinnung! Oft schreien sie auf, dass man den Erzfeind nicht aus falschen Humanitätsgefühlen schonen dürfe. Der Autor hat es vor Augen: Hitler, die lange Strähne auf der Stirn festgepappt, das Bärtchen frisch gestutzt, sitzt an der Bettkante, er versucht, die erste Verlegenheit zu überbrücken, indem er nickt, nein falsch, er hackt mit dem Kinn in die Luft, der Mann im Bett würde gerne mithacken, doch er ist fast zu Bewegungslosigkeit verdammt, er verlegt sich auf das, was er am besten kann, nämlich das Lügen, also wispert er: »Sehen Sie in mir, lieber Herr Hitler, einen ergebenen Freund.« Guter Anfang.
H. ist vermutlich erzürnt, er denkt: »Der Engländer glaubt, ich hole bei ihm Gewissensrat. Ich lasse ihn in dem Glauben.« In diesem Krankenzimmer sind zwei Männer mit harten Männerherzen im Glauben an das Männertum vereint. Deutschlands treueste Söhne: Das ist eine üble Gemeinschaft. Die ohrenschabenden Laute von draußen lassen Chamberlain unruhig rucken, als wolle er den juckenden Rücken an der Matratze scheuern. Wovon träumt er? Von großen Apparaten. Von meuchelnden Maschinen. Da spricht er: »Da draußen sind nicht wenige Männer, die große Rosinen in der Hose haben. Sie sind anders.« Hitler würde wohl am liebsten aufspringen und sich an der Kehle des untoten Menschen im Bett festbeißen. Das ist kein Kraft ausströmendes Wesen. Das ist ein siecher Greis, dessen unwürdiges Gewimmer zur Gewalt reizt. Das ist ein bloßer Ehrendeutscher, und also prüft H., ob es stimmt, was die Leute behaupten: dass er in seiner Überanpassung, in seiner radikalen Angleichung noch den assimiliertesten Juden übertreffe. »England«, ruft er, »ist der Vampir des Festlands, denn die Landgier der Briten ist maßlos!« Chamberlain keucht vor Freude auf. Er krächzt, dass er den Kaiser höchstpersönlich gedrängt habe, gegen das niedergeartete Menschenmischmasch in England vorzugehen; der Kaiser vernachlässigte jedoch die weltanschauliche Seite, er wolle in diesem Falle von einer Selbstbesiegung sprechen. Er sei kein Wissenschaftler, er sei ein Weltenschauer.
Ist Chamberlain ein Verräter? Er ist ein Überläufer, das trifft es am besten. Er muss in seiner Hinwendung zum Deutschtum bis zum Äußersten gehen, er muss seine fanatische Zähigkeit herausstellen, er muss zur großen Waffentat aufrufen, kurz gesagt, er muss maßlos übertreiben. Darin ähnelt er dem Österreicher, der aussieht wie ein Karusselbremser aus dem Balkan und aber sein Deutschtum zur Daseinsnotwendigkeit macht. Der wegen seiner unheldisch eingesunkenen Hühnerbrust die Uniformjacke auspolstern lässt. Der Autor könnte es als Seifenschaum abtun, das hohle Gerede, den ranzigen Maskulinismus, die gepressten Kiefern. Doch die vielen Bosheiten der eingedeutschten deutschesten Deutschen führen zur größten Katastrophe. Er schaudert, weil er unter dem Eindruck der beiden Schwadroneure auch angefangen hat, in Superlativen zu denken.
Hitler sitzt nicht gern am Krankenbett, es steht ihm vielleicht der linde Ekel ins Gesicht geschrieben. Doch er neigt pflichtschuldigst den Kopf vor dem Mann, den er vor anderen deshalb als einen großen Geschichtsdenker rühmt, weil dieser ihn als den Erlöser des Reichs oft gelobt hat. H. glaubt, dass er eine praktisch veranlagte Künstlerseele sei. Er macht den Anstandsbesuch um seines eigenen Vorankommens wegen. Der Autor arbeitet im Geiste weiter an der bizarren Szene. Chamberlain könnte Hitler an den Aufruf aus dem Großen Krieg erinnern: »Sammelt ausgekämmtes Frauenhaar. Unsere Industrie braucht es für Treibriemen!« Er könnte sich, weil ihm die Stimme versagt, mit dem nasenbärtigen Erlöser über Zettel verständigen.
Ja, so kann es weitergehen. Der Engländer lässt die Zettel flattern, er ist maßlos in seinem Wortrausch. Er schreibt auf einen Zettel: ›Ich gehe vor die Hunde!!!‹ Er schreibt auf einen anderen Zettel: ›Legen Sie mir doch eine Handgranate unter die Decke und verlassen schnell das Zimmer. Die Granate würde mich zerfetzen. Ich wäre ein leuchtendes Vorbild. Ich wäre Matsch, den man mit den Überresten des Bettes in die Grube schmisse. Ich fühle mich doch schon halb begraben!!!‹ Chamberlain krächzt, Chamberlain schreibt, Chamberlain setzt bald ein halbes Dutzend Ausrufezeichen hinter jeden Satz. Ja, so wird es gehen. Er schreibt: ›Wilde Leidenschaften!!!! Eisenhärte!!!!!!‹ Er schreibt: ›Die einzig echte Bekleidung des Mannes ist der Soldatenrock!!!!!!!!‹ Genug. Bald liegen auf dem Teil der Decke, der Brust und Bauch bedeckt, fliegende Zettel voller Mahnungen. Genug. Der Greis schläft schlagartig ein, der Füllfederhalter fällt ihm aus der Hand, von dem dumpfen Aufschlag auf dem Boden wacht er nicht auf. Der Österreicher steht auf, schleicht sich in den Flur, ihm entfährt ein Schrecklaut: Chamberlains Frau Eva Wagner sitzt kerzengerade auf dem Stuhl neben der Tür. Ihre Mütterlichkeit stößt ihn ab. Dass sie ihm ihre Ehrerbietung mit einem Hofknicks nicht offen zeigt, verdrießt ihn. Sie könnten sich leise tuschelnd unterhalten – worüber? Sie spricht ihn auf sein Junggesellensein an. Er sagt, dass er für die Ehe noch nicht abgeschliffen sei. Sie weist ihn darauf hin, dass er ein unstetes Leben führe. Er sagt, dass er in allen Angelegenheiten mit Ausnahme der Ehe bewandert sei. Sie vermutet, dass er sich von keiner Frau überwältigen lassen wolle. Hitler schreit: »Die Lebensfrau ist mir noch nicht untergekommen. Ich kenne nur Germania, die hohe Braut!« Dann schweigen sie, sie schweigen und horchen. Doch Chamberlain schläft. Der Mann ist durch eine geheimnisvolle Krankheit invalidisiert, er wird nicht wieder gesunden. Der erlauchte Gast verpatzt beim Abschied den Handkuss, seine Zungenspitze rutscht zwischen die trockenen Lippen, er schmeckt ihren Handknöchel, der Geschmack nach bitterer Salbe lässt ihn auf dem Weg zum Hotel immer wieder schlucken.
Die Menschen halten den Autor für einen Mann vom Ordnungsamt, weil er immer wieder stehen bleibt, gefaltete Zettel oder den Notizblock hervorholt und eilig Worte und Dialogfetzen hinkritzelt. Es ist spät geworden. Der Autor will nicht länger in der fremden Stadt herumirren. Er muss nicht auf die Stadtkarte schauen, er findet den Weg zurück. Er schiebt seine Zimmerkarte in den Schlitz neben dem Hoteleingang. Trotz mehrmaliger Versuche gehen die Türen nicht auf. Der Rezeptionist, der den Nachtdienst versieht, kommt ihm zu Hilfe. Er nimmt den Fahrstuhl in den dritten Stock. Ein nackter Mann kommt ihm im Flur entgegen. Was ist das? Der Autor flieht über die Fluchttreppe, die Sohlen knallen auf die Gitterroststufen.
Er geht durch menschenleere Gassen, zwischendurch verfällt er in den Laufschritt, weil es ihn in der Nachtkälte fröstelt. Weil er sich im tiefsten Inneren bedroht fühlt. Er empfindet plötzlich Seelennot. Es könnte mit ihm ein schlechtes Ende nehmen, wenn er eine Kneipe aufsucht. Das letzte Mal ist ein Kerl, mit dem er kein Wort gewechselt hatte, auf ihn losgegangen. Bestimmt würde wieder so etwas passieren. Er will nicht bei einem wilden Tumult untergehen. Er möchte bloß noch eine Stunde absitzen, bis er sicher sein kann, dass der nachtaktive Nackte weg ist. Im Wirtshaus am Ende der Einkaufsstraße dröhnt keine laute Musik, das ist ihm sehr recht. Die Wirtin trägt einen tiefen, spitz zulaufenden Ausschnitt, Glitter funkelt auf ihrer Haut. Kaum tritt er an den Tresen, sagt sie: »Das Glück ist kugelrund, es trifft wohl manchen Pudelhund.« Sie meint es gut mit ihm. Er bestellt Limonade und Erdnüsse, sie stellt ihm Glas und Schale hin, er wartet vergeblich auf eine bissige Bemerkung. Ein Stammkunde verrät ihm, dass sie es je nach Laune dem einen oder anderen Stammkunden erlaube, ihr auf die Stelle zwischen Drosselgrube und Busenfalte einen Kuss aufzudrücken. Es weht dem Autor kalt um die Waden. Sie stammt aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet, genauer aus dem Harz, mehr möchte sie nicht verraten. Die Schale ist schon leer gegessen. Er glaubte, dass ihn nichts heilen könne von der Missstimmung, nun geht es ihm aber deutlich besser. Fast alle Männer am Tresen und an den Tischen sind mit gutem Gemüt gesegnet. Woher will er das wissen? Sie sehen nicht aus, als hätten sie ein entartetes Triebleben. Kann er das so einfach in diesem Halbdunkel erkennen? Jeder erzählt seine Heldengeschichte, da draußen, die Männer hier drinnen lärmen aus bloßer Munterkeit wegen der vielen Schnäpse im Blut. Er denkt: ›Ich möchte weiterkommen mit dieser Geschichte.‹ Er hofft: Es wird sich schon alles beruhigen. Es wird nicht alles unter seinen Händen zerfallen. Ein anderer Stammkunde stellt sich als Zugezogener aus dem Norden vor. Er trägt einen Hut, dessen Krempe er vorne und hinten umgebogen hat, um wie ein Wildschütz auszusehen. Gelegentlich nimmt er ihn ab und wischt sich mit einem zerknüllten Taschentuch über die Stirnglatze. Der Autor starrt auf die Fusselknötchen am zerschlissenen Hutrand. Der Mann mit Hut erzählt: »Früher war das meiste sauschlecht. Mein Vater wär in den Jahren zwischen den Kriegen fast verreckt. Der Magen hing ihm durch bis zu den Zehen, er hatte Hunger und Hunger und Hunger. Da ging er in die Bouillonbude. Er hat es mir genau beschrieben. Der hintere Saal war eine Wärmestube, die Männer schliefen auf langen Wirtshausbänken an der Wand, Taue waren in Brusthöhe gespannt, dass sie nicht vornüberfielen. Man saß, wenn man nicht schlafen wollte, auf kippligen Schemeln, zahlte die Pfennige, löffelte die wässrige Fleischbrühe. Mein Vater hat mir gesagt: Ich fütterte mich, ich steckte die Faserstücke in meinen Mund, ich warf die Stücke in den aufgerissenen Mund. Mein Vater hat mir gesagt: Ich hab gedacht, mit den Fasern im Mund: Der Tag ist noch nicht vorbei, und es ist nicht dumpf in mir, und es ist noch Sehnsucht in mir nach Bequemlichkeit.« Der Autor gibt dem Wildschütz recht. Noch eine Limonade, noch eine Schale Erdnüsse, die Wirtin glitzert und serviert, der Autor bleibt sitzen und macht alberne Handbewegungen, er macht zustimmende Gesten, während der Wildschütz und andere Männer Geschichten mit einem kläglichen Ende, mit einem schlechten Ausgang erzählen, das macht nichts, das Wirtshaus ist voller Stammgäste, die die Frau Wirtin wie eine Ballkönigin anstaunen, alles riecht so schön und gut und deutsch wie Butterbrot, er versteht, dass man eine dicke Suppe essen möchte, dass man sich dick und rund fressen will, manchmal reichen Milch und ein Gebäckstück, und bei kaltem Wetter tut man Cognac in den Tee, der Autor wird sich das noch einmal überlegen, ob er das Buch machen wird, die exzessive Grübelei macht geisteskrank, das bisschen Schläue wird ihm nicht helfen. Ich will in Ruhe kommen, denkt er, und dann greift der Autor doch zum Notizheft und schreibt Worte, die er dem Elenden, dem Blutsäufer, dem Österreicher in den Mund legen wird, das nimmt er sich vor, er schreibt: ›Ein bisschen Glück steht mir doch zu. Ich werd noch groß. Die anderen sollen kleine Menschenstücke bleiben.‹ Und er macht sich Gedanken über den Elenden, was ist ihm denn widerfahren, dass er zum Menschenschwein geriet, ist ihm das Bürgerliche den Buckel runtergerutscht, war es ihm immer ein Wunsch, alles in Fetzen zu reißen, das ist eine heillose Geschichte, und doch möchte der Autor das Buch machen, das Buch über Hitler im Aufstieg, die Münchner Jahre bis zum Putsch und der Niederschrift von Mein Kampf. Plötzlich ist er von der Sorge gepeinigt, dass der Stammkunde aus der Bierwut heraus ihm das Heft entreißt, und da schreibt der Autor: ›Unbedingt eine Szene mit Sitzschläfern in der Bouillonbude einbauen!!!‹, jetzt fängt er auch an, Ausrufezeichen zu setzen, der Wildschütz ist wegen seiner Schreiberei misstrauisch geworden und rückt von ihm ab, und wenn der Autor so weitermacht, gibt’s von der Wirtin bestimmt bald eine Backenklatsche, er schaut hinaus und sieht: Es ist Nacht, und Käfer und Motten umschwirren die Lichter. Noch eine Limonade, noch mehr Erdnüsse. Zwei Wandergesellen in Trichterhosen hocken friedlich auf der Bank und trinken und trinken. War der Österreicher der Führer des miserablen Pöbels? Ja. War er heftig, höhnisch, hasserfüllt? Ja. Hatte er die fanatische Willensstärke, böse zu sein? Ja. Er hat ein ganzes Volk in den Kot einer üblen Tiefe gezwungen. Der sentimentale Kerl konnte vor innerer Erregung schluchzen. Der Autor ist vor lauter Grübelei in Schweiß geraten. Da erinnert er sich an den Nackten im Flur, der Mann trug an den Zehen fadenscheinige Strümpfe, das hat er gesehen, bevor er die Flucht ergriff. Er ist müde, er bezahlt, die Wirtin wünscht einen guten Heimweg, er stolpert durch die Nacht, und weil er sich wieder verirrt, schimpft er sich halblaut blöd und beschränkt, es schmerzen ihm von krummem Sitzen Kreuz und Rücken. Der Nachtportier ist verblüfft über ihn, den ungeschickten Hotelgast, der schon wieder um Einlass bittet, diesmal fuchtelnd und klopfend. Der Autor macht vorsichtig ein paar Schritte, stürmt in den Aufzug, im dritten Stock späht er in den Flur, rennt zu seinem Zimmer, hält die Karte vor den Türsensor, erst nach dem vierten Mal leuchtet das grüne Lämpchen auf, er drückt hastig die Klinke herunter, tritt ins Zimmer, drückt die Tür zu, klemmt einen Stuhl zwischen die Klinke und den Boden. Jetzt fühlt er sich vor einem Überfall sicher. Im hohen Zimmerwinkel steht, auf einem dicken Zweig festgemacht, eine ausgestopfte Eichkatze, deren Buschschwanz man aufgebürstet hat. Der Mund ist zu einem menschlichen Lächeln verzogen. Ihn schaudert. Der Autor hat Angst, dass es an der Tür rüttelt. Er hat Angst davor, dass die Eichkatze zum Leben erwacht und sich in ihn verbeißt, wenn er schläft und wehrlos ist. Er greift zum Filetdeckchen auf der Kommode, er legt es über das grinsende Tier, er überlegt, ob er das verhüllte Tier mit seinem Gürtel knebeln soll. Er entscheidet sich dagegen. Nach der Dusche kriecht er ins Bett, ihn friert jämmerlich. Immer dann, wenn ihm die Augen zufallen, empfindet er ein Entsetzen. Regt sich die Eichkatze? Er macht Licht. Verkappt sich das Tier? Will es Gewalt über den Autor bekommen? Es ist tot, es ist gefüllt mit Stauberde, mit verwestem Holz. Er schläft ein, er träumt sich mit schweren Achseln leer.
Am nächsten Morgen fühlt er sich, als hätte er auf der Drahtpritsche gelegen. Ist das ein Jammertag oder ein Jubeltag – das wird er noch herausfinden. Im Frühstückssaal sitzen die Festtagsbesucher an vier zusammengeschobenen Tischen, sie bestellen Rührei mit Speck, der Autor nagt lustlos an seinem Pumpernickel, die tropfende Tomatenscheibe fällt ihm von der Gabelspitze, es gelingt ihm nicht, sie aufzuspießen. Hitler. Er beschloss, die Welt bis zu seinem feigen Ende anzuknurren. Bitte nicht. Nicht gleich am frühen Morgen Gedanken über den Mann. Der Autor verlässt den Saal, er eilt zur Rezeption und erzählt von dem gestrigen bizarren Vorfall. Die junge Frau, auf deren Namensschild ein polnischer Name steht, stutzt und schaut zur Seite, der Concierge übernimmt: Er wolle sich im Namen der Hotelleitung vielmals entschuldigen, bei dem besagten unbekleideten Mann handle es sich um einen treuen Kunden, dessen Ehrbarkeit nicht zu beanstanden sei; leider würde der besagte Herr nicht immer, aber recht häufig, schlafwandeln, eine zu Tode erschrockene Dame habe sogar auf den Mann mit ihrer Handtasche eingeschlagen, wolle der Herr bitte zur Wiedergutmachung ein Glas Sekt auf Kosten des Hauses annehmen. Der Autor lehnt dankend ab. Er fragt, ob er nach dem Auschecken seinen Koffer unterstellen dürfe. Und seiner Bitte wird entsprochen. Er bricht zu einem letzten Erkundungsgang auf. Nackter Mann in Strümpfen. Bouillonbude. Eichkatze.
Hitler in Bayreuth. Wer fehlt? Winifred. Für den knallverrückten Österreicher war die Villa Wahnfried eine Hochburg deutscher Volkheit. Er nannte Winifred ein Prachtweib. Es knisterten ihr die Sinne, wenn sie ihn ansah, sie nannte ihn liebevoll Wolf. Sie könnte ihrem Wölfchen die Tür geöffnet haben, sie könnte ihrem Wölfchen bedeutet haben, die braune Cabriohaube abzunehmen. Der Führer kommt sich im Hause des Meisters Richard Wagner mückenklein und blöde vor. Nach einigen Stunden in der Stube führt sie ihn ins Freie, sie braust im langen Rock voran, der Hut mit großer Krempe verschattet Stirn und Augen, die Schleppe schleift durch den Dreck. Im Vorgarten der Villa werden Kartoffeln und Gemüse angebaut. Es ist kalt, es bilden sich Tröpfchen an den Stoppelenden des Nasenbarts, der Österreicher drückt den Ärmel heimlich gegen die Oberlippe. Winifred sagt: »Wir wollen Feuer legen, um das Waldgespenst zu vertreiben.« Sie läuft ins Gehölz, H. folgt ihr in die Nebelnässe. Der Boden ist vom Tauwasser aufgeweicht. Der hechelnde Österreicher sieht den Durchhau, Stöckchen und Bruchholz liegen am Boden, dann stoßen die beiden auf einen Knüppeldamm, der Weg durch den schwarzen Morast ist mit derben Klötzen belegt, Winifred rät laut zu Bedacht und Behutsamkeit, H. rückt den Hut ins Genick, die Cabriohaube steckt in der Tasche des Trenchcoats. H. springt vom letzten groben Holzstück, sie hält ihn am Ellenbogen fest. Er muss zurücktreten, um Berg und Wald zu bestaunen. In die Natur begibt er sich nicht gerne. Sie sagt, dass Siegfried, also Fidi, schon ein Quirlequitsch sei, und weil ihm das Wort nicht geläufig ist, sagt sie: Zappelhans. Sie möchte ihr Herz ausschütten … Der Autor sitzt auf einer niedrigen Natursteinmauer, die Feuchte durchnässt den Hosenboden, das ist ihm egal, er muss jetzt über die Worte nachdenken, die er Winifred Wagner in den Mund legen wird, es muss sich nach einer Lebensbeichte anhören. Er schreibt ins Heft: »Fidi ist schon ein liebenswerter Mann«, ruft sie, »erlebnistief, wenn es um seine Musik geht. Ich will mit einem Mann gleichen Sinnes sein! Sie, Wölfchen Führer, haben ja viele Frauenbekanntschaften, Sie haben ja Abwechslung, ich habe sie nicht. Ich habe die Kinder, ich habe die hohe Frau, die sich jede Nacht im Bett eine Flasche Bier genehmigt. Muss man das wissen? Ja. Denn sonst ist sie steif und hart. Sie, lieber Herr Hitler, haben Herzenstakt.« Wie weiter? H. geht mit ihr einen schönen Waldweg entlang, der Matsch ist zu knöchellangen Kämmen verhärtet, er geht voraus, er spürt ihre Atemwolke an seinem Rücken niederschlagen, sie spricht ihm in den Rücken. Eine äsende Hirschkuh in der Ferne. Der Boden ist weich, H. trägt seine neuen, frisch gewichsten Halbstiefel, er muss achtgeben, dass er nicht einsinkt. Er denkt: ›Blöd wird man, wenn man den Blick schweifen lässt. In der Ferne ist nichts.‹ Winnifred sagt, dass sie ihn eigentlich zu einer verrufenen Lichtung in Waldesmitte führen wollte, doch das dauere zu lange, sie müsse außerdem auf der Hut sein vor den Bayreutherinnen, die ihr eine wesentliche Neigung zu Narrheiten unterstellten, weil sie nicht dem deutschen Stamm angehöre. Da wirft er sich zu ihren Füßen und ruft: »Sie sind mein Ideal!«, er umklammert fest und männlich ihre Beine, seine Hose saugt sich augenblicklich an den Knien und an den Schienbeinen mit Schlammwasser voll, sie scheint seine Anschmiegung als Galanterie zu verstehen, er atmet den Geruch ihres Rocks ein, sie legt ihm zwei Finger auf den Nasenbart. Ganz Gesicht und Gliedmaßen, das ist der Österreicher trotz der Kälte. Sie lehnt an einem Baumstamm, und als sie sich bewegt, rieselt zerbröselte Rinde auf ihre Fersen. Ein Kind mit großen Gelenken, das ist sie. Er schaut hoch, sie lächelt, und er sieht ihre speichelnassen Eckzähne. Er bleibt mit nassen Knien in der Umschlingung. Er benimmt sich ihr zu Füßen gebührlich. Käme ihr Mann Siegfried ins Gehölz und sähe er Hitler die Lippen auf Winnifreds Unterschenkel aufdrücken – spräche er von einer unflätigen Geschichte? H. fühlt wieder ihre Finger an seinem Schnauz.
Sie lösen sich voneinander. Der Führer darf sich bei den Wagners nicht mit verschlammter Hose sehen lassen, Siegfried würde bei seinem Anblick kichern, denn ein Führer hat nicht zu triefen! Also zieht er heimlich davon. Er sieht die von Schädlingen befallenen Straßenbäume, die Feuchtigkeit in der Luft beunruhigt ihn, er schlägt mit der Nilpferdpeitsche beim Gehen gegen die Waden. Man darf keine sentimentalen Anwandlungen haben. Wer denkt das? Der schlammnasse Führer. Der Autor weiß: Das hat sich so nicht zugetragen, er schreibt ja aber auch nicht an einem Tatsachenbericht. Trägt er die Kleinigkeiten zusammen wie einer, der Schmutz zusammenkehrt? Die Wagnerianer, wenn sie denn sein Büchlein lesen, werden die Nase rümpfen: Winnifred hält sich an Hitlers Schnauz fest – wie geschmacklos. Das stimmt. Von Geschmack ließen sich aber die Damen und Herren damals nicht immer leiten. Der Emporkömmling H. war bei ihnen gut aufgehoben. Er galt als Volksliebling, nicht wenige Männer in Bayreuth schwenkten ihm zu Ehren die Mütze. Sie glaubten, in dem Mann eine starke nationale Gärung entdeckt zu haben. Nicht nur die Elendsten sind ihm gefolgt, denkt er. Führer befahl, sie folgten: Sie gaben ihr Blut hin für Luft, für nichts, für lausige laffige Ziele. Dieser Gedanke schwillt in seinem Kopf an, der Autor wird nicht klüger. Es wehten ihn aus wechselnder Richtung diese Idee und jene Idee an. Was gibt es über die Liebesgeschäfte des Mannes H. zu sagen, was über sein Begehren? Wie geht es zu bei Männern seines Schlages? Seine Liebschaften blieben nicht im Verborgenen. Der Autor hat viel über Hitler und die Frauen gelesen. Er musste nicht um Gunst und Gabe betteln, die Frauen vieler deutscher Städte huldigten ihm, weil er als schäumender Redner die Fremdenabwehr lehrte, weil ihm die festgeklebte nasse Locke in der Erregung wie einem kleinen Bub in die Stirn fiel. Weil er den Handkuss fast immer formvollendet gab und weil dabei die abstehenden Borsten seines Nasenbärtchens den Handrücken der Dame kitzelten. Er war ehrerweisend, er verwarf nicht die alte Art, und dass ihm heimtückische Gedanken das Gesicht verdunkelten, machte ihn in den Augen der Frauen nicht unansehnlich. Der Autor zieht das Porträtfoto von Hitler aus dem Innenfach seiner Geldbörse, er vergewissert sich, dass ihm kein Bayreuther über die Schulter schaut, dann starrt er in das Gesicht, als wolle er durch Hypnose dem Abbild Geheimnisse entringen. Lächerlich. Der Autor ist lächerlich. Und der Mann H. ist lächerlich: Er verkneift die Lippen, als wolle er bedeuten, dass er jeden mordet, der ihm in den Lauf kommt. Dass er unbestreitbare Anlagen hat und dass ihm keiner wird einreden können, er sei unbegabt. Der ist vom Kopfdruck ganz grau, denkt der Autor, der ist eigentlich nervenschwach, der befiehlt aber, dass man dem Ganzen mit Lot und Lineal zu Leibe rücken müsse. Es steht ihm deutlich lesbar im Gesicht geschrieben: Es ist wenig Menschengeist