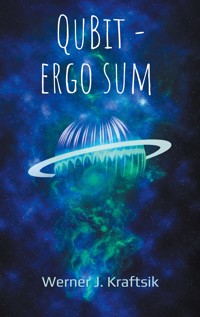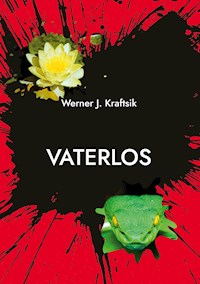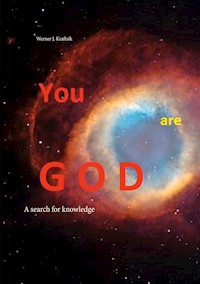Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zufälliges Treffen mit der Tochter führt nicht zu weiteren Kontakten mit ihr, oder ihrem Bruder. Sie bleiben weiter vaterlos, weil ihre Mutter mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln jeden Kontakt zu ihrem Vater unterbindet. Blut ist dicker als Wasser Hält diese Regel, wenn sich, entgegen aller Widerstände Sohn, Tochter und Vater finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Hesse
Glück
Solang du nach dem Glücke jagst,
Bist du nicht reif zum Glücklich sein,
Und wäre alles Liebste dein.
Solang du um verlorenes klagst
Und Ziele hast und rastlos bist,
Weißt du noch nicht, was Friede ist.
Erst wenn du jedem Wunsch entsagst,
Nicht Ziel mehr noch Begehren kennst,
Das Glück nicht mehr mit Namen nennst,
Dann reicht dir des Geschehens Flut
Nicht mehr ans Herz - und deine Seele ruht
Prolog
Als ich auf halbem Weg stand unsers Lebens,
Fand ich mich einst in einem dunklen Walde,
Weil ich vom rechten Weg verirrt mich hatte;
Dante, Göttliche Komödie, Erster Gesang
Der verstorbene Comedian Mitch Hedberg pflegte in seinen Shows eine lustige Geschichte zu erzählen. Während eines live ausgestrahlten Radiointerviews fragte ihn der Moderator: »Nun, wer sind Sie?«
In diesem Augenblick schoss ihm durch den Kopf:
»Ist der Typ tiefsinnig oder bin ich zum falschen Sender gefahren?«
Wie oft wird uns eine einfache Frage gestellt wie »Wer bist du?« oder »Was machst du?« oder »Wo kommst du her?« In Anbetracht dessen, dass es eine oberflächliche Frage ist – wenn wir uns überhaupt darüber Gedanken machen – begnügen wir uns nicht viel mehr als einer oberflächlichen Antwort.
Aber selbst wenn man ihnen die Pistole auf die Brust setzte, könnten die meisten Menschen wohl keine substantielle Antwort geben.
Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir die Zeit genommen, um dir darüber klar zu werden, wer du bist und wofür du stehst?
Oder bist du zu sehr damit beschäftigt, unwichtigen Dingen hinterherzujagen und den falschen Vorbildern nachzueifern?
Schlägst du etwa Pfade ein, die dich enttäuschen, nicht erfüllen oder überhaupt nicht existieren.
6. Januar Ryan Holiday „DER TÄGLICHE STOIKER“
Inhalt
Ein weiterer Sonntag im Ruhe-Modus
Missverständnis
"Verlorene Zeit" gerettet
Bittersüßes
Misstrauen
Kindheitsepisoden
Lebens(t)räume
Die „liebende Mutter“
Alleingang
Warten auf…………
Hoffnung und Entscheidung
Unerwartete Reaktion
Erinnerungen nach dem Sturm
Reue wegen eines Briefes?
Noch ein Versuch
Enttäuschung und Wut
Hoffnung
Ablösung?
Erkenntnis
Überraschung
Wiedersehen
Vater und Sohn
Erste Begegnung
Tischgespräche
Ein Übernachtungsgast
Etwas Besonderes
Erwachen
Reaktionen
Ein Neubeginn?
Überraschung
Feedback
Erklärungen – Aufklärung?
Ein Anruf
Ein weiterer Sonntag im Ruhe-Modus
Da war er schon wieder, der Sonntag, fast vorbei und ganz klar ein typischer "Chill-Sonntag" für Sandra. Nach einer strapaziösen Woche voller Arbeit hatte sie einfach null Bock auf jegliche Aktivitäten. Keine Lust, das Haus zu verlassen, keine Lust auf Spaziergänge und noch nicht mal die Motivation, aus ihren Schlafklamotten raus zu kriechen.
An solchen Sonntagen findet man Sandra vor ihrem Computer, beim Zocken, während ich mich zwischen Fernseher und Computer hin- und her bewege. Gestartet wird der Sonntag mit meinem akademischen „Zoom-Frühschoppen“, mit einigen Kumpels.
Nach den hochintellektuellen Diskussionen brauche ich dann doch erst mal eine Portion TV-Dröhnung zur Entspannung. Egal, was gerade läuft - einfach nur glotzen, nicht denken... und vor allem: keine ernsthaften Gespräche, bitte.
Missverständnis
Aus Sandras Büro tönt ein langes "Joachim" an meine Ohren, gefolgt von einer kurz "Horchpause" und dann einem energischeren "Joachim!", das gelegentlich dazu führt, dass ich auf der Couch dösend, reagiere.
»Ja? Was gibt’s?«, während ich mich mühsam von meinem gemütlichen Sitzplatz erhebe, um zur wartenden Sandra zu schlurfen.
»Sag mal, sagtest du nicht, du wolltest heute kochen?«, ohne ihre Augen vom Bildschirm zu nehmen, damit ihr Spiel nicht unterbrochen wird.
»Ich? Ich dachte, du wolltest kochen. Du hattest doch dieses Rezept für gefüllte Zucchini, oder habe ich da was falsch verstanden?«
Nach einigem Hin und Her übernehme ich die Zucchini-Küchenpflicht, während Sandra weiter am Computer zockt.
Nach kurzer Zeit stehen die Zucchini bereit; natürlich auch die unverzichtbare Flasche Rotwein, und wir genießen gemeinsam das Mahl.
Mit der abendlichen Tagesschau im Hintergrund versuche ich, ein Gespräch zu beginnen, denn Sandras Schweigen ist mir aufgefallen.
»Was ist los? Du bist so ruhig; ich habe das Gefühl, da brodelt was in dir«, versuche ich, sie zum Reden zu bewegen.
»Ich? Ich bin sauer, stinksauer, auf dich!«, platzt es schließlich aus ihr heraus.
»Auf mich?«,
ich bin verblüfft und spüre die Spannung in der Luft wie die kurz vor einem Gewitter. Sie erklärt mir, dass sie sich von mir ausgeschlossen fühlt, weil ich sie nicht über Gespräche mit meiner Tochter und meinem Sohn informiert habe – obwohl wir doch vereinbart hätten, Probleme gemeinsam zu bewältigen.
»Du hast dich mit deiner Tochter getroffen, hast mit ihr anscheinend ein längeres Gespräch geführt, hast auch mit deinem jüngeren Sohn gesprochen und mir keinen Ton davon berichtet! Das ist natürlich dein gutes Recht und mir steht es auch nicht zu, dich deshalb zu kritisieren. Aber weil du mir immer wieder erklärt hast, dass wir die Probleme, die du mit deinen Kindern hast und die dich offenbar sehr belasten, gemeinsam tragen wollten, fühle ich mich von dir ausgegrenzt und verletzt, weil du nicht den Mut hast, mich darüber zu informieren oder mit mir zu besprechen. Das hat mich sehr verletzt und ich fühle mich von dir aus wichtigen Teilen deines Lebens ausgeschlossen!«
Es folgt eine schmerzhafte Stille, in der Sandra gegen aufsteigende Tränen kämpft. Ich bleibe stumm und nachdenklich, schüttele in mich gekehrt immer wieder den Kopf, weil mein innerer Dialog mich zu einer Antwort drängt, ich Worte suche, um zu antworten, ohne sie zu verletzen - und es erst einmal für besser halte zu schweigen.
Minuten vergehen, bis meine Gedanken soweit geordnet erscheinen, dass ich antworten kann.
»Ich kann dich verstehen, dass du enttäuscht und verletzt bist, aber das war nie meine Absicht und es tut mir unendlich leid, wenn ich dich verletzt habe. Ich wollte dich nicht verletzen, aber ich kann es mir auch nicht erklären woran es liegt, dass ich immer wieder versuche, bestimmte Dinge alleine regeln zu wollen.«
»Hast du kein Vertrauen zu mir? Was mache ich falsch? Warum tust du das? Warum schließt du mich so von deinem Leben aus? Warum fällst du immer wieder in dieses Verhalten?«
Fragen, die mich schmerzen und bedrücken. Es dauert wieder, bis ich die Worte finde.
»Ich will versuchen, es dir zu erklären. Manchmal kann ich selbst nicht verstehen, wieso ich meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse nicht so lösen kann, wie ich es in meinem Berufsleben immer konnte. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich in meinem Leben oft, viel zu oft, alleine gefühlt und die meiste Zeit wie ein Einzelgänger reagiert und gehandelt habe? Wahrscheinlich habe ich Menschen, die mir gut gesinnt, die mich liebten, zu oft verprellt und deren Hilfe nicht zugelassen.
Oft und zu lange konnte ich nicht gut damit umgehen, Hilfe anzunehmen. Vielleicht hatte ich Angst davor, verletzt zu werden? Vielleicht gehört das zu den Gründen, weshalb ich mich in meinem Leben oft einsam gefühlt habe? Es tut mir leid, wenn ich dich durch mein Verhalten verletzt habe.«
"Verlorene Zeit" gerettet
Sandra lauscht still, ihre Augen ruhen auf mir, als ich weiter spreche. Es fühlt sich an, als ob die Zeit einfriert und sich dehnt, bis die Worte endlich aus meinem Mund kommen
»Also, es war echt ein verrückter Zufall, dass ich Katharina getroffen habe. Ich war in der City, habe kurz beim Verlag und beim Sender vorbeigeschaut und wollte mir eigentlich nur gemütlich einen Kaffee gönnen – du kennst doch dieses kleine, nostalgische Café – und da sitzt sie plötzlich.«
Sandra bleibt regungslos, ihr Blick ist fest auf mich gerichtet, als wäre ich ein Buch, das sie schon gelesen hat. Ich erkenne diesen intensiven Blick, der mich an die Geschichte mit der Schlange und dem Kaninchen erinnert – ich fühle mich definitiv wie das Kaninchen.
»Weißt du, wann ich Katharina das letzte Mal gesehen habe?«
Sie zuckt lediglich mit den Schultern, als wäre es eine rhetorische Frage.
»Mindestens zwanzig Jahre ist das her, zwanzig verdammte Jahre, die einfach so verflogen sind. Zwanzig Jahre verlorenes, unerlebtes Leben! In all dieser Zeit hätten wir so viel miteinander teilen können, so viele Gespräche, Diskussionen, Streitigkeiten und Versöhnungen – alles einfach weg, nur weil Nicole dazwischen gefunkt hat.«
Sandra unterbricht mich schließlich
»Warum hast du mir nichts davon erzählt? Warum muss ich von anderen hören, dass du dich mit ihr getroffen hast? Kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn mich meine Freundinnen darauf ansprechen, dass es schön ist, dass Vater und Kinder endlich wieder miteinander reden?«
Oh nein, das Gespräch mit Ivonne, einer guten Bekannten, bei dem ich unbedacht von Katharina erzählt habe. Eigentlich hatte ich ganz andere Dinge im Kopf, als ich ihr davon berichtet habe. Jetzt bemerke ich, dass das ein dummer Fehler war.
»Es tut mir leid, dass ich nicht mit dir darüber gesprochen habe. Ich wollte erst abwarten, ob sich etwas Positives aus diesem Treffen entwickelt. Ich wollte nicht, dass es wieder so endet wie damals unter Nicoles 'Aufsicht', die die Kontakte so schnell beendet hatte.
Du weißt noch, wie mies ich mich danach gefühlt habe und wie sehr du unter meiner Laune leiden musstest. Ich wollte dir das ersparen und erst handeln, wenn sich wirklich etwas Ernsthaftes ergeben hätte aus dieser zufälligen Begegnung.«
Bittersüßes
»Na, hast du das Ganze jetzt geregelt oder ist immer noch alles wie vorher?«, und ich gestehe kleinlaut
»Es hat sich nichts geändert!«
»Was meinst du damit, es hat sich nichts geändert?«
Fast Tonlos erzähle ich, was in den letzten drei Monaten passiert ist
»Ich bin damals aus dem Café rausgegangen, ohne eine Telefonnummer, eine Adresse oder irgendeine andere Kontaktmöglichkeit von ihr zu haben. Aber immerhin wusste ich, wo Katharina studiert, also habe ich dem Einwohnermeldeamt dort eine Anfrage geschickt. Nach etwa zwei Wochen haben die geantwortet: Sie lebt jetzt in Berlin. Ich habe eine Adresse.
Anscheinend wohnt Katharina auch in der Nähe von Sebastian, und ich weiß nicht, ob ihm das bekannt ist. Nur um ganz sicher zu gehen, habe ich auch beim Stadtteilbürgerbüro angefragt, aber die haben immer noch nicht geantwortet. Ich hoffe nur, dass Katharina nicht so ein „Daten-Privacy-Freak“ ist und Informationen über sich überall gesperrt hat.«
»Traust du mir etwa nicht, oder warum erzählst du mir das nicht, Joachim?«, Sie schaut mich traurig, vorwurfsvoll und sogar etwas wütend an.
»Warum tust du das? Warum vertraust du mir nicht? Du weißt doch, dass wir Probleme zusammen lösen können und nicht jeder für sich alleine«.
Schon immer musste ich für mich selbst sorgen.
Auf wen sollte ich mich schon verlassen?
Meine Mutter?
Die hat mich gleich nach meiner Geburt weggegeben.
Die erste Person, an die ich mich bewusst erinnern kann, ist eine Frau in einem tiefgrauen Gewand, einer riesigen schwarz-grauen, längs gestreiften Schürze und an ein in durch eine weiße Haube umrahmtes Gesicht mit durchdringend stahlgrauen Augen, einer ziemlich markanten Nase und einem farblosen Mund, der entweder immer fest verschlossen war oder sich nur öffnete, um ihre Anweisungen oder Befehle auszuspucken – Schwester Agatha.
Wie sollte ich der erklären, dass mir ständig kalt war und ich mit Angst die Nächte fürchtete? Ich wusste nicht, was Vertrauen bedeutet, und habe es dort auch nie gelernt.
Später, als ich in einem anderen Bett lag, spürte ich Wärme und die Aufmerksamkeit der Menschen um mich herum.
War das ein Traum oder Realität? Egal, ich kehrte wieder in das „Heim“ zurück in die Obhut von Schwester Agatha und musste ihr schimpfen oder die Befehle mit der donnernde Stimme ertragen.
Hatte ich ins Bett gemacht, landete ich in dem von allen Heimkindern gefürchteten dunklen Verschlag unter der Treppe, wo es immer laut war. Jeder Schritt auf der Treppe fühlte sich an wie ein Schlag auf den Rücken der dort hin Verbannten wie auf eine Trommel. Der Verschlag war eng und man teilte ihn mit Putzeimern und stinkenden Lumpen.
Wenn Schwester Agatha die Bestraften "erlöste", musste jeder „hochheilig“ versprechen, künftig immer "brav" zu sein.
Der Verschlag schien für besondere Vergehen vorgesehen zu sein, während es für kleine Verstöße nur einen Raum mit einem unüberwindbaren Gitter gab. Dort muss ich ebenfalls einige Zeiten verbracht haben, weil ein Bruder meiner Mutter, Onkel Fritz, mir im Erwachsenenalter erzählte, dass er mich gelegentlich dort besucht und mein ausdauerndes Weinen und die sturzbachähnlichen Tränenflüsse aus meinen tiefblauen Augen „bewundert“ haben will. Aber auch er brachte mich nicht von dort weg, – vielleicht ist das der Grund, dass ich mich an das Gitter, aber nicht an den Onkel erinnern konnte, – bis er mir davon erzählte.
»Natürlich vertraue ich dir«, antworte ich leise. »Aber ich dachte, dass ich dir von der Begegnung erst erzähle, wenn es mehr daraus geworden ist. Ich wollte erst herausfinden, wo Katharina und Yannick sind, wo sie wohnen, und dich dann mit dieser "Neuigkeit" überraschen. Du weißt, wie sehr mich das belastet, und es hätte mich enttäuscht, wenn ich es erzählt hätte, bevor es wirklich Ergebnisse gibt.«
»Aber ich hätte mich doch trotzdem für dich gefreut«, und fügt sie nach einigen Sekunden hinzu. Ich weiß doch, wie sehr du dir Gedanken über deine Kinder machst und wie wichtig sie dir sind.«
Sie senkt ihre Stimme wie zu einem Flehen und legt langsam ihre Hände auf meine
»Lass‘ mich an deinen Gedanken teilhaben und denke nicht immer, alle Probleme alleine bewältigen zu können. Deine Sorgen sind meine Sorgen und ich will sie mit dir teilen – schließ‘ mich nicht aus«
während sie wie zum Zeichen von Versöhnung oder Beruhigung ihre Hände langsam auf meine senkt.
»Es tut mir leid, Liebes, ich wollte dich nicht verletzen. Mir fällt es immer noch schwer, meine Sorgen und Ängste mit anderen zu teilen. Ich musste in meinem Leben schon immer alles alleine bewältigen. Ich hatte nie Geschwister oder Partner oder Freunde, mit denen ich reden konnte oder mit denen ich Geheimnisse teilen konnte. Ich musste mich immer nur auf mich selbst verlassen – immer allein!«
Es änderte sich alles plötzlich und ohne Vorwarnung im Heim. Ich kannte das schon. Man stellte mich immer wieder neuen Leuten vor, die mich beäugten oder mir Fragen stellten, auf die ich keine Antworten hatte.
Jedes Mal wurde ich danach von Männern in weißen Kitteln untersucht oder gefragt, ob ich mich auf meine Eltern freue.
Diese Frage erschien mir merkwürdig, denn ich kannte meine Eltern doch überhaupt nicht.
Meine Frage »Sind sie hier? Holen sie mich jetzt ab?« blieb unbeantwortet, und als meine Antwort auf das Schweigen ein schreiender Protest mit Tränen war, riss Schwester Agatha mich energisch am Arm aus dem Zimmer und brachte mich in den Schlafsaal oder manchmal in den Verschlag unter der Treppe, wo ich bleiben musste, bis ich mich "beruhigt" hatte.
Dieses Mal war alles anders. Sie erklärten mir, dass sie meine Eltern gefunden hatten, sie mich heute abholen und ich ab jetzt bei ihnen leben könnte.
Kein Heim mehr, keine Schwester Agatha, kein Verschlag oder Gitter. Das waren meine ersten Gedanken.
Mama, Papa - wer sind sie?
Würden sie mich wieder weggeben wie all die anderen?
Ich war bereits mehrmals "Eltern" übergeben worden, nur um später wieder ins Heim zurückzukehren.
Schwester Agatha brachte mich in das Besucherzimmer
»Hier sind deine Eltern.«
Sie blieb im Türrahmen, beobachtend stehen.
Es war ein Wohnzimmer, in das ich gebracht wurde.
Zwei große Sessel, ein runder Tisch, ein Schrank, ein Radio, Bücherregal, alles da. Auf dem einen Sessel saß ein Mann, der mein Vater sei. Dunkle Haare, dunkle Augen, Anzug. Neben ihm eine Frau, meine Mutter, zierlich und mit Dauerwelle, kritisch und neugierig. Ihr Gesicht erinnerte mich an Schwester Agatha.
Mein Vater beeindruckte mich mit seinem schicken Anzug und der korrekt gebundenen Krawatte.
Ich näherte mich vorsichtig. Der Mann stand auf, kam näher und ging dann vor mir auf die Knie, umarmte mich und murmelte immer wieder: »Mein Junge, mein Junge.«
Mutter legte ihre Hände auf meinen Kopf und meine Schultern, weinte und dann standen wir alle drei schluchzend und tränenüberströmt da. Es dauerte, bis die Gefühle verebbten und die Tränen aufhörten. Währenddessen stand Schwester Agatha regungslos in der Tür.
»So, Familie Wunder, sie können jetzt nach Hause fahren und den Jungen mitnehmen.«
Vielleicht hatte sie erwartet, dass ich bald ins Heim zurückkehren würde. Ich blieb misstrauisch und vorsichtig.
Vielleicht hatte sie recht? Mehrfach wurde ich schon "Eltern" übergeben, die mich später wieder ins Heim zurück gebracht haben.
»Hey, Joachim, was ist los?«, holt mich Sandra aus meinen Gedanken zurück.
»Alles gut«, antworte ich. »Ich habe nur darüber nachgedacht, warum ich immer alles alleine bewältigen will.«
»Du musst nichts alleine bewältigen, ich bin doch bei dir und will alles mit dir teilen. Du musst mir vertrauen«, dabei drückt sie meine Hand so fest, als wolle sie uns verschmelzen lassen.
Die lange Fahrt „nach Hause“ verbrachten wir im Umzugswagen, der unsere Habseligkeiten transportierte. Ich saß auf dem Schoß meines Vaters, der beruhigend auf mich einredete, bis ich einschlief.
Ich träumte von einem großen Bett und lachte, als mich zwei starke Hände immer wieder hochwarfen und auffingen.
Plötzlich ein Quietschen und Rumpeln - Stille.
Der Wagen hatte angehalten, und ich wurde rasch in ein Haus getragen. Sie legten mich in ein riesiges Bett, deckten mich mit dicken Kissen zu und ließen mich mit den Worten "Schlaf schön" allein. Ängstlich unterdrückte ich mein Schluchzen, durchnässte das Kissen mit meinen Angsttränen und schlief ein, während ich glaubte die streng riechende Schürze von Schwester Agatha in der Dunkelheit zu spüren. Es war der Wind, der eine Gardine durch das leicht gekippte Fenster hochblies und mich weckte. Mein rasendes Herz beruhigte sich langsam, denn außer meinen eigenen Atemzügen war es still in diesem Haus.
Kindheitserinnerungen
»Sandra, kannst du dir vorstellen, wie es ist, schon als Kind das Gefühl zu haben, alles alleine bewältigen zu müssen? Später, während Schulzeit und Ausbildung, selbst im Studium, fühlte ich mich stets allein gelassen und dachte, es läge daran, dass ich irgendwie besonders sei. Ich spürte und glaubte, anders, etwas Besonderes zu sein.
Die Vorfreude auf meine Einschulung erwies sich als Enttäuschung.
Eine bunte, mit Süßigkeiten gefüllte Schultüte gab es nicht.
Eine Tafel Schokolade lag an meinem Platz, als ich nach dem ersten Schultag zum Mittagessen nach Hause kam.
Unsere Nachbarin, „Oma Stecker“ belohnte mich, als ich ihr aufgeregt von meinem ersten Tag, bei Herrn Schneckenbühl – ja, der Lehrer hieß wirklich so – erzählte, mit einem dicken Riegel Schokolade mit ganzen Nüssen. Im ersten Schuljahr war ich der Klassenclown. Der Lehrstoff war für mich keine Herausforderung, weil Oma Stecker, mir bereits Lesen, Schreiben und die Grundlagen des Rechnens beigebracht hatte.«
Wir wohnten im ersten Stock und eine Etage über uns lebte Frau Stecker, eine alte Dame, wie mir meine Mutter erklärte. Der Mann von Frau Stecker war im Krieg geblieben und sie musste sich alleine durchs Leben schlagen. Ihre Kinder lebten irgendwo im Ausland und konnten sie nicht besuchen so hieß es.
Frau Stecker bekam deshalb auch nie Besuch und war die meiste Zeit alleine in ihrer kleinen Dachgeschoßwohnung.
Zu unserer Wohnung gehörte, weil es keinen Keller gab, eine Dachkammer, die direkt neben Frau Stecker Wohnung lag und in der das, was in unserer Wohnung im Moment nicht gebraucht, abgestellt wurde. Es war unvermeidlich, dass ich ihr eines Tages begegnete und kurze Zeit später fragte sie mich, ob ich Lust auf eine Tasse Kakao hätte, sie hätte gerade frischen Kakao gemacht.
Ihre Wohnung bestand aus nur zwei Zimmern, wovon, wie ich vermute, eines als Schlafzimmer diente.
Das andere Zimmer war Küche und Wohnzimmer in Einem und beeindruckte mich vor allem mit der überwältigenden Zahl der in den Regalen stehenden Bücher.
»Was sind das für Bücher?« will ich wissen..
»Sind das alles Bilderbücher mit vielen Bilder drin?« sprudele ich weiter und hätte mir am liebsten sofort eines der vermuteten Bilderbücher gegriffen.
»In einigen sind Bilder, aber es sind mehr Bücher zum Lesen« erklärt sie mir auf meine Fragen und ergänzt
»Wenn du lesen kannst, leihe ich dir gerne das eine oder andere Buch aus«.
Auf meinen enttäuschten Gesichtsausdruck folgt ein leises »Ich kann doch nicht lesen, das lerne ich doch erst, wenn ich in die Schule komme«, was Frau Stecker zu einem herzlichen
»Na, vielleicht kann ich dir helfen und du fängst schon einmal an zu lesen, dann kannst du ja vielleicht schon ehe du zur Schule kommst, in das eine andere Buch hineinschauen und merkst, wie toll Lesen sein kann.«
»Au ja« schmettere ich ihr entgegen, »wann fangen wir an?«
Angesichts meiner spontanen Reaktion ist sie mehr als überrascht und erklärt mir, während sie, ihre Tasse mit leicht zitternder Hand abstellt
»Ich werde mit deiner Mutter reden.«
Meiner Mutter war es egal und ab sofort war ich, so oft es ging bei Frau Stecker, um lesen zu lernen.
Es ging schneller als ich dachte und nach relativkurzer Zeit begriff ich Buchstaben, lernte Worte zu lesen, konnte bald kleine Sätze, größer werdende Abschnitte und schließlich ganze Seiten aus dem Buch mit dem Titel >Die Wüste lebt< selbstständig lesen.
Frau Stecker, die ich Oma Stecker nennen durfte, hatte dieses Buch sorgsam ausgesucht.
Es beschreibt die Tier- und Pflanzenwelt einer Wüste mit zahlreichen Bildern und entsprechenden Beschreibungen, die mir aufzeigten, wie sich durch Lesen völlig neue Welten erschließen.
Das erste Mal beschäftigte sich ein Mensch nur mit mir und erklärte mir die Bedeutung von etwas so, dass ich es verstehen und anwenden konnte.
Bücher, Zeitungen oder einfach nur Beschriebenes waren für mich plötzlich Dinge, die „zu mir sprechen“.
In der Zeitung gab es eine Kinderseite mit Zeichnungen, in der zwei kleine Bären verschiedene Abenteuer zu bestehen hatten.
Ich lernte deren Namen kennen und konnte ihre Erlebnisse jetzt verstehen und nicht nur mehr erahnen, wie das vorher war, als ich nur die Bildchen angucken konnte.
Wenn mein Vater, der wegen seiner Arbeit ständig „auf Montage“ war, nach zwei Wochen wieder nach Hause kam, brachte er ein dickes Magazin, den „STERN“ mit.
Der enthielt das „Sternchen“ eine lose Beilage für Kinder, die ich, solange sie es gab, gelesen habe.
Oma Stecker war eine strenge Lehrerin, die mich durch ihre Forderungen in meinen Ehrgeiz förderte und ihr verdanke ich meine bis heute erhaltene Liebe zu Büchern. In unserer Wohnung gab es keine Bücher – außer zwei Gebetbücher in der meine Mutter oft und intensiv las.
Aufgrund meiner Lesefähigkeiten und durch „Oma Steckers Schule“ war ich am Anfang meinen Klassenkameraden etwas voraus. Dies führte dazu, dass sie mich nicht mochten.
Ich wurde als Besserwisser und Streber angesehen, galt als
„schwieriges Kind“ und niemand bemühte sich darum, mein Verhalten zu ändern.
Schule enttäuschte mich zunehmend.
Die Stunden mit Herrn Schneckenbühl, empfand ich als langweilig und kindisch. Das zeigte sich schon beim Lernen des Alphabetes Ein besonderes Lern-Ereignis war die Vorstellung und Einführung des Buchstabens "B".
Sein ungewöhnlicher Unterrichtsstil verwirrte mich.
Erst malte er einen Buchstaben quietschend mit Kreide groß an die Tafel und forderte alle auf, den Buchstaben so zu benennen, wie er ihn vorlas.
„A“ ….und die Klasse blökte laut „A“!
Nachdem alle den Buchstaben nachgesprochen hatten, durften wir mit unseren Bleistiften den Buchstaben in unsere Hefte malen und er kontrollierte penibel, ob jeder seinen Buchstaben innerhalb der dafür vorgesehenen Linien gemalt hatte. Das war nun wirklich keine Aufgabe für mich und entsprechend locker schrieb, nein malte, ich meine Buchstaben in, auf und teils über die vorgesehenen Linien meines Heftes. Die anfangs freundlichen, dann aber immer energischeren Korrekturen meines Schreibstiles durch Herrn Schneckenbühl hatten nur zeitweiligen Erfolg, weil ich schon zu diesem Zeitpunkt eine zugegeben eigenwillige Handschrift entwickelte, die dazu führte, dass ich nie ein „Fleißkärtchen“ für Schönschrift erhielt.
Der Buchstabe „A“ war problemlos.
Aber bei „B“ gab`s Ärger.
Es prangte groß auf der Tafel.