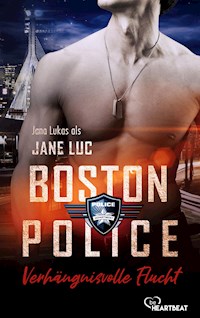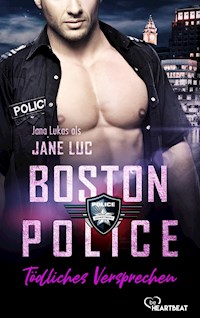
6,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hot Romantic Thrill
- Sprache: Deutsch
Detective Josh Winters liebt seinen Job beim Boston PD, seinen Hund und sein Segelboot. Was braucht ein Mann mehr? Als er nach einem Unfall in der Notaufnahme landet, lernt er die schüchterne, aber sehr attraktive Ärztin Hannah Montgomery kennen. Er setzt alles daran, die junge Ärztin aus ihrem Schneckenhaus zu holen und für sich zu gewinnen. Doch Hannah hat ein dunkles Geheimnis und schwebt in tödlicher Gefahr ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Epilog
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Detective Josh Winters liebt seinen Job beim Boston PD, seinen Hund und sein Segelboot. Was braucht ein Mann mehr? Als er nach einem Unfall in der Notaufnahme landet, lernt er die schüchterne, aber sehr attraktive Ärztin Hannah Montgomery kennen. Er setzt alles daran, die junge Ärztin aus ihrem Schneckenhaus zu holen und für sich zu gewinnen. Doch Hannah hat ein dunkles Geheimnis und schwebt in tödlicher Gefahr …
JANE LUC
BOSTONPOLICE
Tödliches Versprechen
Allen, die jeden Morgen aufstehen,um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Prolog
15. Juni 2022
Einhundertzweiunddreißig Tage im Folsom State Prison. Griffin Gordon konnte sich an jeden einzelnen dieser Tage erinnern. Sie hatten sich in seinem Gehirn festgebrannt. Die elf Jahre, die er in Corcoran verbracht hatte, waren ganz okay gewesen. Dort war er jemand, dort hatte er eine gewisse Bedeutung erlangt. Aber dann mussten diese Schweine ihn in diesen verdammten Knast voller Irrer verlegen – aus Platzmangel. Hier war er niemand. Das hatten sie ihn am ersten Tag spüren lassen.
Und an jedem der einhunderteinunddreißig Tage danach.
In Folsom bekam lebenslänglich eine neue Bedeutung. Wenn es so weiterging, war seine Lebenserwartung nicht besonders hoch. Vielleicht war das ja die Art des kalifornischen Staates, das Knast-Platz-Problem zu lösen. Man steckte die Leute einfach zu einem Haufen völlig kranker Typen, und ein paar Monate später räumte man die Leichen weg. Hurra! Platz für den Nächsten.
Griffin schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben, und erhob sich von seinem Bett. Er hatte sich immer die Option einer Flucht offengehalten. Es war eine Art doppelter Boden, eine Lebensversicherung. Bisher hatte er keinen Gebrauch davon machen müssen. Aber die Zeit schien gekommen. Lange würde er es hier drin nicht mehr aushalten.
Er schlurfte gelangweilt mit den anderen in den Fernsehraum. Wie jeden Tag würden sie irgendwelche beschissenen Klatschnachrichten von der Ostküste ansehen, bevor sie sich einen Actionfilm, eine blöde Agentenserie oder irgend so einen Mist reinzogen. Prentis stammte von der Ostküste und wollte immer wissen, was bei den Schönen und Reichen in seiner alten Heimat los war.
Griffin hatte ziemlich schnell gelernt, dass es nicht besonders clever war, Prentis zu widersprechen. Er hasste die Sendungen, die seine Mitinsassen sehen wollten, da er aber sonst nichts zu tun hatte, sah er sie sich auch an.
Er suchte sich einen Platz in der letzten Reihe des kleinen, muffigen Fernsehraums. Ein blöder Bundesrichter wurde vor einem strahlend hell erleuchteten Fünfsternehotel zu irgendeiner dämlichen Spendengala für irgendein Bostoner Krankenhaus interviewt. Die Kamera schwenkte über die anwesenden Gäste.
Und da stand sie.
Nadine!
Griffin blinzelte. Sie war da. Sie lebte!
Sein Stuhl kippte polternd um, so heftig war er aufgesprungen.
»Ruhe, Arschloch«, brüllte jemand weiter vorn.
Sie lebte.
Das konnte nicht sein. Aber da stand sie, eindeutig. Als er sie zum letzten Mal gesehen hatte, mit ihrem Blut an seinen Händen, wog sie nur noch siebenundvierzig Kilo. Das sagte zumindest der Obduktionsbericht. Ihre Haare waren raspelkurz geschnitten und schwarz gefärbt gewesen. Sie hatte weite, unförmige Klamotten getragen. Jetzt sah sie aus wie an dem Tag, an dem er sie kennengelernt hatte.
Fantastische Figur, lange Beine, weiches rotbraunes Haar, leichtes Make-up und die schmale Silberkette mit dem kleinen Blumenanhänger, die sie damals immer getragen hatte. All das steckte in einem wunderschönen bodenlangen Ballkleid, das den gleichen moosgrünen Farbton hatte wie ihre Augen.
Seine Fingerkuppen kribbelten. Er stand immer noch neben seinem umgekippten Stuhl, die Hände zu Fäusten geballt. Die erste Überraschung und seine Überwältigung wandelten sich in Hass. Langsam hob er den Stuhl auf und setzte sich. Seine Gedanken rasten.
Nadine lebte.
Er saß seit elf Jahren im Knast, verurteilt für den Mord an ihr. Und sie war nicht tot.
Am folgenden Tag kaufte sich Griffin während des Hofgangs ein Telefongespräch mit dem Handy eines anderen Insassen. Zwanzig Dollar pro Minute.
»Es ist so weit«, sagte er, als Scott Levine am anderen Ende abhob. Er musste keine Erwiderung abwarten. Scott wusste, was zu tun war. Er würde endlich seine alten Schulden begleichen können.
1. Kapitel
Zwei Wochen zuvor
»Officer am Boden.«
Nicht schon wieder, dachte Josh, bevor alles um ihn herum schwarz wurde.
Als er zu sich kam, war sein Kopf kurz davor, zu explodieren. Vorsichtig öffnete er die Augen und blinzelte in das grelle Licht, das ihn blendete. Wow. Über ihn gebeugt stand eine echte Klassefrau. »Sie sehen aus wie ein Engel. Ich muss im Himmel sein.«
»Nein, Sie leben noch.« Ihre Stimme hatte einen etwas rauen Unterton, der Josh eine Gänsehaut verursachte.
»Das ist gut«, murmelte er. Er hob die Hände, umfasste ihr Gesicht und zog sie zu einem herzhaften Kuss zu sich herunter. Ja, das tat gut. Sie schmeckte nach Engel. Ein kleiner Kuss half auf jeden Fall gegen die Schmerzen in seinem Schädel.
Die Frau befreite sich mit einer brüsken Bewegung aus seiner Umarmung. Ihr Gesicht schwebte dicht über seinem.
»Ich rechne diese Handlung Ihrem Gesundheitszustand zu«, zischte sie. »Aber wenn Sie das noch einmal probieren, nehme ich keine Rücksicht auf Ihre Verletzung und knalle Ihnen eine.« Ihre Stimme hatte noch eine Spur rauer geklungen. Sie richtete sich auf und nahm eine professionelle Haltung an.
Josh folgte ihr mit seinem Blick. Sie war groß. Ihre rotbraunen Haare waren zu einem schlichten Pferdeschwanz gebunden. Ein sehr hübscher Anblick, ebenso wie die großen dunklen Augen, deren Farbe er nicht genau erkennen konnte, weil er immer noch gegen das grelle Licht ankämpfte. Sie trug einen weißen Kittel über der typischen, etwas unförmigen grünen Krankenhauskluft. Wenn seine Vorstellungskraft ihm nicht völlig einen Strich durch die Rechnung machte, dann verbargen sich darunter Beine, die mindestens eine Meile lang waren. In ihrer Tasche steckte ein Stethoskop, also war sie vermutlich Ärztin. Sein Blick wanderte weiter. Er lag in einem kleinen Untersuchungsraum, vermutlich in der Notaufnahme eines Bostoner Krankenhauses.
Die Frau sah auf ihr Klemmbrett. »Ich bin Dr. Montgomery. Können Sie sich daran erinnern, was passiert ist, Detective?«
Josh seufzte und schloss die Augen, um dem Licht der Untersuchungslampe über sich zu entgehen. »Ja, kleiner Unfall auf dem Baseballfeld.«
»Geht das genauer?«, hakte sie nach.
»Ist das wichtig?«
»Sie waren ziemlich lange bewusstlos. Ich möchte wissen, ob sie Erinnerungslücken haben.«
Josh sah sie wieder an, hielt ihren Blick fest. Jetzt konnte er die Farbe ihrer Iris erkennen. Ein dunkles Grün, es erinnerte ihn an Moos. Faszinierend. »Freundschaftsspiel gegen das Raubdezernat. Siebentes Inning. Ich habe geworfen und McNamara, dieser Idiot, hat den Ball zu mir zurückgeschlagen und mich ausgeschaltet. Irgendein Scherzkeks vom Raubdezernat hat noch Officer am Boden gerufen. Dann war alles schwarz. So wie bei McCarty vor ein paar Jahren.«
»Der Spieler von den Oakland Athletics? Unwahrscheinlich.« Sie drehte sich um und warf einen langen Blick auf die Röntgenaufnahme seines Kopfes, die am Leuchtkasten hing. »Wir haben ihren Schädel geröntgt und ein CT gemacht, während sie bewusstlos waren. Nichts gebrochen«, erklärte sie kühl.
»Eine Frau, die sich mit Baseball auskennt.« Josh legte die Hand auf sein Herz. »Sind Sie sicher, dass Sie kein Engel sind?«
»Ich kenne mich nicht mit Baseball aus. Aber aus medizinischer Sicht waren McCartys Verletzungen und die Behandlung interessant.« Sie legte das Klemmbrett zur Seite und trat wieder neben ihn. »Öffnen Sie bitte den Mund.« Sie ließ ihn die Zunge herausstrecken und prüfte seinen Schluckreflex, bevor sie begann, ihn von der Halswirbelsäule über den Brustkorb nach unten abzutasten. Bauch, Becken, Wirbelsäule. Sie nannte das vermutlich Untersuchung. Für Josh war es eine angenehme Ablenkung von seinem pochenden Schädel.
Sie beschäftigte sich mit seinen Armen und Beinen und kehrte dann zu seinem Kopf zurück.
»Sie haben ein Hämatom und eine Platzwunde im vorderen Kopfbereich, die genäht werden muss. Ihre lange Bewusstlosigkeit spricht für eine Gehirnerschütterung.« Mit präzisen Bewegungen legte die Ärztin die Utensilien zurecht, die sie für die Behandlung brauchen würde. »Weitere Verletzungen hat ihr Sturz offenbar nicht verursacht. Wann wurden Sie zum letzten Mal gegen Tetanus geim…«
Laute Stimmen schallten vom Gang in den Behandlungsraum, bevor die Tür aufgerissen wurde und eine Frau hereinwirbelte. »Dr. Montgomery, ich muss Sie sprechen.«
Eine Schwester rannte hinter ihr her. »Sie dürfen hier nicht …«
»Ist schon gut, Schwester Louisa, ich kümmere mich darum.« Die Ärztin richtete sich zu ihrer vollen Größe auf und blickte auf die kleinere Frau. »Sie können nicht einfach in eine Behandlung hineinplatzen, Mrs Winters. Verlassen Sie bitte den Raum.«
Josh seufzte und verdrehte die Augen, was eine neue Welle des Schmerzes durch sein Gehirn jagte. Heute blieb ihm aber auch nichts erspart. »Hallo Mom.«
Die kleine Frau mit dem perfekten, kinnlangen Bob und dem adretten Kostüm fuhr herum und starrte ihn mit aufgerissenen Augen an. Sie öffnete den Mund, sagte aber keinen Ton. Ihre Hand glitt an den Hals. Dann fand sie ihre Stimme wieder. »Josh, oh mein Gott, Joshua. Wurdest du wieder getroffen?«
»Ja, von einem verdammten Baseball.«
Seine Mutter ließ sich schwer auf einen Stuhl sinken.
Von einer Sekunde auf die andere sah man ihr jedes einzelne ihrer siebenundfünfzig Jahre an.
»Sie sind seine Mutter?« Die Ärztin stemmte die Hände in die Hüften. Sie war offensichtlich nicht begeistert über die Stürmung ihres Behandlungsraums.
»Ja.« Seine Mutter nickte, wirkte aber, als ob sie ein wenig unter Schock stand. »Was ist passiert, Josh?«
»Ein Baseballspiel gegen das Raubdezernat. Ich bin schon wieder fast wie neu.«
Sie seufzte und legte wieder die Hand an ihren Hals. »Wie soll ich das nur deinem Vater erklären? Ist er schwer verletzt, Dr. Montgomery?«
»Mrs Winters, ich muss Sie wirklich bitten, draußen zu warten.«
Josh winkte ab. »Lassen Sie sie hier. Sie wird ja doch keine Ruhe geben, wenn Sie sie rauswerfen.«
Der Blick der Ärztin glitt zwischen Mutter und Sohn hin und her. »Von mir aus. Aber verhalten Sie sich bitte ruhig.«
»Wie schwer ist er verletzt?«, wollte Joshs Mutter noch einmal wissen.
»Nicht besonders schwer. Eine Platzwunde im vorderen Kopfbereich und wahrscheinlich ein etwas angekratztes männliches Ego. Die Vitalparameter sind in Ordnung. Neurologische Störungen kann ich keine feststellen. Ihr Sohn war verhältnismäßig lange bewusstlos und hat eine Gehirnerschütterung.« Sie wandte sich an Josh. »Ich muss einen Teil Ihrer Haare abrasieren, dann werde ich die Wunde lokal betäuben, desinfizieren und nähen.«
Er nickte ergeben. Wenn sie sich über sein Gesicht beugte, konnte er noch einmal diesen angenehmen Duft einatmen, der von ihr ausging. Und die Sommersprossen auf ihrer Nase zählen.
Seine Mutter griff nach seiner Hand und drückte sie aufmunternd. Er konnte davon ausgehen, dass sie die Ärztin mit Argusaugen überwachen würde. »Du bist bei Dr. Montgomery in guten Händen. Sie hat mich letztes Jahr behandelt, als ich diese kleine Unpässlichkeit hatte.«
Das brachte Josh trotz seiner Schmerzen zum Grinsen.
Nur Kathreen Winters kam auf die Idee, einen Schlaganfall, wenn auch einen leichten, als Unpässlichkeit zu bezeichnen.
»Sie ist die Beste«, fuhr seine Mutter fort. »Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich hier bin, Doktor. Sie müssen unbedingt zu der Spendengala kommen, die ich für das St. Josephs Hospital organisiere. Versprechen Sie mir das.«
Die Ärztin blickte nicht von Joshs Verletzung auf. »Ich werde kommen.« Behände setzte sie den nächsten Knoten.
Josh ertrug das Nähen. Als sie ihm eine Tetanusspritze verpasste, kniff er die Augen zusammen. Er wartete, bis sie ihm einen leichten Verband angelegt hatte, dann setzte er sich vorsichtig auf. Ihm war schwindlig. Er war sich nicht sicher, ob das von McNamaras schiefgegangenem Schlag herrührte oder von Dr. Montgomerys betörendem Duft.
Kurz überlegte er, ob er sich neben der Behandlungsliege übergeben sollte, bekam den Brechreiz aber wieder in den Griff. Er ließ die Ärztin nicht aus den Augen, während sie das Untersuchungszimmer aufräumte. Als sie fertig war, hatte Josh genug Kraft gesammelt, mit seiner nervös plappernden Mutter den Raum zu verlassen.
»Wo wollen Sie hin?«
»Nach Hause«, sagte er das Offensichtliche.
»Auf keinen Fall.« Sie stemmte die Hände in die Hüften und bedachte ihn mit einem Blick, den sie vermutlich für nervtötende Patienten reserviert hatte. »Setzen Sie sich wieder hin, Detective. Sie müssen die Nacht über zur Beobachtung hierbleiben.«
»Ich bin fit wie ein Turnschuh. Ich gehe nach Hause.« Josh hatte bereits viel zu viele Nächte in Krankenhäusern verbracht. Er würde nicht hierbleiben, solange er auf seinen eigenen Beinen hinauslaufen konnte.
»Seien Sie vernünftig …«
»Nein. Ich vermute, ich muss irgendetwas unterschreiben. Also geben Sie schon her.«
Sie seufzte und füllte auf ihrem Klemmbrett ein Formular aus, das sie ihm zum Unterschreiben hinhielt.
Mit etwas zittriger Hand setzte er seinen Namen auf die gestrichelte Linie und verließ das Zimmer.
»Ich fahr dich nach Hause«, entschied seine Mutter. Sie hakte sich bei ihm unter, wahrscheinlich weniger, um ihn zu stützen als sich vor dem Einknicken ihrer Knie zu bewahren. Er wusste, wie schwer es für sie war, ihn in einem Krankenhaus liegen zu sehen. Eine Schussverletzung vor ein paar Jahren, nach der sein Leben eine Zeit lang am seidenen Faden hing, hatte seine Familie viel Kraft gekostet. Ihre Angst kam nicht von ungefähr.
Josh warf einen Blick auf seinen Partner, der im Flur an der Wand lehnte. »Nicht nötig, Mom. Du erinnerst dich an Detective Coleman?«
»Ma’am.« Sein Partner reichte seiner Mutter die Hand.
»Dom wird mich nach Hause fahren. Mach dir keine Sorgen.«
Die Ärztin reichte Josh ein Rezept. »Das ist für die Kopfschmerzen. Bleiben Sie heute Nacht nicht allein. Alle zwei oder drei Stunden sollte jemand nach Ihnen sehen. Wenn alles in Ordnung ist, brauchen Sie erst zum Fädenziehen wiederzukommen. Ansonsten melden Sie sich morgen noch einmal.« Nachdem Josh das Rezept für die Kopfschmerztabletten entgegengenommen hatte, drehte sich Dr. Montgomery um und rauschte davon. Er sah ihrem wehenden Kittel und dem wippenden Pferdeschwanz hinterher. »Mom«, sagte er. »Besorg mir eine Karte für diese Spendengala.«
»Was? Aber du gehst nie auf solche Veranstaltungen.«
Josh erhaschte einen letzten Blick auf die Frau mit dem roten Pferdeschwanz, bevor sie um die Ecke verschwand. »Zu dieser werde ich gehen.«
2. Kapitel
17. Juni 2022
In der Nacht vor seinem Ausbruch aus dem FolsomState Prison war Griffin Gordon mit seinen Gedanken bei Nadine.
Der Plan für seine Flucht stand seit langer Zeit fest und würde funktionieren. So konnte er sich vollkommen auf Nadine konzentrieren. Im Laufe der Jahre war ihr Bild in seinem Kopf zu einer unscharfen Sepiaaufnahme verblasst. Nun, da er sie lebendig vor sich gesehen hatte, kamen die Farben zurück und explodierten in einem bunten Kaleidoskop. Sie war zu ihm zurückgekehrt, in ihrer ganzen Schönheit.
Als die morgendliche Sirene durch die Gänge hallte, erhob er sich so ruhig und gelassen wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Er wartete, bis sich die Zellentür mit einem metallischen Klicken öffnete und er mit den anderen Haftinsassen in den großen Speisesaal marschieren konnte. Er setzte sich an den Platz, an dem er jedes Frühstück, Mittagessen und Abendbrot eingenommen hatte, seit er in Folsom saß. Es dauerte immer ein paar Minuten, bis Ruhe einkehrte, bis das Scharren der Füße und Rücken der Stühle nachließ. Griffin konnte Lärm beim Essen nicht ausstehen. Er wartete geduldig. Als es ruhiger geworden war, bestrich er eine Scheibe Toastbrot dick mit Erdnussbutter. Das erste Erdnussbutterbrot, das er sich seit über elf Jahren gönnte. Beherzt biss er zu. Wie erwartet hatte er innerhalb kürzester Zeit die Aufmerksamkeit seiner Tischnachbarn.
»Hey, Gordon! Was ist los?«
»Was soll sein?«
»Sieh dir dein Gesicht an, Alter!«
Griffin fuhr sich über das Gesicht, spürte die Schwellung seiner Wangen. Die Haut spannte sich bereits unangenehm. Er litt seit seiner Kindheit an Anaphylaxie, einer allergischen Reaktion, in seinem Fall auf Erdnüsse. Als er zum ersten Mal in seinem Leben Erdnüsse gegessen hatte, hatte er genau zwei Dinge festgestellt. Zum einen, dass ihm noch nie etwas so gut geschmeckt hatte, und zum anderen, dass er sich bereits nach dem ersten Bissen in ein Monster verwandelte. Sein Gesicht und sein Hals schwollen an, er bekam am ganzen Körper Hautausschlag und eine leichte Atemnot. Das hatte ihm schon als Kind den Spitznamen Ork eingebracht. Er hatte wirklich zum Fürchten ausgesehen.
Wenn er seine Medikamente gegen die Allergie einnahm, ging es ihm ruckzuck wieder besser. Nur die Schwellungen in seinem Gesicht verschwanden nicht so schnell.
Aber er hatte die Finger nicht von den Nüssen lassen können und sich im Laufe der Jahre immunisiert. Bei jedem seiner Versuche hatte er ein wenig mehr gegessen.
Die Symptome hatten sich mit der Zeit verbessert, er hatte keine Atemnot mehr verspürt, die Ausschläge waren zurückgegangen. Nur die Schwellungen im Gesicht konnte er nicht umgehen. Doch das war ihm auch egal.
Ein weiterer Häftling wurde auf ihn aufmerksam, stieß seinen Nachbarn an. »Scheiße, sieh dir sein Gesicht an. Hey, Wärter! Wärter!«
Griffin nahm aus den Augenwinkeln wahr, wie einer der Aufseher auf ihren Tisch zuhielt. Es wurde Zeit für eine kleine Showeinlage. »Es ist heiß hier drin, oder?«, murmelte er.
Er öffnete die obersten Knöpfe seines Overalls, zog ihn vom Hals weg und fächelte sich Luft zu. »Es ist wirklich heiß.«
»Willst du dich hinlegen, Mann?«, fragte jemand.
Er schloss die Augen und schwankte. »Das wäre vielleicht besser. Mir ist irgendwie schwindlig.« Er keuchte ein wenig und hustete. Dann schnappte er nach Atem und wedelte panisch mit den Händen. »Keine Luft«, brachte er gequält heraus. Starke Hände drückten ihn auf die Bank und hielten ihn fest, bis wenige Minuten später zwei Wärter mit einer Trage auftauchten. Griffin konzentrierte sich weiter darauf, Atemnot zu simulieren. Er hatte seine Allergie bei der ersten Untersuchung durch den Gefängnisarzt vor elf Jahren nicht angegeben. Schon damals hatte er darüber nachgedacht, eines Tages mithilfe eines vorgetäuschten anaphylaktischen Schocks zu fliehen. Bis vor ein paar Tagen hatte er keinen Grund zur Flucht gehabt, denn das Einzige, was ihn interessiert hatte, Nadine, war tot. Jetzt sahen die Dinge anders aus.
Niemand wusste, dass lediglich sein Kopf und sein Hals grotesk anschwollen. Atemnot und Bewusstlosigkeit konnte er problemlos vortäuschen. Das kaufte ihm jeder ab. Wer aussah wie er und darüber klagte, keine Luft zu bekommen, wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert – die beste Möglichkeit, zu türmen.
Sein einziges Problem war, dass er seit elf Jahren keine Erdnüsse mehr gegessen hatte und nicht sicher sagen konnte, wie sein Körper mittlerweile mit der Allergie umging. Funktionierte die Immunisierung noch, oder brachte er sich in Lebensgefahr? Er wusste es nicht; aber eine risikofreie Flucht gab es eben nicht.
Es geschah genau das, was er erwartet hatte. Man brachte ihn auf die Krankenstation, spritzte ihm einen Histaminblocker und wühlte hektisch in seiner Krankenakte, um den Grund für den anaphylaktischen Schock zu ermitteln. Aber es war nichts zu finden. Also zogen sie ihm eine Sauerstoffmaske über und riefen einen Rettungswagen.
Der Sanitäter, der kurz darauf seinen Blutdruck und Puls maß, gab ein unbestimmtes »Hm« von sich.
»Was ist?«, wollte der Aufseher wissen, der in der kleinen Krankenstation Wache stand.
»Er müsste eigentlich einen niedrigeren Blutdruck und Herzrasen haben.«
Der Wachmann schwieg einen Moment.
Griffin kannte ihn. Er war ein alter Hund, der wahrscheinlich schon Sachen gesehen hatte, über die er nicht einmal nachdenken wollte. Seinen Blutdruck konnte er nicht beeinflussen, aber sein Herz raste vor Aufregung – und vor Vorfreude auf Nadine – wie nach einem Hundertmetersprint. Reichte das nicht?
»Das Ganze ist doch nicht vorgetäuscht, oder?«
Griffin hielt die Augen geschlossen. Er spürte, wie sich der Aufseher über die Liege beugte. Wahrscheinlich beäugte er ihn misstrauisch und neugierig. Heute Abend würde er seiner Frau beim Essen erzählen, wie einer der Knackis zu einem dieser widerlichen Viecher aus Herr der Ringe mutiert war.
»Sieht das für Sie vorgetäuscht aus?«, entgegnete der Sanitäter gereizt. »Er muss so schnell wie möglich in eine Klinik. Joseph, mach eine Ladung Prednisolon klar«, wies er seinen Kollegen an. Dann wandte er sich an den Gefängnissanitäter. »Haben Sie eine Ahnung, was den Schock ausgelöst hat?«
»Nein. Ein paar der Männer sagen, er hat ein Erdnussbutter-Sandwich gegessen. In seiner Akte steht nichts von einer Allergie.«
»Okay. Wir geben ihm Adrenalin über die Atemmaske, dann wird das mit dem Luftholen bald besser. Aber wir müssen ihn auf jeden Fall mitnehmen. Solange wir nicht wissen, was die Allergie ausgelöst hat, schwebt er in Lebensgefahr.«
Griffins Herzschlag nahm noch mehr Geschwindigkeit auf. Er war nicht sicher, ob das an dem Adrenalin lag, das nun gemeinsam mit dem Sauerstoff in seine Lungen strömte. Vielleicht auch an dem Wissen, dass seine Flucht so gut wie geglückt war. Sie hoben ihn auf eine andere Trage und schoben ihn in den Rettungswagen. Einer der Sanitäter kletterte in die Fahrerkabine, der andere stieg mit einem Wachmann hinter ihm ein. Seine Hand wurde mit einer Handschelle an die Trage gefesselt, bevor sie mit heulenden Sirenen losjagten.
Griffin wusste nicht, in welches Krankenhaus sie ihn brachten. Es war ihm auch egal. Scott Levine würde auf der Straße nach Folsom auf ihn warten.
Es dauerte nur etwa zehn Minuten, bis der Rettungswagen mit quietschenden Bremsen zum Stehen kam.
»Was zum Teufel …« Noch bevor der Wachmann seinen Satz beendete, wurde die hintere Tür aufgerissen. Sein alter Zellenkumpel Scott trieb den Fahrer des Rettungswagens vor sich her und zielte mit einer SIG Sauer in die Runde. »Alle Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du da …« Er wedelte mit seiner Waffe in Richtung des Wachmanns. »Die Knarre vorsichtig auf den Boden legen.«
Er wartete, bis der Mann seiner Aufforderung nachkam.
»Und jetzt mit dem Fuß zu mir schieben.« Erst, als die Waffe sicher in seinem Hosenbund steckte, reichte er dem Fahrer des Rettungswagens zwei Paar Handschellen. »Gib eine deinem Kumpel. Fesselt euch an den Griff da drüben. Und du«, forderte er den Wachmann auf. »Nimm deine eigene Fessel und mach dich da hinten fest.«
Als alle stumm seinen Anweisungen gefolgt waren, warf er Griffin einen Blick zu. »Scheiße Alter, du hast nicht übertrieben. Dein Gesicht sieht verdammt mies aus.«
»Quatsch nicht. Mach mich los.« Mit der linken Hand fing er den Schlüssel auf, den Scott ihm zuwarf. Er löste seine Fessel von der Trage, trat neben Scott und nahm ihm die Pistole ab. »Hast du alles, was ich brauche?«, wollte er wissen.
»Ja klar. Geld. Klamotten. Perücke. Alles im Wagen.«
»Wunderbar.« Ohne mit der Wimper zu zucken, zielte Griffin auf den Wachmann und jagte ihm eine Kugel in den Kopf. Noch bevor Scott etwas sagen konnte, wiederholte er die Prozedur bei den beiden Sanitätern.
In den Nachhall des letzten Schusses hinein hörte er Scotts entsetztes Aufkeuchen. »Was soll das, Alter? Das war nicht abgesprochen.« Erschrocken fuhr er zu ihm herum. »Bist du wahnsinnig?«
»Nein. Auf einer Mission.« Er hob die Waffe und jagte auch ihm eine Kugel in den Kopf. Das Töten lag nicht in seinem Wesen, doch er musste konsequent sein. Er brauchte eine Chance, sich zu Nadine durchzuschlagen. Mit vier Überlebenden in einem Rettungswagen würde es am Ende einer schaffen, Hilfe zu rufen und seine Flucht zu vereiteln. Immer noch aufgeputscht vom Adrenalin, verließ er das Fahrzeug. Die Aktion hatte vermutlich nicht länger als drei Minuten gedauert. Er ging zu Scotts Wagen, der quer auf der Straße stand, zog das auffällig orangefarbene Oberteil seiner Gefängniskleidung herunter und setzte sich hinter das Steuer.
Wahrscheinlich würde die Polizei trotz allem nicht lange brauchen, um herauszufinden, was geschehen war. Doch bis sie sich auf die Suche nach ihm machten, wäre er hoffentlich längst über alle Berge.
Griffin ließ sich Zeit auf dem Weg an die Ostküste. Scott hatte ihm einen Lieferwagen besorgt und mit gefälschten Papieren in einer alten Scheune versteckt. Sie hatten für ein paar Jahre die Zelle geteilt und Griffin hatte Scott bei einer Messerstecherei mehr oder weniger zufällig das Leben gerettet. Ob mit Absicht oder nicht, Scott hatte seitdem in seiner Schuld gestanden und sich bereit erklärt, ihm bei seiner Flucht zu helfen, wenn es so weit war. Für das Fahrzeug und die Papiere war er in Vorkasse gegangen. Griffin hatte ihm versichert, das Geld zurückzuzahlen, sobald er an sein geheimes Depot herankam. Dass er Scott erledigte, bevor er sich zu seinem Geldbunker in Stanford durchschlug, war eine praktische Entscheidung gewesen. Er konnte sein Erspartes ausgraben und den gesamten Betrag für seine Mission einsetzen. Für das Aufspüren und die Überwachung Nadines würde er sicher viel Geld benötigen. In den vergangenen elf Jahren hatte sich die Technik weiterentwickelt, also war sie auch teurer geworden. Sein Geld hatte in dem Erdbunker nicht gerade Zinsen eingebracht. Er konnte froh sein, es noch unter den alten Eichen zu finden, trocken und ohne Schimmelflecke.
Während er im Verborgenen reiste, verfolgte er die Jagd auf ihn im Internet. Sie konzentrierten sich auf Kalifornien und die mexikanische Grenze.
Perfekt.
Niemand kam auf die Idee, ihn in Boston zu suchen.
Jetzt saß er in dem schäbigen kleinen Diner, das Nadines Haus gegenüberlag, und wartete auf sie. Sie wohnte nicht gerade in der besten Gegend. Das hatte er zwar nicht erwartet, doch für seine Zwecke war es geradezu perfekt.
Es erleichterte ihm das Herumlungern in ihrer Nähe. Hier würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, die Cops zu rufen, weil er in ihm einen entflohenen Straftäter erkannt hatte.
Griffin nippte an dem grottenschlechten Kaffee und trommelte mit seiner rechten Hand auf dem zerkratzten, fleckigen Resopal der Tischplatte herum. Sie musste bald kommen. Jedes Mal, wenn sich die Haustür öffnete, setzte sein Herz einen Schlag aus, bevor es mit doppelter Geschwindigkeit weiterjagte. Sie musste jeden Moment kommen. Ihre Schicht begann bald.
Er nippte noch einmal an dem Kaffee und bemühte sich, das Gesicht nicht zu verziehen. Die Gegend war zwar etwas zwielichtig, auffallen wollte er aber trotzdem nicht. Zumindest nicht, indem er die lauwarme Brühe, die seine Geschmacksnerven strapazierte, auf den dreckigen Tisch spuckte.
Da war sie! In Jeans und einem sommerlichen Top trat sie aus dem Haus und lief in Richtung U-Bahn. Er legte ein paar Dollarscheine auf den Tisch und hängte sich an ihre Fersen. Die Jeans brachte ihre langen Beine perfekt zur Geltung. Diese ellenlangen Beine hatte er schon immer am meisten an ihr gemocht. Ihren wippenden Pferdeschwanz hingegen weniger. Am liebsten sah er es, wenn ihr rotbraunes Haar in einem offenen Vorhang über ihren Rücken fiel, wie sie es bei ihrer ersten Begegnung getragen hatte. Bald, sagte er sich, bald würde sie sich genauso kleiden und herrichten, wie er es wollte.
Er genoss es, ihr zu folgen. Das altbekannte Kribbeln in seinen Fingerspitzen setzte wieder ein. Als er sie im Fernsehen gesehen hatte, hatte er es zunächst nicht glauben können. Hier, wenige Schritte hinter ihr, fühlte er sich so lebendig wie seit elf Jahren nicht mehr.
Er wartete mit ihr auf die U-Bahn und setzte sich zwei Sitzreihen hinter sie. Sie hatte Kopfhörer in den Ohren und wippte mit dem Fuß im Takt. Ob sie noch auf Bruno Mars und Katy Perry stand wie vor ihrer angeblichen Ermordung?
Er stieg mit ihr aus und folgte ihr zum St. Josephs Hospital. Es war aufregend und belebend, ihr zu folgen. Einmal näherte er sich ihr so weit, dass er die Härchen in ihrem Nacken erkennen konnte. Er nahm ihren Duft wahr.
Sie roch anders als früher. Die Vorfreude wuchs. Nadine und er würden sich völlig neu kennenlernen, neue Facetten aneinander entdecken. Noch einmal näherte er sich ihr im Strom der Berufstätigen, die an ihre Arbeitsstellen hasteten, bis auf einen Meter. Es wäre ein Genuss, wenn sie sich jetzt umdrehen und ihn erkennen würde. Die Angst und die Panik, die plötzlich in ihren Augen aufleuchten würden, wären unbezahlbar. Das würde ihn zumindest ein wenig für die vergangenen elf Jahre entschädigen, besonders für die beschissenen letzten Monate in Folsom.
Aber im Moment würde sie ihn nicht erkennen. Mit seiner mausbraunen Perücke mit Seitenscheitel, dem Schnauzbart und den Silikoneinlagen, mit denen er seine Wangen auspolsterte, war er der Inbegriff des unscheinbaren Hausmeistertypen. Die schlichte Kleidung und der Bodysuit, der ihn um die Mitte herum ein wenig fülliger wirken ließ, taten ihr Übriges, ihm einen unentdeckten Aufenthalt in ihrer Nähe zu ermöglichen. Nach so vielen Jahren ohne sie wollte er ihre Gesellschaft noch ein wenig genießen, bevor er entschied, was mit ihr geschehen sollte.
Er ließ sich ein wenig zurückfallen und wartete, bis Nadine durch den Personaleingang in dem Krankenhaus verschwand, in dem sie jetzt arbeitete. Zufrieden machte er sich auf den Rückweg. Es gab viel zu planen. Er hatte sie wiedergefunden. Nadine Montgomery würde ihm kein zweites Mal entwischen.
Oktober 2009
Das Peaches war eine Bar nach Griffins Geschmack. Sie lag in Campusnähe und zog die Studenten an wie das Licht die Motten. Die Drinks waren billig, das Essen fettig und die Musik laut. Freitags spielten Studentenbands, die darauf hofften, irgendwann entdeckt zu werden, was nie passieren würde, denn sie waren durch die Bank weg schlecht. Eine Qual für die Ohren. Der Stimmung im Peaches schadete es nicht.
Griffin stieß die Tür der Bar auf und wurde von einer kreischenden E-Gitarre und warmer, nach Bier riechender Luft empfangen. Er rieb sich die Hände und warf einen Blick in die Menge. Draußen war es für Oktober schon ziemlich kalt, und er hatte seine Jacke im Wagen gelassen. Doch hier drin würde ihm ruckzuck warm werden.
Der Laden war gerammelt voll. Studentinnen, die deutlich zu wenig trugen, bedachte man die Kälte, die draußen herrschte, hüpften auf der winzigen Tanzfläche herum oder rieben sich an den Männern, besser Jungs, um deren Aufmerksamkeit zu erregen. Eine Menge Typen würde heute Abend das Glück haben, eine ihrer Kommilitoninnen flachzulegen. Vielleicht suchte er sich später auch eine aus. Aber jetzt war es Zeit für ein Bier und ein Glas guten Whiskey. Er bahnte sich einen Weg durch die Menge und stellte zufrieden fest, dass die Studenten seines Shakespeare-Kurses einen Tisch ergattert hatten, an dem ein Platz für ihn frei war.
Griffin lag mit seinen achtundzwanzig Jahren deutlich über dem Altersdurchschnitt der anderen Gäste. Aber er konnte sich nicht dagegen wehren. Er liebte das College, er liebte den Campus, das Studentenleben. Auch wenn er diesem eigentlich längst entwachsen sein müsste. Er hatte nicht ewig studieren können, auch wenn es jede Menge Studienrichtungen gab, in die er sich gern eingeschrieben hätte. Sein Studentenfonds reichte dafür nicht aus. Also war er den Weg gegangen, der dem Studentenleben am nächsten lag. Er war Dozent geworden. Professor für englische Literatur. Nicht etwa, weil ihm die Literatur besonders am Herzen lag, sondern weil er dieses Fach unterrichten konnte, ohne sich großartig anstrengen zu müssen.
Er hielt auf den Tisch seiner Studenten zu und hob grüßend die Hand. Sie winkten ihm ausgelassen. Er war spät dran. Wahrscheinlich hatten sie schon ein paar Bier intus. Zumindest erweckte Becky Masterson den Eindruck. Sie betete ihn noch offener an als sonst und schielte ein klein wenig. Oh ja, sie war mit Sicherheit mehr als nur angetrunken. Leichte Beute. Aber er hielt sich an den einzigen Grundsatz, den er sich für sein Leben am College auferlegt hatte. Er schlief nicht mit den Studentinnen aus seinem Kurs. Niemals. Wenn er das tat, wäre Ärger vorprogrammiert. Wie es das Leben wollte, waren es ausgerechnet die Mädchen in seinen Studiengruppen, die ihn am meisten anhimmelten. Aber er blieb eisern. Auch wenn es ihm manchmal eine geradezu stählerne Selbstbeherrschung abverlangte. Er wusste, dass er gut aussah. Sein Professorentitel war natürlich auch nicht gerade von Nachteil. Die Frauen lagen ihm zu Füßen und er genoss es, von ihnen bewundert zu werden. Mehr als eine hatte sich ihr jungfräuliches Dasein von ihm beenden lassen.
Er vögelte sie meist nur einmal. Nur zwei- oder dreimal hatte er mehr als eine Nacht mit einer Studentin verbracht. Das lag aber lediglich an ein paar besonders ausgefallenen, in einem Fall sogar spektakulären Fähigkeiten, über die die Damen verfügt hatten. Sicher, es gab auch Tränen und Dramen, wenn sie nach einer Nacht begriffen, dass die Beziehung schon wieder vorbei war. Zweimal war sogar eine Abtreibung notwendig geworden. Aber er saß am längeren Hebel. Wenn die Frauen begannen, ihm Stress zu machen, drohte er ihnen, sie vom College werfen zu lassen. Er hatte nicht die Macht dazu. Aber die Emotionen einer Frau, die sich betrogen und verlassen fühlte, vernebelten ihr das Gehirn. Das machte es ihm leicht, sie zu manipulieren.
Er schüttelte jedem seiner Studenten am Tisch die Hand und setzte sich. So sehr ihn die Frauen anbeteten, bewunderten ihn die männlichen Studenten. Was kein Wunder war. Die meisten hielten ihn für den Inbegriff der Coolness. Er kleidete sich ausgesprochen modisch, sein Haarschnitt unterschied sich nicht von dem der Zwanzigjährigen. Seine Vorlesungen waren beliebt und seine Seminargruppen immer voll. Klar, schließlich erreichte man bei ihm leicht seinen Abschluss. Und welcher der alten, angestaubten Professoren diskutierte Shakespeares Sonette mit den Studenten in einer Bar?
Der einzige Wermutstropfen seines Lebens war der fehlende Doktortitel. In seinem Fachbereich hatten alle promoviert. Nur er nicht. Dieses Jahr würde er sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Sein Dekan hatte bereits angedeutet, dass er das erwartete, wenn er weiter in Stanford bleiben wollte. Er musste nur noch ein Thema finden, mit dem er seinen Doktor erlangen konnte, ohne viel Zeit und Energie zu investieren.
Er dachte noch einen Moment darüber nach, wie er an ein möglichst einfaches Promotionsthema gelangen konnte, als die Kellnerin, die einer seiner Schüler herangewinkt hatte, auf ihren Tisch zukam.
Er blickte auf, und …
Bumm. Sein Herz blieb stehen.
Oder setzte zumindest einen Schlag aus. Genau wusste er es nicht. Auf einmal fühlte er sich taub, und die Welt um ihn herum schien in Watte zu versinken. Aus den Augenwinkeln konnte er erkennen, dass einer der Studenten etwas zu ihm sagte, aber er verstand ihn nicht. Er konnte seinen Blick nicht von der Kellnerin lassen, die auf ihn zu lief, nein, tänzelte traf es eher. Sie war groß und schlank.
Ihre Glieder erinnerten ihn an frische grüne Weidenruten.
Biegsam, aber voller Spannung und Energie. Sie bewegte sich im Takt der Musik durch die Studentenschar. Ihr Haar war ein langer, rotbrauner Vorhang, der bis über die Mitte ihres Rückens fiel, und ihre Augen waren von einem ungewöhnlichen Grün, wie er es noch nie gesehen hatte.
Wie saftig grünes Moos nach einem Regenguss. Dunkel und geheimnisvoll. Mit einem strahlenden Lächeln blieb sie vor ihm stehen, um seine Bestellung aufzunehmen. Sie beugte sich ein wenig zu ihm herunter, damit sie ihn über den Lärm hinweg besser verstehen konnte. Ihr Duft traf ihn wie ein Faustschlag, sanft aber unnachgiebig. Sie roch frisch, fast ein wenig unschuldig. Ein Geruch, der perfekt zu ihrem Wesen passte.
Griffins Gehirn war noch in der Lage, ein Bier und ein Glas Whiskey bei ihr zu bestellen. Sie lächelte breit, ließ ihn mit ihrer etwas rauchigen Stimme wissen, dass sie gleich zurück war, und drehte ihm ihren knackigen Hintern zu. Er blickte ihr nach, folgte ihren Schritten in den schmalen Jeans und dem hautengen Top, bis sie in der Studentenmeute verschwunden war.
Sie war neu hier, er hatte sie noch nie zuvor gesehen.
›Nadine‹ stand auf dem kleinen Namensschild am linken Spaghettiträger ihres Oberteils.
Da saß er, in einer Studentenbar, zusammen mit seinen Studenten, und hatte einen verdammten Ständer.
3. Kapitel
»Ich muss noch kurz ins St. Josephs«, sagte Josh.
Dominic verdrehte auf dem Beifahrersitz die Augen. »Lass mich raten, was es diesmal ist. Ein merkwürdiges Pochen unter dem Narbengewebe?«
Josh nahm die Augen nicht von der Straße. Der Verkehr war zu dicht, um sich die Zeit nehmen zu können, seinem Partner einen bösen Blick zuzuwerfen. »Es ist ein Juckreiz. Wirklich sehr unangenehm.«
Dominic schüttelte den Kopf und trank einen Schluck aus seinem Kaffeebecher. »Oh Mann, frag sie doch einfach, ob sie mit dir ausgeht.«
»Hab ich.« Josh fuhr sich mit der Hand über seine stoppelkurzen Haare. Dominic hatte nach seinem Baseballunfall darauf bestanden, dass er die Nacht bei ihm verbrachte. Er hatte ihn mit nach Hause genommen, und seine Frau Elena hatte ihm den Rest seiner Locken abgeschnitten und ihm schließlich den Kopf rasiert. Der Unfall lag vier Wochen zurück. Mittlerweile sah er aus wie ein verdammter Marine mit den kurzen blonden Stoppeln. »Aber sie will nicht. Wahrscheinlich mag sie meine Haare nicht.«
»Wahrscheinlich mag sie dich nicht«, brummte sein Partner auf dem Beifahrersitz.
Dominic irrte sich. Josh hätte Dr. Hannah Montgomery nach der Spendengala nicht so küssen können, wie er es getan hatte, wenn sie ihn nicht mögen würde. Er hatte sich tatsächlich in einen Smoking gequält und war zu dieser Veranstaltung gegangen. Durch einen kleinen Trick hatte er sich den Platz neben ihr gesichert. Er hatte mit ihr getanzt. Versucht, mit ihr zu flirten. Und als sie gehen wollte, hatte er darauf bestanden, sie nach Hause zu fahren.
Starrköpfig, wie sie war, hatte sie abgelehnt und ein Taxi angehalten.
Sie hatte bereits die Wagentür geöffnet, als Josh den Fahrer bat, kurz zu warten und sie ein letztes Mal an sich zog. Sie war in seine Arme gesunken, ihre Lider hatten sich gesenkt. Selbst wenn Josh es gewollt hätte, hätte er ihr in diesem Moment nicht widerstehen können. Ohne zu zögern, hatten seine Lippen ihre gefunden. Ihr Geschmack hatte ihn nicht mehr losgelassen, seit er sie, halb bewusstlos, im Krankenhaus geküsst hatte. Er wollte sich ihr nicht aufzwingen, gab ihr die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Doch sie widerstand ihm nur den Bruchteil einer Sekunde, dann erwiderte sie den Kuss mit einer überwältigenden Leidenschaft. Oh ja, davon wollte er mehr. Er hatte den Kuss vertieft, sie noch näher an sich gezogen. Sie schmiegte sich in seine Arme, als gehöre sie genau dort hin. Erst das ungeduldige Hupen des Taxifahrers hatte sie in die Wirklichkeit zurückgeholt.
»Soll ich das Taxameter schon mal laufen lassen, oder was? Ich verdiene mein Geld nicht durchs Rumstehen«, bellte er vom Fahrersitz. Hannah hatte geblinzelt, sich aus seinen Armen gelöst und war mit einem »Gute Nacht« im Fond des Wagens verschwunden.
Seit dieser Nacht gab sie sich ihm gegenüber unnahbar. Sie reagierte nicht auf seine Anrufe. Die regelmäßigen Besuche im St. Josephs waren seine einzige Chance, sie zu sehen. Zwischen ihnen war etwas. Das spürte er deutlich.
Und sie fühlte es auch. Dessen war sich Josh sicher. Andernfalls hätte er sie in Ruhe gelassen. Schließlich war er kein irrer Stalker.
Er lenkte den Wagen auf einen der Parkplätze vor der Notaufnahme und betrat, gefolgt von Dominic, den klimatisierten Anmeldebereich. Die diensthabende Schwester hinter dem Tresen, Schwester Gerty, wie er mittlerweile wusste, warf ihm aus zusammengekniffenen Augen einen missbilligenden Blick zu. »Lassen Sie mich raten. Sie wollen zu Dr. Montgomery.«
»Genau.« Josh schenkte ihr sein Guter-Junge-Grinsen.
»Warten Sie einen Moment. Ich piepse sie an.«
Bis jetzt hatte er noch nie mit all den anderen Patienten in der Notaufnahme warten müssen, wofür er dankbar war. Ob das daran lag, dass er ein Cop war oder an dem dicken Scheck, den seine Eltern dem Hospital ausgestellt hatten, wusste er nicht. Es war ihm egal. Auch wenn er sonst keinen Wert auf die Sonderbehandlungen legte, die seiner Familie zuteilwurden, in diesem Fall kümmerte es ihn nicht. Dr. Hannah Montgomery ging ihm unter die Haut. Und er würde alle Vorteile nutzen, die sich ihm boten, um bei ihr einen Schritt weiterzukommen.
Zwei Minuten später rauschte sie um die Ecke. »Was ist los, Gerty?«, wollte sie atemlos wissen. »Ich war gerade in der Mittagspause.«
Die Schwester nickte mit dem Kopf in Joshs Richtung. Die Ärztin sah zu ihm, und ihr Blick verhärtete sich. Dabei wirkte sie unglaublich sexy, unaufdringlich, aber sexy.
Grüne Krankenhauskluft unter einem weißen Arztkittel, die Haare zu einem einfachen Pferdeschwanz zusammengebunden, das Stethoskop um den Hals. »Kommen Sie bitte mit, Detective Winters.« Ohne auf ihn zu warten, drehte sie sich um und steuerte eines der Behandlungszimmer an.
*
Hannah wartete, bis Josh hinter ihr ins Behandlungszimmer getreten war. Sie schloss die Tür und lehnte sich dagegen. »Was für ein Problem hast du heute?«
Er lümmelte sich auf die Behandlungsliege, als ob er sich häuslich einrichten wollte. »Ich habe einen unheimlichen Juckreiz an der Narbe.«
Sie verschränkte die Arme vor dem Oberkörper. Von ihrem Platz an der Tür aus betrachtete sie die Narbe auf seiner Stirn. »Deine Wunde heilt. Das habe ich dir bereits erklärt. Benutz die Salbe, die ich dir mitgegeben habe, und hör auf, mich zu belästigen. Es gibt Menschen, die tatsächlich krank sind und meine Hilfe dringender brauchen als du.« Sie hatte ihrer Stimme einen noch frostigeren Ton verliehen. »Du verschwendest nur meine Zeit.«
»Geh mit mir aus«, bat er, als hätte er ihr gerade nicht zugehört.
»Ich dachte, ich hatte mich klar ausgedrückt. Die Antwort lautet Nein.«
»Ich werde so lange wiederkommen, bis du Ja sagst.« Ein sehr männliches Grinsen zog sich über sein Gesicht.
Hannah hob eine Augenbraue und rieb unbehaglich über die Gänsehaut, die plötzlich ihre Arme überzog. »Das könnte man Stalking nennen, Detective.«
»Nein.« Josh erhob sich von der Behandlungsliege und trat vor sie. Viel zu dicht. Am liebsten wäre sie einen Schritt zurückgewichen. Aber die Tür presste sich bereits in ihren Rücken. Er hob seine Hand und fuhr mit dem Zeigefinger über ihren Wangenknochen, wo er eine brennende Spur hinterließ. »Ich habe dich geküsst, Hannah Montgomery. Und das hat dir gefallen.« Er kam noch näher. »Ich weiß nicht, warum du mich abblitzen lässt«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Aber es liegt nicht daran, dass du dich von mir gestalkt fühlst. Wenn dem so wäre, hättest du längst den Sicherheitsdienst gerufen, egal, wie viele Nullen der Scheck hatte, den meine Mutter dem Hospital überreicht hat.«
Es klopfte. Dominic schob die Tür einen Spalt auf und spähte herein. »Es gibt Arbeit, Josh.«
»Ich komme.« Nachdem sein Partner verschwunden war, wandte er seine gesamte Aufmerksamkeit wieder Hannah zu. »Samstag, vierzehn Uhr. Ich hole dich ab.«
»Samstag habe ich …«
»Keinen Dienst«, erwiderte er mit einem Zwinkern. »Das habe ich schon überprüft.«
»Aha. Und du bist sicher, dass du kein Stalker bist?«