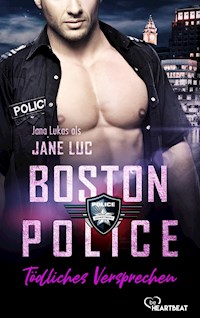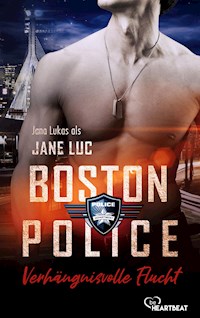
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hot Romantic Thrill
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Drei Morde und der Schmuggel von fünfhundert Kilogramm Kokain. Die Beweise gegen Jared Paxton sind erdrückend. Er landet im Gefängnis und entgeht dort knapp einem Mordanschlag. Für ihn gibt es nur eine Chance, sein Leben zu retten und herauszufinden, wer ihn hinter Gitter gebracht hat - Flucht. Als sich die Möglichkeit ergibt, nimmt er eine Geisel und erpresst sich den Weg in die Freiheit. Doch die Frau, die er entführt, ist keine Unbekannte für ihn ... Kann er ihr Vertrauen zurückgewinnen und den wahren Mörder finden? Und warum beschleunigt sich sein Herzschlag, wenn er neben ihr steht?
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Epilog
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Drei Morde und der Schmuggel von fünfhundert Kilogramm Kokain. Die Beweise gegen Jared Paxton sind erdrückend. Er landet im Gefängnis und entgeht dort knapp einem Mordanschlag. Für ihn gibt es nur eine Chance, sein Leben zu retten und herauszufinden, wer ihn hinter Gitter gebracht hat – Flucht. Als sich die Möglichkeit ergibt, nimmt er eine Geisel und erpresst sich den Weg in die Freiheit. Doch die Frau, die er entführt, ist keine Unbekannte für ihn … Kann er ihr Vertrauen zurückgewinnen und den wahren Mörder finden? Und warum beschleunigt sich sein Herzschlag, wenn er neben ihr steht?
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
JANE LUC
BOSTONPOLICE
Verhängnisvolle Flucht
Für die Fans von Dominic und Josh
Prolog
New York City
Die drei Blutlachen schimmerten in den letzten Sonnenstrahlen des Tages, die durch die hohen, vergitterten Fenster in die Lagerhalle fielen. Staubkörnchen schwebten in den Lichtbahnen, bevor sie sich sanft auf den dickflüssigen, nach Kupfer riechenden Pfützen niederließen.
Er zog vorsichtig Jared Paxtons Pistole aus dem Plastikbeutel. Putz spritzte auf, als er zwei Schüsse in die gegenüberliegende Wand feuerte. Zufrieden schob er die Waffe unter eine alte Holzkiste und ließ seinen Blick ein letztes Mal aufmerksam durch die Halle gleiten, in der sich außer dem Blut nur ein wenig Gerümpel befand.
Er hatte alles erledigt und wandte sich zur Tür. In der zunehmenden Dämmerung war das Echo seiner Schritte das einzige Geräusch.
Am nächsten Tag
»Notrufzentrale. Welchen Notfall möchten Sie melden?«
»Im Lagerhaus 8643 Brownstreet wurden drei Menschen umgebracht. Esteban Moreno, Kelly Andrews und Leon Cook.«
»Können Sie mir mehr dazu sagen, Sir?«
»Nein.«
»Nennen Sie mir bitte Ihren Namen, Sir. Sir? Hallo?«
1. Kapitel
Crockett, Texas
Jared verließ die Reisehöhe. Die Maschine ging in den Sinkflug über. Er reduzierte die Leistung und zog die Vergaservorwärmung. Mit einem Blick auf das Foto seiner Exfrau, das am Armaturenbrett klemmte, begann er den Gegenanflug. fünfhundert Fuß über Grund schaltete er die Benzinpumpe ein und stellte die Propellerdrehzahl auf Maximum. Er verringerte die Geschwindigkeit, fuhr die Landeklappen aus. Das Flugzeug schwebte über der Landebahn aus. Mit einem Holpern, das er sich zu Militärzeiten nicht geleistet hätte, setzte er auf dem dunklen Untergrund auf. Das Landen auf einem winzigen Flugplatz kurz hinter der mexikanischen Grenze, mitten in der Nacht – mit tausend Pfund Kokain an Bord – war kein Vergnügen. Doch er hatte das schon besser hinbekommen.
In Zukunft musste er sich unbedingt die Zeit nehmen und öfter in ein Flugzeug steigen, als es zum Erhalt seiner Lizenz notwendig war. Automatisch schaltete er die Vergaservorwärmung aus und fuhr die Landeklappen ein. Er bremste ab. Die Maschine rollte aus. Neben einem heruntergekommenen kleinen Hangar brachte er sie in die Parkposition.
Nirgendwo ein Anzeichen von Esteban Moreno und seinen Leuten. Er schaltete den Motor aus und steckte das Foto seiner Exfrau in die Brieftasche. Die meisten Leute fanden es sicher bescheuert, ein Bild der Frau mit sich herumzutragen, die ihn vor sieben Monaten vor die Tür gesetzt hatte und ganz begierig darauf war, endlich von ihm geschieden zu werden. Er trug ihr Bild nicht aus Sympathie mit sich herum. Zur Zeit ihres Kennenlernens hatte er als Air-Force-Pilot große Maschinen über sämtliche Krisengebiete der Welt geflogen. Er hatte ihr Bild mit ins Cockpit genommen, damit sie ihm Glück brachte. Dort hing es seitdem bei jedem Flug. Nein, Jared Paxton war nicht sentimental. Er war abergläubisch. Verdammt abergläubisch. Er würde niemals vom Boden abheben, wenn das Foto nicht an seinem Armaturenbrett klemmte. Wenn sie zwanzig Jahre geschieden waren und sie das Leben lebte, das sie so unbedingt führen wollte – verheiratet mit einem Collegeprofessor, mit zwei Teenagerkindern und einem Hund in einem Vorstadthäuschen –, würde ihn ihr Bild immer noch auf seine Flüge begleiten. Er warf einen letzten Blick auf das abgegriffene Papier mit der strahlend lachenden Blondine, klappte die Brieftasche zu, hob seine Hüfte ein wenig an und schob das Portemonnaie in die Gesäßtasche seiner Jeans.
Mit der linken Hand stieß er die Tür des Cockpits auf und atmete die schwere, feuchte Luft ein, die die klimatisierte Kühle im Flugzeug verdrängte. Über dem kleinen Flughafen lag ohrenbetäubende Stille. Die Härchen auf seinen Armen stellten sich umgehend auf. Langsam zog er die Glock aus seinem Hosenbund. Die Gedanken an seine Exfrau hatten ihn für einen Moment abgelenkt, aber seine Instinkte funktionierten nach wie vor ausgesprochen gut. Viel zu oft war er in Kriegs- und Krisengebieten gewesen. Er konnte die Gefahr geradezu riechen. Sie waberte mit der schweißtreibenden Schwüle ins Cockpit.
Wo steckten Esteban und seine Leute? Seit Ted Hudson den Flug auf diesen Flugplatz umgeleitet hatte, hatte sich niemand mehr bei ihm gemeldet. Er war davon ausgegangen, dass sie ihn erwarteten und das Kokain, das in Sporttaschen im Frachtraum lag, sofort umluden. Doch niemand von der »Familie«, wie Esteban sie nannte, war hier. Stattdessen tauchte eine Handvoll schwarz gekleideter Männer aus den Schatten der Nacht auf und richtete ihre Waffen auf ihn.
Jared zählte auf den ersten Blick zwei Pistolen, zwei MPs und eine Pumpgun. Verdammt. Er hatte zu lange gezögert. Jetzt würde er nicht mehr unbemerkt aus dem Cockpit gelangen. Er erkannte die Schutzwesten, die sie trugen, bemerkte die Abzeichen auf ihren Ärmeln. Das war ein SWAT-Team. Scheiße. Was wollten die Cops hier?
Fieberhaft überlegte er, ob er sein Handy ausgeschaltet und irgendetwas nicht mitbekommen hatte. War etwas schiefgelaufen? Hatte man Esteban festgenommen? Er kam nicht dazu, sich großartig Gedanken zu machen. Er wusste nur eins: Er saß in der Falle.
»Waffe weg.« Die Stimme des Mannes, der in der Dunkelheit vor ihm stand, war ruhig und befehlsgewohnt. Er war der Boss. Jared hätte wetten können, dass sich der Puls des Cops wahrscheinlich nicht einmal um drei Schläge erhöhte. Er hatte ebenfalls gelernt, in Ausnahmesituationen nicht durchzudrehen. Deshalb war er nicht weniger ruhig als sein Gegenüber. Er wusste genau, was jetzt kam. Es war unvermeidlich. Ganz langsam hob er die Glock und legte sie auf das Armaturenbrett.
»Aussteigen!« Der Sprecher der Gruppe steckte die Pistole weg und löste ein Paar Handschellen von seinem Einsatzgürtel.
Jared trat auf die Trittleiter des Cockpits. Er hatte den Fuß gerade auf die zweite Stufe gestellt, als der Cop ihn am Arm nach vorn riss. Das hatte er erwartet, aber er konnte sich nicht dagegen wehren – denn dann hätten sie ihn durchsiebt wie eine alte Erbsendose auf dem Schießplatz. Er stürzte auf den asphaltierten Boden, der Hitze und Feuchtigkeit gefangen hielt. Sie drangen von unten durch seine Kleidung und seine Haut.
»Emilio Martinez, ich verhafte Sie wegen der Einfuhr von eintausend Pfund Kokain in die Vereinigten Staaten von Amerika.«
*
Ferry Pass, Florida
Stanley Williamson musste sich beherrschen, um nicht nervös mit den Fingerspitzen auf seinem Oberschenkel herumzutrommeln. Der Schweiß rann unter seinem Hemd, über dem er noch Krawatte und Jackett trug, in Bächen seinen Rücken hinab. Diese widerliche Südstaatenluft an der Grenze zwischen Florida und Louisiana raubte ihm den letzten Nerv. Ebenso wie Sharon Tallford. Allerdings waren ihr die Kleidervorschriften egal. Sie hatte irgendwann stöhnend und mit viel Gewese ihre Kostümjacke ausgezogen und die Ärmel ihrer weißen Bluse aufgerollt. Unter ihren Achseln hatten sich Schweißflecken gebildet, die denen auf seinem Rücken in nichts nachstanden.
Stanley hatte keine Ahnung, wie George Campbell das machte. Kühl und unbeweglich saß er zwischen Tallford und ihm und starrte mit ausdrucksloser Miene auf die Monitore in ihrem fensterlosen, zu einem Überwachungswagen umgebauten Van. Campbell schwitzte nicht. Er sagte nichts. Er starrte einfach nur mit völlig unlesbaren Gesichtszügen auf das GPS und das Radar, das zwar arbeitete wie verrückt, aber kein sich näherndes Objekt anzeigte.
Alle waren auf ihren Positionen. Estebans Männer warteten auf Emilio Martinez. Ihre Leute standen bereit, um den Sack zuzumachen, sobald er landete. Sie würden sowohl hier als auch in New York, wo ebenfalls alles vorbereitet worden war, zuschlagen.
Stanley ließ sich vom Blinken des GPS hypnotisieren und widerstand dem Bedürfnis, einen Schweißtropfen, der aus seinem Haaransatz rollte und sich an seinem Auge vorbei einen Weg über seine Wange nach unten suchte, wegzuwischen. Er kitzelte ihn, aber Campbell würde es als Schwäche auslegen, wenn er deshalb sein Taschentuch aus der Hosentasche zog. Er rief sich ins Gedächtnis, dass es ihn schlimmer hätte treffen können. Als Mitglied des Zugriffstrupps läge er jetzt mit Schutzweste und Helm draußen in der schwülheißen Nacht und ließe sich von den Mücken auffressen.
Wo blieb nur dieses verdammte Flugzeug? Das GPS-Signal, das die Position des Wagens von Estebans Männern anzeigte, blinkte grün und träge vor sich hin. Die Übergabe hätte vor mehr als zwei Stunden stattfinden sollen.
Aber sie warteten vergeblich. Die Abhörgeräte aus den beiden Lieferwagen sendeten nur vereinzelte, gemurmelte Kommentare. Wahrscheinlich schliefen die Gangster – im Gegensatz zu ihm. Nun hatten sich seine Finger doch noch selbstständig gemacht und trommelten auf seinem Oberschenkel herum. Er zwang sich, stillzuhalten, und presste die feuchte Handfläche fest auf sein Bein. Campbell hasste unruhige Typen, ganz egal, ob sie einen nervösen Abzugsfinger an der Waffe hatten oder einen nervösen Tick. Stanley wollte Karriere machen und war deshalb freiwillig in Campbells Team eingestiegen. Sein Boss war das größte Arschloch, das die DEA zu bieten hatte. Aber er bekam die besten Fälle zugeteilt. Für jemanden, der die ganz große Karriere machen wollte, das perfekte Sprungbrett.
Stanley würde es weit bringen. Im Gegensatz zu Tallford, die auf ihrem Platz herumrutschte und immer wieder an ihren Gürtel griff, wo ihr Handy summte. Campbell hasste es, wenn während eines Einsatzes telefoniert wurde. Stanleys Handy hatte ebenfalls schon dreimal in seiner Hosentasche vibriert. Er hatte die Anrufe selbstverständlich nicht angenommen. Er sah nicht einmal nach, wer etwas von ihm wollte.
Tallford war anders. Sie hielt sich nicht an Campbells ungeschriebene Regeln. Auf der Karriereleiter würde sie nicht besonders hoch klettern. Wenn es der Anrufer noch einmal probierte, würde sie das Telefonat annehmen. Es vibrierte wieder. Bingo. Tallford zog es aus der Hülle an ihrem Gürtel und meldete sich. Campbell ließ sich nicht stören und starrte unbeirrt auf die Monitore vor sich. Wo steckte bloß dieses verdammte Flugzeug?
Tallford hatte nur ›Hallo‹ gesagt und hörte dem Anrufer schon eine geraume Weile zu. »Warte. Warte«, sagte sie jetzt. »Der Boss sitzt neben mir. Erzähl es ihm.« Sie nahm das Handy vom Ohr und hielt es Campbell hin. »Das New Yorker Büro, Sir.«
Langsam drehte Campbell den Kopf in ihre Richtung. Einen langen Moment starrte er auf das Smartphone, als überlegte er, ob er bereit war, diese Störung zu akzeptieren. Dann nahm er es in seine spinnenhaften Finger, wischte das Display an seinem Hosenbein ab und hielt es ans Ohr. »Ich höre.« Und das tat er auch. Sein Gesicht blieb ausdruckslos, und doch konnte Stanley eine feine Röte erkennen, die seine Züge zu überziehen begann.
»Ich verstehe. Ja, tun Sie das. Ich kümmere mich um den Rest.« Er beendete das Gespräch und warf Tallford das Handy in den Schoß. Dann tippte er an die Sprechtaste seines Headsets. »An alle eingesetzten Kräfte. Abbruch! Ich wiederhole: Abbruch!« Ohne ein weiteres Wort streifte er das Headset ab und warf es in Richtung der Monitore, wo es abprallte und zu Boden fiel. Er stand auf, schob seinen hageren Körper an Tallford vorbei und verließ den Überwachungswagen.
Verdammt. Was war passiert? Jetzt, wo Campbell verschwunden war, wischte sich Stanley den Schweiß aus dem Gesicht. Würde er jetzt ernsthaft seine Kollegin um Informationen anbetteln müssen? Sie sah zu ihm herüber und öffnete den Mund. Nein, er würde sie nicht lange bitten müssen. Sie war viel zu begierig darauf, ihre Informationen weiterzugeben.
Bevor sie loslegen konnte, hörten sie über die Sprachübertragung der Wanze in einem der überwachten Lieferwagen ebenfalls ein Handy klingeln. Morenos Handlanger nahm den Anruf entgegen.
Das statische Rauschen nahm zu, aber die Stimme des Mannes war gut verständlich. »Carlos, ich bin es, Tomas.« Esteban Morenos Cousin und rechte Hand.
»Was geht, Alter?« Morenos Handlanger klang ungeduldig. »Wo bleibt das verdammte Flugzeug?«
»Es wird nicht kommen. Wir wurden reingelegt. Hör zu, sammle deine Männer ein und sieh zu, dass du verschwindest.«
»Was ist los, Alter? Du klingst nicht gut, gar nicht gut.« Es war eine von Carlos’ nervigsten Angewohnheiten, den letzten Teil eines Satzes zu wiederholen. Das hatten sie in den Monaten der Überwachung schmerzlich lernen müssen.
In der Leitung blieb es kurz still. »Esteban ist tot.« Tomas räusperte sich, bevor er fortfuhr. »Er wurde erschossen. Genau wie Kelly und dieser Typ, Leon Cook. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst.«
Stanleys Herz begann zu rasen. Sein Mund war mit einem Mal staubtrocken. Scheiße! Verdammte Scheiße! Ted Hudson, der verdeckte Ermittler, für den er verantwortlich war und der unter dem Decknamen Leon Cook in Esteban Morenos Drogenring eingeschleust worden war, war tot? Erschossen? Fast hätte er über das Brausen in seinen Ohren Tomas Morenos letzte Sätze überhört.
»Sie haben Emilio Martinez’ Waffe gefunden. Sie ist offenbar die Tatwaffe. Wie es aussieht, hat sich Martinez mit dem Kokain abgesetzt.« Er knurrte. »Aber das wird ihm nichts nützen. Ich werde ihn finden, und dann gnade ihm Gott.«
*
Andover, Massachusetts
Er fuhr den Wagen am Ende der Gasse an den Straßenrand. Das ständige Klackern der Tastatur neben sich ging ihm schon seit einer Stunde auf die Nerven. »Gibt es etwas Neues?«
»Nein«, kam die Antwort vom Beifahrersitz. »Drei Blutlachen in einem Lagerhaus, das Esteban Moreno gehört. Mehr bringen die Medien noch nicht.«
»Gut. Hier ist es.« Unbehaglich sah er in Richtung des alten Häuschens. Die Veranda war abgesackt und die Farbe blätterte von den Fensterläden. Der Garten schien allerdings liebevoll gepflegt zu werden. Alles in allem ganz ordentlich für eine Sechsundneunzigjährige, die immer noch ohne fremde Hilfe lebte.
Er hatte seit Jahren nicht mehr mit seiner Großtante gesprochen – und hätte es auch jetzt nicht getan, wenn sie nicht ihr Haus als vorübergehenden Unterschlupf benötigen würden. »Wir machen es wie besprochen. Ich kümmere mich um die Alte und du wartest hier, bis ich dir ein Zeichen gebe.«
»Sicher. Beeil dich gefälligst ein bisschen. Ich muss pinkeln und habe keine Lust, ewig hier rumzuhocken.«
Ja, ja. Er würde sich genau so viel Zeit lassen, wie er brauchte. Er hatte sich noch nie herumkommandieren lassen und würde jetzt nicht damit anfangen. Mit knackenden Knochen stieg er aus dem Wagen, streckte sich nach der langen Fahrt und ging über den Weg mit den gebrochenen Gehwegplatten zum Haus seiner Großtante. Auf sein Klopfen hin dauerte es lange, bis sie endlich erschien.
Sie sah gebrechlicher aus, als er es sich vorgestellt hatte.
Sie würden leichtes Spiel mit ihr haben.
»Ja, bitte?«
»Ich bin es, Tante Elsie. Erkennst du mich nicht mehr?«
Sie musterte ihn einen langen Augenblick aus zusammengekniffenen Augen. »Jungchen. Bist du das wirklich?«
Sie hatte ihn immer Jungchen genannt, und er hatte es gehasst. Jetzt lächelte er sie an. »Genau, der bin ich.«
»Sag das doch gleich. Meine alten Augen sehen nicht mehr so gut, und mein Kopf arbeitet nicht mehr so schnell. Komm herein. Komm nur herein. Was für eine Überraschung. Ich habe das Gefühl, dich schon ein Jahrzehnt nicht mehr gesehen zu haben. Wie geht es dir?«
Er trat in die Diele. Das Haus roch muffig nach alter Frau, war aber recht ordentlich und sauber.
»Möchtest du etwas zu trinken? Ich kann Eistee machen.«
»Nein, danke. Ich würde gern etwas aus dem Keller holen, das ich beim letzten Mal hier liegen gelassen habe.«
»Aus dem Keller? Da war ich ja schon seit Weihnachten nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass du dort etwas untergestellt hast.«
»Hilfst du mir?«, überging er ihren Kommentar.
»Sicher. Meine alten Beine brauchen zwar eine Weile, bis sie unten sind, aber eine Taschenlampe kann ich noch für dich halten, Jungchen.«
Sie folgte ihm langsam die steilen Stufen hinunter. Unten angekommen sah er sich im Licht der funzligen Deckenlampe um. An der hinteren Wand stand ein alter Schemel. Das musste reichen. Er packte seine Großtante am Arm und führte sie in die Ecke. »Setz dich.« Ohne ihre Antwort abzuwarten, drückte er sie auf den Hocker, zog ein Paar Handschellen aus seiner Gesäßtasche und schloss ihre Hände an einem Heizungsrohr fest. Ihre Handgelenke waren so dünn, dass sie fast durch das Metall gerutscht wären. Mit einer kräftigen Bewegung hätte er sie sicher brechen können wie trockene Zweige.
Verwirrt sah sie zu ihm auf. »Jungchen, was tust du denn?«
»Hör gut zu, wir wollen dir nichts tun. Wir brauchen nur dein Haus für ein paar Tage. Verstehst du? Wenn du mitspielst, wird dir nichts passieren.«
»Willst du Geld? Ist es das? Ich kann meine Rente abheben. Ansonsten habe ich nichts Wertvolles im Haus.« In ihre Verwirrung schlich sich der erste Hauch von Angst. Zaghaft zog sie an den Handschellen, was ihn fast Mitleid mit ihr haben ließ.
»Ich will deine Rente nicht. Ich will nur, dass du hier unten bleibst und Ruhe gibst. Falls du versuchst, zu schreien, wird dich sowieso niemand hören. Aber mir wird dann trotzdem nichts anderes übrig bleiben, als dich zu knebeln.
Das ist gefährlich. An so einem Tuch im Mund kann man schnell ersticken. Also lass es bleiben, okay? Verhalte dich schön still. Ich sehe später nach dir.«
2. Kapitel
Crockett, Texas
Jared hatte bereits angenommen, dass es sich bei dem Mann, der bei seiner Festnahme das Sagen gehabt hatte, um den örtlichen Polizeichef handelte.
Die Autorität, die er ausstrahlte, war typisch für leitende Polizeibeamte oder führende Militärs. Jetzt ließ er Jared schmoren. Eine klassische Cop-Taktik, die er selbst schon Hunderte, wenn nicht gar Tausende Male angewandt hatte. Sperre den Verdächtigen für ein paar Stunden in einen kleinen, fensterlosen Raum mit einer summenden Neonröhre an der Decke und am Boden verschraubtem Tisch und Stuhl. Gegenüber zwei weitere Stühle, auf denen man sich mit verschränkten Armen zurücklehnen und aus angeschlagenen Bechern Kaffee schlürfen konnte, während man sein Gegenüber wortlos fixierte, bis es begann, unruhig herumzurutschen und mit den Handschellen zu klappern, mit denen es an die Metallöse gefesselt war.
Sie standen auf der anderen Seite des venezianischen Spiegels und beobachteten ihn. Das nervte Jared. Er hatte bereits versucht, mit dem Sheriff zu sprechen, doch der hatte ihn abgekanzelt. Ein Rauschgiftschmuggler hatte keine Forderungen zu stellen, ließ man ihn wissen. Jetzt musste er in diesem verdammten, winzigen Raum die Zeit totschlagen, bis sie bereit waren, mit ihm zu reden und er die Geschichte endlich aufklären konnte.
Er wusste nicht, was schiefgelaufen war. Ted hatte ihm klare Anweisungen gegeben. Warum war niemand hier gewesen, um die Ladung in Empfang zu nehmen? Und warum, verdammt noch mal, war niemand aus seinem Team hier? Dieser Transport hätte der finale Schlag gegen Esteban Moreno und seinen Rauschgiftring sein sollen.
Was in aller Welt war geschehen, dass er mit einer halben Tonne Kokain auf einem kleinen Flugplatz gestrandet und vom örtlichen Sheriff festgenommen worden war?
Die Tür wurde geöffnet und der Polizeichef betrat in Begleitung eines Uniformierten den Raum. Der Officer drehte den Stuhl um und setzte sich so, dass er seine Arme auf die Lehne stützen konnte. Die Tasse dampfend heißen Kaffees, rabenschwarz und stark – zumindest roch es so –, stellte er behutsam vor sich auf den Tisch. Jared hätte seine Seele für eine Kanne dieses Gebräus verkauft. Von seinem Gegenüber würde er allerdings keinen Tropfen bekommen. Er konnte die Überlegenheit im Blick des Sheriffs sehen. Der Mann wusste ganz genau, wie man Machtspielchen spielte.
Der Schweiß brannte in der Schürfwunde an Jareds Schläfe, die er sich beim Sturz aus dem Flugzeug zugezogen hatte. Aber er würde den Teufel tun und Schwäche eingestehen, indem er den Schweiß wegtupfte.
Der Polizeichef schaltete das Tonbandgerät auf dem Tisch ein. »Vernehmung Emilio Martinez, geboren am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertfünfundachtzig, der beschuldigt wird, circa eintausend Pfund Kokain in die Vereinigten Staaten von Amerika geschmuggelt zu haben. Er wurde mit dem Betäubungsmittel aufgegriffen, nachdem telefonisch ein anonymer Hinweis im hiesigen Sheriffbüro eingegangen war. Bei der Vernehmung anwesend sind neben dem Beschuldigten Sheriff Landers und Deputy Bexter. Ihre Rechte wurden Ihnen bereits genannt, Mr Martinez. Sollen sie noch einmal wiederholt werden?« Der Polizist sah ihn herausfordernd an.
»Kann ich einen Moment unter vier Augen mit Ihnen sprechen, Sheriff? Ohne ihn.« Jared nickte in Richtung des Deputys. »Und ohne das Mikrofon?«
»Nein. Das können Sie nicht. Ich will wissen, woher das Kokain stammt und für wen es bestimmt war.«
»Genau das werde ich Ihnen sagen. Nur Ihnen.«
Landers fixierte ihn aus zusammengekniffenen Augen. »Ich bin der, der die Regeln aufstellt. Reden Sie schon.«
»Ich rede unter vier Augen oder gar nicht.«
Der Sheriff wartete einen Moment ab. Er schien zu überlegen. »Also gut.« Mit einer Kopfbewegung schickte er den Deputy aus dem Raum und schaltete das Tonband ab. »Ich warte.«
Jared schob die Hand über den Tisch und drückte auf den Knopf, der den Lautsprecher im Beobachtungsraum ausschaltete.
Landers zog die Augenbrauen hoch.
»Nur Sie und ich«, wiederholte er noch einmal. »Ich lege Sie nicht rein, Sheriff, und Sie mich nicht. Ich bin Special Agent Jared Paxton, DEA. Ich bin undercover im Einsatz gegen ein New Yorker Drogenkartell. Während meines Fluges hat mir mein Partner eine Änderung der Route mitgeteilt. Die Koordinaten waren der Flugplatz in Crockett. Irgendetwas muss passiert sein. Vielleicht haben die Kuriere, die die Lieferung abholen sollten, ihre Männer bemerkt und sich zurückgezogen.«
Der Sheriff erwiderte nichts. Er zog die Tasse, die der Deputy zurückgelassen hatte, zu sich herüber und trank einen Schluck, bevor er die Aktenmappe, die vor ihm lag, aufschlug. »Emilio Martinez, ehemaliger Navy-Pilot. Eine verschlossene Jugendakte. Seit dem Ausscheiden aus dem aktiven Militärdienst Verhaftungen wegen Drogenbesitzes, Körperverletzung, Ruhestörung, noch einmal Körperverletzung. Es fällt mir schwer, Ihre Geschichte zu glauben, Special Agent Paxton.« Er betonte den Dienstgrad und Jareds Nachnamen ironisch. »Wir sind nur eine kleine Grenzstadt. Von den Metropolen im Norden wissen wir nichts. Es gibt nur drei Dinge, mit denen wir uns hier auskennen.« Er hob die Hand und zählte vor Jareds Gesicht die Finger ab. »Menschenschmuggel. Waffenschmuggel. Rauschgiftschmuggel. In diesen drei Kategorien bin ich verdammt gut. Wir haben die beste Aufgriffsrate des gesamten Staates Texas. Ich kann Ihnen versichern, dass ich schon bessere Storys als Ihre gehört habe, Martinez.« Ein schiefes, definitiv nicht ernst gemeintes Lächeln begleitete seine nächsten Worte. »Ich bewundere Ihre Idee. Als Bundesagent hat sich bisher noch niemand ausgegeben.« Er klappte die Akte zu, trank den Rest des Kaffees und stand auf. »Ich habe Ihre Fingerabdrücke und Ihr Lichtbild in dieser Akte. Beides sagt klar und deutlich: Emilio Martinez.« Landers sprach langsam und betont, als hätte er es mit einem Zweijährigen zu tun. »Und Martinez bleiben Sie für mich auch. Sie werden morgen früh einem Richter vorgeführt. Ich bin mir ziemlich sicher, zu welchem Entschluss er angesichts der Beweislage kommen wird.«
»Natürlich habe ich eine kriminelle Akte. Ich befinde mich in einem Deep-Cover-Einsatz, Sheriff.« Einem Einsatz, in dem man eine völlig neue Identität inklusive Vergangenheit erhielt und über Monate in einem Kartell ermitteln konnte. »Meine Dienstnummer ist 3304854. Überprüfen Sie das.«
»Natürlich.« Landers drehte sich um und ließ Jared in der stickigen Kammer allein zurück.
Eine weitere halbe Stunde ließen sie ihn in dem schäbigen Raum schmoren. Genug Zeit, den Fleck an der gegenüberliegenden Wand genauer zu betrachten. Dunkel hob er sich von dem schmutzigen Waschbeton ab. War das Blut?
Entweder hatte jemand vor lauter Verzweiflung seinen Kopf gegen den Beton geknallt, so wie auch er es am liebsten tun würde, oder einer der Beamten hatte bei einem Geständnis ein wenig nachgeholfen. Als sie ihn endlich telefonieren ließen, wog er ab, wen er anrufen sollte. Eigentlich müsste er sich bei seiner direkten Ansprechpartnerin bei der DEA, Sharon Tallford, melden. Sie war für ihn und seinen Einsatz verantwortlich. Wahrscheinlich hatte seine Einheit inzwischen bemerkt, dass etwas nicht stimmte, und zog im Hintergrund die Fäden, um ihn hier herauszubekommen. Wichtiger war im Moment, wieso er aufgrund eines anonymen Anrufs festgenommen worden war. Er entschied sich dafür, seinen Partner Ted Hudson anzurufen. Er hatte ihm diese Suppe mit der Änderung der Flugroute schließlich eingebrockt.
Ted nahm nicht ab. Nach dem siebten Klingeln schaltete sich die Mailbox ein. »Hier ist Leon Cook«, meldete er sich mit seinem Undercovernamen. »Ich bin gerade nicht erreichbar, also wartet auf den Piep.« Jared legte auf. Sie hatten Weisung, keine Nachrichten auf den Handys des anderen zu hinterlassen. Ted würde den Anrufversuch sehen und sich melden, sobald er konnte.
Er begann, Sharons Nummer zu wählen, doch der Deputy, der neben ihm Wache stand, riss ihm den Hörer aus der Hand. »Nur einen Anruf«, knurrte er. Laut dem Namensschild an seinem Uniformhemd hieß er Johnston, seinem Gesichtsausdruck nach eher schlecht gelauntes Arschloch.
»Es hat niemand abgenommen.«
»Die Mailbox ist rangegangen. Das ist das Gleiche, als wenn jemand den Anruf entgegennimmt«, wies ihn der Deputy zurecht.
Jared kniff sich mit der freien Hand in die Nasenwurzel. »Sie haben doch mitbekommen, dass ich nicht auf die Mailbox gesprochen habe.«
Johnston zuckte die Schultern. »Wenn Sie nicht aufs Band sprechen, ist das Ihr Problem. Und jetzt kommen Sie.«
Sie brachten ihn in eine Zelle im Keller des Sheriffdepartments, in der er die Nacht verbringen würde, bevor am nächsten Morgen ein Richter über seine Freiheit entschied.
Jared ließ sich noch einmal den gesamten Einsatz durch den Kopf gehen. An irgendeiner Stelle war etwas schiefgelaufen. Er wusste nur nicht, wo. Seit Ted ihn auf die neue Flugroute umgeleitet hatte, hatte er weder mit jemandem aus dem Team noch mit einem Mitglied aus Estebans Organisation gesprochen.
Das Klappern der Tür zu dem winzigen Zellentrakt, in dem sonst wahrscheinlich nur hin und wieder ein illegaler Einwanderer, dessen Glück in den Fängen Sheriff Landers’ endete, bis zu seiner Abschiebung untergebracht wurde, riss ihn aus seinen Gedanken. Der Officer, der vorhin bei dem Versuch, ihn zu vernehmen, dabei gewesen war, trat in den kleinen Vorraum. Deputy Bexter, erinnerte sich Jared. Der Mann warf einen wachsamen Blick in den Gang hinter sich, bevor er an die Zellentür trat und ihm ein Handy zwischen den Gitterstäben durchreichte. Jared sah ihn abwartend an, blieb aber auf seiner Pritsche sitzen.
Bexter wedelte mit dem Handy. »Nun machen Sie schon.«
»Was soll ich machen?« Jared starrte ihn irritiert an.
»Rufen Sie jemanden an.«
Jared erhob sich langsam und trat an das Gitter. »Warum tun Sie das?«
Der Deputy wurde ein wenig rot und zuckte unbehaglich die Achseln. »Ich fand es nicht in Ordnung, dass Johnston Ihnen nicht die Möglichkeit gegeben hat, jemanden zu erreichen. Dieses Recht sollte jeder haben.«
»Danke, Deputy Bexter.« Seit seiner Festnahme waren Stunden vergangen. Jared hatte keine Ahnung, was passiert war. Sein Team hätte ihn längst finden müssen. So schwer war seine Spur schließlich nicht zu verfolgen, wenn man wusste, wonach man suchte.
Warum kam niemand? Er konnte Sharon anrufen, wie er es vorhin geplant hatte. Oder vielleicht sollte er es gleich bei seinem Vorgesetzten, Special Agent Campbell, versuchen.
Aber wenn sie überhaupt an ihre Handys gingen, konnten sie wahrscheinlich nicht offen sprechen, was ihm nicht weiterhelfen würde. Er entschied sich dagegen, sein Einsatzteam zu informieren. Das beschränkte die Möglichkeiten auf die beiden Nummern, die er auswendig wusste. Die seiner Mutter, die er ganz sicher nicht aus der Zelle eines texanischen Sheriffbüros anrufen würde. Und die der einzigen Person, die ihm möglicherweise helfen konnte.
»Nun machen Sie schon«, wiederholte der Deputy. »Ich will mich nicht erwischen lassen.«
Jared nahm das Handy und wählte.
»Sie haben die Mailbox von Judy Paxton erreicht. Ich kann Ihren Anruf im Moment leider nicht entgegennehmen. Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Erreichbarkeit. Ich rufe so bald wie möglich zurück«, erklang die kühle Stimme seiner Fast-Exfrau aus dem Hörer. Er seufzte. Heute war eindeutig nicht sein Tag. Verdammt.
Er legte auf. Ging denn heute niemand an sein Handy?
Wen konnte er noch anrufen? Außer Judy fiel ihm niemand ein. Nachdenklich klopfte er sich mit dem Telefon gegen das Kinn. Immerhin würde sie handeln, wenn sie eine Nachricht von ihm bekam. Sie würde für ihn bürgen und Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Landers klarzumachen, wer er wirklich war. Er drückte die Wahlwiederholung und wartete, bis ihm der Piepton das Signal zum Sprechen gab. »Hey, mi Cielo«, benutzte er den Kosenamen, mit dem er sie bedachte, solange sie sich kannten. »Ich bin so weit. Ich unterschreibe die Scheidungspapiere, genau, wie du es wolltest. Du musst sie nur nach Crockett, Texas bringen. Am besten ins Sheriffbüro. Ich warte in der Zelle hinten links auf dich.« Er machte eine kleine Pause. »Ich schätze, ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Könnte sein, dass ich in ein kleines Problem geschlittert bin. Und Judy … ich bin wirklich bereit, die Papiere zu unterschreiben. Bring sie einfach mit, okay? Oh, und mein Name ist Emilio Martinez.« Er legte auf und reichte Bexter das Handy durch die Gitterstäbe.
Judy mochte ihn hassen und die Scheidung von ihm mit jeder Faser ihres Herzens herbeisehnen, aber sie würde ihm helfen. Sie würde hier auftauchen – höchstwahrscheinlich mit den Scheidungspapieren im Gepäck, die er wohl oder übel würde unterschreiben müssen.
Nachdem ihn der Deputy wieder allein gelassen hatte, legte er sich auf die Pritsche und starrte die Betondecke an.
Es wurde sowieso höchste Zeit, dass er unterschrieb und sie weiterziehen ließ. Sie hatte es verdient, das Leben zu führen, das sie sich wünschte. Er passte weder in die Welt, von der sie träumte, noch wollte er ein Teil davon sein.
Unbehaglich rieb er sich mit der Faust über den Brustkorb, um den Schmerz in der Herzgegend zu verdrängen. Sie brauchten beide ihre Freiheit.
*
Boston, Massachusetts
Judy schlug die Augen auf und schloss sie stöhnend wieder. Sie streckte sich und rieb sich über die Schläfen, hinter denen es verdächtig zog. Vorsichtig hob sie die Lider erneut und blinzelte in das grelle Sonnenlicht, das in ihr Zimmer fiel. Sie hatte einen Kater und in der Nacht ganz offensichtlich vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Nach dem Volleyballtraining hatte sie sich zu einer kleinen Kneipentour überreden lassen. Schließlich war das besser, als an einem Freitagabend im Haus ihrer Eltern gemeinsam mit ihnen und ihrem Großvater vor dem Fernseher zu sitzen und Gameshows anzusehen. Es war schlimm genug, dass sie überhaupt hier wohnte. Eine vorübergehendeSituation, rief sie sich ins Gedächtnis.
Sie strampelte die Decke zur Seite und rollte sich aus dem Bett, in dem sie bereits vor ihrer Collegezeit geschlafen hatte. Ihr Morgenmantel hing an dem geschwungenen Haken an der Zimmertür. Sie zog ihn über die Shorts und das T-Shirt, das sie zum Schlafen getragen hatte. Jareds T-Shirt. Ja, das war erbärmlich. Als sie heute Nacht nach Hause gekommen war, mit einem kleinen Schwips im Kopf und viel Traurigkeit in der Brust, hatte sie in einem schwachen Moment das alte, ausgebleichte Air-Force-Shirt aus dem Schrank gezogen und ihr Gesicht darin vergraben. Es roch nur nach Waschmittel, trotzdem glaubte sie, seinen Duft wahrzunehmen. Sie hatte sich wieder einmal in den Schlaf geweint, aber es wurde besser. Immerhin musste sie nicht mehr bei jedem glücklichen Paar, das ihr begegnete, die Tränen zurückhalten. Sie dachte nicht mehr ständig an Jared. Hier, in ihrem Jugendzimmer im Haus ihrer Eltern, gab es keine gemeinsamen Erinnerungen, die sie quälten.
Barfuß tapste sie die Treppe hinunter. Es war kurz vor zehn und ihre Mutter werkelte bereits in der Küche herum und schnippelte auf der Arbeitsfläche neben dem Herd vor sich hin. Wahrscheinlich war sie schon mit den Vorbereitungen für das Mittagessen beschäftigt. Gefrühstückt wurde bei den O’Donnells um halb acht, an jedem Wochentag. Wenn es um das Essen ging, herrschten strenge Regeln.
Ihr Vater saß mit der Zeitung am Küchentisch. Judy küsste beide auf die Wange, bevor sie sich eine Tasse aus dem Schrank nahm und unter die Kaffeemaschine stellte.
Ihre Eltern waren in vielen Dingen altmodisch, aber wenn es um Kaffee ging, hatte ihr Vater – ein pensionierter Polizist – hohe Standards. Die deutsche Maschine begann lautstark, die italienische Bohnenmischung zu mahlen.
»War spät gestern«, stellte ihr Vater fest, ohne von seiner Zeitung aufzusehen. Judy zog eine Grimasse, die nur die Kaffeemaschine sehen konnte. Das Glück, mit siebenunddreißig im Haus der Eltern zu wohnen.
»Leroy«, ermahnte ihre Mutter ihn. »Soll ich dir etwas zum Frühstück machen, Schätzchen?«
»Nein danke, Mom. Kaffee reicht. Es ist gestern nämlich nicht nur spät geworden. Ich habe vielleicht auch ein oder zwei Bier zu viel getrunken.«
Ihr Vater sah auf und blickte sie mit zusammengekniffenen Augen über den Rand seiner Lesebrille hinweg an. Dieser Blick hatte in der Vergangenheit manch einen Straftäter in die Knie gezwungen. Sie seufzte und zog die Tasse unter der Maschine hervor. Auf dem Weg aus der Küche küsste sie ihn noch einmal auf die Wange. »Hört auf, euch Sorgen zu machen. Ich bin fast vierzig«, rief sie über die Schulter.
Sie suchte im Flur ihr Handy aus der Handtasche und trug den Kaffee auf die Veranda. Judy wollte wissen, ob Margery Livton sich schon gemeldet hatte. Dazu brauchte sie ihre neugierigen Eltern nicht. Sie setzte sich auf die Bank neben der Haustür und winkte ihrem Großvater zu, der im Garten vor seinem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Hecke schnitt. Er grinste und warf ihr eine Kusshand zu.
Judy trank einen Schluck Kaffee und warf einen Blick auf das Display ihres Handys. Eine Nachricht von ihrer Schwiegermutter, die fast so sehr wie sie selbst unter der bevorstehenden Scheidung litt. Flor wollte wissen, wie es ihr ging. Schnell tippte sie eine beruhigende Antwort und ging zu den beiden Anrufen über. Ein Anrufer mit einer Handynummer, die sie nicht kannte, hatte beim zweiten Versuch eine Nachricht hinterlassen. Sie hörte die Mailbox ab. Wie ein heißer Stich fuhr ihr Jareds Stimme in den Magen. Verdammt. Was hatte er angestellt, um in einem texanischen Sheriffoffice zu landen?
Mit einem Mal stieg Wut in ihr auf. Was dachte sich dieser Kerl? Dass er nur anzurufen brauchte, wenn er in Schwierigkeiten steckte, und sie losrennen und seine Probleme lösen würde? Okay, er war normalerweise nicht der Typ, der seine Probleme von anderen Leuten lösen ließ. Trotzdem erwartete er, dass sie ihm half. Warum rief er nicht einfach jemand anderen an? Einen seiner neuen Kollegen, von denen sie keinen einzigen kannte. Oder einen seiner alten Air-Force-Kumpel. Sie waren seit sieben Monaten kein Paar mehr. Seit drei Monaten versuchte sie, ihn dazu zu bewegen, die Scheidungsurkunde zu unterschreiben. Er tat es nicht. Jeder Tag, den er es hinauszögerte, machte die Situation zwischen ihnen unerträglicher. Er war bereit, sich endlich scheiden zu lassen, wenn sie nach Texas flog? Das konnte er haben. Er würde unterschreiben, oder sie würde ihm eigenhändig den Hals umdrehen und anschließend einen Weg finden, seine Leiche verschwinden oder es wie einen Unfall aussehen zu lassen.
Grimmig trank sie ihren Kaffee aus und brachte die Tasse zurück in die Küche. »Ich fliege nach Texas. Jared hat sich in irgendwelche Probleme manövriert.«
Ihre Mutter verharrte einen Moment mit dem Messer in der Hand über dem Gemüse, bevor sie sich langsam umdrehte. »Du fliegst für Jared nach Texas?«, fragte sie ungläubig.
»Der verdammte Mistkerl soll seine Probleme gefälligst selbst lösen«, knurrte ihr Vater. Er setzte seine Brille ab und starrte sie böse an. »Du wirst nicht für ihn durch das beschissene halbe Land fliegen.«
»Ich bin keine siebzehn mehr, Dad. Ich werde fliegen.«
Sie warf ihrer Mutter einen Blick zu. »Er ist im Gegenzug bereit, endlich in die Scheidung einzuwilligen. Wenn das durch ist, werde ich nie wieder auch nur den kleinen Finger für ihn krumm machen.«
Judy duschte, zog sich an und packte eine kleine Reisetasche. Auf dem Weg zum Flughafen hatte sie gerade noch Zeit, den Umschlag mit den Scheidungsunterlagen aus dem Haus zu holen, das sie zusammen mit Jared gekauft und renoviert hatte. Allein, und umgeben von all den Erinnerungen und wunderschönen Momenten der Vergangenheit, hatte sie es dort nicht mehr ausgehalten und war kurz nach der Trennung zu ihren Eltern gezogen. Inzwischen lebte sie seit sieben Monaten in ihrem alten Kinderzimmer. Sobald die Scheidung rechtskräftig war, würden sie das Haus verkaufen müssen. Keiner von ihnen konnte es auf Dauer allein halten. Sie öffnete die Tür und trat in den lichtdurchfluteten Flur, in den sie sich bei der Besichtigung als Erstes verliebt hatte. Damals hatte die Sonne, genau wie an diesem Tag, mit aller Kraft durch die rückseitigen Fenster geschienen und sie regelrecht in Licht gebadet. Rechts von ihr führte die Treppe ins Obergeschoss, links lagen Küche und Wohnzimmer. Am Ende des Flurs fanden sich die Gästetoilette und das Arbeitszimmer, das ursprünglich als Wintergarten gedient hatte. Auch dieser Raum war hell. Ihre Absätze klackerten auf dem Hartholzboden, als sie eintrat – und einen Niesanfall bekam. Seit dem Umzug zu ihren Eltern war hier nicht mehr geputzt worden. Alles war mit einer dünnen, aber unübersehbaren Staubschicht bedeckt.
Ihr Blick fiel auf den Boden, und sie stutzte. Waren das Schuhabdrücke? Vorsichtig ging sie in die Hocke und betrachtete die Spuren näher. Tatsächlich, durch den Staub fraßen sich die Abdrücke großer Männerschuhe. Vorsichtig wischte sie mit dem Zeigefinger durch eine der Spuren.
Kein Staub. Sie waren ganz frisch. Judy erhob sich wieder und ging zurück in den Flur. Neben ihrer eigenen Spur schlängelte sich die größere von der Haustür ins Arbeitszimmer. Sie folgte ihr bis zum Wandtresor, der hinter einem hübschen Blumendruck hing. Jared war vor Kurzem hier gewesen. Sie gab die Zahlenkombination ein und wartete, bis das Schloss mit einem Piepton aufsprang. Um den Umschlag ihres Anwalts herausziehen zu können, musste sie Jareds Waffenkoffer zur Seite schieben. Er fühlte sich erstaunlich leicht an. Neugierig öffnete sie ihn. Jareds Zweitwaffe fehlte. Das war also der Grund, aus dem er hier gewesen war. Wozu hatte er die Pistole gebraucht? War sie der Grund, dass er in Texas festsaß?
*
New York City
»Wir haben ihn.« Stanley schob sein Handy in die Hosentasche und trat an die Karte der USA. »Hier.« Er tippte nördlich von Huntsville, Texas auf den Plan. »Der Sheriff von Houston County – nicht zu verwechseln mit der Stadt Houston, wie ich gerade gelernt habe – hat ihn geschnappt. Anscheinend gab es einen anonymen Hinweis. Ein Richter hat Haftbefehl wegen Rauschgiftschmuggels erlassen. Paxton sitzt im Moment in Untersuchungshaft im Dooly State Prison.«
Das Team war von Florida nach New York zurückgeflogen und hatte sich den Tatort angesehen, an dem einer ihrer besten Männer sein Leben gelassen hatte – zumindest musste man aufgrund der festgestellten Blutmenge davon ausgehen. Campbell hatte die Kriminaltechniker und die Ermittlungsteams eingewiesen, während Tallford und er fieberhaft nach Paxton gesucht hatten. Schließlich hatte Stanley ihn in Texas ausfindig gemacht.
Campbell sah einen Moment mit unlesbarem Gesichtsausdruck auf die Karte, dann stand er auf. »Packen Sie Ihre Sachen und organisieren Sie einen Flug. Der Sheriff soll Paxton aus dem Untersuchungsgefängnis auf die Polizeistation zurückbringen. Ich will dort mit ihm reden, nicht im Knast. Abflug in einer Stunde.«
*
»Wir haben ihn.« Carlos beendete das Gespräch und schob sein Handy in die Gesäßtasche seiner Jeans.
Tomas saß an Estebans Schreibtisch und sah die Unterlagen durch, die sich darauf stapelten. Als Carlos sich auf den Besucherstuhl vor dem massiven Tisch fallen ließ, hob er den Blick. »Und?«
»Sieht so aus, als hätte er versucht, sich mit dem Kokain aus dem Staub zu machen. Er ist in Houston County, Texas, gelandet.«
»In Houston?«
»Nicht in der Stadt. Ein Stück nördlich auf einem alten, stillgelegten Flugplatz in der Nähe einer Stadt namens Crockett. Der Sheriff hat ihn erwischt. Martinez sitzt schon in U-Haft im Dooly State, dem örtlichen Knast.«
Tomas lehnte sich im Sessel seines Cousins zurück. Er musste Estebans Geschäfte führen, weil dieses Arschloch Martinez seinen Cousin umgebracht hatte. »Kennen wir jemanden in diesem Knast?«
Carlos nickte. »Wir kennen jemanden, der jemanden kennt.«
»Gut.« Tomas legte die Hände unter dem Kinn zusammen und stützte seinen Kopf darauf, wie es Esteban immer getan hatte. »Leite alles in die Wege. Ich will Emilio Martinez tot sehen.«
3. Kapitel
Dooly State Prison, Texas
Ein Staatsgefängnis war nichts, worüber sich Jared jemals Gedanken gemacht hatte. Er kannte einige Knäste. Bisher hatte er immer auf der anderen – der richtigen – Seite gestanden, hatte Inhaftierte vernommen oder sogar wegen Straftaten in einem Gefängnis ermittelt.
Darüber, wie es war, selbst in eine solche Anstalt eingeliefert zu werden, hatte er nie nachgedacht. Es war auch nicht notwendig gewesen – bis jetzt.
Er hätte gut darauf verzichten können, ging es ihm bei der Leibesvisitation durch den Kopf, die er über sich ergehen lassen musste. Bei der Air Force war er oft untersucht worden. Die Ärzte beim Militär waren nicht zimperlich. Trotzdem war es etwas anderes, sich in Anwesenheit zweier Aufseher nackt auszuziehen und von einem Mediziner untersuchen zu lassen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte, sich zu beherrschen. Einen Wutanfall würde er sich für den Zeitpunkt aufheben, an dem er wieder draußen war und herausgefunden hatte, wer ihm diesen Mist eingebrockt hatte.
»Mit wem werde ich mir die Zelle teilen?«, fragte er den Wärter, der ihn, nachdem er in den orangenen Overall mit der Nummer 5246 geschlüpft war, durch die langen Flure des Gefängnisses führte.
»Balding?« Der Mann zuckte die Achseln. »Hat seine Frau ein paar Mal zu oft verprügelt. Offenbar hat sie sich irgendwann tatsächlich getraut, ihn anzuzeigen. Sitzt noch knapp vier Jahre ab.«
Um einen Mann, der seine Frau schlug, musste er sich keine Gedanken machen. Das waren in der Regel miese kleine Feiglinge, die sich eher verpissten als sich mit gleichstarken anzulegen. Die Bewohner der Zellen, die sie passierten, bedachten ihn mit aufmerksamer Neugier. Jared schleppte die Bettwäsche und das Handtuch, das man ihm gegeben hatte, vor sich her und legte alles auf das untere der Doppelstockbetten in seiner neuen Unterkunft. Sein Mitbewohner musterte ihn vorsichtig vom oberen Bett aus.
Jared entschied sich, sich hier drinnen so wenig Feinde wie möglich zu machen. Er reichte dem Mann die Hand.
»Emilio Martinez«, stellte er sich mit seinem Undercovernamen vor. Wenn im Knast irgendjemand spitz bekam, dass er ein Cop war, brauchte er sich nicht mehr viele Gedanken darüber zu machen, wie er sein Leben nach der Pensionierung verbringen sollte.
»Paul Balding«, murmelte der andere. Er sah Jared nicht in die Augen, aber er sah genauso aus, wie Jared sich einen Mann vorstellte, der seine Frau schlug.
Obwohl er natürlich wusste, dass diese Vorurteile Quatsch waren und häusliche Gewalt in allen Gesellschaftsschichten vorkam. Paul Balding war auf den ersten Blick eine gescheiterte Existenz. Jared hätte seinen schicken Overall darauf verwettet, dass er seit Jahren arbeitslos war oder sich höchstens mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hatte. Er hatte zu oft und zu viel gesoffen und seinen Frust bei der Rückkehr aus der Kneipe an seiner Frau ausgelassen, die er vermutlich mit siebzehn heiratete, weil er sie noch vor dem Highschoolabschluss geschwängert hatte.
»Hi, Paul. Gibt es irgendetwas, worauf ich hier drin achten muss?«
»Am besten ist es, unauffällig zu bleiben.« Sein Zellengenosse legte sich zurück auf sein Bett und ließ die Beine über die Kante baumeln.