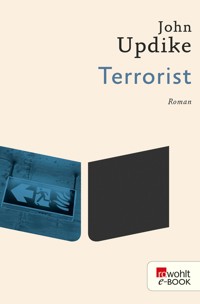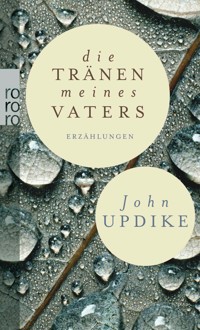7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tristão, ein schwarzer Junge aus den Slums, und die weiße Diplomatentochter Isabel verlieben sich am Strand von Copacabana. Auf der Flucht vor ihren entsetzten Familien stürzen sie sich in immer exotischere und sinnlichere Abenteuer. Eine beunruhigende Liebesgeschichte, ein Abenteuerroman mit magischen Zügen und bisweilen auch ein ironisch gebrochener Kolportageroman. Aber vor allem: eine Feier der Liebe, der Unschuld, der Treue. Also - ein Märchen? "Brasilien ist nichts als ein grandioser Roman. Fabelhaft spannend, fabelhaft schön, fabelhaft schlimm und fabelhaft lustig. Ein wahres Konfekt, weil kein Mensch satt wird davon." (Süddeutsche Zeitung) "Man liest das Buch mit Spannung von Anfang bis Ende." (FAZ) "Softporno? Im Gegentei, das ist Hardcore, grell und ungeschminkt." (Der Spiegel) "John Updike ist die lebhafteste, menschenfreundlichste Stimme der amerikanischen Literatur." (DIE ZEIT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
John Updike
Brasilien
Roman
Über dieses Buch
Tristão, ein schwarzer Junge aus den Slums, und die weiße Diplomatentochter Isabel verlieben sich am Strand von Copacabana. Auf der Flucht vor ihren entsetzten Familien stürzen sie sich in immer exotischere und sinnlichere Abenteuer. Eine beunruhigende Liebesgeschichte, ein Abenteuerroman mit magischen Zügen und bisweilen auch ein ironisch gebrochener Kolportageroman. Aber vor allem: eine Feier der Liebe, der Unschuld, der Treue. Also – ein Märchen?
«‹Brasilien› ist nichts als ein grandioser Roman. Fabelhaft spannend, fabelhaft schön, fabelhaft schlimm und fabelhaft lustig. Ein wahres Konfekt, weil kein Mensch satt wird davon.» (Süddeutsche Zeitung)
«Man liest das Buch mit Spannung von Anfang bis Ende.» (FAZ)
«Softporno? Im Gegenteil, das ist Hardcore, grell und ungeschminkt.» (Der Spiegel)
«John Updike ist die lebhafteste, menschenfreundlichste Stimme der amerikanischen Literatur.» (DIE ZEIT)
Vita
John Updike, 1932 in Shillington, Pennsylvania, geboren, studierte in Harvard, bevor er als Redakteur des «New Yorker», als Lyriker, Essayist und Romancier hervortrat. Er wurde unter anderem mit dem National Book Award, dem National Book Critics Circle Award, dem Prix Médicis und zweimal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
John Updike starb am 27. Januar 2009 in Beverly Farms, Massachusetts. Sein gesamtes Werk ist auf Deutsch im Rowohlt Verlag erschienen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel «Brazil» bei Alfred A. Knopf, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, April 2019
Copyright © 1996 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Brazil» Copyright © 1994 by John Updike
Umschlagkonzept any.way, Hamburg
Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung zodebala/iStock
ISBN 978-3-644-05661-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Du weißt, ’s ist aller Los: was lebt, muß sterben
Und Ewges nach der Zeitlichkeit erwerben.
DIE KÖNIGIN in Hamlet
Willkommen, brasilianischer Bruder – dein weites Feld ist dir bereitet;
Eine liebende Hand – ein Lächeln aus dem Norden – ein sonnig unverzagtes Heil!
WALT WHITMAN, Ein Weihnachtsgruß
1.Der Strand
Schwarz ist ein Sonderfall von Braun. Ebenso Weiß, wenn man genau hinsieht. Auf der Copacabana, dem demokratischsten, überfülltesten und gefährlichsten Strand von Rio de Janeiro, verschmelzen alle Farben zur jubilierenden, sonnensatten Farbe von Fleisch, die den Sand mit einer zweiten, lebendigen Haut überzieht.
An einem Tag nicht lange nach Weihnachten, Vor Jahren, als im fernen Brasilia die Militärs an der Macht waren, schien der Strand zu blenden, was an der Mittagsgrelle lag, an dem Gedränge der Leiber und an dem Salz, das Tristão in seinen Augen von den Brechern jenseits der Sandbank mitgebracht hatte. So heftig strahlte die Dezembersonne vom Himmel, daß in der Gischt der Brecher dort draußen jenseits der Sandbank immer neue, kleine, kreisförmige Regenbogen rund um den sprühenden Kopf des Jungen aufgeblitzt waren, wie Geister. Trotzdem fiel ihm, als er zu dem zerschlissenen T-Shirt zurückkehrte, das ihm auch als Handtuch diente, das hellhäutige Mädchen im hellen Bikini auf, das im Hintergrund stand, wo sich die Menschenmenge verlief. Hinter ihr erstreckten sich die Freiflächen für die Volleyballspieler und der Bürgersteig der Avenida Atlântica mit seinem wellenförmig gestreiften Mosaikpflaster.
Sie war in Begleitung eines anderen Mädchens, das kleiner und dunkelhäutiger war und ihr den Rücken mit Sonnenmilch einrieb. Unter den kühlen Berührungen krümmte sie den Rücken, drehte die Brüste nach einer Seite und die schmalen Halbkreise ihrer schon eingecremten Hüften nach der anderen. Es war weniger die Blässe ihrer Haut, die Tristãos schmerzenden Blick auf sie gelenkt hatte. Sehr helle Ausländerinnen aus Kanada oder Dänemark kamen an diesen berühmten Strand, auch Brasilianerinnen von deutscher oder polnischer Abkunft aus São Paulo oder aus dem Süden. Es war nicht ihre weiße Haut, sondern die provozierende Wirkung ihres knappen Badeanzugs, der mit der Haut verschmolz und den Eindruck völliger Nacktheit in aller Öffentlichkeit hervorrief.
Nicht völlig: Sie trug einen schwarzen Strohhut mit flacher Krone, aufgerollter Krempe und einem schimmernden, dunklen Band. Ein Hut von der Art, dachte Tristão, wie ihn ein Oberschicht-Mädchen aus Leblon zum Begräbnis ihres Vater tragen würde.
«Ein Engel oder eine Hure?» wandte er sich an seinen Halbbruder Euclides.
Euclides war kurzsichtig, und wo er nichts erkennen konnte, verbarg er seine Unsicherheit hinter philosophischen Fragen. «Kann ein Mädchen denn nicht beides sein?»
«Dieses Püppchen ist wie für mich gemacht», sagte Tristão impulsiv, aus jenen inneren Tiefen heraus, in denen sein Schicksal von jähen, unbeholfenen Schlägen geformt wurde, die ganze Stücke seines Lebens auf einmal losbrachen. Er glaubte an Geister und an das Schicksal. Er war neunzehn, und er war kein abandonado, denn er hatte eine Mutter, die aber eine Hure war und sogar noch schlimmer als eine Hure, denn im Suff schlief sie mit Männern ohne Geld und brütete Kaulquappenkinder aus wie ein menschlicher Sumpf aus Gleichgültigkeit und beiläufiger Lust. Er und Euclides waren im Abstand eines Jahres geboren worden. Keiner von ihnen wußte mehr von seinem Vater, als ihre völlig verschiedenen Gesichtszüge verrieten. Sie hatten gerade genug Zeit auf der Schule verbracht, um Straßen- und Reklameschilder lesen zu können, mehr nicht. Sie arbeiteten im Team, klauten und raubten, wenn der Hunger zu groß wurde, und fürchteten die Banden, die sie zu ihren Mitgliedern machen wollten, nicht weniger als die Militärpolizei. Diese Banden bestanden aus Kindern, die so gnadenlos und unschuldig waren wie Wolfsrudel. In Rio gab es damals weniger Verkehr und Gewalt und Armut und Verbrechen als heute, aber denjenigen, die damals dort lebten, erschien die Stadt lärmend und brutal und arm und kriminell genug. Schon seit geraumer Zeit hatte Tristão das Gefühl, daß er über die Kriminalität hinausgewachsen war und sich einen Weg in die Oberwelt suchen mußte, aus der die Reklame und das Fernsehen und die Flugzeuge kamen. Dieses ferne, bleiche Mädchen, so versicherten ihm nun die Geister, wies ihm den Weg.
Sein feuchtes, sandiges T-Shirt in der Hand, bahnte er sich den Weg zwischen den anderen fast nackten Körpern zu dem ihren, der im Bewußtsein, Beute zu sein, verkrampfter war als die übrigen. Auf seinem T-Shirt in verblichenem Orangerot stand LONE STAR, eine Werbung für ein Gringo-Restaurant in Leblon. In seiner schwarzen Badehose, die so eng anlag, daß sich die kompakte Wölbung seines Geschlechts abzeichnete, trug er in der kleinen Tasche, die für Münzen oder einen Schlüssel vorgesehen war, eine einschneidige Rasierklinge der Marke Diamant bei sich, die in einem Stück dicken Leders steckte, das er vorsichtig aufgeschlitzt hatte. Seine blauen Gummischlappen aus Taiwan hatte er unter einem Stranderbsenstrauch am Rand des Bürgersteigs versteckt.
Und außerdem, erinnerte er sich, besaß er noch einen weiteren Schatz: einen Ring, den er einer ältlichen amerikanischen Touristin vom Finger gerissen hatte, messingfarben, mit den Buchstaben DAR in einem kleinen Oval – drei Buchstaben, die ihn immer aufs neue verblüfften, denn sie bedeuteten «schenken». Jetzt wollte er diesen Ring der bleichen Schönheit schenken, deren Haut, während er näher kam, stolze Angst und Abwehr ausstrahlte. Obwohl sie aus der Ferne groß wirkte, war Tristão um eine Handbreit größer. Ein Duft, der von ihrer Haut ausging – die Sonnenmilch oder eine Ausdünstung ihrer Überraschung und ihrer Angst –, brachte ihm den Geruch des mütterlichen Sumpfs zurück, einen schwachen, leicht medizinischen Geruch aus einer Zeit, als er mit Fieber oder Würmern krank in der fensterlosen Dunkelheit ihrer Hütte in der favela gelegen hatte und seine Mutter, noch nicht vom Alkohol verwüstet, noch eine Quelle der Barmherzigkeit, ein einhüllender Mantel von Fürsorge gewesen war. Sie mußte die Arznei von dem Missionsarzt unten am Fuß des Hügels erbettelt haben, wo jenseits der Straßenbahnschienen die Siedlungen der Reichen begannen. Seine Mutter war damals selbst noch fast ein Mädchen, so fest im Fleisch wie dieses hier, wenn auch ohne solche ranken Glieder, und er, er mußte eine Miniaturausgabe seiner selbst gewesen sein, mit Füßen und Händen, die fett waren wie aufgehende kleine Brotlaibe, und mit Augen, die wie kleine schwarze Perlen aus seinem Schädel strahlten. Aber das lag außerhalb der Erinnerung, dieser Augenblick, der den köstlichen, sanften Duft gespendet hatte, welcher ihn erfüllte wie ein schläfriger Schrei. Jetzt erwachte er, hier in dieser sonnigen, salzigen Luft, windwärts vom Leib dieses schönen Püppchens.
Gegen einen leichten Widerstand seiner feuchten, vom Meerwasser runzlig gewordenen Haut zog er den Ring von seinem kleinen Finger, auf den er genau paßte. Die alte Gringa mit dem lockigen, blaugefärbten Haar hatte ihn an dem Finger getragen, auf den der Ehering gehört hätte, an der anderen Hand. Er hatte sie unter einer kaputten Straßenlaterne in Cinelândia erwischt, während sich ihr Ehemann in das Schaufenster eines Nachtklubs um die Ecke vertiefte, das voller Fotos von Mulattentänzerinnen hing. Als er ihr die Rasierklinge gegen die Wange preßte, wurde sie schlaff, als wäre sie selbst eine Hure, diese alte, blauhaarige Gringa, die nur noch wenige Jahre von der Grube trennten und die gleichwohl den größten Horror vor einem Kratzer in ihrem faltigen Gesicht hatte. Während Euclides die Tragegurte ihrer Handtasche durchtrennte, zog ihr Tristão den messingfarbenen Ring herunter, und für einen Augenblick verschlangen sich ihre Hände wie die Hände von Liebenden. Und jetzt streckte er diesen Ring dem fremden Mädchen entgegen. Ihr Gesicht hatte im Schatten des schwarzen Hutes etwas von einem Äffchen, wölbte sich über dem kräftigen Gebiß, das zu lächeln schien, auch wenn ihre Lippen, so wie jetzt, weit von einem Lächeln entfernt waren. Voll waren diese Lippen, vor allem die obere.
«Darf ich Ihnen dieses unbedeutende Geschenk überreichen, Senhorita?»
«Warum sollten Sie, Senhor?» Auch die Höflichkeit dieser Anrede hatte etwas von einem Lächeln, obwohl der Augenblick gespannt war und ihre untersetzte Begleiterin beunruhigt wirkte, eine Hand schützend vor die Brüste im Bikini-Oberteil legte, als wären sie Kostbarkeiten, die gestohlen werden sollten. Aber es waren nur braune Säcke voll Glibber, von keinem größeren Wert als dem gewöhnlichsten, die Tristãos unverwandten Blick für keine Sekunde abzulenken vermochten.
«Weil Sie schön sind und, was seltener ist, sich Ihrer Schönheit nicht schämen.»
«Sich zu schämen ist nicht der Stil der Zeit.»
«Und doch schämen sich viele Frauen noch immer. Zum Beispiel Ihre Freundin hier, die ihre schweren Kelche verbirgt.» Die Augen des minderen Mädchens blitzten, doch als sie einen Seitenblick auf Euclides warf, fiel ihre Empörung in sich zusammen, und sie mußte kichern. Tristão verspürte einen Anflug von Ekel vor diesem komplizenhaften, unterwürfigen Geräusch. Das weibliche Bedürfnis nach Unterwerfung machte seinem kriegerischen Geist allemal zu schaffen. Euclides rückte einen halben Schritt im Sand näher, akzeptierte den kampflos aufgegebenen Raum. Er hatte ein breites, finsteres Gesicht, unbarmherzig und verwirrt und lehmbraun. Sein Vater mußte zum Teil von indianischer Abstammung gewesen sein, während sich Tristãos Vater rein afrikanischen Blutes gerühmt hatte, so rein, wie Blut in Brasilien nur sein kann.
Das weißschimmernde Mädchen reckte weiter sein Kinn in die Luft und sagte zu Tristão: «Es ist gefährlich, schön zu sein. So haben die Frauen gelernt, sich zu schämen.»
«Von mir droht dir keine Gefahr, ich schwöre es. Ich will dir nichts Böses.» Der Schwur klang feierlich, die Stimme des Jungen tauchte probehalber in ein tiefes, männliches Register. Jetzt blickte sie ihm prüfend ins Gesicht: Die gerundeten Züge des Negers waren in einen Untergrund geschnitzt, der keine Völlerei gekannt hatte; aus den beherrschenden Augen drang ein kindliches Leuchten, die knochige Stirn ragte auf wie ein Festungswall, und über dem Schopf aus dicht gekräuselten Haaren lag ein Hauch von Kupfer, ein bloßer Anflug, der jedoch genügte, um einige Strähnen im weißen Feuer des Sonnenlichts hellrot aufleuchten zu lassen. Fanatismus war in diesem Gesicht zu lesen und Distanz – aber nichts Böses ihr gegenüber, wie er gesagt hatte.
Mit einer flüchtigen Bewegung berührte sie den Ring. «Schenken», entzifferte sie und streckte spielerisch die bleiche Hand aus, so daß er ihr den Ring überstreifen konnte. Der Ringfinger, an dem ihn die Amerikanerin getragen hatte, war zu dünn; erst der dickste, der Mittelfinger, bot den nötigen Halt. Sie hielt den Ring in die Sonne, so daß das ovale Feld aufblitzte, und präsentierte ihn ihrer Begleiterin. «Gefallt er dir, Eudöxia?»
Eudöxia war über die Vertraulichkeit entsetzt. «Gib ihn zurück, Isabel. Das sind üble Burschen, Straßenjungen. Bestimmt ist er gestohlen.»
Euclides warf Eudóxia einen Blick aus zusammengekniffenen Augen zu, als koste es ihn Anstrengung, ihre bewegliche, pummelige Gestalt und ihre Mischlingsfarbe zu erkennen, deren Terrakotta seinem Lehmbraun ähnlich war. Er sagte: «Die ganze Welt ist gestohlenes Gut. Eigentum ist Diebstahl, und diejenigen, die am meisten stehlen, machen die Gesetze für uns übrige.»
«Die Jungs sind in Ordnung», beruhigte Isabel ihre Begleiterin. «Was kann es uns schaden, wenn wir ihnen erlauben, sich zu uns zu legen, während wir uns sonnen und miteinander schwatzen? Wir langweilen uns mit uns selbst, du und ich. Außer unseren Badetüchern und unseren Kleidern haben wir nichts, was sie uns stehlen könnten. Sie können uns von ihrem Leben erzählen. Oder Lügen – das wäre genauso amüsant.»
Es kam so, daß Tristão und Euclides fast nichts von ihrem Leben erzählten, dessen sie sich schämten: einer Mutter, die keine Mutter war, und eines Zuhauses, das diesen Namen nicht verdiente. Sie kannten kein Leben, nur ein Hetzen und Hasten, das allein von ihren leeren Mägen angetrieben wurde. Statt dessen breiteten die Mädchen, miteinander plaudernd, als hätten sie keine Ohrenzeugen, die luxuriösen und leichtgewichtigen Einzelheiten ihres Daseins aus, als enthüllten sie seidene Unterwäsche. Sie klatschten über die Nonnen an der Schule, die sie gemeinsam besuchten – darunter solche, die so männlich waren, daß ihnen Schnurrbärte sprossen; solche, die sie für Lesbierinnen mit einer Pseudogattin hielten; solche, die Hahn im Korb, und solche, die Hennen waren; solche, die ihre Schülerinnen zu verführen trachteten, und solche, die die Liebessklavin eines Priesters waren, und solche, die den Gärtnern Geld fürs Vögeln gaben, und solche, die die Wände ihrer Zellen mit Bildnissen des Heiligen Vaters gepflastert hatten und vor dessen schmallippigem, sorgenschwerem Antlitz masturbierten. Es klang wie aus einem Buch, dem Buch des Sex, verziert mit sprachlichen Stickereien, in die die flinken Finger eines Nähkränzchens den blitzenden Silberfaden hellen Mädchenlachens verwoben hatten. Tristão und Euclides, die in einer Welt lebten, in der Sex eine Armenspeisung war wie Feuerbohnen oder farinha, nicht mehr als ein paar abgegriffene Cruzeiros auf einem weinflekkigen Holztisch wert, und die ihre Jungfräulichkeit schon verloren hatten, ehe sie noch Teenager waren, lauschten mit offenen Mäulern, verzaubert von den phantastischen Vermutungen, die die Mädchen, bis zum Tränenlachen belustigt, zusammenspannen.
Bei der Schilderung ihrer klösterlichen Schule hatten sie ein verbotenes Radiogerät erwähnt, das eine der Nonnen beschlagnahmt hatte, was Tristão die Gelegenheit gab, sein Wissen über Samba und Choro, über Forró und Bossa Nova und über die Stars – Caetano, Gil und Chico – einzuflechten, die jeder dieser Musikstile hervorgebracht hatte. Der ganze elektronische Himmel über ihnen, in dem Sänger und Seifenopernstars und Fußballhelden und die Superreichen wie flitterbunte Engel herumschwebten, senkte sich herab und wurde zu einem gemeinsamen Grund, auf dem sie standen. Funken von Liebe und Haß, die leidenschaftlichen Urteile der Jugend, flogen zwischen den vieren hin und her, die in ihrer Ferne von jener Welt so gleich waren wie in ihrem Besitz eines Körpers, zu dem vier Gliedmaßen, ein Augenpaar und eine grenzenlose Haut gehörten. Wie fromme Bauern aus der Alten Welt glaubten sie daran, daß dieser Himmel, der ihnen seine Neuigkeiten auf unsichtbaren Ätherwellen übermittelte, sein beseeltes, lächelndes Gesicht jedem einzelnen von ihnen ganz persönlich zuwandte, so wie die unfaßbare Kuppel des blauen Himmels sich exakt über jeden wölbt, der seinen Blick nach oben richtet.
Die Hitze des Sandes durchglühte sie von unten; eine unwiderstehliche Trägheit ließ das Gespräch langsam verebben. Als sich Euclides und Eudóxia zögernd, jedoch gleichzeitig erhoben und zum Wasser hinuntergingen, um zu schwimmen, ließen sie die beiden anderen in angespanntem Schweigen zurück. Isabel streckte ihre Hand, an welcher der geraubte Ring glitzerte, nach der Innenfläche seiner Hand aus, die hell war wie Silberpolitur. «Willst du mit mir kommen?»
«Ja. Immer», sagte Tristão.
«Dann komm.»
«Jetzt?»
«Jetzt ist die Zeit», sagte sie und blickte mit ihren blaugrauen Augen in die seinen, während sie ihre volle Oberlippe ernst und nachdenklich schürzte, «für uns.»
2.Das Appartement
Isabel hatte ein hauchdünnes Strandkleid in einem Maracujafarbton bei sich, das sie jedoch nicht anzog, als sie den Strand verließ. Sie streifte nur dünne weiße Ledersandalen über, als sie den berühmten Bürgersteig der Avenida Atlântica mit seinem geschwungenen, schwarzweißen Mosaikmuster betrat. Das Kleid und ihr Badetuch trug sie zusammengerollt im angewinkelten linken Arm, so daß mindestens ein Passant einen Seitenblick nach unten warf, wo er ein in fröhliches Bunt gewickeltes Baby vermutete. Ihr dunkler Strohhut – so dunkel, als wäre er mit dem Saft von Genipapo-Beeren gefärbt – schwebte vor Tristão wie eine fliegende Untertasse, die freien Enden des schwarzen Bandes flatterten. Sie bewegte sich rascher, in einer sportlicheren Gangart, als er erwartet hatte, so daß er Wechselschritte und Sprünge einlegen mußte, um nicht den Anschluß zu verlieren. Sein Gefühl für Schicklichkeit hatte ihn veranlaßt, sein sandiges T-Shirt mit dem LONE-STAR-Aufdruck anzuziehen; seine zerfledderten blauen Gummischlappen, die er unter dem zählebigen kleinen Strauch hervorgeholt hatte, schlugen lose gegen seine Sohlen.
Das bleiche Mädchen, das die Länge seiner bloßen Beine um so größer erscheinen ließ, bewegte sich mit der blinden Zielstrebigkeit einer Schlafwandlerin, als könnte ein Augenblick des Zögerns ihre Entschlossenheit zunichte machen. Sie marschierte in südlicher Richtung, auf das Fort zu, dann schwenkte sie nach rechts in eine Straße ein, die nach Ipanema führte – die Avenida Rainha Elisabete oder die Rua Joaquim Nabuco, er war zu abgelenkt oder zu ängstlich, um es zu registrieren. Dort, im Schatten von Gebäuden und Bäumen, zwischen Geschäften und Restaurants und den verspiegelten Aluminiumfassaden der Banken, wo Portiers und Wachmänner in Uniform auf Posten standen, schimmerte ihre fast völlige Nacktheit noch unheimlicher und zog noch mehr verstohlene Blicke auf sich. Tristão rückte näher, um sie zu beschützen, doch angesichts ihrer tranceartigen Unbeirrbarkeit, in der sich ihre Hand eiskalt anfühlte, kam er sich fremd und tolpatschig vor. In dieser Welt von Appartementhäusern und bewachten Straßen war sie seine Führerin. Jetzt bog sie unter einem kastanienbraunen Baldachin mit einer Hausnummer in ein dunkles Foyer ein, wo ein Japaner hinter einem Empfangspult aus schwarzem, grüngeädertem Marmor überrascht die Augen zusammenkniff, ihr dann aber einen kleinen Schlüssel aushändigte und auf einen Knopf drückte, der mit einem Summton die nach innen führende Glasschiebetür öffnete. Als er den Eingang durchschritt, fühlte sich Tristão wie von Röntgenstrahlen durchleuchtet, die Rasierklinge in seiner engen, schwarzen, feuchten Badehose vibrierte, genau wie sein Penis, der zu einem gekrümmten Cashewkern geschrumpft war.
Der Aufzug, dessen Türen mit einem silbrigen, dreieckig gemusterten Metall verkleidet waren, glitt nach oben: ein Messer, das aus seiner Scheide gezogen wird. Da war ein kurzer Korridor mit gestreiften Wänden in einer gedämpften Variante der fruchtigen goldenen Farbe ihres zusammengeknüllten Strandkleids. Eine Kassettentür aus rotem Brasilholz, glänzend blank poliert, öffnete sich ihrem kleinen Schlüssel, der nicht größer war als seine Rasierklinge. Drinnen herrschte das Schweigen erlesenster Materialien – Vasen und Teppiche und gefranste Kissen und die goldgeprägten Lederrücken von Büchern. Er hatte sich noch niemals in einem solchen Raum befunden. Er hatte das Gefühl, daß ihm Bewegungsfreiheit und die Luft zum Atmen genommen wurden. «Wer wohnt hier?»
«Mein Onkel Donaciano», sagte das Mädchen. «Mach dir keine Sorgen, du wirst ihm nicht begegnen. Er arbeitet den ganzen Tag, im Centro. Oder er spielt Golf und trinkt mit seinen Geschäftsfreunden. Das ist seine eigentliche Arbeit, mit den Freunden zu trinken. Ich werde dem Hausmädchen sagen, daß sie uns auch etwas zu trinken bringen soll. Oder möchtest du vielleicht etwas essen?»
«Oh, nein, Senhorita. Ich bin nicht hungrig. Ein Glas Wasser oder einen kleinen suco, mehr brauche ich nicht.» Sein Mund war staubtrocken geworden, während er sich umsah. So vieles gab es hier, das man stehlen konnte! Von einem einzigen silbernen Zigarettenetui, von zwei kristallenen Kerzenleuchtern konnten er und Euclides einen ganzen Monat leben. Die Gemälde, die Rechtecke und Kreise und wilde Farbspritzer zeigten, hatten sicher keinen großen Wert, es sei denn für den Maler im Augenblick des Malens, aber auf den Rücken der Bücher sah er Buchstaben aus purem Gold.
Er staunte über die Höhe der Regale, die bis zur Größe einer Palme aufragten. Dieser Raum der Wohnung hatte Galerien an zwei Seiten und als Decke eine kuppelförmige Rose aus mattierten, gläsernen Blütenblättern, aus deren Mitte an einer Kette, die so lang war wie die des Ewigen Lichts in einer Kirche, ein Kronleuchter mit s-förmig geschwungenen Messingarmen herabhing. Sich im Inneren eines Gebäudes zu befinden hatte für Tristão immer die lichtlose Höhle einer Elendshütte bedeutet. Hier war es so hell, daß er das Gefühl hatte, sich im Freien aufzuhalten, geschützt vor jedem Luftzug in einer lichtdurchfluteten Stille, die ihn gefangennahm.
«Maria!» rief Isabel mit halber Stimme.
Die stämmige junge Frau, die ohne Hast, als hätte sie einen weiten Weg durch viele Zimmer hinter sich, zur Tür hereinkam, blickte voller Verachtung, mit einem Aufflackern von Angst in den tiefliegenden Augen, auf Tristão. Sie hatte dicke Wa.ngen, ein indianisches Erbteil oder die Folge von Schlägen, mit Pockennarben darauf. Ihr gemischtes Blut hatte der Haut den düsteren Farbton von Schnupftabak verliehen. Bestimmt hätte dieses Hausmädchen seine diebischen Gedanken lesen können und sich darüber erhaben gefühlt. Als ob ihr Leben in den Häusern der Reichen, ihr Auftritt in den adretten Kleidern, die ihr die Reichen zur Verfügung stellten, nicht selbst schon eine Art Diebstahl war.
«Maria», sagte Isabel in einem Tonfall, der weder herrisch noch zaghaft klingen sollte, «bring uns zwei vitaminas mit Bananen oder Avocados, wenn welche da sind. Für mich nichts weiter, aber für meinen Freund noch irgendwas zu essen, vielleicht etwas von dem, was du dir selbst zu Mittag gemacht hast? Das ist mein Freund Tristão.» Zu ihm gewandt, fragte sie: «Ein Sandwich?»
«Das ist wirklich nicht nötig, Ehrenwort», protestierte der Junge mit aller Tapferkeit, die seine ragende Stirn, die beherrschenden hellen Augen, die Tiefen hinter seinem Blick versprachen.
Doch als das Essen auf dem Tisch stand – aufgewärmter acarajé mit gebackenen Bällchen aus vatapá, Shrimps und Paprika –, aß er wie ein Wolf. Er hatte seinen Hunger dazu erzogen, sich nicht bemerkbar zu machen; doch wenn es etwas zu essen gab, erwachte er zur Wildheit, und so blieb nichts, nicht einmal ein Fleck, auf dem Teller übrig. Sie schob ihren eigenen, noch halbvollen Teller auf dem niedrigen Intarsientisch zu ihm hin. Er aß auch ihn noch leer.
«Kaffee?» fragte Maria, als sie zum Abräumen kam. Sie strahlte jetzt weniger Mißgunst aus, dafür einen leicht verschwörerischen Duft wie nach dendê-Öl, das der Küche des Nordens ihr Aroma verleiht. Vielleicht war irgend etwas faul an diesem seltsamen Haushalt aus einem jungen Mädchen und dessen Onkel, etwas, das der Haushälterin mißfiel. Sie war, wie es die niedrig Geborenen sind, offen für das Unheil und den Wandel; die Welt ist für sie keine kostbare Reliquie unter Glas, die unverändert erhalten werden muß.
«Ja, und dann laß uns allein», sagte Isabel. Sie hatte ihr Hütchen abgenommen und ihr langes, blond schimmerndes Haar unterstrich ihre Nacktheit, gab ihm das Gefühl der Blendung wieder, das er empfunden hatte, als er mit schmerzenden Augen aus dem Ozean gestiegen war.
«Magst du mich?» fragte sie und wurde rot und schlug die Augen nieder.
«Ja. Mehr als das.»
«Hältst du mich für eine Draufgängerin? Für ein schlimmes Mädchen?»
«Ich halte dich für ein reiches Mädchen», erwiderte er, wobei er sich umsah, «und Reichtum macht die Leute komisch. Die Reichen können tun, was sie wollen, und daher kennen sie den Wert der Dinge nicht.»
«Aber ich bin nicht reich», sagte Isabel in einem neuen, mürrisch-gereizten Tonfall. «Mein Onkel ist reich und mein Vater auch, der weit weg in Brasilia sitzt, aber mir selbst gehört überhaupt nichts – sie halten mich wie eine Sklavin im goldenen Käfig, die eines Tages, sobald die Nonnen mir das Abschlußzeugnis ausgestellt haben, mit einem jungen Mann verheiratet werden wird, der genauso ist wie sie, genauso aalglatt und höflich und gefühllos.»
«Wo ist deine Mutter? Wie denkt sie über deine Zukunft?»
«Meine Mutter ist tot. Der kleine Bruder, den sie mir schenken wollte, hat sich auf dem Weg nach draußen mit der Nabelschnur erdrosselt, und in seinem Todeskampf hat er ihr die Gebärmutter zerfetzt. So hat man mir das jedenfalls erzählt. Ich war vier, als es passierte.»
«Wie traurig, Isabel.» Er hatte ihren Namen von Eudóxia gehört, aber nun gebrauchte er ihn zum erstenmal. «Du hast keine Mutter, und ich habe keinen Vater.»
«Wo ist dein Vater?»
Tristão zuckte die Achseln. «Vielleicht ist er tot. Aber bestimmt ist er auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Meine Mutter hatte viele Männer und weiß nicht genau, welcher davon er war. Ich bin neunzehn, also liegt es zwanzig Jahre weit zurück. Sie trinkt viel cachaça und kümmert sich um nichts.» Trotzdem hatte sie ihm einmal die Arznei besorgt, die er brauchte. Sie hatte ihn gestillt und Läuse von seinem Kopf geklaubt und in seiner Scheiße nach Würmern gesucht.
Um ihn zu sich zurückzurufen, verkündete Isabel: «Ich bin achtzehn. Noch.»
Er lächelte und wagte es, die Hand auszustrecken und ihre leuchtenden Haare zu berühren, die voller kleiner Lichter waren, wie Rio bei Nacht, wenn man vom Zuckerhut hinunterblickte. «Wie schön. Ich würde dich nicht älter oder reicher wollen.»
Sie duldete seine Berührung, ohne zurückzuweichen, aber sie erwiderte sein Lächeln nicht. «Du hast mir diesen Ring geschenkt.» Sie hielt die Hand empor, an deren dickstem Finger das Oval aus Messing steckte. «Jetzt muß ich dir auch etwas schenken.»
«Das ist nicht nötig.»
«Das Geschenk, das ich im Sinn habe, wäre auch ein Geschenk für mich selbst. Die Zeit ist reif. Die Zeit in meinem Leben ist da.»
Sie stand vor ihm und reckte ihre Lippen gegen die seinen, weniger ein Kuß als die Imitation von Küssen, die sie im Fernsehen oder in Illustrierten gesehen hatte. Ihr bisheriges Leben hatte darin bestanden, die Geschichten anderer Menschen zu verfolgen. Jetzt erschuf sie sich ihre eigene Geschichte. Sie führte ihn zu einer Wendeltreppe aus sandig rot gestrichenem Metall, die ins Obergeschoß hinaufführte. Ihr Körper erschien ihm, als sie sich vor und über ihm hinaufschraubte, perspektivisch verkürzt und in Scheiben geschnitten, schmale Dreiecke aus Fleisch, die halb verdunkelt zwischen den Dreiecken der Treppenstufen aufblitzten. Mit einem Finger spielerisch über das Geländer gleitend wie über eine Wasseroberfläche, lief Isabel die Galerie entlang, die sich in Höhe des schlangenarmigen Kronleuchters an der Wand erstreckte, und bog von dort in ein Zimmer ein, das ihr Zimmer war, noch voller Plüschtiere aus ihren Mädchenjahren, die Wände dekoriert mit Postern, die langhaarige Popsänger aus England zeigten. Der Druck auf Tristãos Lungen schien hier weniger belastend, so als wehte der Wind des Geldes zwischen diesen kindlichen Wänden weniger stürmisch. Die winzigen, hellen Fetzen von Isabels Bikini wurden mit einem Schlängeln der Schultern und der Hüften abgestreift, eine beiläufige, gewohnte Tanzfigur ihres schlanken Körpers, die sie mit einem gleichermaßen herausfordernden wie fragenden Lächeln ihres tapferen Äffchengesichts vollführte. Sie wirkte jetzt kaum nackter als zuvor. Noch niemals hatte er einen Schamhaarbusch wie ihren gesehen, so durchscheinend und ungekräuselt. Der Luft und seinen Blicken ausgesetzt, versteiften sich ihre Brustwarzen, die von Scheiben aus hellbrauner Haut umgeben waren. «Wir müssen uns säubern», sagte sie nachdrücklich zu ihm.
Die Wasserhähne in der marmornen Duschkabine waren zahlreich und ließen das Wasser auf die verschiedensten Weisen sprudeln – als Gebinde aus feinen Nadeln oder mit dem Trommelschlag schwerer Tropfen im Rhythmus eines jagenden Pulses. Als er mit ihr unter dem warmen Wasserfall stand, ihre Haut einseifte, so daß die nachgiebige Seidentextur unter einem weißen Schaumfilm verschwand, und sich dann umgekehrt von ihr einseifen ließ, fühlte er, wie sich sein Cashewkern in eine Banane und schließlich in eine pulsierende Yamswurzel verwandelte, die fast unter ihrem eigenen Gewicht zerbarst. Sie seifte ihn an dieser Stelle besonders gründlich ein, neigte ihren Kopf in den trommelnden Wasserstrahl, um die angeschwollenen Adern, die blauschwarze Haut, die rotviolette, herzförmige, einäugige Eichel genauer betrachten zu können. Während dieser Untersuchung enthüllte ihr vornüberfallendes Haar ihre rosige – nicht weiße, wie er es erwartet hatte – Kopfhaut. Als die Dusche abgedreht war, sagte sie, noch immer in Betrachtung versunken, mit den Fingern einer Ader nachfühlend: «So sieht er also aus. Ich mag ihn. Er ist häßlich, aber unschuldig, wie eine Kröte.»
«Noch nie?» fragte er, unangenehm berührt und dankbar, daß er gerade hinter dem wolkigen Weiß eines riesigen Badetuchs verborgen war, das sie aus einem Schrank geholt hatte. In den Spiegeln, die an allen Wänden dieses Raumes hingen, sah er sich selbst in weiße und schwarze Schnitzel zerschnitten. Sein Gesicht war das strenge Gesicht eines Kriegers, gleichzeitig aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen.
«Nein, noch nie. Macht dir das angst, Tristão?»
Ja, das machte es, denn wenn sie noch Jungfrau war, wurde das Ficken mit ihr zu etwas Religiösem, gleichbedeutend mit der Übernahme einer untilgbaren Schuld. Doch sein Blut, das hilflos in der Yamswurzel pulsierte, die er unter dem togagleichen Badetuch vor sich hertrug, trieb ihn zu dieser Erscheinung hin, die ihr Badetuch höher geschürzt hatte, wie einen Umhang, der die untere Hälfte ihres Körpers, ihre stramm wippenden Hinterbacken entblößte. Als sie sich an der Marmorschwelle des Badezimmers bückte, um seine kleine, schwarze Badehose aufzuheben, die er dort fallen gelassen hatte, teilte sich ihr weißer Hintern, und eine senkrechte, braun ausgekleidete Spalte wurde zwischen den Backen sichtbar, eine unveränderliche Hautfärbung rund um ihr Arschloch, vor der er einen leichten Ekel empfand.
Als sie seine Badehose dann ausschüttelte und zusammenlegte, um sie säuberlich aufzuhängen, stieß sie einen Schrei der Überraschung aus. Die Rasierklinge in der kleinen Seitentasche war aus ihrer behelfsmäßigen Scheide gerutscht und hatte ihr einen Schnitt in den Daumen versetzt. Sie zeigte ihm die weiße Haut mit dem Wirbel feiner Linien, das träge Rubinrot der Wunde. Auch dies machte ihm angst, weil es eine Prophezeiung war: Er würde ihr Schmerzen bereiten.
Und doch setzte sie, mit einem verwundeten Gesichtsausdruck am Daumen lutschend, Blutflecken in die Ecke ihres endlosen Badetuchs tupfend, unbeirrt den Weg zu ihrem Jungmädchenbett fort, einem schmalen Bett mit einer leichten Steppdecke, deren zarter Grünton Tristão an das Porzellan der Wasserkrüge und der Nachttöpfe in den favelas erinnerte, an den schmalen Strich aus zartem Schaum knapp unter dem Rand. Über dem Messinggestänge des Kopfteils hing ein kleines, süßliches Bild der Heiligen Jungfrau, die ihren Heiligenschein wie einen in den Nacken geschobenen Sombrero trug und ein unnatürlich ernstes und fettes Baby auf dem Schoß hatte, das mit seinen dicken Fingern eine unbeholfene Geste machte. Mit einem feierlichen und entschlossenen Ausdruck in ihrem Äffchengesicht nahm Isabel das Bild von der Wand und legte es unter das Bett. Als sie sich nackt auf die Steppdecke legte, verloren einige glasäugige Plüschtiere den Halt. Sie stopfte sie in eines von mehreren Regalfächern neben dem Bett, die in den verschiedenen Farben des Regenbogens gestrichen waren, einem Kind zu gefallen. Sie ging zügig und geschickt zu Werke und ließ sich endlich in die genaue Mitte ihres Bettes fallen, so daß für ihn nur ein Platz zum Hinlegen blieb, nämlich auf ihr. Doch als er gehorchte, preßte sie ihre Fingerspitzen gegen seine Brust, als wollte sie ihn fernhalten, den Augenblick hinauszögern. Ihre Augen, ein Graublau aus Hunderten von fragilen Fasern, starrten fast zornerfüllt in die seinen. «Ich habe nicht gedacht, daß er so groß ist», sagte sie.
«Wir müssen jetzt gar nichts machen. Wir können uns einfach festhalten und uns streicheln und uns unsere Geschichten erzählen. Wir können uns morgen wiedersehen.»
«Nein. Wenn wir warten, wird nichts geschehen. Jetzt ist die Zeit für uns.»
«Wir können uns morgen wieder treffen, am Strand.»
«Wir werden den Mut verlieren. Andere werden dazwischenkommen.»
Unsicher, in seinem Gesicht nach Anleitung suchend, spreizte sie ihre weißen Schenkel.
Sie fragte: «Hast du schon viele Mädchen gehabt?»
Er nickte und schämte sich, daß es nicht nur Mädchen gewesen waren, sondern am Anfang auch Frauen, doppelt so alt wie er, alte Trinkerinnen, Freundinnen seiner Mutter, die ihm ihr Stückchen Fleisch hingehalten hatten, wie man einem possierlichen kleinen Ferkel sein Futter hinwirft.
«Dann kannst du mir vielleicht einen Rat geben?»
Seine Eichel ruhte wie ein violettes Herz, das einem Lebewesen von der Größe eines Hasen aus dem Leib gerissen worden war, auf der durchscheinend behaarten Wölbung ihres Schamhügels. Normalerweise nahm die Frau, bei der er lag, sie in die Hand und führte sie ein. Dieses Mädchen hier hob ihm ungeschickt den Hintern entgegen und blickte ihm hilfeheischend in die Augen. Sie sah die dunkle Iris mit dem Schwarz der geweiteten Pupillen verschmelzen. Sie hörte, wie seine Stimme wieder in das tiefe, männliche Register tauchte: «Mein Rat ist, daß du dich fallen läßt, bis zu dem Punkt, an dem meine Lust und deine Lust verschmelzen. Es wird nicht leicht sein beim erstenmal. Es wird weh tun.» Sein Atem roch nach dem würzigen acarajé
Er ließ seine Hand nach unten gleiten, wo sie erkundete und die Stelle fand, an der sich ihre Lippen klebrig öffneten, und die Führung übernahm. Gleich darauf, als zweifelte er an seinem guten Rat, fragte er: «Tut es dir weh?»
In ihrem Bemühen, die instinktive Abwehr ihres Körpers zu überwinden, hatte sich Isabel unter ihm verkrampft. Ein warmer Schweißfilm war plötzlich überall auf ihrer bleichen Haut erschienen. Ihr Kinn zuckte, als wäre es der einzige Teil ihres gepfählten Leibes, der sich bewegen durfte. Auch ihm brach der Schweiß aus angesichts ihrer jungfräulichen Enge. Es war eine Last, ein Liebender zu sein und nicht nur ein putziges kleines Schwein, das sich an einem feuchten Stückchen Fleisch gütlich tat. Doch hinter der dunklen Mauer, vor der sie standen, lag ein Paradies, das wußte er.
«Soll ich aufhören? Ich kann mich zurückziehen.»
Ihr Kinn zuckte noch wütender hin und her, was nein bedeutete. «Mach weiter, um Himmels willen», sagte sie trotzdem.
Er drängte sich hart in ihre Finsternis hinein, und mit jedem Stoß wurde der rote Schleier hinter seinen zusammengepreßten Augenlidern dunkler. Tief in seinem Innerenjenseits des Ortes, wo sein Hungergefühl hauste, versuchte sich ein versperrter Durchlaß einem Lichteinbruch zu öffnen, einem immer steigenden Druck, der den Atem nahm und frösteln machte und seine Fersen tanzen ließ, als die Grenze erreicht und, im Aufschwung einer alle Welt verschlingenden Empfindung, übersprungen war. Die Zuckungen seines Höhepunkts schreckten sie aus ihrem Körper auf; staunend und zärtlich glitten ihre weißen Hände über seinen gekrümmten schwarzen Rücken, als wollten sie die Anstrengung des großen Durchbruchs lindern, den er in ihren nachgiebigen Tiefen, im Gespinst ihrer seidigen Glieder genossen hatte. Sein Keuchen verebbte; seine Stimme wurde vernünftig, teilnehmend. «Hat es weh getan?»
«Ja, das hat es, bei Gott. Genau, wie es die Nonnen vorhergesagt haben, wegen Evas Sündenfall.» Doch ihre Beine, ihre Arme schlangen sich fester um ihn, als sie seine ritterliche Absicht bemerkte, ihren Körper von der Last des seinen zu befreien.
«Liebe Isabel», stammelte er, um bessere Worte verlegen und noch immer voller Scheu, wenn er ihren Namen aussprach. Daß er eine Aufgabe heldenhaft bestanden hatte, stellte ihn noch nicht auf die gleiche Stufe mit dieser Patrizierschönheit. Als es ihm endlich gestattet wurde, sein Glied herauszuziehen, war es mit ihrem Blut bedeckt, und sie schien ihm Vorwürfe machen zu wollen, weil er die schaumig-grüne Satinsteppdecke befleckte.
«Maria wird es sehen und meinem Onkel erzählen!» rief sie.
«Ist sie seine Spionin?»
«Sie sind – Freunde.»
Sie war hochgesprungen und hatte aus dem Badezimmer einen feuchten Waschlappen geholt, mit dem sie an dem Flekken herumrieb und -tupfte. Es war ein Flecken von unregelmäßiger Form, dem er mit seinem Angebot, sich zurückzuziehen, die Umrisse eines Kelchs verliehen hatte, mit einer Schale, einem Fuß und einem schmalen Stiel dazwischen.
«Du hättest ein Handtuch unterlegen sollen», sagte er, verärgert, weil sie ihm die Schuld an ihrem eigenen Blut zu geben schien und weil sie von dem großen Augenblick, den sie gemeinsam erlebt hatten, so hastig zu hausfraulichem Kleinkram zurückkehrte.
Sie hörte den beleidigten Tonfall und beeilte sich, seinem verletzten Stolz Tribut zu zollen. Fügsam ließ sie von der Bettdecke ab und machte sich mit dem rot verfärbten Waschlappen an dem zu schaffen, was wieder die Gestalt einer Cashewnuß anzunehmen begann. Wie es zusammenschrumpfte, sikkerte ihr Jungfrauenblut bräunlich zwischen die Falten der auberginefarbenen Haut. Ungeduldig, weil sie den Schmerz zwischen ihren Schenkeln um so deutlicher spürte, je mehr sich das grandiose Schauspiel ihrer selbst, rücklings hingestreckt im Akt der Defloration, verflüchtigte, drückte sie ihm den feuchten Lappen in die Hand.
«Hier, Tristão. Das ist auch deine Schweinerei.»
Obwohl er von dem hochfliegenden Stolz durchdrungen war, den man selbst unter den ärmsten Männern Brasiliens findet, nahm Tristão den Waschlappen entgegen, und er verstand ihre Gefühle. Ihr war schwindelig angesichts dessen, was sie gewagt hatte und was nicht mehr rückgängig zu machen war. Solche unbeherrschbaren Stimmungen sind der Preis, den Männer zahlen müssen für die unirdische Schönheit der Frauen und für ihren unvermeidlichen Schmerz.
Als Tristão, bekleidet mit seiner noch feuchten Hose, aus dem Badezimmer zurückkam, trug Isabel immer noch nichts weiter als den DAR-Ring und auf ihrem blonden Schopf einen Strohhut, ähnlich dem schwarzen, den sie am Strand getragen hatte, aber knallrot gefärbt. Auf den regenbogenbunten Regalen, die zwei der vier Wände ihres kleinen Zimmers einnahmen, stapelten sich vielerlei neckische Hüte, die sie, wie den Überfluß an Spielzeugen, von einem Onkel geschenkt bekommen hatte, für den sie immer ein kleines Mädchen bleiben sollte.
Sie legte den Kopf schräg und nahm die Pose einer Nachtklubtänzerin ein, mit herausgestreckten Hinterbacken und einem angewinkelten Knie, unter dem sich der Fuß auf die Zehenspitzen wölbte. Ihre Zehen verfärbten sich weiß unter der Anspannung der Pose, und am inneren Schenkel des angezogenen Beins wurde ein trocknender Streifen Blut sichtbar. Wie wunderbar war es doch, dachte sie, sich einem Mann nackt zeigen zu können und sich nicht vor ihm schämen zu müssen. «Magst du mich noch?» fragte sie mit gespielter Besorgnis, ihr Augenaufschlag knapp sichtbar unter der Krempe des knalligen Hutes.
«Ich habe keine Wahl», erwiderte er. «Du gehörst jetzt zu mir.»
3.Onkel Donaciano
«Nein, das finde ich nicht, meine Liebe», sagte ihr Onkel Donaciano, der seine geschmeidige Fülle in einen grauen Anzug gehüllt hatte, der wie Aluminium aufblitzte, wenn das Licht in einem bestimmten Winkel auf ihn fiel. «Ich finde nicht, daß das noch innerhalb der Grenzen liegt, ganz und gar nicht innerhalb der Grenzen, selbst für unsere tolerante Zeit und diese allzu fortschrittliche Gesellschaft.»
Ein Monat war vergangen. Maria hatte ihrem Arbeitgeber vom damaligen Besuch des Jungen und von Isabels regelmäßigen Ausflügen zum Strand erzählt – Ausflügen, die so lange dauerten und ihrer Haut so wenig Sonnenbrand zufügten, daß sie und der Junge vermutlich in einem Kino, wenn nicht in einem Stundenhotel Zuflucht suchten. Fest stand jedenfalls, daß Isabel nicht mit Eudóxia herumzog, denn Eudóxia und ihre drei Brüder waren von den Eltern in die Berge mitgenommen worden, um der Sommerhitze zu entgehen – erst nach Petrópolis, wo der Hof des zweiten Dom Pedro einen Palast, das heutige Museu Imperial, errichtet hatte und man an den Ufern der Kanäle und auf den kurvenreichen Hangstraßen mit den prächtigen Villen noch Reitpferde und Kutschen sehen konnte, und dann für einige Wochen nach Nova Friburgo, wo eine Kolonie von schweizerischen Einwanderern ein heimwehkrankes Alpendorf errichtet hatte. Klettern, Tennis spielen, Bootspartien, Reitausflüge und eine immerwährende Blütenpracht: Isabel hatte diese Vergnügungen, als sie noch jünger war, oft genug mit ihrem Onkel und dessen Frau genossen, der schlanken und eleganten Tante Luna, ehe es zu der unseligen Trennung der beiden kam – ihrer desquite, denn eine Scheidung war rechtlich unmöglich. Tante Luna entstammte der dünnen Oberschicht von Salvador und lebte jetzt in Paris, von wo sie Isabel alljährlich zu Weihnachten ein Hermès-Halstuch oder einen Gürtel von Chanel schickte. Sie war für das Mädchen einer Mutter am nächsten gekommen. In Petrópolis war es, selten genug, vorgekommen, daß Isabels Vater sich von seinen Verpflichtungen in Brasilia freimachte und für ein Wochenende herübergeflogen kam. Wie aufregend sie das gefunden hatte, neben ihm im Restaurant des Grand Hotels zu sitzen, angezogen wie eine richtige Frau, affektiert und aufgeputzt, mit gestärkten Rüschen rund um das Dekolleté, die zart auf ihrer nackten Haut kratzten, während im Hintergrund, jenseits des Panoramafensters, ein dünner Wasserfall zwischen fernen, grünen Bergkegeln funkelte und Wasserskifahrer hellblaue, verschlungene Spuren ins dunklere Blau eines Sees zeichneten. Doch diese Freuden gehörten zur Kindheit, waren schon so klein wie das Lächeln auf den Erinnerungsfotos.
«Welche Grenzen gibt es denn in Brasilien?» fragte sie ihren Onkel. «Ich dachte, dies wäre ein Land, in dem jedermann seines eigenen Glückes Schmied ist, egal, welche Hautfarbe er hat.»
«Ich spreche nicht von der Farbe. Ich bin farbenblind, ganz wie unsere Verfassung, ganz wie unser Volkscharakter, den wir von den großherzigen Zuckerbaronen geerbt haben. Wir sind hier nicht in Südafrika, Gott sei Dank, und auch nicht in den Vereinigten Staaten. Aber ein Mann kann sein Glück nicht aus heißer Luft schmieden. Er braucht Ressourcen.»
«Die in den Händen der wenigen liegen, wo sie schon immer gelegen haben», sagte Isabel und zog ungeduldig an einer der gefärbten englischen Zigaretten ihres Onkels.
Onkel Donaciano verankerte seine Zigarettenspitze aus Ebenholz und Elfenbein – die leer war, weil er mit dem Rauchen aufhören wollte und die Spitze nur als Surrogat benutzte – tiefer im Mundwinkel, was seinen Lippen einen wissenden und warnenden Zug verlieh. Seine Lippen waren schmal, aber rötlich, als hätte er sie eben abgeschrubbt. «In den Händen der vielen würde alles zerrinnen», erklärte er. «Auch so hat sich das Rio meiner Jugend schon in einen einzigen großen Slum verwandelt. Dabei war es so schön, so vergnüglich – die Straßenbahn, die am botanischen Garten entlangfuhr, der Schrägaufzug nach Santa Teresa oder das Casino, in dem Bing Crosby gastierte. Dieser altmodische Charme, wie ein seltenes Stück Muranoglas, ganz einzigartig. Und heute ist es unter seiner prächtigen Schale verfault. Es hat keine Luft zum Atmen und keine Ruhe. Andauernd der Verkehrslärm und die Musik, diese hirnlose Sambamusik. Überall der Gestank von menschlichen Ausscheidungen. Überall bodum. »
«Stinken wir etwa nicht, du und ich? Haben wir keine Ausscheidungen?» Mit jeder Silbe stieß Isabel eine Rauchwolke aus, wie Wolken des Zorns.
Donaciano musterte sie und versuchte, seinen höhnischen Gesichtsausdruck wieder in den eines liebenden Onkels zurückzuverwandeln. Er nahm die leere Zigarettenspitze aus dem Mund. In seine glatte, hohe Stirn – die dank einer feinfühligen Dosierung von Sonnenbädern ebenmäßig walnußbraun gefärbt war – gruben sich Falten, wie mechanisch eingepreßt, als er sich ihr mit neuem Nachdruck und Freimut entgegenbeugte. «Du hast den Jungen benutzt. Ich hätte dir nicht dazu geraten, aber du hast recht, es gibt in jedem Leben Dinge, die man nicht vom Rat der Älteren abhängig machen kann. Manche Schritte müssen im Trotz, gegen den Strom getan werden. Es gibt kein Wachstum ohne Überschreitung, ohne Schmerzen. Die primitiven Völker waren weise genug, den Schmerz ins Zentrum ihrer Einweihungsriten zu rücken. Also gut, meine Liebe, du bist nun eingeweiht. Du bist zum Strand gegangen und hast dir dort ein Werkzeug aufgelesen, mit dem du dich selbst verstümmeln konntest. Du bist, durch dieses lebendige Werkzeug, zu einer Frau geworden. Du hast es hinter meinem Rücken getan, und das war wohlüberlegt und angemessen. Aber eine längere Beziehung würde sich nicht hinter meinem Rücken abspielen, sondern vor meinen Augen, vor den Augen der Gesellschaft und vor den Augen deines exponierten Vaters. Ja sogar, falls du irgend etwas von dem glaubst, was dir die Nonnen erzählen, vor den Augen deiner lieben Mutter, unserer teuren, verblichenen Cordélia, die unter Tränen vom Himmel auf dich herunterblickt.»
Isabel rutschte auf dem üppigen, karmesinroten Sofa hin und her, was den feingerippten Samtbezug unter ihren Schenkeln raunen ließ. Sie drückte ihren Zigarettenstummel aus. Sie haßte die Vorstellung, daß ihre Mutter hinter ihr herspionierte. Sie wollte keine andere Frau in ihrem Leben. Ihre Mutter war bei dem Versuch gestorben, ihr einen Bruder in die Welt zu setzen: Isabel hatte ihr diesen doppelten Verrat niemals verziehen, auch wenn sie oft vor dem Spiegel stand und Fotos ihrer Mutter – alle durch ihren Tod unscharf und nebelhaft geworden – mit ihrem eigenen Gesicht verglich. Ihre Mutter war dunkler gewesen als sie selbst, viel brasilianischer in ihrer Schönheit. Isabels blondes Haar war ein väterliches Erbteil, von der Seite der Lemes.
«Also», kam Onkel Donaciano zum Schluß: «Du wirst dich mit diesem moleque nicht mehr treffen. Nach dem Karneval wirst du dein Studium an der Universität aufnehmen, an unserer illustren Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Während deines Aufenthalts an diesem Institut wirst du, dessen bin ich sicher, von den modischen linken Hirngespinsten infiziert werden, wirst an Protestaktionen gegen unsere Regierung teilnehmen, eine Bodenreform fordern oder ein Ende des Völkermords an den Amazonasindianern; und im Zuge dieser engagierten Donquichotterien verliebst du dich vielleicht in einen anderen Protestler, der nach dem Abschluß seiner Studien, allen jugendlichen Skrupeln zum Trotz, einen hohen Rang im Berufsleben einnehmen und vielleicht sogar ein Mitglied der Regierung werden wird, der es die Militärs zu diesem Zeitpunkt womöglich schon gestatten, sich wieder als zivile zu gebärden. Oder – unterbrich mich noch nicht, meine Liebe; ich weiß, mit welchem Argwohn deine Generation Vernunftehen betrachtet, aber glaube mir: Vernunft besteht, wenn die Leidenschaft geht– du entschließt dich, selbst eine Rechtsanwältin, eine Ärztin, eine leitende Angestellte bei Petrobras zu werden. Solche Möglichkeiten gibt es heute für Frauen in Brasilien, wenn auch widerwillig gewährt. Noch immer müssen Frauen gegen die Vorstellung unserer würdigen Vorväter ankämpfen, sie wären nur zum Zweck von Zucht und Zierde auf der Welt. Dessenungeachtet steht dir, wenn du nur auf Mutterschaft und die traditionellen Freuden des Nestbaus zu verzichten bereit bist, die Teilnahme am Spiel um die Macht offen. Aber glaube mir, herzliebste Nichte, das ist ein langweiliges Spiel, sobald man die Regeln beherrscht und seine ersten Züge gemacht hat.»
Er seufzte; wie immer bei Onkel Donaciano begann die Langeweile, alle Energie aus seinen Worten zu saugen. Nach einer Viertelstunde langweilte ihn einfach alles. Und auf diese Weise, sagte Isabel zu sich selbst, schaffen wir ihn uns vom Hals. Die Jugend läßt sich nicht so schnell langweilen.
Doch er war wiederbelebt worden von einer neuen Idee: «Oder –jetzt kommt mir ein Gedanke, der mich, ehrlich gesagt, ganz neidisch macht – warum gehst du nicht ins Ausland ? Warum sollen wir uns auf diesem immer kleiner werdenden Erdball auf Brasilien beschränken, mit seiner abscheulichen Geschichte, seinen dumpfen, schmuddeligen Massen, seiner ewigen Rückständigkeit, seinem Sambawahn am Rand des Chaos? Wir sind nicht nur Brasilianer – wir sind Kinder des Planeten! Geh nach Paris und lebe unter den Fittichen deiner Tante Luna! Oder, falls dir das zu sehr nach familiärer Enge schmeckt, gönn dir ein Jahr in London oder in Rom oder meinethalben sogar im verkommenen alten Lissabon, wo sie Portugiesisch so schnell sprechen, daß du kein Wort verstehst! In San Francisco, hab ich in den Zeitungen gelesen, ist etwas an der Macht, das sich Flower-power nennt, und Los Angeles ist die Hauptstadt von einem neuen Gebilde namens Pazifisches Becken!» Er beugte sich ihr entgegen und lüpfte die langen, schmalen Augenbrauen, die blonder waren als seine walnußbraune Stirn, auf eine Weise, die Dutzenden von Frauen vor ihr bedeutet hatte, daß ihnen gleich ein faszinierender Vorschlag offenbart würde. «Laß mich frank und frei sprechen, Isabel, als dein Onkel, der genau weiß, daß sein seriöser Bruder ihm nicht beipflichten, ihm ganz entschieden widersprechen würde. Wenn du unbedingt die Konventionen brechen willst, dann werde eine Abenteurerin – eine Schauspielerin oder Sängerin, ein Phantom in der elektronischen Welt, die unsere langweilige Welt der schweren Elemente und der drei Dimensionen immer mehr ersetzt! Laß uns zurück! Brich auf zu den Sternen! Eine schwindelerregende Fülle von Möglichkeiten wartet auf dich, wenn du erst einmal Schluß gemacht hast mit diesem, diesem –»
«Tristão», fiel ihm Isabel ins Wort, das sie nicht hören wollte. «Meinem Mann. Eher würde ich mit mir selbst Schluß machen.»
Onkel Donaciano verzog schnell und spitz den roten Mund und stellte fest, daß sein schlankes Glas, in dem sich ein Drink von der gleichen silbrigen Farbe wie sein Anzug befunden hatte, leer war. «Das ist die Sprache der Gosse, meine Liebe. Vulgärromantik von der durchsichtigsten Sorte, was das einzige ist, das den Armen bleibt, um sich ihr Leben erträglich zu machen. Aber du, wir beide genießen das Privileg, unseren Verstand gebrauchen zu können. Auf diese unsere Fähigkeit gründet sich, nach all den elenden Jahrhunderten iberischer Phantasterei und gemeiner Habgier, die ganze Hoffnung Brasiliens.»
Isabel lachte herzhaft, kannte sie doch den Tageslauf ihres Onkels nur zu genau: den Morgenspaziergang an den Stränden von Ipanema und Leblon; den vormittäglichen Anruf bei seinem Börsenmakler, einem gerissenen mulatto claro, der an der London School of Economics studiert hatte und ihm jede finanzielle Denkanstrengung abnahm; den Mittagslunch und die darauffolgende Siesta mit einer seiner Geliebten in deren lauschigem Vorstadtbungalow; und dann die Spätnachmittage auf der Terrasse des Jockey Clubs, wo er sich mit Gin abfüllte, während der Himmel hinter dem Corcovado mit dem Rosarot der Dämmerung vollief. Herzhaft drückte sie einen Kuß auf seine walnußbraune Stirn und spazierte aus dem Salon hinaus und über die Wendeltreppe nach oben, fest überzeugt (irrigerweise), daß ihr Onkel nur eine leere, verbale Pflichtübung abgeliefert hatte, deren es bedurfte, um die Geister der Familie zu besänftigen.
Seit sie begonnen hatte, mit einem der Armen zu schlafen, fühlte sie sich vor Maria nicht mehr so befangen – spürte weniger Angst vor ihrem indianischen Erbteil und dessen Bitterkeit und Schweigen. «Mein Onkel!» schnaubte sie in der Küche. «Er hält mich immer noch für ein Kind, das in die Obhut der Nonnen gehört.»
«Er liebt dich sehr und will nur dein Bestes.»
«Warum erzählst du ihm alles? Ich kann Tristão nicht mehr in mein Zimmer mitnehmen, du bist eine Verräterin!»
«Ich möchte deinen Onkel nicht hintergehen. Er ist sehr gut zu mir.»
«Ha!» spottete Isabel, während sie sich einen Teller von dem caruru nahm, den Maria eigentlich für sich selbst gekocht hatte. «Er zahlt dir einen Hungerlohn und vögelt dich und verprügelt dich noch obendrein. Ich weiß, daß er dich prügelt. Ich kann die Geräusche aus deinem Zimmer hören, auch wenn du nie zu schreien wagst.»