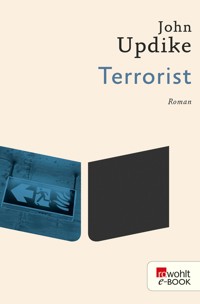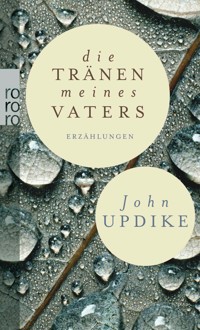
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Es ist leicht, Menschen in der Erinnerung zu lieben», schreibt John Updike, und genauso leicht, «die Toten falsch zu zitieren». Darum will er sie so zärtlich, aber auch so genau wie möglich beschreiben – die Großeltern, die musische Mutter mit ihren jähen Zornesausbrüchen, den lehrenden Vater, die eigenen Kinder und Enkel. Und natürlich die Frauen, immer die Frauen: Ehe, Ehekrisen, Ehebruch – auch davon handeln diese nachgelassenen Erzählungen. «Die Tränen meines Vaters» ist ein Buch voller Echos, voller Wiederbegegnungen, und es ist eine Feier der sinnlichen Welt: Erste Küsse, die «tauig» waren, erste Zigaretten, die die Nerven vibrieren ließen, all die durstig gekippten Gläser eines überreichen Lebens führen zurück zu seinen Quellen. «Wer sich Updike anvertraut, dem kann es im Leben, und zwar gerade im banalsten Leben, niemals langweilig werden.» (Süddeutsche Zeitung) «Die lebhafteste, menschenfreundlichste Stimme der amerikanischen Literatur.» (Die Zeit)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
John Updike
Die Tränen meines Vaters
Erzählungen
Aus dem Englischen von Maria Carlsson
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Den EnkelkindernAnoff, Kwame, Wesley, Trevor,Sawyer, Kai und Seneca und Adèle, Helen, Alex, Isabel,Lily, Charlotte und Katharine
Inhalt
Marokko 9
Archäologie in eigener Sache 25
Frei 39
Der Spaziergang mit Elizanne 52
Die Hüter 73
Das Lachen der Götter 86
Spielarten religiöser Erfahrung 106
Spanisches Präludium zu einer zweiten Ehe 145
Verletzbare Ehefrauen 162
Die sich beschleunigende Ausdehnung des Universums 175
Deutschunterricht 196
Die Straße nach Hause 215
Die Tränen meines Vaters 244
Kinderszenen 268
Die Erscheinung 290
Blaues Licht 307
Stromausfall 332
Das volle Glas 346
Marokko
Die Küstenstraße schwang sanft hinauf und hinab, aber verglichen mit einem amerikanischen Highway war sie unheimlich leer. Andere Autos tauchten drohend auf, kamen, auf dem Mittelstreifen fahrend, wie Geschosse auf uns zu. Am Straßenrand, allein in der sonnenversengten Weite, streckten kleine Mädchen in bunter Berbertracht uns Blumensträuße entgegen – Veilchen? Mohn? –, aber wir hatten Angst anzuhalten. Wovor hatten wir Angst? Vor einer Falle. Vor Banditen. Davor, dass wir zu wenig Geld gäben oder zu viel. Wir konnten nicht genug Französisch und weder Arabisch noch den Berberdialekt. «Nicht anhalten, Daddy, nicht!», schrien die Kinder, und sie hatten recht, denn wenn wir doch anhielten, auf Marktplätzen, sammelten sich jedes Mal Interessenten aus der Umgebung um unseren gemieteten Renault, linsten hinein und machten uns unverständliche Angebote.
Wir waren eine amerikanische Familie, die 1969 in England lebte, und waren nach Marokko gekommen in dem naiven Glauben, dass es im April eine ebenso sichere Flucht in die Sonne sei wie zur selben Zeit im Jahr ein Flug in die Karibik vom Osten der Vereinigten Staaten aus.
Aber Restinga, wohin ein britisches Reisebüro, das hinsichtlich der klimatischen Verhältnisse ebenso ahnungslos war wie wir, uns geschickt hatte, war verlassen und windig. Das Hotel, neu gebaut auf Anordnung des fortschrittlichen, tourismusorientierten Königs, war halbkreisförmig angelegt. Nachts knallten Türen in den geschwungenen Korridoren, und ein einsamer Aufseher im Burnus wachte über die leeren Zimmer und die sonderbare, in der Vorsaison erschienene amerikanische Familie. Am Tag waren die Wellen zu kabbelig, als dass man hätte schwimmen können, und das Mittelmeer war nicht weindunkel, es war ölschwarz. Wenn wir am Wassersaum entlanggingen, waren unsere Fußsohlen voller Teer. Wenn wir uns am Strand hinlegten, blies uns der Wind Sand in die Ohren. In einiger Entfernung wurden langsam Apartmentgebäude aus rosa Beton zusammengesetzt, und es gab Anzeichen, dass in einem Monat Feriengäste von irgendwoher die öden Plazas, die mit Brettern vernagelten Arkaden bevölkern würden. Vorläufig aber gab es nur den peitschenden Wind, eine nutzlose Sonne und – vereinzelt, müßig, stumm im Mittelgrund – Araber. Oder waren es Berber? Dunkle Gestalten jedenfalls, in langen Gewändern, die unserer Jüngsten, Genevieve, Angst machten. So unglaubhaft es erscheint, jetzt, da sie so groß und hübsch ist in ihrem glitzernden Discokleid, damals war sie pummelig und acht. Caleb war zehn, Mark zwölf und Judith knospende vierzehn.
«Je le regrette beaucoup», erklärte ich dem Manager des Restinga-Hotels, einem jungen Mann in blauem Sweater, der durch die Flure streifte und vom Zugwind aufgestoßene Türen schloss, «mais il faut que nous partirons. Trop de vent, et pas de bain de la mer.»
«Trop de vent», stimmte er zu und lachte, als sei er erleichtert, dass wir nicht so verrückt waren, wie es den Anschein gehabt hatte.
«Les enfants sont malheureux, aussi ma femme. Je regrette beaucoup de partir. L’hotel, c’est beau, en été.» Ich hätte den Konjunktiv nehmen sollen oder das Futur und hörte auf mit meinen Erklärungsversuchen.
Der Manager gab unserer Abreise seinen gleichmütigen Segen, setzte uns aber in Kaskaden von Finanzfranzösisch auseinander, warum er uns nicht das Geld erstatten könne, das wir in London vorausbezahlt hatten. So saß ich da mit ein bisschen Bargeld, einer Hertz-Kreditkarte, vier Kindern, einer Frau und Flugtickets, die uns zu zehn weiteren Tagen in Marokko verurteilten.
Wir wollten den Bus nach Tanger nehmen. Wir standen um zwölf Uhr mittags an einer verlassenen Straße, sechs versprengte Amerikaner, klobig und schutzlos in unseren englischen Wollsachen, die Koffer voller bei Lilywhite’s gekaufter europäischer Sommerklamotten und Penguin-Taschenbücher als Ferienlektüre. Die Sonne drosch auf uns ein. Und der Wind. Die Straße zerging an beiden Enden in einem rosa Flimmern. «Ich glaub das nicht», sagte meine Frau. «Ich könnte heulen.»
«Mach den Kindern keine Angst», sagte ich. «Was sollen wir denn machen? Es gibt keine Taxis. Wir haben kein Geld.»
«Es muss eine Möglichkeit geben», sagte sie. Aus irgendeinem Grund hat meine Erinnerung an diesen Moment ihr ein höchst unvorteilhaftes marineblaues Barett aufgesetzt.
«Ich hab Angst», verkündete Genevieve, umklammerte ihren Rucksack und sah schrecklich erhitzt und rotbackig aus in ihrem schweren grauen Mantel.
«Baby», höhnte ihre große Schwester, die allenthalben die Blicke einheimischer Männer auf sich zog und eine gewisse Überlegenheit empfand.
«Der Bus kommt bestimmt», versprach Daddy und sah über ihre Köpfe hinweg zum Fluchtpunkt, wo die Straße sich im rosa Gewirr der neuen Gebäude verlor, die der König sehr langsam bauen ließ.
Ein dünner dunkler Mann in schmutzigem Kaftan tauchte plötzlich auf und redete in einer langatmigen nasalen Sprache. Er hielt seine Handflächen hin, als sollten wir daraus lesen.
«Dad, der Mann redet mit dir», sagte Mark – damals in der Pubertät, heute Student der Computerwissenschaft – peinlich berührt.
«Ich weiß», sagte ich hilflos.
«Was sagt er, Dad?», fragte Genevieve.
«Er fragt, ob dies die Bushaltestelle ist», log ich.
Der Mann kam, immer weiterredend, näher, aus seinem Mund wehte ein Hauch reich an muslimischen Essenzen – einheimische Gewürze, Zahnfäule, ausgedörrte Schleimhäute vom frommen Fasten. Er redete immer schneller, drängender, aber in seinen blutunterlaufenen Augen verglomm ein Licht.
«Sag ihm, er soll weggehn.» Dieser Vorschlag kam von Caleb, unserem stoischen, schweigsamen, vernünftigen Sohn, heute ein Collegestudent im zweiten Jahr, der im Hauptfach Zoologie studiert.
«Ich glaube, er geht von allein», sagte ich auf gut Glück, und der Mann ging tatsächlich, über unsere verständnislose, reaktionslose Idiotie den skelettdürren Kopf schüttelnd. Unsere kleine Familie rückte erleichtert enger zusammen. Sand wehte in unsere Schuhe, und die halbkreisförmigen Flure des verlassenen Hotels, unserer einzigen Heimstatt in diesem fremden Land, heulten hinter uns wie ein tiefklingendes, ungefüges Musikinstrument.
Der Bus! Der Bus nach Tanger! Wir winkten – und wie wir winkten! –, und kaum zu glauben, der Bus hupte und hielt. Er war grün wie welkes Gras, und auf dem Dach waren Bretterverschläge mit Hühnern und aufgerollte Teppiche festgebunden. Drinnen saßen Marokkaner: staubige gebeugte geduldige fremde Menschen, mit etwas kleinem Gehäkelten auf dem Kopf und etwas kleinem Gehäkelten an den Füßen, die Körper kaum zu unterscheiden von den Gepäckbündeln auf dem Schoß, die Frauen gehüllt in Schwarz, manche mit verschleiertem Gesicht, aller Augen funkelnd, in erschrecktem Staunen aufwärtsgewandt bei diesem Ansturm großer, erhitzter kindischer Amerikaner.
Der Fahrpreis, ein paar Dirhams, wurde gleichmütig von einem Fahrer mit Schnurrbart à la Nasser und dazu passendem Kinn entgegengenommen. Hinten im Bus war noch Platz. Als wir uns mit unseren sperrigen Koffern durch den Gang kämpften, schwankte der Bus, und ich fürchtete, das fragile Fahrzeug mit seiner empfindlich ausbalancierten Armutsfracht könnte unter unserer schwerfälligen Unschuld zusammenbrechen. Weiter hinten im Bus verstärkte sich ein einheimischer Geruch, wie von verbrannten Seilen.
In Tanger wechselten wir vom schwankenden Bus in ein überladenes Taxi, dessen Fahrer, im dringenden Bedürfnis, uns abzuladen, mit ins Hertz-Büro kam und uns bei den Verhandlungen zu helfen versuchte. Allah sei gepriesen, seine Hilfe war nicht nötig: die Hertz-Karte aus gelbem Plastik, die ich aus der Tasche zog, genügte vollauf. Wäre ich in der Lage gewesen, auch eine blassgrüne American-Express-Karte hervorzuziehen, hätte das unsere von Ungewissheiten bedrohte Fahrt die Küste hinunter, von Tanger nach Rabat nach Casablanca und dann durch die schmaleren Straßen von El Jadida und Essaouira und Tafraout, enorm entspannt, denn so mussten wir in jedem Hotel zunächst den Empfangschef beknien, einen Verrechungsscheck von unserer Londoner Bank zu akzeptieren, und nur die teuersten Hotels waren bereit, es zu riskieren; daher hin und wieder Einsprengsel von Luxus auf unserer entbehrungsreichen Flucht vor den Mittelmeerwinden.
Die breiten Straßen von Rabat waren rot geschmückt. Der Gedanke, die roten Transparente könnten uns gelten, verging uns, als wir Hämmer und Sicheln und Poster von Lenin erkannten. Eine hochrangige Sowjetdelegation, zu der Kossygin und Podgorny gehörten, wurde soeben vom flexiblen König empfangen, erfuhren wir im Rabat Hilton, das bis zum letzten Zimmer ausgebucht war, vollgepackt mit Kommunisten, und selbst die bedürftigsten Kinder der freien Wirtschaft nicht unterbringen konnte.
Aber ein Hotel, das bei den Sowjetherren weniger gefragt war, nahm uns auf, und zum Abendessen ließ man uns, halb verhungert wie wir waren, im Kreis auf Teppichstapeln Platz nehmen, um ein, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, riesiges Messingtablett herum, während hinter uns ein lachendes barfüßiges Mädchen von einem zum andern ging und unsere Haare mit Rosenwasser besprenkelte. Mark, angenehm gekitzelt, machte sein Äffchengesicht.
Dieses Gefühl, schön bewirtet zu werden, umgeben von unterschwelligem Amüsement, erlebten wir noch einmal: auf einer Wiese hoch über dem Meer, wo nach Meilen leerer Landschaft und leerer Mägen ein winziges Lokal, kaum mehr als ein Schuppen, mit einem hölzernen Pfeil auf sich aufmerksam machte. Wir hielten an und gingen beklommen im Gänsemarsch übers Gras, fühlten uns wieder riesenhaft, wie vor Tagen, als wir tiefer in jenen duftenden Bus vordrangen. Wir blieben stehen, als ein Mann mit einem Tisch aus der Hütte kam und ein Junge mit Stühlen ihm folgte. In einer Atmosphäre allgemeiner Belustigung wurden die Möbel auf die grasbewachsene Erde gestellt, an einen Platz, auf den wir mit leichter Handbewegung hindeuteten. Nach einer kleinen Weile wurden Wein, Reis, Kebabs und Coke aus der Hütte gebracht, und wir aßen und tranken mit Blick auf den Atlantik, auf beigefarbene Klippen und weite Weiden, auf denen ein einsamer Esel graste – die einzigen Gäste vielleicht, die dieses schöne Lokal am Meer je gehabt hatte.
Sogar auf der holprigen Nebenstraße nach Tafraout, in die steinigen Hügel des Anti-Atlas hinauf – der Benzinanzeiger auf null und weit und breit kein Haus, kein Schaf, keine Ziege –, stand in einer Senke der ungepflasterten Piste ein kleines Mädchen und hielt uns eine Handvoll Blumen hin. Die Straße war hier eins geworden mit den Steinen eines ausgetrockneten Flussbetts, und der Renault kam nur langsam voran, so langsam, dass die Kleine, als sie sah, dass wir nicht anhalten würden, Zeit hatte, unseren Kotflügel mit ihren Blumen zu peitschen und sie ins offene Autofenster zu werfen. Zwei oder drei fielen uns in den Schoß, der Rest fiel auf die Erde zu ihren Füßen. Im Rückspiegel sah ich, wie sie wütend mit dem Fuß aufstampfte. Vielleicht weinte sie. Sie war ungefähr so alt wie Genevieve, die Mitleid hatte und traurig aussah, als das Mädchen hinter uns immer kleiner wurde, bis es nicht mehr zu sehen war.
In Tafraout konnte Caleb den Blick nicht abwenden von einem schrecklich verkrüppelten Mann, der sich, einer Spinne gleich, hurtig über die festgetretene Erde fortbewegte, auf den Armen, und den kleinen Körper zwischen ihnen mitschleppte. Er bettelte nicht; im Gegenteil, er bewegte sich wie jemand, der am Ort ein gewisses Ansehen genießt, der Geschäfte zu erledigen hat.
Nördlich von Agadir saßen wir in unseren Motelzimmern und warteten, dass die Minuten bis zur Abendessenszeit verstrichen, als wir plötzlich merkten, dass der Verkehr auf der Straße draußen verstummt war. Die Polizei war rasch zur Stelle, und die Beamten redeten mit dem Fahrer eines staubigen Lastwagens, einem jungen Mann in sandfarbenen Arbeitskleidern, der in sich zusammengesackt mit gesenktem Kopf am Führerhaus lehnte und nickte, nickte, während die Polizisten ihn befragten. Der Verkehr war auf beiden Seiten der Straße angehalten worden. Wir blieben auf unserer Seite, Touristen bloß, aber interessiert. Es war schwer zu erkennen, was passiert war. So etwas wie ein Bündel lag da, wurde aber von einem Rad des Lastwagens fast ganz verdeckt. Den Tumult nutzend, der entstand, als die Polizei die Mutter holte, ging Mark über die Straße und sah nach.
Sein Gesicht war blass, als er auf unsere Straßenseite zurückkehrte. Er machte nicht sein komisches Äffchengesicht. Wir fragten ihn, was es da drüben zu sehen gebe. «Ihr wollt das nicht sehn», war seine Antwort.
«Es war ein kleines Mädchen», sagte er uns später.
Die Mutter war stämmig und trug Schwarz, aber ihr Gesicht war unverhüllt; sie rannte die kahle Böschung auf der anderen Straßenseite hinauf und hinunter und zerriss den Himmel mit ihrem unheimlichen Heulen, ihrem Wehklagen, während Männer ihr nachrannten und versuchten, sie festzuhalten. Es gelang ihnen nicht, und die erregte Menge, die sie einholen wollte, wurde immer größer, ein Gefolge schwerfälliger Körper, den ihr Gram in seiner übermenschlichen Kraft hinter sich herzog. Kein Amerikaner hätte die Töne hervorbringen können, die sie ausstieß; aller Atem ihrer Brust verströmte sich aufwärts zum Himmel, der ihr so jäh, so machtvoll einen Schlag versetzt hatte. Uralte Klageweisen hielten sie aufrecht. Die Art, wie sie ihr Leid ausdrückte, war so nackt, so rein, dass wir uns abwandten. Diese Szene in Marokko war nicht für unsere Augen und Ohren bestimmt. Als zwei Männer sie schließlich packten und an den Armen festhielten, brach sie ohnmächtig zusammen.
Wir fanden das Klima, auf das wir gehofft hatten, in Agadir. Der Strand dort war breit, aber fast menschenleer, obwohl Sonne und Meer warm genug waren. Wir sahen uns nach anderen Feriengästen um, in deren Nähe wir uns niederlassen könnten, und weil wir keine entdeckten, breiteten wir unsere Handtücher nicht weit von der Strandmauer aus. Judith entfernte sich ein wenig von uns, staksig und perlweiß in ihrem Bikini, sammelte Muscheln auf und sah aufs Meer hinaus, abseits ihrer Eltern und Geschwister. Genevieve und Caleb begannen mit einer Sandburg. Mark legte sich zurück und konzentrierte sich mit finsterer Miene darauf, braun zu werden.
Erst nach einer Weile fiel uns der Araber in langen Gewändern auf, der etwa dreißig Meter entfernt von uns lag, das Gesicht uns zugewandt. Sein Gesicht – dunkel, fünfeckig, sah unentwegt in unsere Richtung, starrte wie unter dem Druck eines stummen Schmerzes, einer angestauten Gier aus seinen zerkrumpelten Kleidern. Genevieve und Caleb wurden plötzlich still bei ihrem Burgenbau. Judith zog es wieder näher zu uns hin. Niemand von uns wagte zum einladenden Meeressaum zu gehen, über die Wüste aus Sand unterm stummen Schimmern der starrenden Augen des Arabers. Leise, damit die Kinder es nicht hörten, murmelte Mommy mir zu: «Sieh nicht hin, aber der Mann da masturbiert.»
Er tat’s. Zwischen den Stofffalten. Zu Judith und uns gewandt.
Ich stand mit zitternden Knien auf und organisierte unseren eiligen Rückzug vom Strand, und am Nachmittag ließen wir uns an einem privaten Pool nieder – Zutritt bloß ein Dirham –, wo alle Europäer schwammen und sich sonnten und sicher waren vor der einheimischen Kultur. An jedem unserer fünf Tage in Agadir gingen wir zum Pool. Die Sonne schien, und es gab nur wenig Wind. Wir hatten ein kleines Hotel gefunden, das von einem alten französischen Ehepaar geführt wurde; es war von Bougainvillea überwachsen, im Innenhof wohnte ein Papagei, und die Speisekarte war europäisch.
Keine zehn Jahre zuvor, am 29. Februar 1960, waren bei einem Erdbeben in Agadir schätzungsweise zwölftausend Menschen umgekommen und große Teile der Stadt zerstört worden. Wir sahen keine Spuren davon. In Agadir vereinigten wir uns wieder mit der Mittelschicht. Wir hatten wieder Geld. Ich hatte meiner Bank in London telegraphiert, und die Herren hatten eines ihrer geliebten britischen Übereinkommen mit einer Bank in Agadir getroffen. Das Bankgebäude hatte eine strenge Granitfassade – es war nach 1960 erbaut worden –, innen aber herrschte eher die Atmosphäre einer Viehauktion. Händler in Schäferkutten warteten brummelnd an einem langen chaotischen Tresen. Jedes Mal, wenn ein Geschäft sich dem Abschluss näherte, wurden laut Namen auf Arabisch ausgerufen. Als mein Name an der Reihe war, wurde offenbar auch der telegraphisch aus London überwiesene Geldbetrag lautstark mitgeteilt. Das Gebrummel verstummte. Verblüffte braunäugige Blicke flitzten den Tresen entlang in meine Richtung. Ich schwoll zu enormer Größe – ein Wundertier, eine Ausgeburt an Geld. Errötend wollte ich erklären, während ich die pastellfarbenen Scheine in meine abgeschabte Brieftasche stopfte: «Ich habe Kinder zu versorgen.»
Genevieve fütterte gern die Hunde, die um unser Hotel strichen. Haustiere in fremden Ländern sind sonderbar. Allein der Gedanke, dass sie Französisch oder Arabisch besser verstehen als du. Und sie sehen auch nie ganz so aus wie amerikanische Tiere: eine andere Schrägstellung der Augen, eine andere Gangart. Auf den meisten unserer Dias, stellte sich heraus, waren diese Tiere zu sehen, allesamt leicht verwackelt. Die Kinder hatten die Nikon mit Beschlag belegt.
Wir entkamen Agadir, Marokko, mit knapper Not. Auf einer basketballgroßen Erdkugel kann man mit der Breite eines Daumennagels die Strecke bemessen, die wir an jenem letzten Tag zurücklegten. Im Büro der Air Maroc sagte man uns, für sechs Personen sei kein Platz, auf keinem Flug von Agadir nach Tanger, wo wir für diese Nacht Hotelzimmer hatten und Flugreservierungen nach Paris für den nächsten Morgen. Es half alles nichts, wir mussten fahren, die Strecke, für die wir Tage gebraucht hatten, fünfhundert Meilen, achthundert Kilometer, die nordwestliche Schulter von Afrika entlang.
Wir machten uns bei Tagesanbruch auf den Weg. Wir hatten uns mit einer großen Tüte Orangen und vielen Flaschen Perrier ausgerüstet. Daddy fuhr, Stunde um Stunde; Mommy weigerte sich, in Marokko zu fahren, oder vielleicht schloss der Automietvertrag sie aus. Ihr Kinder, alle vier hinten im kleinen Renault zusammengepfercht, wart still, spürtet, wie Kinder es tun, echte Gefahr, echte Bedrängnis.
In irgendeiner staubigen kleinen Stadt, vielleicht in Safi, übersah ich ein Rotlicht und fuhr einfach weiter. Eine Trillerpfeife gellte, und im Rückfenster sah ich, so deutlich, wie ich das kleine Blumenmädchen mit dem Fuß hatte aufstampfen sehen, einen Polizisten mit weißem Helm, der gelassen unsere Zulassungsnummer notierte. Sein weißer Helm blieb hinter uns zurück, sein Blick folgte uns. Mein Magen verkrampfte sich. Aber die Straße führte weiter geradeaus, und die Passanten in ihrer einheimischen Tracht gingen, ohne uns zu beachten, ihrer Wege. Noch ein Tag, und wir würden in Paris sein, in Sicherheit; im Übrigen war die Verkehrsampel sehr schlecht platziert, viel zu weit auf der Seite und hinter irgendwelchen Reklameschildern. Kriminell fuhr ich weiter. Die Jungen klatschten Beifall, die Mädchen waren sich nicht so sicher.
«Vielleicht hätte er dich bloß ausgeschimpft», sagte Genevieve.
«So siehst du aus», sagte Mark. «Er hätte Dad in ein dreckiges Loch voller Ratten und Wanzen gesteckt.»
«Ich habe das Rotlicht gesehn», sagte Mommy sanft, «und nahm an, du siehst es auch.»
«Tausend Dank», sagte ich, weniger sanft.
«Ich hab’s nicht gesehn», sagte Caleb, unser geborener Tröster und Vermittler. «Vielleicht stand die Ampel auf Gelb und sprang gerade um.»
«Wer hat’s gesehn und glaubt, die Ampel stand auf Gelb?», fragte ich hoffnungsvoll.
Schweigen war die Antwort.
«Wer hat die Ampel gesehn, und welche Farbe hatte sie?»
«Rot», antworteten drei Stimmen im Chor.
«Was soll ich eurer Meinung nach tun? Umkehren und mit dem Polizisten reden? Je le regrette beaucoup, Monsieur, mais je n’ai pas vu le, la lumi–»
«Nein!», entschied ein anderer Chor; Mommy enthielt sich der Stimme.
«Du hast deine Entscheidung getroffen», sagte Judith, und ihre Stimme klang fast wie die einer Frau.
«Gib Gas, Dad», sagte Mark.
Wir waren schon am Stadtrand, und kein Polizeiauto machte Jagd auf uns. Das leere grüne Weideland, die ruhige leere Straße hatten uns wieder. Unsere lange strapaziöse Fahrt die Küste hinunter spulte sich rückwärts ab. Hier war das kleine Lokal auf der Wiese oben auf dem Kliff. Hier war die Stelle, wo alle sich geweigert hatten, die Lebersandwiches zu essen, die ein Einäugiger auf einem Holzkohleherd am Straßenrand für uns zubereitet hatte. Hier war Casablanca, das überhaupt nicht so aussah wie im Film. Und hier war Rabat. Die roten Transparente waren abgenommen worden, die Russen waren weitergezogen. Mittlerweile war es später Nachmittag, und Daddys Nackenmuskeln schmerzten, seine Augen waren voller Sand, so kam es ihm vor, und inzwischen war er sicher, dass die Nummer auf seinem Zulassungsschild die ganze Küste hinauf und hinunter gekabelt wurde, mittels des Netzwerks der Geheimpolizei, die alle Monarchien sich halten. Jeden Augenblick würden Sirenen heulen, und man würde ihn festnehmen und tief hineinstoßen in die bittere Wahrheit von Marokko, die er zu ignorieren versucht hatte, während er sich Sonne und Exotik stahl.
Oder die Polizei wartete auf ihn an der Hotelrezeption in Tanger; man hatte seinem Namen bereits von Restinga aus nachgespürt auf einer Fährte von Übernachtungen bis zur Empfangsbescheinigung, die er in der Bank von Agadir unterschrieben hatte. Oder aber es würde eine Szene im Flughafen geben: Handschellen an der Passkontrolle. Oh, warum hatte ich nicht angehalten, als die Trillerpfeife ertönte?
Wäre mein Französisch weniger primitiv gewesen, hätte ich vielleicht angehalten.
Hätten wir nicht kürzlich, im Hotel mit dem Papagei, in einer Newsweek-Ausgabe einen Artikel darüber gelesen, wie unschuldige Amerikaner in afrikanischen und asiatischen Gefängnissen dahinvegetierten, ich hätte vielleicht angehalten.
Hätten die Vereinigten Staaten nicht so unentschuldbar, wenngleich unlösbar in Vietnam gekämpft, ich hätte vielleicht angehalten.
Wären nicht die roten Fahnen in Rabat gewesen, der masturbierende Mann am Strand, das tote Mädchen neben dem Lastwagenrad ... mein Versagen, meine Weigerung oder Feigheit sind immer noch da, ein Fleck auf meinen Erinnerungen an Marokko.
Es war dunkel, als wir in Tanger ankamen, und das Hotel war nur durch ein Labyrinth von Einbahnstraßen zu erreichen, aber der Mann am Empfang hatte unsere Reservierung säuberlich aufgeschrieben vor sich liegen und keinen Haftbefehl für mich. Der König selbst hätte nicht touristenfreundlicher sein können, der grauhaarige Hotelpage (der aussah wie Omar Sharif) lächelte, als er meinen kleinen Salat aus Dirhamscheinen entgegennahm, die Kellner im Hotelrestaurant verbeugten sich so tief, als seien wir die einzigen Gäste. Was wir um diese Uhrzeit auch beinah waren; die Fahrt hatte fünfzehn Stunden gedauert. Wir hatten sämtliche Orangen aufgegessen und alle Perrier-Flaschen ausgetrunken. Am nächsten Morgen nahmen wir betrübt Abschied von unserem treuen Renault, der uns nicht im Stich gelassen hatte und den wir mit Staub bedeckt zurückgaben. Die Leute bei Hertz, gegen deren Nummernschild ich mich vergangen hatte, sahen kaum auf von ihren Abrechnungen, die einen Monat später, aus dem Ozon von Zahlen, der die Welt erstickt, in London eintreffen würden. Wir waren davongekommen.
Erinnert ihr euch an Paris, Kinder? In der rauen Frühlingskühle der knospenden Tuillerien drängten wir uns noch eng aneinander. Hinten im Renault war nicht genug Platz gewesen, dass ihr euch alle vier hättet zurücklehnen können, einer von euch, meistens war es Genevieve, musste vorn auf der Kante sitzen und atmete an meinem Ohr. Mommy saß angeschnallt neben mir und verteilte Orangenspalten und Wasser; Caleb und Mark debattierten endlos, wer wen gerade knuffte; Judith, am Fenster, versuchte, sich fortzuträumen. Wir hatten in Marokko ein Höchstmaß an familiärer Verdichtung erreicht und konnten uns von nun an nur zerstreuen. Erwachsen werden, aus dem Haus gehen, mit ansehen, wie eure Eltern sich scheiden ließen – alles hat sich in dem Jahrzehnt seither zugetragen. Aber auf einer hellen hohen Plattform des Eiffelturms hatte ich noch das Gefühl, wir seien für alle Zeit untrennbar verbunden.
Archäologie in eigener Sache
In seiner zunehmenden Isolation – in die Jahre gekommene Golfkumpel tot oder im Sterben liegend, seine alten Geschäftskontakte abgerissen, kein Büro mehr, in das er gehen könnte, seine Frau immer weg, bei ihrem Bridge oder ihren Komitees, seine Kinder beschäftigt und von Sorgen in Anspruch genommen, wie er selbst es in mittleren Jahren gewesen war – entwickelte Craig Martin ein Interesse an den Spuren, die frühere Besitzer seines großen Grundstücks hinterlassen hatten. In der Blüte seiner Jahre, als er jeden Tag zehn oder zwölf Stunden arbeitete und das ganze Wochenende geselligen Umgang pflegte, hatte er kaum Augen für sein Land gehabt. Jahre waren vergangen, ohne dass er entlegenere Ecken je betreten hätte. Die vier Hektar sollten sein Haus gegen die Beeinträchtigungen durch zu nahe Nachbarn abpolstern und eine Investition für den Tag sein, an dem diese Hektar verkauft werden würden, aller Wahrscheinlichkeit nach an einen Bauunternehmer, und der Profit an Craigs Witwe Grace ginge, die sechs Jahre jünger war als er.
Das Gelände war, soweit er wusste, bis etwa 1900 ein bewaldeter Hügel hinter einem Landsitz gewesen. Ein wohlhabender älterer Mann, der sich mit dem Heiraten Zeit gelassen hatte, baute für seine frisch angetraute Frau und sich ein geräumiges Sommerhaus auf einem einstigen, von Findlingen umrahmten Picknickplatz, auf dem genug Bäume gefällt worden waren, dass man einen Ausblick auf den ungefähr fünfhundert Meter entfernten Atlantik hatte.
Es gab auf dem Gelände alte, zwischen Stützmauern aus Feldstein angelegte Wege, die für Autos mit Verbrennungsmotor zu steil waren und zu scharfe Kurven hatten; Pferde mussten Wagen durch diese Haarnadelkurven hinaufgezogen haben, durch diese Tunnel ausdauernden Grüns. Bäume scheuen sich selbst nach Jahrzehnten noch, Wurzel zu fassen auf einem Boden, der einst von Rädern zusammengepresst wurde. Auf dem Rand eines der Granitfelsen stehend, die ihm gehörten, stellte Craig sich vor, dass Farmwagen oder Ponykarren quietschend und knarrend auf ihn zukamen, die Räder mit den schmalen Speichen sich durch sumpfige, jetzt von Stechwinde überwucherte Senken pflügten, die in seiner Phantasie Fahrwege waren, und junge Leute in sommerlichen Musselinkleidern und mit Bändern geschmückten Schuten und weißen Segeltuchhosen und Strohhüten vorbei an der Stelle, wo er stand, zu einem Picknick brachten.
Aber Massachusettsland war vor hundert Jahren schon weitgehend gerodet, schutzlos Wind und Sonne ausgesetzt, abgeweidet von Schafen und Kühen. Vielleicht malte er sich alles ganz falsch aus. Der gewundene Fahrweg lief auf eine schroffe Wand aus Monolithen zu; wie hatte er den Rest des Hügels erklommen? Nahe dem Haus legten die zutage getretenen Granitadern rätselhaftes Zeugnis ab. Hier und da waren Löcher in den Stein gebohrt, als habe man Eisentore oder schwere Markisen verankern wollen. Eine verglaste Veranda mit Meerblick war vor langer Zeit verrottet und eingestürzt, und Craig selbst hatte an der Vorderseite des Hauses eine baufällige, mit Säulen geschmückte Holzveranda instand gesetzt, die auf die runde Asphaltzufahrt, einst ein kiesbestreuter Wendeplatz für Kutschen, hinausging.
Im Wald gab es von Kletterpflanzen überrankte Haufen zerklüfteten Gesteins: er nahm an, dass es Überreste der Sprengung der alten Hausfundamente waren. In den Anfangsjahren des zwanzigsten Jahrhunderts zogen Maurertrupps aus Italien durch diese Gegend und bauten mächtige Mauern, die nach und nach, Stein für Stein, zusammenbrachen. Eines Nachts stürzte ein Teil der Böschungsmauer ein, die die ehrgeizigsten Blumenbeete seiner Frau abstützte, und es wurden nicht bloß Erde und Blumen umhergestreut, sondern auch Schlacke, zerbröckelte Klinkersteine, die in einem Kohlenofen gebrannt worden waren, und ein Durcheinander aus alten Büchsen und Glasbehältern. Der Untergrund des Gartens war ein Schutt- und Müllabladeplatz gewesen. Wann war der Blumengarten angelegt worden? Vermutlich später, als Craig dachte – zur gleichen Zeit, als die Betonvertiefungen für die glasgedeckten Frühbeete gegossen wurden, abgesenkte Beete, die jetzt unter Rahmen aus morschem Holz, krümeligem Kitt und zerbrochenem Glas lagen.
Craig sah es so, dass das Anwesen vier Epochen erlebt hatte, bevor seine begann. Die erste Epoche war die der Entstehung und der liebevollen Instandhaltung, eine Zeit, da der hochgestimmte, frisch verheiratete reiche Mann noch lebte und Dienstboten mit Körben voll dampfender Wäsche von den steinernen Becken im Souterrain hinauseilten auf den mit Ziegeln gepflasterten Trockenplatz und das Regenwasser von den Dachrinnen aus geöltem Zedernholz in die Fallrohre floss und hinabgurgelte in funktionstüchtige unterirdische Abflussrohre. Dann starb dieser glückliche Mann, und die viel jüngere Witwe, die die Gesellschaft in Boston ihrem einsamen Haus auf dem Hügel vorzog, kümmerte sich nachlässig und fast nur aus der Ferne um ihren Besitz, sodass durch ein im Winter entstandenes Leck im Dach eine Esszimmerwand mit der handgedruckten französischen Landschaftstapete zuschanden ging und die Veranden des Sommerhauses, zierliche, mit Säulen und Balustraden geschmückte Vorbauten, die dem Wetter ausgesetzt waren, den Schneestürmen und den harschen Nordostwinden nach und nach erlagen. Dann kam eine Epoche, da auch sie tot war und das Haus leer stand. Vielleicht waren Vernachlässigung und Verfall vor allem diesem Interregnum zuzuschreiben, das kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs endete, als eine junge, wachsende Familie das Anwesen als ganzjährigen Wohnsitz übernahm. Eine Zentralheizung wurde eingebaut, und von der grandiosen Empfangshalle wurde ein Teil abgetrennt und zu einem mit Kiefernholzpaneelen ausgestatteten Studio gemacht. Die Ziegelschornsteine wurden neu verfugt, und die brüchigen Dachschindeln wurden ersetzt. Durch den Krieg kamen die Instandsetzungsarbeiten vorübergehend zum Erliegen. Der Hausherr meldete sich zur Navy, um den Ozean zu befahren, der von den Fenstern aus zu sehen war, bis sie mit Verdunkelungspapier zugeklebt wurden.
Der Held kehrte als Konteradmiral zurück und lebte in dem Haus, bis er achtzig war und seine fünf Kinder alle fortgezogen waren und sich anderswo niedergelassen und selber Familien gegründet hatten. Die meisten Sachen, die Craig im Wald fand, hielt er für Überbleibsel aus dieser langwährenden, umtriebigen Epoche – Einmachgläser, Blumentöpfe, Schrotpatronenhülsen, Gummireifen, halb eingesunken im vermoderten Laub und ein gelbes Rechteck schaumigen Wassers umschließend, Stücke von vergrabenen Rohren, verrostete Drahtstränge, die von einem einstigen Einzäunungsprojekt zeugten. Baumhäuser waren gebaut und vergessen worden zwischen den Felsen und Bäumen; in Porzellanisolatoren und isolierten Kupferdrähten wohnte das Gespenst der Elektrizität; Teile eines Motorradmotors, mit einem Film schwarz gewordenen Schmierfetts überzogen, erinnerten an eine Zeit, als die steilen alten Wege dem Rennsport eines jungen Mannes dienten. Diese Hektar hatten viel körperliche Arbeit absorbiert: gestapeltes Holz, auf Kaminlänge zugeschnitten, vermoderte zwischen zwei noch lebenden Bäumen und war von Pilzen befallen; Craigs Schuhe scharrten eine glitzernde Karbonschicht unter dem Laub hervor, den Holzkohlerückstand alter Feuer. Es gab Gruben, die aussahen, als seien sie von Menschen gegraben worden, und Erhebungen, die zu regelmäßig waren, um natürlich zu sein. Oberhalb der Eisenbahnschienen, an einem von Eindringlingen ausgetretenen Pfad neben einer einst tadellosen stämmigen Mauer, die sich jetzt gefährlich weit über den erodierten Bahndamm neigte, sammelte er Bierdosen auf, Sixpack-Kästen aus Kunststoff, Glasscherben, Flaschen aus unzerstörbarem Plastik. Im tiefer gelegenen Teil des Geländes, wo eine breite Spur über Kiefernnadeln sich abwärtsschlängelte zu einem Durchgangsweg, der, illegal, durch mehrere Privatgrundstücke zu einem Strand führte, war ein wahres Schneegestöber von blassem Plastikmüll niedergegangen – Deckel von Styroporbechern, Trinkhalme, Milchverpackungen. Auf seinen Erntestreifzügen mit einem Müllsack wurde Craig gelegentlich belohnt, indem er, versteckt in der Stechwinde und im Sumpfgras, Flaschen von einer nostalgischen Dickwandigkeit fand, solche, wie er sie als Kind gekannt und aus denen er Root-Bier und Sarsaparilla getrunken hatte.
Unbefugte, Besitzer und Gäste waren über das Land getrampelt – uneben, wie es war –, waren drübergetrampelt und hatten ihm Narben zugefügt. Ein uralter Freund des vorigen Besitzers hatte ihm geschildert, wie ein nicht mehr sicher auf den Beinen stehender Dinnergast in einer eisigen, alkoholgeschwängerten Nacht in sein Auto gestiegen und prompt in die Mauer aus mächtigen Steinen an einer Kurve der asphaltierten Zufahrt geschlittert war; die Stoßstange hatte einen backenzahnförmigen Findling herausgeschlagen, der jetzt einige Dutzend Meter weiter weg im Wald hockte – ein beständiges Denkmal für das Missgeschick eines Augenblicks, zu massiv, in dieser schwächlichen neuen Zeit, um an seinen Platz zurückgebracht zu werden. Als Craig sich erkundigte, ob man nicht mit entsprechendem Gerät kommen und den Felsbrocken wieder in die Mauer einfügen könne, sagte man ihm, unter dem Gewicht des Heckbaggers könnte die Zufahrt einbrechen.
Auf einem Abhang hinter dem gewaltigen Granitkubus, wo Craig selten hinkam, fand er beim Aufsammeln von Totholz einen verkohlten Arbeitshandschuh, steif wie ein totes Eichhörnchen. Mit einem Filzmarker, einer Sorte, die erst in den sechziger Jahren in Gebrauch kam, war auf den Rücken des Handschuhs das Wort SARGE geschrieben. Wer war Sarge gewesen? Einer aus einem Arbeitstrupp, spekulierte Craig, der seinen Handschuh achtlos am Rand eines sich ausbreitenden Buschbrands hatte fallen lassen. Oder ein Waldarbeiter, der, Reisig in ein loderndes Feuer werfend, plötzlich sah, dass seine Hand aufflammte, und den Handschuh unter Schmerzen von sich geschleudert hatte. Als er rings ums Haus, bei einem Frühjahrsputz, organische Abfälle zusammenharkte, entdeckte Craig unter einem überhängenden Forsythienstrauch etwas weich Geschwungenes aus schimmerndem Porzellan, und es mit den Fingern ausgrabend, sah er, dass es der Henkel einer Teetasse war. Er grub ungefähr sechs Fragmente aus; jemand hatte die zarte Porzellantasse mit Goldrand im Garten fallen gelassen oder zerbrochen, vielleicht ein Kind, das aus Angst und schlechtem Gewissen den Beweis seiner Missetat in einer Rabatte vergraben hatte. Das feine Porzellan der Tasse ließ auf eine der frühen Epochen schließen, vielleicht auf die fast mythische erste. Zeit und Feuchtigkeit können Porzellan, im Gegensatz zu Metall und Holz, nichts anhaben. Aber die Erde, gefrierend und tauend in ihrem Jahreszyklus, bringt irgendwann an die Oberfläche, was der Übeltäter sicher begraben und für immer verborgen glaubte.
Craigs Träume, jene, die ihn genug beunruhigten, um ihm noch im Gedächtnis zu haften, wenn er aufwachte, kehrten, wie ein Hund zu einer verscharrten Beute, immer wieder zu einem verhältnismäßig kurzen Abschnitt seines Lebens zurück, als er in einen familiären Zwiespalt geraten und in eine emotionale Bigamie verwickelt war. Da waren seine erste Frau, die in seinen Träumen eine gewisse porzellanhafte Glätte hatte, und seine zukünftige Frau, deren Kummer an vielen Stellen des Traumbilds zu spüren war, indes er sich mühte, die Teile dieses Menschenpuzzles festzuhalten. Seltsamerweise verlor er in seinen Träumen immer die zweite Frau – sah sie fliehen und in der Ferne sich verlieren –, sodass es jedes Mal ein leiser Schock war, wenn er aufwachte und sah, dass Grace und nicht seine erste Frau, Gloria, neben ihm im Bett lag, seit zwanzig Jahren nun schon. Seine Verwirrung löste sich nach und nach in Erleichterung auf, und er schlief wieder ein, ein lebendiger Verband, der sich über eine Wunde legt. Seine Kinder, jetzt mittleren Alters, kamen in den Traumdramen verschwommen vor, in Gestalt wechselnder Teilnehmer einer vielköpfigen Festgesellschaft, die sich auf halber Treppe eingefunden hatte; das Hauptelement der Party war jedoch nicht Fröhlichkeit, sondern Schmerz, ein Schmerz, der klebrig gemischt war aus Unentschlossenheit, unausgesprochenen Entschuldigungen und unerträglicher Ungewissheit. Craig wachte auf und sah, dass die Party längst vorbei war, dass er ein alter Mann war und seine Tage harmlos auf vier Hektar Land verbrachte, das mit dem gesprenkelten Mulch früherer Generationen bedeckt war. Er wurde selten irgendwohin eingeladen.
Die Partys waren Vehikel gewesen für Flirt und Erkundung, ein Zug aneinandergekoppelter Wochenenden, der sie alle in ausgelassenem Getöse mit sich nahm; er und seine Freunde standen in der Blüte ihres Lebens und erwarteten, dass, so amüsant und wunderbar alles war, ganz sicher noch Wunderbareres geschehen müsse. Es gab zwei simultane Partys, zwei Party-Schichten – die offen zutage liegende Schicht, da sie sich als Erwachsene über lokale Politik unterhielten, über nationale Belange (für gewöhnlich war Richard Nixon das Hauptthema), über ihre Autos und Schulen für ihre Kinder, über Baulanderschließungsausschüsse und Renovierungen ihrer Häuser, und dann die unterschwellige, da Männer und Frauen mit raschen Blicken und geflüsterten Worten kommunizierten, mit einem Druck der Hand und übermäßiger Heiterkeit. Diese zweite Schicht untergrub manchmal die obere und mit ihr das scheinbar solide Gefüge der eng verquickten Familien.
Cocktailpartys waren tödliche Getümmel, bei denen Liebende mit einem Murmeln Verabredungen aufkündigten oder sich über Abtreibungen einigten. Craig sah vor seinem inneren Auge in einem Flur in einem oberen Stockwerk vor einer Badezimmertür eine Frau, noch jung, mit glattem Gesicht und glatten Armen, die auf ihn zukam, die Lippen zum Kuss gespitzt, und leise «Angsthase» sagte, als er ihr auswich. Aber an wie viele Augenblicke aus jener fernen Zeit er sich auch erinnerte, für jeden gab es Hunderte, die er vergessen hatte und die sich im Gestrüpp dieser immer wiederkehrenden Partyträume in sein Bewusstsein zurückkämpften. Was er in diesen Träumen empfand, war immer dasselbe: Lampenfieber, ein schuljungenhaftes Gefühl, dass das, was er darstellte, zu groß für ihn war, zu ewig in seiner Bedeutung.
Er wachte auf und war erleichtert, der Aufruhr hatte sich gelegt, seine jetzige Frau war nicht mehr im Bett, sie rumorte schon unten im Haus. Manchmal wachte er in einem anderen Bett auf, weil er auf seine alten Tage hilflos, abstoßend schnarchte und ins Gästezimmer verwiesen wurde. Beim Aufwachen in diesem Zimmer fanden seine Augen an der Wand gegenüber ein Bild, das im Haus seiner Kindheit gehangen hatte – in den verschiedenen Häusern in Pennsylvania, die seine Familie bewohnt hatte. Das Bild, ein rührendes, ihm teures Zeugnis für Kultur, das seine Mutter für (wenn er sich recht erinnerte) fünfunddreißig Dollar in einem Bilderrahmenladen gekauft hatte, zeigte eine Landschaft in Massachusetts, einige hohe Dünen in Provincetown, ganz hinten ein flaches Dreieck aus Wasser, ein Blick aufs Meer, gerahmt von den beiden entferntesten Sandhügeln. War es dies Bild gewesen, das ihn aus jenem Commonwealth in dieses geführt hatte, in das Haus auf dem Hügel mit seiner diskreten Aussicht aufs fünfhundert Meter entfernte Meer?
Verschiedene andere Überbleibsel aus seiner Kindheitswelt waren wie Strandgut ins Haus gespült worden: die in Fraktur beschriftete Rasierschale seines Großvaters; ein eingekerbter kupferner Aschenbecher, in dem der Vater – der kleine Craig hatte es oft gesehen – Old-Gold-Zigaretten ausgedrückt hatte; ein Paar Messingleuchter, wie zu Kordeln gedrehte Seilstücke, die seine Mutter auf den Esszimmertisch stellte, wenn sie die aus New Jersey angereisten Verwandten des Vaters bewirtete. Diese Gegenstände waren im Abgrund verlorener Zeit bei ihm gewesen und hatten, anders als er, unverändert überlebt. Was bedeuteten sie? Sie mussten etwas bedeuten, befrachtet und schwer, wie sie waren, mit dem Geheimnis seiner vergänglichen Existenz.
«Ich gäbe sonst was darum, wenn ich dich nicht geheiratet hätte», sagte Grace manchmal, wenn sie zornig oder schwermütig war. Sie machte dann, so empfand er’s, einem Groll gegen ihn Luft, weil er schnarchte, obgleich er hilflos war und ebenso wenig dagegen tun konnte wie gegen seine Träume.
«Hätte ich doch nur auf mein Gewissen gehört.»
«Gewissen?», sagte er. Angsthase, erinnerte er sich. «Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin sehr glücklich. Du bist eine wunderbare Ehefrau. Wunderbar.»
«Vielen Dank, Schatz. Aber es war einfach so falsch. Damals bei den Rosses’ oben im Haus, wie du da im Flur auf mich zugesprungen bist – du warst zum Fürchten, wie ein großer Wolf aus dem Dunkeln. Deine Zähne haben geblitzt.»
«Geblitzt?» Er konnte es sich nicht vorstellen. Er hatte trübe, vom Tee verfärbte Zähne; aber er erkannte, dass das Blitzen etwas Wahres und Kostbares war, das sie aus ihrem tiefsten Innern heraufgeholt hatte, um ihrer Vergangenheit einen Leitstern zu geben, eine Illusion, an die sie sich halten konnte.
Errötend und mit niedergeschlagenen Augen sagte sie: «Ich dürfte so etwas nicht sagen, aber manchmal glaube ich, ich hasse dich.»
Ich hasse dich: von Zeit zu Zeit gab sie dies kund, und im nächsten Augenblick wollte sie mit dieser Kundgebung nichts zu tun haben; aber Craig erkannte die Äußerung als ehrlich an, er wusste, dass sie mit Mühe hervorgezerrt worden war aus der dichten Last täglicher Vortäuschung und Anpassung. So wie wir einander lieben, so hassen wir einander auch, sogar uns selbst.
Eines Tages nach der Schule hatte sein jüngerer Sohn traurig zu ihm gesagt, Graces Sohn, eine Klasse unter ihm, habe ihm anvertraut, dass seine Eltern sich trennen wollten. Craig war übel geworden bei der beiläufigen Offenbarung, er wusste, dass der Junge ihm Neuigkeiten mitteilte, die ihn bald selbst betreffen würden. Sein vertrauensvolles Kind stand am Rand eines sich öffnenden Abgrunds, einer Katastrophe, die sein Vater gerade anrichtete.
Während der Zeit, von der er immer wieder träumte, hatte er kein Lampenfieber gehabt. Sonderbar, wenn er daran zurückdachte: er hatte sich seltsam gelassen gefühlt, meisterlich ruhig inmitten von Skandal und Protest und Kummer. Es hatte einen Psychiater gegeben, der ihm Mut machte. Seine Mutter, anfänglich empört, wurde philosophisch, legte sich postmoderne Ironie zu und eine Talkshow-Toleranz, die sie während vieler Stunden vor dem Fernseher eingeübt hatte. Seine Kinder trösteten sich mit dem Gedanken, dass sie eines Tages erwachsen und nie wieder so hilflos sein würden. Wenn ein Mann seine Familie verlässt, wird eine belebende Fülle an Zeit für ihn frei. Craig fand sich in neuartige Situationen versetzt – im Morgengrauen aus einem fremden Bett aufstehen, Besuche in Anwaltskanzleien, Hotelaufenthalte Hunderte Meilen von zu Hause entfernt – und reagierte wie ein Schauspieler, der seinen Text geprobt, der sich mit heißem Eifer auf diesen unsympathischen Part vorbereitet hatte und ihn achtbar spielte, ganz gleich, was die Rezensenten sagten. Warum das Lampenfieber also jetzt, im Schlaf? Es war die ganze Zeit da gewesen und stieg jetzt in ihm hoch, wie sein Tod.
Er hatte kürzlich einen alten Freund, einen korpulenten Golfkumpel, der einen Herzinfarkt gehabt hatte, im Krankenhaus besucht. Al lag da, mit Schläuchen in der Nase und im Mund, die für ihn atmeten. Seine Brust hob und senkte sich mit einer mechanischen Regelmäßigkeit, die von hüpfenden grünen Linien auf dem Monitor an der Wand aufgezeichnet wurde: eine TV-Show, Als letzte Stunden. Es war fesselnd, obschon der Plot dünn war, nur diese unentwegt in einem leuchtenden Sorbetgrün hüpfenden Linien. Als Wimpern, blass und pelzig, flatterten, als Craig, zu laut, als rufe er vom Rand einer Klippe, sagte: «Danke für all den Spaß, Al. Tu, was die Schwestern und Ärzte dir sagen, dann wird alles gut.» Als Hand, gedunsen wie ein aufgepumpter Gummihandschuh, wackelte auf dem weißen Laken. Craig nahm sie in seine, vorsichtig, um die intravenösen Schläuche am Handgelenk nicht zu verrücken. Die Hand war warm und fühlte sich seidig an, wie eine Frauenhand – sie hatte seit einigen Jahren keinen Golfschläger mehr geschwungen –, aber sie schien ohne Leben, obwohl sie den Druck von Craigs Hand erwiderte. Unsere Körper, dachte Craig, sind ein schwerfälliges Überbleibsel, das der Geist zurücklässt.
Eines der Häuser seiner Kindheit war ein Farmhaus gewesen, ein paar Hektar Land gehörten dazu, und als er an einem einsamen Nachmittag allein das kleine Gehölz erkundete, war er auf eine alte Familien-Müllkippe gestoßen – einen fast ganz mit Efeu bewachsenen Hügel aus Glasflaschen mit erhabenen Beschriftungen, so selbstgewiss und dauerhaft wie die Inschriften auf Grabsteinen. Viele der Flaschen waren zerbrochen, obgleich das Glas für heutige Begriffe erstaunlich dick war, eine Art Kandis, der gezackte Rand bildete eine dritte Oberfläche, zwischen der inneren und der äußeren. Malzbraun, meerblau, beryllgrün, bernsteingelb, weißlich trüb, trugen sie in erhabener Schrift die Namen stillgelegter örtlicher Abfüllanlagen. Die Flüssigkeiten, die sie enthalten hatten, waren verdunstet oder ausgetrunken, ob die Getränke und Arzneien nun zum Guten oder zum Schlechten gewesen waren – nicht einmal so viel wie eine schlammige kleine Pfütze im Oval eines alten Reifens war noch übrig. Der Haufen, dieser Beweis für die Tiefen der Zeit, hatte den kleinen Craig erschreckt, wie ein Haufen Knochen es getan hätte, aber in seiner ländlichen Isolation war diese Müllkippe in dem abgelegenen Winkel des Gehölzes, ohne dass er sich dessen bewusst war, eine glitzernde, heitere Gesellschaft für ihn gewesen.
Mit dem Müllbeutel in der Hand über sein eigenes Land streifend, fand er in der Senke jenseits des vereinzelten Felsbrockens und des verbrannten Handschuhs mehrere halb begrabene Golfbälle, die Unterseiten von der sauren Erde braun verfärbt, die Hartgummihüllen schon leicht verrottet. Er erinnerte sich, wie er in seiner ersten Zeit hier, als er noch hoffte, ein guter Golfer zu werden, sich an den Rand des Rasens gestellt und ein paar alte Bälle – sparsam nie mehr als drei auf einmal – in den Wald unten geschlagen hatte. Sie schienen für immer zu fliegen, bevor sie in den Bäumen verschwanden. Er hatte nie damit gerechnet, sie wiederzufinden. Sie markierten, nahm er an, den Beginn seiner Epoche.
Frei
«Sie hat so schöne Augen.» Diese Bemerkung war von seiner Mutter gekommen, bei einem ihrer Besuche in der Stadt, in der Henry und Leila, verheiratet mit anderen, damals lebten. Sie konnte nicht gewusst haben, dass ihr Sohn und Leila eine Affäre hatten – eine, die wie ein Grasfeuer jedes Mal wieder aufflammte, wenn sie dachten, sie hätten es ausgetreten. Aber Leila wusste natürlich, dass es die Mutter ihres Geliebten war, und dieses Wissen gab den ungezwungenen Höflichkeiten, die sie der älteren Frau in der Unterhaltung erwies, eine zusätzliche Lebhaftigkeit, ein Augenfunkeln. Einmal war Leilas Mutter zu Besuch in ihrer überhitzten kleinen Stadt, und Henry hatte sich gewundert, als er auf der kleinen Party, die ihre Tochter gab, das Profil der stämmigen Frau von Mitte sechzig betrachtete, dass eine so unattraktive, geschlechtslose Person eine solche Schönheit hervorgebracht haben konnte, eine so geschmeidige, wollüstige Anstachlerin männlichen Entzückens.
Die Bemerkung seiner Mutter hatte seiner unerlaubten Leidenschaft einen gespenstischen Segen gegeben; den beiden Frauen war eine Liebe zur Natur gemein – sie kannten die Namen von Vögeln und Blumen, und wenn er und Leila zusammen sein wollten, trafen sie sich oft in der Wildnis, am waldigen Ende einer benachbarten Stadt in einem Cottage am See, das eine freisinnige Freundin, eine ältere Frau, ihr zur Verfügung stellte. Die klamme Kühle der Vor- oder Nachsommerzeit und der modrige Geruch der Segeltuch- und Korbmöbel, der kahlen Matratze und des nicht angeschlossenen Kühlschranks wichen den Aromen ihrer eigenen nackten Wärme, indes vor dem Fenster der See glitzerte und Eichhörnchen über das Dach liefen. Leila unter sich, goss er seinen Blick in ihre geweiteten Augen, die wirklich schön waren, ein helles Braun, gemischt aus Grün und einem rötlichen Braun rings um die schwarzen Pupillen, die durch den Schatten seines Kopfes vergrößert waren. Das Cottage hatte ein Oberlicht, er konnte das Rechteck, struppig eingefasst von herabgefallenen Zweigen und Kiefernnadeln, in der feuchten Konvexität ihrer bestürzt blickenden Augen sehen.
Seine Mutter hatte sich für seine Frau nie erwärmen können: Irene war zu großstädtisch, zu korrekt, zu stoisch. Henry war durch sie auf der Leiter eine Sprosse höher, in eine Familie gutsituierter Anwälte, Banker und Professoren aufgestiegen, aber zu Hause, im engen ständigen Miteinander, waren Irenes Intimitätsbewilligungen knapp bemessen und wurden immer knapper. Henry gab sich Mühe, seine Bedürfnisse einzuschränken, um sich anzupassen, und fand durchaus Gefallen an seiner zunehmenden Trockenheit, seiner immer müheloser gelingenden Verkörperung eines wohlerzogenen Stocks. Seine Mutter, deren unerfüllte Hoffnungen den Ambitionen für ihren Sohn etwas allzu Blühendes gaben, sah diese häusliche Eingeschnürtheit und hegte einen Groll dagegen; ihr Groll bestärkte ihn, als er, mit Leila intensiver als mit etlichen anderen, vom Pfad ehelicher Treue abwich und die wilde feuchte Luft der Natur atmete.
Feucht: er vergaß nie, wie Leila sich an einem sonnigen, aber kühlen Oktobertag plötzlich auszog und vom noch nicht abgebauten Anlegeponton einen perfekten Hechtsprung – ihr Hinterteil ein jähes weißes Herz, in der Mitte gespalten, im Zentrum seines Blickfelds – in den See vollführte. Sie tauchte auf, ihr Kopf war so klein und nass wie der eines Otters, ihre Lider flatterten, und ihr Mund rief: «Huuuh!»
«Bist du nicht halb tot?», fragte er, angezogen auf dem wackeligen Ponton stehend und sich ängstlich nach spionierenden Fremden umsehend, die hinter all diesen herbstlichen Bäumen auf der Lauer liegen könnten.
«Ich bin in Ekstase!», sagte sie und schnitt eine Grimasse, um ihre Zähne am Klappern zu hindern. «Man muss sich nur trauen, dann erlebt man’s. Komm schon, komm rein, Henry.» Wassertretend breitete sie die Arme aus und stieß sich hoch, sodass ihre schimmernden Brüste entblößt waren.
«O nein», sagte er, «bitte», hatte aber keine Wahl, als er sah, dass dies ein erotischer Wettstreit war; er zog sich aus, legte seine Sachen gefaltet ein gutes Stück entfernt vom Gespritz ab und wagte ungelenk einen herzstockenden Sprung ins schwarze Seewasser. Die rosa Blätter von Rotahornen, zu flachen Bootsformen verwelkt, trieben nah vor seinen Augen, als er hochkam; sein untergetauchter Körper fühlte sich geschwollen und glühend heiß an, als ob ein Blitz ihn getroffen hätte. Leila kraulte mit kräftigen Zügen von ihm fort, zur Mitte des Sees hin, ihre sehnigen Füße wirbelten weißschäumendes Wasser auf. Er rang nach Luft und paddelte wie ein Hündchen zum Ponton zurück und sah aus dieser tieferen Perspektive die Bäume ringsum als die Seiten eines goldenen Brunnens, eine Umfriedung, die ihn im Mittelpunkt des umgrenzten Himmels hielt. Dies war einer der Momente, erkannte er, da ein Leben die Früchte erntet, die die Natur bereithält. Dies war Gesundheit: der kleine nasse Kopf, die glänzenden Otteraugen, der kleinbrüstige Körper, ihm zur Verfügung, wenn die Elektrizität aus seinen Adern ebbte und ihrer beider Haut trocken gerubbelt war mit den Handtüchern, die Leila vorsorglich mitgebracht hatte.
Aber selbst dann drängte die weniger gesunde Welt sich dazwischen. Er fragte sich, ob Irene wohl den schwarzen See mit seinem morastigen Boden aus totem Laub an ihm rieche. Sie würde sich wundern, warum seine Haare feucht waren. Er war im Ehebrechen nicht gut, nicht so wie Leila, weil er sich nicht ganz und gar dem Augenblick hingeben, ihm nicht blind entgegenstürzen konnte. Der Segen seiner Mutter schützte ihn nicht vor Gastritis und einer ominösen Diagnose seines Arztes: «Etwas nagt an Ihnen.»
Die Stichhaltigkeit des Satzes erschreckte Henry; sein Verlangen nach Leila war wie ein wildes Tier. Es fiel über ihn her, wenn er nicht darauf gefasst war, und nagte an ihm im Dunkel. «Die Arbeit», log er.
«Können Sie’s nicht ein bisschen langsamer angehn lassen?»
«Noch nicht. Ich muss die nächste Stufe erreichen.»
Der Arzt seufzte und sagte – und von seinem zusammengepressten müden Mund war nicht abzulesen, wie viel er erriet oder wusste –: «Vorläufig, Henry, müssen Sie auf dieser Stufe leben. Geben Sie irgendetwas auf. Sie haben sich zu viel vorgenommen.» Dies Letzte kam mit einem Nachdruck, der Henry unheimlich war, wie der Segen seiner Mutter aus heiterem Himmel. Die Luft selbst, stellte er sich manchmal vor, schwebte behütend über ihm und beaufsichtigte sein Schicksal, indes er sich im Nebel vorankämpfte.
Er trat von seinem Amt als Co-Captain der kirchlichen Spendenaktion zurück. Dies und der Verzicht auf Kaffee und Zigaretten verschafften seinem Magen ein wenig Erleichterung, aber der scheuernde Schmerz ging nicht weg, bis Leila plötzlich, ohne je zu erklären, warum, Pete, ihrem Mann, alles gestand. Im selben Jahr zogen sie nach Florida; wenige Jahre später kam die Nachricht, dass sie geschieden seien. Ihre Ehe war ihm immer ein Rätsel gewesen. «Er braucht mich nicht», hatte sie einmal gesagt und war, was sonst nie vorkam, in Tränen ausgebrochen, während sie einen Punkt irgendwo über seiner Schulter fixierte. «Er braucht mein Arschloch.» Henry konnte nicht glauben, was er hörte, und wagte nicht, sie um nähere Auskunft zu bitten. Es gab vieles, fiel ihm auf, das er nicht wissen wollte. Wenn das Leben ihm auch Beförderungen im Beruf bescherte und Ferien in Florida und Maine und Enkelkinder und seine Verkörperung eines wohlerzogenen Stocks unter Irenes Anleitung immer überzeugender wurde – eine Liebesbestie gab es nie wieder. Solche Feuer brennen das Feld nieder.
Als Irene in ihren Sechzigern war, starb sie an Krebs, und er war frei. Über seine Freunde – diese unentrinnbaren, allwissenden Freunde – war er Leila auf der Spur geblieben und wusste, dass sie noch zweimal geheiratet hatte und jetzt wieder unverheiratet war: der erste nach Pete war ein älterer Mann gewesen, der ihr ein bisschen Geld hinterlassen hatte, der zweite war jünger als sie gewesen und hatte sich, natürlich, als ungeeignet erwiesen. Henry erfuhr ihre Adresse und schrieb ihr einen Brief, in dem er vorschlug, dass er sie besuche. Er und Irene hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, im Winter für zwei Wochen nach Florida zu fahren und sich in ihrem Lieblingshotel auf einer Insel vor der Golfküste einzuquartieren – eher Irenes Lieblingshotel als seines. Es roch nach lasiertem Kiefern- und Teakholz, und in den langen Korridoren waren ausgestopfte Tarpune und Schwertfische an den Wänden befestigt und alte Photographien von Fischfangpartys und Hurrikanverwüstungen; auf den sonnigen breiten Treppenabsätzen standen Glaskästen mit Muschelsammlungen, die Tinte auf den trockenen, an den Rändern sich hochbiegenden Schildchen war verblasst. Es roch nach einem Florida, das noch eine abgelegene Gegend war, das spartanische Paradies reicher Männer, und nicht der Vergnügungspark und das Pensionärsheim der großen Demokratie. Aber seit Irenes Tod, nach den zwei Jahren gemeinsam durchlittener Qualen, nach den mühevollen Fahrten ins Krankenhaus, den aufkeimenden und sinkenden Hoffnungen, der endgültigen Hoffnungslosigkeit und dann nach diesen posthumen Monaten der Erleichterung und Trauer und betäubend fortdauernder Abwesenheit hatte Henry eine Scheu entwickelt, von den Reisepfaden abzuweichen, die Irene für sie beide festgelegt hatte.
Das Hotel lag an der Westküste, südlich von Port Charlotte, und Leilas Condo war an der Ostküste, in Deerfield Beach, nördlich von Fort Lauderdale, und so war es eine beschwerliche Fahrt, nach Süden und dann nach Osten in die Sonne, gegen den, wie ihm schien, massiven Verlauf der Maserung in der struppigen Everglades-Landschaft. Die Ostküstenüberfülltheit – die vielen aggressiven dunkelhäutigen Fahrer, die Blocks eingeschossiger Häuser mit weißen Dächern, die über Meilen hin in die flachen Sandweiten gestellt worden waren, nahmen ihm die Orientierung. Das Alter, entdeckte er, brachte einen Zuwachs an Unsicherheit. Straßenschildern, Rückspiegeln und seiner Fähigkeit zu improvisieren war nicht mehr zu trauen. Er fragte dreimal nach dem Weg, steuerte fort von den jungen Leuten auf den hellen Straßen und hielt sich neben schreckhaften und vorsichtigen Senioren, bis er Leilas Condocomplex fand; mit zusammengekniffenen Augen machte er den richtigen Eingang ausfindig und den versteckten Besucherparkplatz. Dann stand er in einem von zwei Stockwerken umschlossenen weiten viereckigen Innenhof, auf den in jeder Etage eine Wohneinheit mit verglaster Sonnenveranda hinausging. Ein Stück bekritzeltes Papier in der Hand, verglich er die notierte Nummer mit einer an einer Tür im Parterre: sie stimmten überein. Als auf sein Klingeln geöffnet wurde, hatte er Mühe, die Leila seiner Erinnerung und Imagination in Beziehung zu bringen mit der winzigen Frau, deren nussfarbenes Gesicht kreuz und quer von Fältchen durchzogen war. Ihr Gesicht hatte in den vergangenen dreißig Jahren viel Sonne gesehen.
«Henry, Lieber», sagte sie, und es klang eher wie eine Bestätigung denn wie eine Begrüßung. «Du hast dich über eine Stunde verspätet!»
«Die Fahrt hat länger gedauert, als ich dachte, und in einigen Blocks hier habe ich mich dauernd verfahren. Es tut mir so leid. Du hast immer gesagt, ich sei ein bisschen chaotisch.» So, wie sie das Gesicht hochhielt, ganz reglos, nahm er an, dass er es küssen sollte; abrupt fiel ihm ein, dass er ihr kein Geschenk mitgebracht hatte. Es war die Natur ihrer alten Beziehung gewesen, dass er einfach seinen Körper mitbrachte und sie den ihren. Ihre Wange hatte eine trockene, krispelige Textur unter seinen Lippen, war aber warm, wie die Ballen von Hundepfoten.