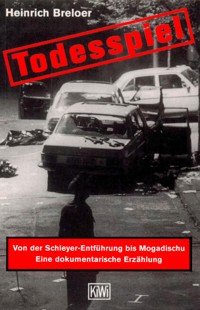22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Heinrich Breloers großes Portrait über Bertolt Brecht: Ein Denkmal wird lebendig. Der bedeutende deutsche Film- und TV-Autor und Regisseur Heinrich Breloer hat mit seinen Filmen und Büchern schon viele Figuren der deutschen Geschichte zu neuem Leben erweckt. Nun stellt er uns Bertolt Brecht vor. Über Jahrzehnte hat er mit Brechts Weggefährten, mit Frauen, Geliebten, Familienmitgliedern und Freunden, Verbündeten und Verstoßenen gesprochen, darüber ein großartiges Buch geschrieben und mit einem Starensemble Brechts Leben verfilmt. »Ich komme gleich nach Goethe«, ruft ein 17-jähriger Augsburger Schüler seiner jungen Liebe Paula entgegen. Das letzte Genie wolle er werden. Seine Freunde lachen mit ihm über seine Anmaßung, und doch glauben sie dem schmächtigen, schüchtern wirkenden Brecht. Am Ende ist er, nach den wilden, anarchischen Anfängen als Lyriker und Dramatiker, nach dem Welterfolg der »Dreigroschenoper«, nach seiner Annäherung an die kommunistische Partei, seiner Flucht vor den Nazis und dem amerikanischen Exil, tatsächlich eine Jahrhundertfigur. Er führt gemeinsam mit Helene Weigel das Berliner Ensemble am Schiffsbauerdamm zu Weltruhm, ist im geteilten Deutschland politisch heftig umkämpft und wird weltweit zum Klassiker erklärt. »Ich werde der Welt zeigen, wie sie ist. Aber wie sie wirklich ist.« Dieses Brechtsche Programm wendet Breloer in seinem Dokudrama und in seinem Buch auf Brecht selbst an. Und so begegnen wir statt einem Klassiker dem Menschen in einer aufregenden, romanhaften Lebenserzählung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Ähnliche
Heinrich Breloer
Brecht
Roman seines Lebens
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Heinrich Breloer
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Motti
Unterwegs zu Bertolt Brecht
Teil 1 Die Liebe dauert oder dauert nicht
Frühjahr 1956. Kalte Morgendämmerung ...
Augsburg, eine Gasse in ...
Erst im Frühling des ...
In einer Mansarde, Bleichstraße ...
In Brechts Mansarde ist ...
Schon der erste Blick ...
Tief erschrocken und in ...
Auf dem Plärrer, dem ...
Am Lech, eine eher ...
An der Westfront. Granatlöcher, ...
Viele Gewässer, Gräben, Kanäle ...
Zarte, sentimentale Melodien füllen ...
Brecht hat noch rasch ...
Nachts, am Lech. Vor ...
Und jetzt hat er ...
Hotel Reichsadler, München. Brecht ...
An der Westfront in ...
In der Augsburger Bleichstraße ...
Brecht kommt eilig in ...
Brecht ist in die ...
Kimratshofen, ein kleines Dorf ...
Im Versammlungssaal einer Augsburger ...
Ostern 1919 sitzen Brecht ...
Auf einer Straße in ...
In Kimratshofen, im Haus ...
Brecht steht in München ...
Augsburg, Wohnung der Familie ...
Am nächsten Morgen in ...
Augsburger Stadttheater. Auf einer ...
Auf der Straße vor ...
München, Brechts Studentenzimmer. Es ...
Vor dem Bühneneingang des ...
In Brechts Mansarde ist ...
Im Augsburger Stadttheater, in ...
München, Büro des Filmagenten ...
Ein Waldweg in Kimratshofen. ...
Jemand hat an die ...
In ihrem Münchener Zimmer ...
Einige Wochen später rennt ...
Auf Verrat steht die ...
Augsburg, Wohnzimmer der Familie ...
Am Starnberger See, in ...
Am Starnberger See, andere ...
D-Zug München-Berlin. Aus dem ...
Berlin, Wohnung der Eltern ...
Berlin, Straße vor einem ...
Ein kleines Theater in ...
Marianne Zoff tritt mit ...
Der Regisseur Brecht war ...
Am nächsten Tag sitzt ...
Auf Brechts Liebeswirren hat ...
Herbst 1923. Brecht ist ...
So kommt es, dass ...
In Bronnens Zimmer steht ...
Im Atelier Spichernstraße hat ...
München, Feuchtwangers Wohnung. Bücher ...
Münchner Kammerspiele, Bühne. Caspar ...
Am 9. November 1923 ...
Im Schlafzimmer der Münchener ...
Ein paar Tage später ...
München, Kammerspiele. Eine der ...
Im August 1924 stemmen ...
Am Sonntag, dem 25. ...
Am nächsten Vormittag kommt ...
In der vordersten Reihe ...
In Caspar Nehers Berliner ...
Atelier Spichernstraße. Helene Weigel ...
Max Schlichters Gaststätte in ...
Hoch über Berlin haben ...
Der frischgebackene Theaterdirektor Ernst ...
Im Theater am Schiffbauerdamm. ...
Im Direktionsbüro des Theaters ...
Es ist früher Morgen, ...
Elisabeth Hauptmann öffnet die ...
In der Koblanckstraße, nicht ...
Ein paar Tage später ...
Brecht stehtam großen Fenster ...
Im Januar 1932 wird ...
Berlin, Komödienhaus am Schiffbauerdamm. ...
Am Bühnenausgang wartet Brecht ...
Wenige Tage später ist ...
Als Grete Steffin am ...
Mitte August 1932. Brecht ...
Szenen aus dem Exil
»Die Ratten besteigen das ...
Vor dem Haus von ...
Auf der Terrasse einer ...
In seinem Arbeitszimmer im ...
Ruth Berlau lenkt ihr ...
Das Motorrad ist vor ...
Als Ruth ihre Geschichte, ...
In Moskau, nicht weit ...
In ihrem kleinen, deutlich ...
Grete Steffin wird von ...
Im Arztzimmer der Klinik ...
An Grete Steffins Krankenbett ...
Brecht kommt ein letztes ...
Im Express Moskau-Wladiwostok, der ...
In ihrem Bett in ...
Es ist der 4. ...
Vier Tage später. Im ...
TEIL 2 Das Einfache, das schwer zu machen ist
Im New Yorker Apartment ...
Im Rauchersalon des Zuges ...
In New York, in ...
Zürich, Atelier Gartenstraße 38. ...
Auf der Bühne des ...
Das Deutsche Theater steht ...
In Helene Weigels Garderobe ...
Im Foyer des Deutschen ...
In der Garderobe kleidet ...
Auf der Bühne des ...
Das Hotel Adlon am ...
Auf dem Perlachturm, dem ...
In der Nähe der ...
Berlin-Weißensee, Brechts Villa in ...
Im gerade erst eingerichteten ...
Heiligabend in Brechts Haus ...
In der Wohnung von ...
Die ersten Morgenstunden gehören ...
Auf der Probebühne in ...
Im Fotolabor des Berliner ...
Ein Krankenwagen fährt die ...
Im Büro Brechts im ...
Auf der Probebühne in ...
In Brechts Arbeitszimmer in ...
In der Küche in ...
Auf der Probebühne in ...
Am Rand der Probebühne ...
Der 22. Februar 1953 ...
Am Sonntagmorgen sind kaum ...
Im Stasi-Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen wird ...
In Brechts Büro über ...
Die Lichter auf der ...
Auf der Probebühne Reinhardtstraße ...
In der Villa in ...
Tage später. In seinem ...
Helene Weigel hat das ...
In der Chausseestraße 125, ...
In seinem Büro in ...
Am 16. Juni 1953, einen ...
Spät am selben Abend ...
Im Büro über der ...
Wekwerth und Elisabeth Hauptmann ...
Währenddessen diktiert Brecht im ...
Am 21. Juni 1953 ...
Im Probenhaus Reinhardtstraße versammeln ...
In seinem Büro in ...
Brecht sitzt in Buckow ...
Morgenstimmung in Käthe Reichels ...
Im Arbeitszimmer in Buckow ...
Brecht geht mit Wilhelm ...
Im Sommer 1953 fährt ...
In seinem Büro im ...
Auf der Probebühne in ...
In ihrer Berliner Wohnung ...
Brecht geht mit dem ...
Brecht sitzt im Krankenzimmer ...
Brecht öffnet die Tür ...
Auf der Probebühne in ...
New York, 1944, Apartment ...
Auf der Bühne im ...
Der Zug Union Pacific ...
Jetzt, 1954 in Berlin, ...
Im Jahr 1944 steht ...
Im South Oaks Hospital ...
Fortsetzung der Proben im ...
Manfred Wekwerth kommt mit ...
In seiner Wohnung in ...
Die Tür zu seiner ...
Später sitzt Brecht im ...
In dem kleinen Garten ...
Im zweiten Stock der ...
Brecht empfängt in seiner ...
Juni 1954. Auf dem ...
Paris, Juni 1954. Auf ...
In ihrer Garderobe im ...
In einem Zimmer des ...
Paris, Théâtre Sarah Bernhardt. ...
Hinter dem Vorhang des ...
In der Loge des ...
In seinem Bibliothekszimmer in ...
Im Schlafzimmer in der ...
Inzwischen hat sich Brecht ...
Im Swerdlowsaal des Kreml ...
Auf der Bühne im ...
Durch die enge Durchfahrt ...
In seinem Krankenzimmer in ...
An Brechts Krankenbett sucht ...
Brecht geht in seinem ...
Im Bibliothekszimmer in der ...
Galilei-Probe auf der Bühne ...
Und jetzt sitzt Brecht ...
Kurze Zeit später steht ...
Am 10. August 1956 ...
Im großen Arbeitszimmer in ...
Wenig später sitzt Helene ...
Es ist mittlerweile Mitternacht. ...
Der 15. August 1956 ...
Später am Vormittag. Helene ...
Helene Weigel führt den ...
Am nächsten Tag. In ...
Am frühen Morgen des ...
Vor dem Friedhofstor in ...
Auf dem Hof des ...
Anhang
Besetzung
Texthinweise
Bücher
Bildnachweis
Dank
Inhaltsverzeichnis
Mitarbeit: Rainer Zimmer
Inhaltsverzeichnis
Die Widersprüche sind die Hoffnungen.
Bertolt Brecht, Motto zu Der Dreigroschenprozeß
Ihre Hände sind befleckt, sagten wir – Sie sagen: Besser befleckt als leer.
Bertolt Brecht, Leben des Galilei
Brecht gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat.
Heiner Müller
Er hat gespielt und wir durften mitspielen.
B. K. Tragelehn zur Probenarbeit mit Brecht
Er hat mich gekannt, und zwar sehr gut. – Ihn konnte man nicht kennen.
Regine Lutz über Bertolt Brecht
Es gibt da auch nach meinem Tode noch gewisse Möglichkeiten.
Bertolt Brecht zum Pfarrer Karl Kleinschmidt
© Bavaria Fiction GmbH/Nik Konietzny
Inhaltsverzeichnis
Unterwegs zu Bertolt Brecht
Die Nazis hatten ihn ausgebürgert und seine Bücher verbrannt. Wenn ihm auch die Flucht im letzten Augenblick gelungen war: Der Mann schien erledigt. In zwanzig bis dreißig Jahren sollte sich niemand mehr an ihn oder seine Werke erinnern, in Deutschland würde er für immer vergessen sein. 1945, nach zwölf Jahren, waren die Nazis weg und er kurz darauf wieder da: zunächst als Gerücht, als eine schwache Erinnerung, eine Hoffnung. Dann trat Brecht persönlich auf.
Überall gab es nach Kriegsende kleine Glutnester der Erinnerung. Jemand hatte eine Erstausgabe der Hauspostille über die ›finstere Zeit‹ gerettet, ein anderer hatte eine alte Platte mit den Songs der Dreigroschenoper aufgehoben und jetzt wieder aufgelegt. Sofort war die Kraft wieder da, die von Bertolt Brecht und seiner Sprache ausging. Zwischen den Ruinen wurden die ersten Stücke von ihm wieder aufgeführt. Und die Menschen bemerkten, was sie mit ihm und seinen Werken verloren hatten. Manch einer verfolgte den Weg des Vertriebenen aus Amerika über die Schweiz zurück nach Berlin. Vor dem Mann kam das Gerücht. Als er dann kam und man ihn und die Weigel bei den Aufführungen der Mutter Courage im Winter 1949 im Deutschen Theater in Berlin erleben konnte, waren viele zutiefst beeindruckt. »Ein Realitätsschock«, sagt der spätere Brecht-Assistent B.K. Tragelehn, »plötzlich konnten die Leute sehen, wie sie ein paar Jahre vorher ausgesehen hatten.«[1] Für die junge Generation war das etwas völlig Neues. Noch während der Vorstellung fiel für den Regieschüler Egon Monk eine Lebensentscheidung. »Alle meine Gesichtspunkte veränderten sich. Ganz abgesehen davon, dass diese Aufführung an bestimmten Stellen so durch und durch ging bis auf die Knochen, wie ich es vordem auf dem Theater noch nie erlebt hatte. Und da sagte ich mir persönlich: Zu dem musst du!«[2]
© Bavaria Fiction GmbH/Stefan Falke
Und wie ist er zu mir, dem Nachgeborenen in der Bundesrepublik um 1960, gekommen? – »Brecht ist ein Schwein. Dass solche Stücke gespielt werden!« – So oder so ähnlich empörte sich die bigotte Deutschlehrerin in der Oberstufe. Es ging bestimmt um die Dreigroschenoper. 1958 war eine viel beachtete Schallplattenaufnahme mit Lotte Lenya und populärer Westberliner Besetzung erschienen. Eine dermaßen wütende Verachtung war für mich damals, in dieser erzkatholischen Internatsschule auf meinem Weg von der katholischen Tabernakellaus zum Menschen, ein Qualitätsmerkmal. Der Index, das Verzeichnis der vom Vatikan verbotenen Bücher, war für die kleine Gruppe von Außenseitern – meine Freunde, die Freidenker – die Bestenliste. Wer für diese Lehrerin ein Schwein war – dessen Werke musste man in die Finger bekommen. Der erste Band erreichte mich dann in Gestalt eines Geburtstagsgeschenks. Die Hauspostille war das erste Schweine-Buch. Es war genau die richtige Medizin. Schon allein die Frechheit, das als religiöse Erbauungsschrift mit Exerzitien, Bittgängen und Chroniken auszugeben! Und die Anleitung des Autors, das Lied vom ertrunkenen Mädchen »mit geflüsterten Lippenlauten zu lesen«[3] – das war das ideale Erziehungsprogramm für einen Klosterschüler, für einen eingeschüchterten, im Herzen religiös erpressten Primaner mit Hunger auf Leben und Wirklichkeit. Durfte man so etwas überhaupt aussprechen, wenn auch nur hingeflüstert? »Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war/Geschah es (sehr langsam), dass Gott sie allmählich vergaß …«[4]
Aber welches Gedicht, welches Lied aus dieser Sammlung hätte man überhaupt laut singen dürfen? Es war doch alles eine grässliche Gotteslästerung. Dafür aber mit dramatischen Ermutigungen. »Laßt euch nicht verführen!/Es gibt keine Wiederkehr. (…) Ihr sterbt mit allen Tieren/Und es kommt nichts nachher.«[5]
Das alles war ein Riss in den katholischen Himmel, in diese festgefügte Welt aus Himmelskuppel und tief unten brennendem Höllenpfuhl mit den Marterwerkzeugen der vielen Teufel, die auf uns warteten. »Oh, show us the way to the next whisky-bar«[6] half schon mal darüber weg.
Als ich am Hamburger Studententheater, der Studiobühne, mitarbeiten konnte, merkte ich schnell, dass ich in der richtigen Stadt in guter schlechter Gesellschaft angekommen war. Ich war dabei, als der Kommilitone Claus Peymann Brechts Antigone-Bearbeitung nach dem Antigonemodell 1948 inszenierte. Das war im Sommer 1963, Brecht war sieben Jahre tot. Bei den Proben mit Peymann konnte ich lernen, welch ein Gewinn die Verfremdung und das gestische Spielen und Sprechen für das Theater sein können. Dass hier eine Distanz zwischen den Darstellern in ihren Rollen und den Zuschauern aufgebaut wurde, machte die Probleme auf der Bühne sichtbarer, vorzeigbarer. Und auch diskutierbarer, weil es eben kein auf Illusion und Einfühlung ausgerichtetes Spiel war.
Heinrich Breloer 2018 © Bavaria Fiction GmbH/Stefan Falke
Schon ein Jahr vorher hatte Peymann mit der Studiobühne Der Tag des großen Gelehrten Wu inszeniert. Das war ein Stücklein aus der Brecht-Werkstatt; die Bearbeitung eines chinesischen Volksstücks durch Brechts Assistenten Peter Palitzsch und Carl M. Weber, entstanden unter Brechts Oberaufsicht. Das Programmheft hebt die Produktion im Kollektiv schon bei der Entstehung des Werks hervor. Und eigentlich war es auch bei den Proben mit Peymann ähnlich wie bei Brecht. Wir Assistenten und die Darsteller konnten jederzeit Vorschläge machen, die dann daraufhin abgeklopft wurden, ob sie praktikabel waren oder nicht.
Bei den Aufführungen im Hamburger Audimax haben wir direkt nach der Vorstellung ganz in Brechts Sinn mit dem Publikum die Inszenierung diskutiert. Wie hatten die Zuschauer das Spiel verstanden? Was konnte, was sollte die Regie verbessern?
Heinrich Breloer 1963 © Sammlung Heinrich Breloer
Nachdem sich die DDR 1961 eingemauert hatte, gab es bei den Künstlern dort die Hoffnung, dass nun, da man ja nicht mehr in den Westen fliehen konnte, vom Staat mehr Freiheiten gewährt würden. Diese Hoffnung erfüllte sich auf Dauer nicht, Kontrolle und Zensur wurden vielmehr noch verschärft. Trotzdem bekamen wir aus der DDR eine Einladung, Peymanns Inszenierung der Antigone in Leipzig zu zeigen.
Der Kontakt mit den Studenten in der DDR – »DDR«: das durfte man damals in Hamburg auf den Plakaten keinesfalls ohne Anführungszeichen schreiben – führte auch zu persönlicheren Beziehungen. Mit einem jungen Schriftsteller habe ich über Jahre einen inoffiziellen Austausch West- gegen Ostbücher arrangiert. In der DDR nicht erhältliche oder, riskanter, nicht erlaubte Bücher aus dem Westen gingen von Hamburg aus an das Literaturwissenschaftliche Institut der Universität Rostock. Ich bekam dafür von meinem Partner die – wenn man den brechtisch unscheinbaren graugelben Schutzumschlag entfernt hatte – schönen, in rotes Leinen gebundenen Bände der Brechtausgabe des Aufbau-Verlags.
Meine erste persönliche Begegnung mit dem Berliner Ensemble, das war Helene Weigel. Sie kam zum ersten Mal im Januar 1969 zu uns. Begleitet von einigen Mitgliedern des Ensembles, las sie im Audimax der Hamburger Universität Gedichte von Brecht. Ich hatte mich in eine der vorderen Reihen gesetzt, um das Schauspiel so nah wie möglich zu erleben.
Was über die Jahre bei mir blieb, ist das Bild der überaus disziplinierten alten Dame – 69 Jahre alt war sie damals –, die sich auf der großen, leeren Bühne an einem kleinen Tisch in einen Sessel setzte, einen Gedichtband aufschlug und darin scheinbar suchend blätterte. Dann hatte sie wohl eine Stelle gefunden, die sie sich genauer ansah, und schließlich las sie das Gedicht so vor, als ob sie es seit langer Zeit zum ersten Mal lesen würde. Das war erstaunlich. Wir fragten sie nachher, warum sie das gemacht hätte. Sie konnte doch sicher diese Gedichte alle längst auswendig vortragen. Aber genau das wollte sie nicht. Sie wollte sich frisch und neugierig auf diese Zeilen konzentrieren, sie gewissermaßen auf-lesen. Diese Stimme, die Haltung, das Buch in der Hand – ein Eindruck, der sich mir eingeprägt hat.
Helene Weigel © Akademie der Künste, Berlin: Vera-Tenschert-Archiv
Was am Studium der Literaturwissenschaft an der Universität zu Beginn so ermüdend und einschüchternd war: diese endlosen Reihen mit den Büchern der Sekundärliteratur. Das Sekundäre schob sich vor das Primäre. Ich wollte aber von Anfang an wissen, wer diese Dichter waren, wie sie gelebt hatten, wie sie in ihren Werken wiederzuerkennen waren. Wie ein Jagdhund war ich in diesem staubtrockenen Bücherwald unterwegs auf der Blutspur des Lebens. Und vor allem war da die »unwissenschaftliche« Frage: Könnte ich hier dem Leben begegnen? Wie sich diese Außenseiter ihren Weg in die Gesellschaft erkämpft hatten oder auch gescheitert waren? Und wie das ihre Literatur geprägt hatte? Eine verpönte Angelegenheit war das damals: Biografismus! Nach dem Verrat an der Literatur im Dritten Reich hatte sich die Germanistik vom Bündnis mit Volk und Rasse, Blut und Boden gelöst und sich vorübergehend eine »werkimmanente Betrachtungsweise« zugelegt: Nur der Text sollte zählen, sonst nichts.
Mit der Studentenbewegung wurde die Literatur zwar in größere Zusammenhänge gestellt, die Autorenbiografik gehörte aber nicht unbedingt dazu. Von großen Persönlichkeiten hatte man erst einmal die Nase voll. Wir interessierten uns jetzt für die gesellschaftliche Funktion der Literatur, wir eigneten uns historische und soziologische Fragestellungen und Begriffe an. So wurde es für mich wieder spannend, in den Werken auf die Suche nach den Spuren des Lebens der Autoren und ihrer Zeit zu gehen.
Außerdem beschäftigten sich die Vorlesungen und Seminare mittlerweile auch mit Autoren, die nicht zum klassischen Kanon gehörten. Die neuer waren, frischer, widerständiger. Auch solche, die der Nationalsozialismus aus der Literaturgeschichte getilgt hatte oder die von ihm ins Exil getrieben worden waren. Heinrich Heine, Thomas Mann, Heinrich Mann. Und schließlich sogar Bertolt Brecht, der Kommunist von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs.
»Persönliche Erfahrung und ästhetische Abstraktion«, so lautete nun der wissenschaftliche Ausdruck für Leben und Werk. Alltagsfantasie und dichterische Fantasie – die Fragen der Kunstproduktion wurden für mich die spannenden Fragen. »Sich in schwierigen Situationen sämtliche Möglichkeiten aufschreiben und dann durchdenken. Im Anfang mit Punkten, die die Annehmbarkeit bezeichnen. (Vorschläge zur Bekämpfung von Gefühlsverschwommenheiten)«[7]. Das hatte sich der junge Brecht als Maxime in sein Tagebuch geschrieben. Machen es nicht alle Menschen so, dass sie ihre Probleme in Fantasien durchspielen, sehr schnell oft und ungeordnet Bilder und Szenen von möglichen Situationen sehen, in die sie geraten können? Und ist die Besonderheit von Schriftstellern darin zu sehen, dass sie beim Schreiben mithilfe der Sprache eine besondere Phase zwischen Fantasie und Handeln eröffnen, eine Phase, in der sie vom Handlungsdruck des Lebens freigestellt sind? Und könnte es sein, dass etwa die Dramen des jungen Brecht eine Abfolge solcher Problemlösungsspiele darstellen? Probt er im Baal die Möglichkeit, ob und wie man in dieser Gesellschaft als Künstler überlebt? Unterstellt er probeweise dieser Figur auch Anteile seiner eigenen Persönlichkeit? Wie ergeht es einem wie Baal, der keine Kompromisse macht und bereit ist, dafür zu zahlen? Welche Konsequenzen hat das im Leben und im Werk, wenn Baal systematisch die soziale Treppe herabgestoßen wird, bis er elend im Wald verreckt? Solche Fragen habe ich dann von der Universität ins Fernsehen getragen. In zwei Sendungen für den NDR unter dem Titel Die Ausforschung des Glücks habe ich ein Seminar mit dem Hamburger Literaturwissenschaftler Heinz Hillmann über Brechts Problemlösungsspiele gefilmt.
Kann man in das Leben eines Dichters nicht auch hineinfahren? Lebten vielleicht in Augsburg noch Freunde oder Verwandte von Bertolt Brecht?
Werner Frisch und K.W. Obermeier haben 1975 eine äußerst reichhaltige Materialiensammlung über Brecht in Augsburg vorgelegt. Mit diesem Buch im Gepäck bin ich in Brechts Heimatstadt aufgebrochen.
So sitze ich 1977 in einem Augsburger Hotel und wähle eine Nummer im Stadtgebiet. Paula Gross – so hieß die alte Dame nun, die Brecht einst »die Bi« genannt hatte, »Bi« für »Bittersweet«, seine erste große Liebe. Ja, ich könne herüberkommen und sie besuchen. Fürs Fernsehen ein Gespräch vor der Kamera – ja, das würde sie mitmachen.
In der Fernseh-Dokumentation dieser Reise, Bi und Bidi in Augsburg, war dann nicht nur Brecht – der Bidi – das Ereignis, sondern auch die Bi, Paula Banholzer.
Im August 1977 saß ich also der Bi gegenüber in ihrem gutbürgerlichen Wohnzimmer im einfachen Reihenhaus. Paula Gross, eine ältere Dame, weißhaarig, freundlich, ganz offen für alle Fragen nach der lange zurückliegenden Zeit. Eine Kamera und ein Tonband durften dabei sein und die Augenblicke festhalten, in denen er wieder zu ihr sprach. Soeben waren die Tagebücher des jungen Brecht erschienen. Aber niemand hatte Paula darauf aufmerksam gemacht, dass gerade sie dort eine große Rolle spielte. Und nun las sie zum ersten Mal überrascht und verwundert, was der Schüler und Student Berthold Eugen Brecht vor sechzig Jahren über seine Liebe und sein Leben mit ihr aufgeschrieben hatte.
Paula Gross-Banholzer 1977 und 1919 © Sammlung Heinrich Breloer
Bald fand ich noch andere ehemalige Freunde Brechts, die in Augsburg lebten. Walter Groos, der Klassenkamerad. Otto Bezold aus der »Clique der Verworfenen«, die der Schüler und spätere Student Brecht um sich versammelt hatte. Die Jugendfreundin Ernestine Müller, Mitglied eines vom Jüngling Brecht angeführten Puppen- und Laientheaters, eine Art erstes Berliner Ensemble. Oder Marietta Neher, die Schwester seines Lebensfreundes, des Bühnenbildners Caspar Neher. Auch Aja Hartmann lebte noch, die erste Frau vom vertrauten Jugendfreund Otto Müllereisert, den Brecht von Augsburg nach Berlin gelockt hatte und der schließlich als Arzt an sein Totenbett gerufen wurde. Männer und Frauen aus der Nachbarschaft, die noch Erinnerungen an die Auftritte des so besonderen Sohnes vom Direktor Brecht hatten, dem kaufmännischen Leiter der bedeutenden Papierfabrik Haindl. Manche hatten in deren Firmensiedlung in der Augsburger Vorstadt gewohnt. Gymnasiasten wie Müllereisert, Bezold oder Neher lebten eher in der bürgerlichen Mitte der Fuggerstadt.
© Akademie der Künste, Berlin: Bertolt-Brecht-Archiv/Fotoarchiv, Foto: Friedrich Fohrer
Otto Bezold zeigt mir ein altes Foto. Der Schüler Brecht, der viele Stunden mit dem Reclam-Heft oben im Rang auf den Stehplätzen des Augsburger Stadttheaters verbringt, hat sich für die Aufnahme in einer leeren Nische der Theaterfront aufgebaut. In der Nische über ihm steht die Statue von Schiller. »Ich bin der Nächste. Ich werde da eines Tages stehen!« Und Bezold drückt auf den Auslöser.
© Bavaria Fiction GmbH/Michael Praun
Ich frage den alten Herrn: »Haben Sie ihm das geglaubt?« – Otto Bezold: »Ja, absolut! Er hat immer gesagt: Ich bin der letzte Dichter der deutschen Sprache. Das letzte deutsche Genie!« Das alles war für die Freunde nicht nur so hingesprochen. Sie glaubten es, weil Brecht für sie glaubhaft war. Bezold: »Eine Unterhaltung mit Bert Brecht war natürlich ein nicht endendes Feuerwerk von Geist, Kenntnissen auf dem Gebiet der Literatur und Klugheit, es war ein Vergnügen. Er war ein völlig anderer Mensch als alle Menschen und alle Kameraden aus der Schule, mit denen ich früher zusammen war. Wenn jemand ein Gefühl für Geist und Bedeutung hatte, für die Tatsache, dass hier ein Mensch auftritt, der weit aus den herkömmlichen Gesprächen herausragt, der musste ja merken: Hier ist etwas Produktives. Wer ist schon produktiv in dem Sinne, wie es Brecht war?«
Nach und nach wurde mir in diesen Gesprächen klar, wie intensiv sich Brecht in das Leben seiner Freunde hineingeschrieben hatte und wie ich im Abglanz ihrer Erzählungen dem jungen Brecht selbst näherkommen konnte.
»Ich habe ihn sehr gern gemocht«, sagt Bezold. »Er war sehr stark, aber er musste ja irgendein Bassin haben, in dem er schwimmen konnte. Einen Teil seiner Lebensführung und auch seiner Kraft hat er aus der Tatsache gezogen, von Menschen umgeben zu sein, die mit ihm harmonieren, die ihn auch bewundern. Das ist sicher.«
Es war nicht nur das schützende Band der Liebe und Ergebenheit seiner Freunde, es war noch etwas anderes.
»Er war also schon ein Gott, der seinen Tribut holte. Das war er zweifellos.« Meine Frage: »Haben Sie mal erlebt, was passiert, wenn man ihm den verweigert, den Tribut?«
Antwort: »Na ja, das ist ja dann die allmähliche Erkaltung gewesen.«
Wie kam es, dass sich ein Bewunderer wie der Bez, so hatte Brecht ihn getauft, dann trotzdem von ihm lösen konnte? – »In dem Maße, wie mir Brecht die Tür geöffnet hat in die große bestehende viel weitere Welt der Literatur, ging natürlich der Einfluss der Enge dieses Kreises verloren. Man kam in eine Sicht hinein, die man vorher nicht hatte, in der aber der Mann Bert Brecht, der einem zunächst mal als unendlicher Geistesriese und Dichterriese erschienen war, natürlich etwas relativiert wurde.«
Das waren für Brecht seltene, aber besonders schmerzhafte Erfahrungen, wenn es jemanden aus dem Kreis gab, der ihn verlassen wollte. Er hat das als Verrat erlebt und sich, wenn möglich, mit allen Mitteln gewehrt. Die Entfremdung konnte aber auch von Brecht ausgehen, auch das hat Bezold sensibel registriert. »Das Offene, was er mir gegenüber hatte, (…) wurde meinem Gefühl nach reservierter in dem Maße, als er an Bedeutung und Anerkennung zunahm.« Wenn Brecht glaubte, einer Beziehung entwachsen zu sein, wenn sie ihm nicht mehr nützlich schien, konnte er sie auch brüsk beenden. Bezold ist ein Beispiel für die Freunde, die genug Kraft hatten, auch ohne Anleitung ihres Lehrers Brecht einen eigenen Weg zu gehen. Nach dem Studium war er Staatsanwalt in München. Da er sich den Nazis nicht anbiederte, wurde er zwölf Jahre nicht befördert, nach dem Krieg aber Senatspräsident am Oberlandesgericht in München, FDP-Landtagsabgeordneter und bayerischer Wirtschafts- und Innenminister.
Brecht war wohl ein Mensch, der wirklich effektiv und vor allem mit dem unbedingt notwendigen »Spaß« nur im Kollektiv arbeiten konnte. Er brauchte das Gegenüber, den Dialog, das Echo der Freunde und Mitarbeiter.
Alle Augen auf Brecht: von links: Otto Müllereisert, Otto Bezold. Stehend: Georg Pfanzelt © Akademie der Künste, Berlin: Bertolt-Brecht-Archiv/Fotoarchiv, Foto: Friedrich Fohrer
Er musste produktiv sein, schrieb ununterbrochen. Und hielt die anderen dazu an. So wurde er auch in ihnen produktiv, brachte sie dazu, ihr Leben zu ändern, sich mit ihm auf den Weg zu machen.
Schon beim ersten Puppenspiel hatte der zehnjährige Brecht sein eigenes Ensemble, dann beim richtigen Laientheaterspiel die Nachbarn, Freunde und Verwandten und schließlich die »Clique der Verworfenen«. Während der Weimarer Republik hatte er Freunde, Lehrer, Weggefährten und Mitarbeiter wie Lion Feuchtwanger, Arnolt Bronnen, Günther Weisenborn, Walter Benjamin, wieder Caspar Neher, die Komponisten Kurt Weill und Hanns Eisler. Selbst in der Abgeschiedenheit des skandinavischen Exils holten ihm Helene Weigel und seine Freundinnen Grete Steffin und Ruth Berlau, allen Widrigkeiten zum Trotz, immer wieder Gesprächspartner ins Haus. Und nach der Rückkehr aus dem Exil hatte er von Beginn an eine große Gruppe von Mitarbeitern und Schülern um sich versammelt. Denn ein Lehrer, das war er auch und wollte es sein.
Otto Bezold © NDR, Hamburg aus dem Film »Bi und Bidi« (Heinrich Breloer, 1978)
Von den Augsburger Jugendtagen an führte er die Freunde, wollte sie weiterentwickeln. Brachte sie dazu, Tagebuch zu schreiben. Gab ihnen Aufgaben, schlug ihnen vor, welche Bücher sie lesen sollten. Auch für die Meisterschüler am Berliner Ensemble gab es noch Leselisten mit Lektürevorschlägen.
Später nannte er dieses Ziel: andere Menschen produktiv machen, verändernd in ihr Leben eingreifen, damit auch sie andere verändern können. Was das bedeuten konnte, wenn es sich um die Entwicklung einer geliebten Frau handelte, einer neuen Spielweise auf dem Theater oder gar um den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft, auch das wollte ich auf meiner Reise zu Bertolt Brecht herausfinden.
Und dann stehe ich doch noch vor einer Haustür mit dem Namensschild »Brecht« neben der Klingel. Das Haus liegt im Darmstädter Tintenviertel – so genannt nach seiner traditionellen Bewohnerschaft, Akademikern und höheren Beamten. Brecht – einmal die Klingel drücken, und 1978 ist konfrontiert mit dem ersten Viertel des Jahrhunderts. Aber gleich mit der Begrüßung gibt es einen Abschied: »Kein Fernsehinterview – niemals! Ist nicht persönlich gemeint. Ein Prinzip!« Und einen Satz, den ich nie vergessen habe: »Mein Bruder im Himmel würde lachen, wenn er mich hier über ihn reden sähe!« Es hörte sich fast an, als ob hier Bert Brecht sprechen würde. Genau dieser Augsburger Dialekt, wie wir ihn von den wenigen Originalaufnahmen der Lieder oder Gedichte Brechts kennen. Dann führte Professor Dr.-Ing. Walter Brecht mich durch einen schmalen Zugang in den Flur. Und dort oben auf einem alten Eichenschrank sah ich schon den anderen. Eine schöne Bronzebüste lächelte herab – Bertolt Brecht war auch da. Beim Tee lernte ich den Bruder kennen.
Der um zwei Jahre jüngere Walter durfte manchmal dabei sein, wenn Eugen mit den Freunden Pfanzelt und Müllereisert im Kinderzimmer oder sommers auf dem Freigelände des Gartens groß angelegte Schlachten mit Zinnsoldaten und Pulverkracker-Kanonen aufführte. »Eugen war der Feldherr, der immer gewann.«[8] Walter hatte den älteren Bruder aber auch erlebt, als der sich vor der Nacht fürchtete, wenn die Gespenster wieder auftraten, als der ein Öllicht am Bett haben musste und manchmal zur Mutter ins Bett durfte, um sich zu beruhigen. Gemeinsame Bubenstreiche, das erste Staunen über das Anderssein des anderen. Dann die Distanz – zwei Jahre Abstand können in diesem Alter ein Abgrund sein. Der rebellische Bert wurde in der Familie mehr und mehr zum »verlorenen Sohn«, der den Eltern Sorgen und Schmerzen bereitete. Walter dagegen mauserte sich zum »Mustersohn«, der den Eltern Liebe und Dankbarkeit bewies und die in ihn gesetzten Erwartungen freudig erfüllte. Er hatte sich noch kurz vor Kriegsende freiwillig an die Front gemeldet und ging dann den geradlinigen, vom Vater gebahnten bürgerlichen Berufsweg, als Ingenieur für Papierherstellung zunächst, schließlich als Professor an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Dort blieb er vierzig Jahre. In Fachkreisen war er international anerkannt, und er hatte einige für die Papierproduktion wichtige Patente erlangt.
Warum kannten wir diesen Bruder nicht?
Walter und Eugen Berthold Brecht © Akademie der Künste, Berlin: Bertolt-Brecht-Archiv/Fotoarchiv
Professor Walter Brecht wollte keinesfalls nur der kleine Bruder des großen Bert Brecht sein, diese Sichtweise war ihm entsetzlich. Er wollte auch nicht Gefahr laufen, für einen Hochstapler gehalten zu werden, für jemanden, der sein eigenes Ansehen auf der Berühmtheit eines anderen aufbauen will. So war er all die Jahre stumm geblieben, hat, wenn möglich, darüber geschwiegen, dass es diesen Bruder gab. Später sagte er mir: »Ich habe mein eigenes Leben geführt. Ich betrachte mich nicht als Nebenprodukt, als einen Mann, der dazu da ist, über den anderen zu berichten.« Er tat es dennoch, einige Zeit nach unserem Gespräch. Seine Jugenderinnerungen nannte er Unser Leben in Augsburg, damals. Nicht etwa Mein Bruder Bertolt Brecht.
Berlin, Chausseestraße 125, Seitenflügel, erster Stock. Als ich das erste Mal mit Brechts ehemaligem Assistenten Peter Voigt durch die Räume der jetzigen Brecht-Weigel-Gedenkstätte ging, kam schnell die Warnung: »Achtung, Museum! So hat das hier nie ausgesehen. Du musst dir das ganz anders vorstellen.« Zu Brechts Zeit lagen überall auf dem Boden Stapel von Zeitungen, auch die aus dem Westen, und internationale Presse – Brecht konnte sich diese in der DDR verbotene Lektüre täglich anliefern lassen. Das war sein Privileg – wie vieles andere auch. Neben der Schreibmaschine: Texte auf dünnstem Papier – vierter und fünfter Durchschlag. Aschenbecher voll mit Zigarrenresten. Teetassen und Reste von einem Imbiss für die Gäste, mit denen diskutiert worden ist. Bücher aufgeschlagen auf den Ablagen. Brecht hatte zeitlebens solche Arbeitshöhlen. Zuerst in Augsburg die Mansarde über der Wohnung seiner Eltern. Dann in Berlin das von Helene Weigel übernommene Atelier in der Spichernstraße und auf den weiteren Lebensstationen – mit Ausnahme der letzten in der Chausseestraße – ebenfalls von der Weigel bereitgestellte bequeme, praktische Arbeitsräume.
Bertolt Brechts letzte Wohnung (von 1953 bis 1956) hat zwei Arbeitszimmer, ein kleineres mit Kachelofen und zwei Tischen für den Besuch sowie der Bibliothek und ein großes Zimmer, in dem mehrere Tische und ein Stehpult aufgestellt wurden. So konnte Brecht an verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeiten. Überall Bücher, auch in Nischenregalen und Schränken. Verbunden sind diese beiden Räume durch eine weite Tür. Stahlschränke für die zahlreichen Manuskripte, für veröffentlichte und unveröffentlichte Texte. Auch für das Material aus dem Exil: Wertpapiere für die Zeit danach. Dazu ein großer Eichenschrank für die Kleidung. Eine Tür zu dem kleinen, schmalen Schlafzimmer mit Fenstern zum Hof. Ein kleines Bett an der Wand, ein Telefon auf dem Tischchen daneben mit einer Liste der wichtigsten persönlichen Telefonnummern. Direkt darunter die Garage für sein Cabriolet. Durch einen schmalen Gang geht es vom Schlafzimmer in ein ebenso schmales enges Badezimmer mit Wanne und Dusche. Direkt neben dem Fenster die Toilette. Vor dem Spiegel und auf dem Lokus täglich der Blick auf die Gräber der Großen: Hegel, Fichte, Schadow. Heute liegt dort das halbe Berliner Ensemble. Weit und grün ist es vor den Fenstern. Sogar einen kleinen Garten hat das Haus, nur durch eine Mauer von den Gräbern getrennt.
Eine großzügig gebaute Altbauwohnung ist das, gedacht für ihn allein. Helene Weigel hatte, nachdem sie aus der seit 1949 gemeinsam bewohnten Villa in Weißensee ausgezogen war, zunächst eine eigene Wohnung in der Nähe des Deutschen Theaters bezogen, dann war sie aber bald auch in die Chausseestraße 125 übersiedelt. In die Wohnung direkt über Brecht.
© Bavaria Fiction GmbH/Nik Konietzny
© Bavaria Fiction GmbH/Nik Konietzny
Nachdem er 1953 in dieses Arbeitsparadies mit angeschlossenem eigenen Theater und Ensemble eingezogen war, blieben ihm nur noch drei Jahre, bis sie ihn schließlich hinausgetragen haben auf den Friedhof gegenüber. Dabei hatte er sich in den sieben Jahren seit seiner Rückkehr aus dem Exil fast alles zurückgeholt, was ihm die Nazis gestohlen hatten: sein Publikum im Theater, seine Leser und sein Cabriolet. Außerdem war wenigstens in einem Teil Deutschlands eine Partei an der Macht, die behauptete, eine sozialistische Gesellschaft in seinem Sinn aufzubauen.
Wenn man an diesem Fenster in Brechts Badezimmer steht und auf den Friedhof blickt, wird einem bewusst, wie viele seiner Geliebten, seiner Mitarbeiter und Freunde, auch von den Menschen aus der eigenen Familie ihm dorthin gefolgt sind. Helene Weigel wollte sogar quer zu seinen Füßen beerdigt werden, wie sie ihm, dem Genie, ihr Leben lang gedient hatte. Man hat sie aber doch neben ihn zur Ruhe gebettet, mit eigenem Stein. Werner Hecht, der intime Kenner von Brechts Lebensläufen, hat es mir vor Jahren erzählt. Lange Zeit war er Leiter des Brecht-Zentrums der DDR, ist wie ein Kartograf durch Brechts Leben gegangen und hat es in einer großen Chronik anhand der Dokumente als Lebensbild aufgezeichnet, fast Tag für Tag. Er ist mit mir durch die Archive gegangen, er wusste, wo das interessante Material zu finden war. Jetzt liegt auch er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Wie auch ein beträchtlicher Teil der Menschen, die in meinem Brecht-Lebensfilm wichtige Rollen spielen, ohne dass ich sie persönlich kennenlernen konnte: Elisabeth Hauptmann, Ruth Berlau, Isot Kilian haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden, ebenso Brechts Tochter Hanne (Hiob) aus seiner ersten Ehe, Hanns Eisler, Erich Engel, sogar Arnolt Bronnen. Alle, nun auch die Tochter Barbara, um Brecht versammelt auf dem Friedhof an der Chausseestraße. Käthe Reichel, die ich noch kurz vor ihrem Tod sprechen konnte, liegt gleich nebenan auf dem Französischen Friedhof.
Die Steadycam hängt am Operator. Michael Praun blickt auf das Bild oben im kleinen Monitor. Er sieht dort, was Brecht in den Fingern hält: Tagebuch und Stift. Genau diesen Ausschnitt markiere ich Michael gerade noch einmal. Gleich wird er einige Schritte rückwärts in den Raum gehen, das Bild öffnen und mehr und mehr vom Dachzimmer des jungen Brecht zeigen. Die Steadycam hat so die Schienenfahrt mit dem Dolly ersetzt.© Bavaria Fiction GmbH/Nik Konietzny
Eine große Menge Material, Texte, Fotos und Filme, liegt in den Archiven.
Es ist bewegend, die Originalpapiere, die durch Brechts Hand gegangen sind, selber zu berühren, in ihnen bisher unveröffentlichte Texte zu lesen. Oder seine Stimme auf alten Tonbändern zu hören, die während seiner Proben aufgenommen wurden. Ihm immer wieder auf den vielen Fotos ins Gesicht zu schauen, mit der Frage: Was ist dir in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen, als dich Ruth Berlau fotografierte? Warum hast du die Augen niedergeschlagen, wenn es eine nicht vertraute Person war? Ist das der Liebesblick auf Gerda Goedhart? Direkt in die Kamera, weil du ihr vertrauen konntest?
Als ich ein Fernsehinterview mit ihm machte, hat mir Max Frisch einmal geraten, bei der Suche nach einem Thema nicht die Tageszeitungen zu befragen. Das, was da stünde, sei morgen vorbei. Man solle bei sich selber in die Tiefe gehen. Dann fände man etwas Allgemeines. Darin würden sich dann auch die Leser wiederfinden, als hätte der Autor gerade ihre Geschichte erzählt. So hat es Max Frisch selber gehalten. Auch Thomas Mann hat eigentlich immer wieder nur von sich selber erzählt, von dem, was er beim Gang in seine Tiefen gefunden hat. Bertolt Brecht dagegen wollte genau das nicht. Abgesehen von den frühen Jahren war er, was sein Privatleben betraf, ein verschwiegener Mensch. In den späteren Tagebüchern kaum ein Wort über sich selbst, das meiste nur Arbeitsberichte. Er hat es meist entschieden abgelehnt, von sich zu erzählen. Für seine Figuren beharrte er darauf, dass deren soziale Lage das Entscheidende sei. Die Probleme der Charaktere entstünden aus der Gesellschaft, und nur von der Gesellschaft her seien sie zu verstehen und zu verändern. Wir dürfen, wenn wir unsererseits den Charakter Brecht verstehen wollen, einen anderen Weg gehen.
Wie kann ich das biografische Material lebendig werden lassen, damit ich eine Vorstellung von ihm gewinne, Szenen finde und erfinde, in denen er zu sprechen beginnt? Ich muss am Ende meine Vorstellung von Brecht gestalten, seine hat er ja nicht veröffentlicht. Das war die Entscheidung, mit der ich von dem festen Grund all dieser Materialien abgesprungen bin, in das andere, fremde Leben hinein.
Und die Laterna magica, der Film, ermöglicht das auf eine seltsam zauberische Weise: Ich konnte direkt in Brechts Mansarde hineintreten, in seinen Büchern stöbern und an seinem Schreibtisch sitzen. So war es auch in der Chausseestraße 125, die der Filmarchitekt Christoph Kanter in den Prager Barrandov-Studios eins zu eins nachgebaut hatte, inklusive aller Möbel, Bilder und Masken an den Wänden. Und wenn man dann vor dem Monitor sitzt und sieht, wie die Schauspieler in Kostüm und Maske sich unterhalten, als ob es das Jahr 1955 wäre, und niemand sonst im Zimmer ist und alles stimmt und klingt, dann hat man das Gefühl, für einen Moment in diesem Leben dabei gewesen zu sein. Burghart Klaußner, der Darsteller des alten Brecht, sagte einmal: »Du veranstaltest das Ganze nur, um all die Toten noch einmal ins Leben zurückzuholen.« Vielleicht hat er recht.
Im Film habe ich mir die Freiheit genommen, ausgehend von den Fakten und Dokumenten dieses Biografie-Spiel mit den Figuren in Gang zu setzen. Das Filmbuch ist um weiteres Material ergänzt worden. Szenen tauchen hier auf, die im Film aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden konnten, und im Ablauf der Szenen nutzt der Erzähler öfter die Gelegenheit, interpretierende Einordnungen vorzunehmen. So versucht das Filmbuch auf seine Weise, die produktive Spannung zwischen Spiel und Dokument zu bewahren.
Eine romaneske Erzählung von Brechts Leben auf der Basis der Recherche und der biografischen Quellen, ohne an ihnen zu kleben: Diese Freiheit des Erzählers bietet vielleicht eine Möglichkeit, trotz der Vielfalt, der Lücken und auch der Widersprüche in den Berichten und Lebensdokumenten dem Menschen Brecht etwas näherzukommen.
Schon die Zeitgenossen, die Freunde und Geliebten des Dichters hatten ihre Schwierigkeiten, den Mann zu verstehen. Er war einfach nicht zu fassen. Natürlich hat er gelogen, vielleicht sogar in seinem Tagebuch, wenn er die Geschichten vom Tage scheinbar dokumentarisch notierte. »Da ist schon eine gehörige Portion dichterischer Fantasie dabei«, sagt seine Jugendgeliebte Paula Banholzer, als sie zum ersten Mal eine Tagebucheintragung von ihm über einen Sommertag am See mit ihr zu lesen bekommt.
Eine gewisse Laxheit im Umgang mit der Wahrheit ist auch seiner ersten Frau Marianne Zoff aufgefallen. In einer Notiz schreibt sie: »Ein großer Mann darf auch lügen – immer lügen, warum auch nicht? Macht das vielleicht den Menschen arm. Überhaupt, wenn man so lügt, so daß man selbst alles glaubt, was man sagt – das ist auch Kunst.«[9]
Vielleicht hat Brecht es also nicht als Lüge gesehen, sondern als Erfindung seiner Person, wenn er Szenen seines Lebens umschreibt. Damit verhält er sich zu sich selbst wie ein Erzähler zu einer literarischen Figur. Ein Autor, der am Roman seines Lebens schreibt.
Auch Brechts Lebensabschnitts-Freund Arnolt Bronnen konnte das Problem von Brechts unergründlicher Vielfalt nicht übersehen: »Indessen war Brecht ein Lebewesen besonderer Art. Er vervielfachte sich dauernd, und selbst wenn man ihn allein in ein Zimmer sperrte, so konnte man sicher sein, beim Wiederaufsperren einen bis zum Rande mit Brechts angefüllten Raum vorzufinden.«[10]
Als ich mich im Jahr 2010 auf eine zweite Reise zu Brecht gemacht habe, kam ich gerade noch rechtzeitig, um authentische Auskünfte und Einblicke in dieses geheimnisvolle Leben – nun vor allem aus der Zeit nach seiner Rückkehr aus dem Exil – zu bekommen.
Jung waren sie noch und nicht verseucht vom Gift der Nazis, die meisten Männer und Frauen, die Brecht nach seiner Ankunft in Ostberlin als Assistenten an sich zog. Mit ihnen wollte ich sprechen. Ein besonders angenehmer, anregender Gesprächspartner war B.K. Tragelehn, Brechts hochbegabter Regieschüler. Er hatte sich 1945 aus den brennenden Trümmern von Dresden gerettet und war seit 1954 an Brechts Seite. Wie bei vielen anderen veränderte die erste Begegnung mit Brecht auch sein Leben grundlegend. »Der Wiedereintritt Brechts in die deutsche Literatur und ins deutsche Theater in der Nachkriegssituation – das ist, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft: Es zieht Kreise. Und ich bin tief davon bewegt worden.«
So haben es viele Menschen erlebt, die in das Kraftfeld, in den Lebensbereich Bertolt Brechts hineingeraten sind. Nachher waren sie andere Menschen. Wer Brecht begreifen will, sollte auch mit denen sprechen, die ihm so intensiv begegnet sind wie Tragelehn. In diesem lebendigen Spiegel kann man ihn selbst erblicken, wenn man Glück hat.
Es waren interessante Stunden, wenn Tragelehn mit seiner Brecht-Zigarre seinen Denk- und Vorstellungsapparat in Schwung brachte und dabei die Probleme neu sortierte und denkend entwickelte. Wenn er mit Freude und Vergnügen am Denken abwägend und probierend die passenden Worte fand, hatte ich das Gefühl, Brecht beim Spielen zuschauen zu können. »Brecht war kein Belehrmich, kein Besserwisser, überhaupt nicht, was unter Lehrer verstanden war. Bei seiner Art zu probieren kam ungeheuer viel vor. Er konnte sonst was ranziehen, er konnte was improvisieren, da war ein ungeheurer Fundus, der ihm zur Verfügung stand. Das heißt, eigentlich hat er gespielt, und wir durften mitspielen.«
Von dieser Stimmung, dem heiteren Spiel mit den ernsten Fragen des Lebens in diesem freien Raum einer Probenbühne für eine neue Gesellschaft, haben mir andere, die dabei waren, ebenfalls berichtet, Mitarbeiter wie Zuschauer. Carl »Charlie« Weber erzählte mir von einem Probenbesuch: »Und da ging ich also rein und Brecht saß in seinem Sessel und lachte ganz schrecklich, also ganz laut und vergnügt. Und die Schauspieler, die standen da so rum und stiegen alle auf den Tisch und fielen wieder runter vom Tisch. Und dann machten sie noch mal so irgendwas, was ich für Dummheiten hielt, mit dem Tisch. Und Brecht lachte, und dann quatschte er wieder mit seinen Assistenten. Und ich dachte: Die haben Pause. Nach einer halber Stunde überlegte ich, das kann doch wohl nicht mehr Pause sein? Und da realisierte ich: Das war Probe. Und das war für Brecht ungeheuer wichtig, dass die Probe amüsant war, dass die Probe Spaß machte. Und dass die Schauspieler produktiv waren – aber nicht, indem sie quatschten über das, was sie machten. ›Erzählen Sie es mir nicht, zeigen Sie es mir.‹ Und dann hat der Schauspieler eben gezeigt, was er im Kopf hatte. Und wenn Brecht es mochte, lachte er.«
Eine Insel war dieses Berliner Ensemble, befreites Land. Erst als es zu Ende ging, merkten seine Bewohner, mit welchen Privilegien sie dort gelebt und gearbeitet hatten.
Der Schlag der Klappe war früher für den Schnitt das notwendige Signal, um den Ton, der separat aufgezeichnet wurde, synchron zum Bild anlegen zu können. Heutzutage synchronisiert die elektronische Kamera automatisch. Trotzdem kracht auch heute noch die Klappe zur Sicherheit vor jedem Take – manchmal auch dicht vor dem Gesicht des Schauspielers, der sich gerade für die Aufnahme konzentrieren will. © Bavaria Fiction GmbH/Nik Konietzny
Heute sehe ich, dass wir in den ersten Jahren der dritten Programme ähnlich frei und unbeschwert gearbeitet und gelebt haben. Damals, als das Fernsehen noch jung war und wir auch. Mein Partner Horst Königstein und ich konnten uns im dritten Programm ungewöhnliche, neue Aufgaben stellen. Damals hatten wir uns einen Exilroman vorgenommen, Arnold Zweigs Das Beil von Wandsbek. Das Buch spielte in Hamburg, im »Dritten Reich«, und es ging von einem Zeitungsausschnitt aus. Könnte man nicht,wenn man nach den historischen Wahrheiten hinter dieser Fiktion fragte, die Recherche mitdrehen und gleichzeitig einige Schlüsselszenen des Romans als Spiel inszenieren? Am Ende musste im Schneideraum dafür eine neue Form gefunden werden. Wir waren sicher genauso aufgeregt, fröhlich und gespannt wie die Gesellschaft auf Brechts Probenbühne, wenn wir erlebten, wie durch den kalkulierten Zusammenprall von Dokumentation und Spiel etwas Drittes, Neues entstand, das wir vorher so nicht gesehen hatten. Man blickte mit anderen Augen auf die Spielszenen, wenn man zuvor die dokumentarischen Figuren erlebt hatte. Es war eine Art Verfremdung möglich, wie sie Brecht in seinem Theater erreichen wollte. Ein Fernsehspiel als Spiel mit den Mitteln des Fernsehens. Die Spannung der Fiktion wird gebrochen durch das Dokument, der Zuschauer im halbdunklen Zimmer kann anfangen zu denken.
All das stand auch unter dem Eindruck der Fernsehspiele vom Brechtschüler Egon Monk, die wir mit Begeisterung gesehen hatten. Als ich über sein Ein Tag, den ersten deutschen Fernsehfilm über ein KZ, einen längeren Bericht machen konnte, habe ich Monk persönlich kennengelernt. Er hat das, was wir in den Jahren danach gemacht haben, auch als ein fernes Fortwirken von Brecht in einem anderen Medium wiedererkannt.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1Die Liebe dauert oder dauert nicht
Frühjahr 1956. Kalte Morgendämmerung in Brechts Wohnung: Berlin, Chausseestraße 125. Aus dem großen Arbeitszimmer blicken wir durch die offen stehende Tür ins Schlafzimmer. Zeitungen liegen auf dem Boden, auf den flachen Tischen sieht man Manuskripte, ausgeschnittene Fotos und Artikel aus Zeitungen und Illustrierten, West und Ost, deutsch- und englischsprachig. Brecht sitzt auf der Bettkante, in eine helle Decke gehüllt. Durch einen Spalt im Vorhang fällt ein Streifen Licht auf sein Gesicht. Die erste Orientierung nach dem Erwachen. Der frühe Morgen, das ist seine Zeit. Noch ist es ruhig im Haus. Nur eine frühe Straßenbahn rollt auf den Schienen durch die Stille. Die Vogelstimmen durchs offene Fenster. Die Amsel, ihr Lied am Morgen, sie singt über den Gräbern. Das Haus liegt direkt am Dorotheenstädtischen Friedhof, berühmte Tote ruhen dort wie der von Brecht wegen seiner Dialektik verehrte Philosoph Hegel oder dessen Berufskollege Fichte. Der Bildhauer Schadow, der Architekt Stüler. Alles preußische Beamte. Die Amsel wird dort, über den Gräbern, auch dann weiter singen, wenn Brecht ihr Lied nicht mehr hören kann. Erst kürzlich hat er sich in einem Gedicht selbst versichert, dass ihn der Gedanke an die eigene Sterblichkeit nicht mehr ängstigt. »Als ich in weissem Krankenzimmer der Charité/Aufwachte gegen Morgen zu/Und eine Amsel hörte, wußte ich/Es besser. Schon seit geraumer Zeit/Hatte ich keine Todesfurcht mehr, da ja nichts/Mir je fehlen kann, vorausgesetzt/Ich selber fehle. Jetzt/Gelang es mir, mich zu freuen/Alles Amselgesanges nach mir auch.«[11] – Na ja, »gelang es mir« – so völlig unangestrengt klingt diese Freude über ein Weiterleben aller anderen nach dem eigenen Tod noch nicht.
Er blickt hoch zu einem chinesischen Rollbild, das ihn auf allen Etappen seines Exils begleitet hat. Es heißt Der Zweifler. Ein alter, allem Anschein nach weiser Mann sitzt gebeugt auf einer Bank. Was er dabei denken könnte (oder sollte), hat Brecht schon vor fast zwanzig Jahren in einem Gedicht festgehalten, eine Art Checkliste zur Qualitätskontrolle für die eigene literarische Produktion und die seiner Mitarbeiter. »Ich zweifle, ob/Die Arbeit gelungen ist, die eure Tage verschlungen hat./Ob, was ihr gesagt, auch schlechter gesagt, noch für einige Wert hätte./Ob ihr es aber gut gesagt und euch nicht etwa/Auf die Wahrheit verlassen habt, dessen, was ihr gesagt habt./Ob es nicht vieldeutig ist, für jeden möglichen Irrtum/Tragt ihr die Schuld. Es kann auch eindeutig sein/Und den Widerspruch aus den Dingen entfernen; ist es zu eindeutig?/Dann ist es unbrauchbar, was ihr sagt.«[12] So hat sich Brecht die Haltung des Alten auf dem Rollbild für den eigenen Gebrauch zurechtgelegt.
© Bavaria Art Department, Bavaria GmbH
Das beständige kritische Befragen der eigenen Arbeit hat Brecht sein ganzes Leben über praktiziert. Von denen, die schnell Bescheid wissen und keine Fragen mehr zulassen wollten, gab es immer schon zu viele. Auch jetzt und hier in der DDR. Und von Jahr zu Jahr scheinen es mehr zu werden.
Diese Mischung aus Angst, Größenwahn und Dummheit, die sich ganz oben in Regierung und Parteispitze ausbreitet, wo er es mit Menschen wie diesem unsäglichen Bürokraten Ulbricht und diesem bornierten Erich Honecker zu tun hat. Diese Murxisten! Was hat er da neulich dieser Person von der Kunstkommission – nein, neuerdings gehört das ja zum Kulturministerium! – ins Telefon gebrüllt: »Ich kann meine Texte selber verantworten. Ich bin ein weltbekannter Schriftsteller!« Sie mussten schon mal den Hörer weit vom Ohr weghalten, so laut ist er geworden. Schließlich wollte er sich ja nicht von Ulbricht sagen lassen, wie man Gedichte schreibt! Der Ulbricht sollte sich vielmehr mal anhören, was der Brecht ihm über eine vernünftige Staatsführung erzählen kann!
Brecht blickt auf die Stahlschränke im großen Arbeitszimmer. Sie sind voller Manuskripte. Böse Worte, böse Szenen sind darunter, Worte, die der Regierung der DDR nicht gefallen würden. Brecht empfindet immer eine Art tröstlicher Genugtuung, wenn er auf die Schränke blickt.
© Bavaria Fiction GmbH
Die wissen nicht so genau, wie sie mit ihm umgehen sollen. Er ist kein Parteimitglied und war nie eins, damit war und ist er keiner Parteidisziplin unterworfen. So kann man ihm auch nicht aus irgendwelchen »Abweichungen« vom Parteikurs in der Vergangenheit einen Strick drehen. Sie haben ja nicht mal eine Parteiakte von ihm, mit der sie ihn erpressen könnten. Und als Ultima Ratio haben Helene Weigel und er ja auch noch die österreichische Staatsbürgerschaft. Ihn kann man nicht so ohne Weiteres demütigen, zu Sündenbekenntnissen zwingen und degradieren wie Wolfgang Langhoff, den Intendanten des Deutschen Theaters, seinen Hausherrn der ersten Jahre hier.
Allerdings, wenn sie ihm das Theater nehmen würden? Noch einmal einpacken, noch einmal von vorn anfangen, womöglich gar als Renegat im Westen? Bloß nicht dran denken. Der wohlbeleibte, grauhaarige, scheinbar so gemütliche Staatspräsident Pieck oder Ministerpräsident Grotewohl sitzen schon mal in der Loge seines Theaters. Das hilft. Aber vor allem schützt ihn der Stalin- oder jetzt besser Lenin-Preis, der ihm letztes Jahr in Moskau verliehen wurde. Seitdem fällt es deutlich schwerer, ihn in seiner Arbeit zu behindern oder ihn über die staatstreuen Zeitungen anzupöbeln. Und wenn die Volkspolizei ihn bei seinen Fahrten zum Landhaus in Buckow an der Sperrgrenze um Berlin anhält und verdächtige Gegenstände wie etwa seine Schreibmaschine findet, dann genügt sein Ausweis, und jedermann weiß: Das ist ein anständiger Kommunist. Keine weitere Durchsuchung nötig, bitte weiterfahren!
Brecht greift nach einem Zigarrenstummel aus dem Aschenbecher und zündet ihn an. Ein erster Zug – belebend und beruhigend. Er hustet und spürt das Herz, es klopft jetzt nicht mehr so schnell wie gerade noch im Augenblick des Erwachens. Noch lebe ich. Wo bin ich gerade gewesen? Wer ist mir da im Traum begegnet? War das Paula, die Bi damals in Augsburg? Bi, das stand für Bittersweet, bitter, herb und süß zugleich, und er, er war der Bidi. Immer hat er den Frauen neue Namen gegeben. Sie getauft, wenn sie zu ihm gehören sollten, hat sie sich so angeeignet. Ein Spiel, und doch auch mehr. Die Bi, die He, dann die Mar, die Bess, die Grete – ach ja, die Margarete Steffin; Helli sowieso, die Käthe, Kathrin, die eigentlich Waltraut heißt. Und jetzt die Ise. Sie wird vielleicht die Letzte sein. Sie tut ihm gut. Sie erinnert ihn an die erste, Paula, die Bi. Beide sind sie natürlich, unkompliziert, kein betrügerisches Herz. Im rechten Augenblick auch schamlos, wenn man mit ihnen zusammen ist. Aber liebt sie mich, die Ise?
Einen Sohn hatten sie zusammen gehabt, Bi und er, den Frank. Sie hat dafür büßen müssen, unter den katholischen Bauern da unten im Allgäu. Das Kind wuchs bei einem Wegmacher auf. In Pflege gegeben. Manchmal hat er ihm später kleine Geschenke geschickt, dann hat sich das Kind auch brav bedankt. Wollte der Bub nicht auch mal Schauspieler werden? Na ja. Irgendwelchen Streit um den Unterhalt gab es da doch auch noch? Erst nach dem Krieg hat er erfahren, wie es mit dem Frank weitergegangen ist. Als Soldat der faschistischen Wehrmacht, mit dem Hakenkreuz an der Uniform, ist er hinter der Ostfront ums Leben gekommen, irgendwo zwischen Moskau und Leningrad soll’s gewesen sein. Ausgerechnet in einem Kino hat es ihn erwischt, Partisanen haben das Gebäude mit den Besatzern drinnen gesprengt.
Das Telefon steht am Bett. Ein Blick auf die Liste der wichtigen Rufnummern auf seinem Nachttisch: die Namen der Frauen, die Helli, Isot, Käthe, Kathrin, Ruth; das Theater, die Probebühne, der West-Verleger Suhrkamp. Neuerdings Walter, der Bruder.
Ein paar Schritte um die Ecke, und er steht im Bad. Das Fenster hat er sich eigens in die Wand brechen lassen. Von hier aus schaut er direkt auf den Friedhof. Er setzt seine Brille auf. Jetzt erkennt er das zarte Grün des Frühlings über den Gräbern. Ja, an den Augen spürt man es, das Alter. So wie damals wird er den Frühling nicht mehr sehen. Die ersten Blüten, wie das leuchtete! In Augsburg, da waren seine Augen noch jung. Jetzt pisst er über die Gräber.
Er nimmt sein Gebiss aus dem Wasserglas, schiebt sich die Zähne über den Kiefer und blickt grimmig in sein Gesicht. Er hatte sich nach und nach alle Zähne ziehen lassen. Das war doch vernünftig. Besonders schön waren sie ja nie gewesen. Vernünftig war auch der Cäsarenschnitt, einfach und kurz. Passt zu den praktischen Jacken, die er sich hat schneidern lassen, mit den vielen Taschen für Bleistifte, Kugelschreiber und Merkhefte. Es sind die Kleider des Stückeschreibers. So kennt man ihn. Die Lieblingsfarbe: Grau. Und natürlich immer nur das beste Material – auch für die feinen Hemden und die Schuhe. Das hält wenigstens. Am teuersten lebt stets der arme Mann. Und so lässt sich’s arbeiten, ist etwas da. Gleich wird er anfangen.
Nachher wird das Mädchen kommen und im Wohnzimmer die Spuren der Sitzung mit seinen Assistenten gestern abräumen. Dann wird sie ihm ein wenig Haferschleim anrichten. Noch gehört der Morgen ihm allein.
Jetzt will Brecht etwas festhalten von der Fracht der Nacht. Er geht zum kleinen Schreibtisch im großen Arbeitszimmer. Der Gang eines vor der Zeit gealterten Mannes. Er hustet. Auf dem Weg dahin hat er an der Tür zum Badezimmer seine Mütze vom Haken genommen und aufgesetzt. Er öffnet den Fenstervorhang einen Spalt. Etwas Licht fällt auf das Papier.
Dann sitzt er mit Brille und Zigarre vor dem weißen Blatt und notiert die erste Zeile. »Bidi in Peking/Bi …« – »Bi in Augsburg?«[13] – Langweilig, dieselbe Reihenfolge. Prosa. Er streicht das »Bi« durch. Jawohl, »In Augsburg Bi« klingt viel besser, und das »Bi« ergibt ja auch gleich noch einen Reim, wenn wir die beiden voneinander so weit Entfernten im Morgengruß zusammenführen. »Guten, sagt er/Morgen, sagt sie.« Schön, diese freundliche Verschränkung. Obwohl – natürlich liegen immer noch Welten zwischen China und Augsburg. So soll es sein.
© Bavaria Fiction GmbH
© Bavaria Fiction GmbH
© Bavaria Fiction GmbH/Nik Konietzny
Brecht schaut auf die Zeilen. Es ist in seinem Leben viel zerrissen. Das mit Paula ist eigentlich eher versandet, entglitten. Da kam ja bald die Marianne, und dann auch noch die Helli dazu …
Das Gedicht jedenfalls ist ihm gelungen, der Gleichklang des Getrennten über die Distanz hinweg. Meilenweit entfernt von jedem Gefühlskitsch. Und ganz ohne Erklärungen kommt es aus. Erklären müssen sich die Leute das schon selbst.
Augsburg, eine Gasse in der Nacht. Wir blicken auf eine hohe Mauer. Ein Lampion erscheint, wie ein Ton auf einer Notenlinie. Ein zweiter Lampion und ein dritter, vierter. Rot, Grün, Blau, Gelb. Der Gymnasiast Eugen Berthold Brecht und seine Freunde Bezold, der Müllereisert, der Georg Pfanzelt, der Hartmann tragen, an Stäben befestigt, bunte Lampions, in denen Kerzen brennen. Brecht hat eine Gitarre umgehängt und will seine selbst gedichtete und komponierte Serenade vortragen. Die Gruppe gelangt, Brecht vorneweg, zum Haus des Dr. med. Banholzer. Dort wohnt dessen Tochter, eine sechzehnjährige Schülerin, der Brecht auf dem Schulweg begegnet ist und an der er Gefallen gefunden hat. An die Mädchen vom Lyzeum kommt man nur schwer heran, und Mädchen ansprechen, das kann der Eugen nicht. Er ist scheu. Er fürchtet sich davor abzublitzen, fürchtet die Niederlage, bevor er noch ein Wort gesagt hat. Gerade bei einem so hübschen Mädchen, wie es die Paula ist, mit vielen Verehrern. Vielleicht kann da ein Ständchen helfen?
Mit den Freunden im Rücken, mit der Gitarre in der Hand und mit seinem Lied, da ist seine Schüchternheit wie verflogen. »Jetzt wachen nur noch Mond und Katz,/Die Menschen alle schlafen schon/Da trottet übern Rathausplatz …« – Kleine dramatische Pause, in der die Freunde geheimnisvoll flüstern: »Bert Brecht, Bert Brecht«, dann übernimmt Brecht wieder: »Bert Brecht mit seinem Lampion.«[14]
© Bavaria Fiction GmbH/Stefan Falke
Paula Banholzer öffnet das Fenster ihres Schlafzimmers und schaut auf die Sänger unten vor dem Haus. Eine Serenade, eigens für sie geschrieben und dann in der Nacht vor ihrem Fenster vorgetragen – das ist doch was, so romantisch. Der Paula gefällt das, sie findet es hübsch und zum Lachen. Das ist gut! Noch eine Strophe.
»Wenn schon der junge Mai erwacht/Die Blüten sprossen für und für,/Dann taumelt trunken durch die Nacht …« – wieder die Freunde: »Bert Brecht, Bert Brecht«, und der Vorsänger: »Bert Brecht mit seinem Klampfentier.«
© Bavaria Fiction GmbH/Stefan Falke
Hinter Paula ist inzwischen Dr. Banholzer ans Fenster getreten, ihr Vater. Er schüttelt den Kopf. »›Klampfentier‹ – spinnerter Uhu!«
Leise geflüstert, wie in einer Verschwörung, wird die letzte Strophe gesungen. »Und wenn Ihr einst in Frieden ruht/Beseligt ganz vom Himmelslohn/Dann stolpert durch die Höllenglut/Bert Brecht mit seinem Lampion.«
Dr. Banholzer ist immer für einen guten Scherz zu haben, das geht aber dann doch zu weit. Ein ganz Gescheiter soll das sein, der Älteste vom Direktor Brecht. Da muss man wohl ein Auge drauf haben, die Paula darf keinesfalls ins Gerede kommen. Und mit so einem schon gar nicht. Aber die ist ja eh noch ein Kind.
Nachbarn kommen vorbei. Sie lupfen den Hut und lächeln freundlich.Dr. Banholzer nickt ihnen zu und wendet sich dann energisch zu den Musikanten: »Gute Nacht, meine Herren!« Damit schließt er das Fenster und beendet die Vorstellung. Paula schaut noch einmal an der Gardine vorbei auf den Otto Müllereisert. Der Mitschüler Brechts, hübsch und groß gewachsen, wie er ist, der gefällt ihr schon. Mit dem ist sie sogar schon mal spazieren gegangen. Und im Winter waren sie zusammen rodeln. Sie winkt ihm mit einer kleinen verstohlenen Handbewegung zu. Müllereisert macht eine elegante Verbeugung. Brecht hat es nicht bemerkt.
»Der Müllereisert war eigentlich meine erste Liebe, na ja, ich bin mit ihm gerodelt und auf dem Schulweg habe ich ihn getroffen«, erzählte Paula Gross-Banholzer 1977. »Und da bin ich auch mal mit ihm gegangen, und da kam ein anderer Herr, ein Junge, auf der anderen Straßenseite. Und der hat nur so gemacht …« Paula hat diese Begegnung, diese Geste auch nach sechs Jahrzehnten noch genau im Gedächtnis. Sie spielt mir Brechts herrischen Wink mit dem gekrümmten Zeigefinger in Richtung seines Freundes vor. Wie mit einem Haken hat er ihn zu sich herübergezogen und ihm gesagt: »›Das Mädchen will ich haben. Die lässt du gehen!‹ – Ja, so war das. Und es hat noch lange gedauert, bis er mit mir sprechen konnte. Aus dem hab ich mir ja gar nichts gemacht.«
Lange Zeit hat Brecht es so eingerichtet, dass er Paula auf der Straße begegnet, hat sie aus der Entfernung gegrüßt. Aber Paula und ihre Freundin sind ihm aus dem Weg gegangen. Es ist schon fast ein Spiel. Auch beim Eislaufen im Winter ist er ihnen nicht nähergekommen. Gerade auf Schlittschuhen war sie schneller. So hat es Paula immer vermieden, mit ihm allein zu sein.
Erst im Frühling des Jahres 1917 nimmt Paula Banholzer endlich doch eine Einladung zu einem Spaziergang mit Brecht an. Sie laufen auf schmalem Spazierweg am Lech entlang. Brecht ist von Paulas Natürlichkeit, von ihrer gutartigen Herzlichkeit angezogen. Er hat seine Serenade für sie abgeschrieben und sie ihr geschenkt. Ein Original aus der Hand des Dichters. Das muss doch wohl Eindruck machen. Doch sie scheint eher skeptisch.
»Warum sagen Sie so was?«
»Was meinen Sie?«
Paula hält ihm das Blatt hin. »Dann stolpert durch die Höllenglut …«
Brecht versteht, dass er damit das naiv fromme katholische Herz des Mädchens betrübt hat. »Ist doch nur ein Lied, Fräulein Paula, ein Spiel …«