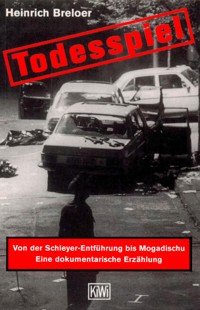7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine Entdeckungsreise in das wahre Mallorca: Schon jetzt mehr als 150.000 begeisterte Leser! Dieser Roman ist eine Entdeckungsreise in das wahre Mallorca, ins Innere einer Insel, die hinter den Mauern der Touristenghettos ihr eigenes Leben führt. Michael Weidling, Fernsehjournalist im Polittheater der Hauptstadt, steckt in einer Lebenskrise. Nach einem Blackout in einem Live-Interview kracht auch noch das Kartenhaus seiner Liebesbeziehung zusammen. An diesem Wendepunkt seines Lebens beschließt er, eine Auszeit zu nehmen und nach Mallorca zu gehen. Es beginnt eine unerwartete Liebesgeschichte, eine deutsch-spanische Freundschaft mit Toni, dem mallorquinischen Architekten, und mit Tomeu, einem geheimnisvollen Mann, der viele Türen und die Augen für eine unbekannte Welt öffnet. Der Leser wird heimisch auf dem Marktplatz von Llucmajor, wo alle Fäden zusammenlaufen, und in der Bar Colón, wo der Losverkäufer Enrique und der Friseur Augustín die Inselgerüchte weitertragen. Er sieht den Strand von Es Trenc ohne die zahlreichen Besucher im Sommer und erfährt, wie Michael Weidling ein altes Gemäuer zu einem neuen Zuhause ausbaut. Mit den Augen der Hauptfigur entdeckt er das andere Mallorca, seine Menschen, die uralten Traditionen und Feste, die fast unsichtbaren Machtverhältnisse, die etwas bizarre Kolonie der deutschen Inselbewohner. Vor dem Hintergrund der mediterranen Landschaft, die ihr Gesicht im Laufe der Jahreszeiten ändert, erlebt der Leser, wie Michael Weidling in der Fremde zu sich selbst kommt und auf der Insel heimisch wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Ähnliche
Heinrich Breloer
Mallorca, ein Jahr
Ein Inselroman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Heinrich Breloer
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Es geht nicht so sehr darum zu reisen, als abzureisen. Wer von uns hätte nicht irgendeinen Schmerz zu überwinden oder irgendein Joch abzuschütteln?
George Sand, 1855
Si hi ha solució, no et preocupis
si no, tampoc.
(Wenn es eine Lösung gibt, kümmer’ dich nicht darum, wenn es keine Lösung gibt, auch nicht.)
Mallorquinisches Sprichwort
1.Der Schlüssel von Christiane und Blackout beim Kanzler
Kein Mensch erregt viel Aufmerksamkeit, wenn er in einem Reisebüro seinen Flug nach Mallorca bucht. Vor allem dann nicht, wenn nebenan gerade ein gutaussehender Mann eine Asienrundreise erster Klasse ordert und beiläufig erwähnt, dass sich die Platinum-Card-Leute um seine Hotelreservierungen und Städterundreisen kümmern.
»Hinflug Düsseldorf – Palma de Mallorca am 7. Oktober um 15.25 Uhr?!«
»Ja!«
»Und Rückflug?!«
»Am 6. Oktober!«
Die junge Frau blickte über den Rand ihres Buchungscomputers. Der Mann im Regenmantel mit seiner freundlichen Hornbrille hatte noch vor einer Minute so vernünftig ausgesehen.
»Ist das Ihr Ernst?!«
Michael hatte sich selbst gefragt, ob das eines Tages wirklich sein Ernst sein könnte. Bei der Asienreise nebenan war es ruhiger geworden. Man schien sich dort dieselbe Frage zu stellen.
»Genau so! Rückflug am 6. Oktober in einem Jahr«, hörte Michael sich sagen. Die Finger der Reiseverkehrsfrau trommelten ratlos auf dem Rand des Computers. Woher kannte sie dieses Gesicht? Vom Fernsehen?
»Tut mir leid. Das geht nicht mit dem Rechner. Ich glaube, da müssen wir ein one way buchen. Um den Rückflug kümmern Sie sich dann selber auf Mallorca.« Sie schenkte ihm ein kleines Lächeln. »Dann können Sie es sich ja immer noch überlegen, wie lange Sie dort bleiben wollen, Herr Weidling!«
Endlich hatte sie es: Weidling. Reporter aus dem Bonner Studio. Michael kannte diesen ratlosen Ausdruck in den Gesichtern der Leute kurz vor dem Wiedererkennen. Das Fernsehen machte sie alle für die Zuschauer jünger und größer. Ein Kollege von einer Münchner Zeitung hatte ihm einmal bei einem Pressegespräch mit Helmut Schmidt erschrocken zugeflüstert: »Ich wusste gar nicht, dass Deutschland von einem Zwerg regiert wird!«
Michael setzte sich auf den Stuhl, während das Ticket ausgestellt wurde. Gab es noch etwas zu überlegen? Das Wetter vor dem Reisebüro war die Antwort. Hier war wieder einmal bereits im September November. In dünnen Fäden trieb der Wind den Sprühregen gegen sein Gesicht, als er wieder auf der Straße stand. Fast war es schon dunkel geworden. Im Zwielicht des Nieselregens schoben sich die Autos mit nervösem Hupen durch den Kreisverkehr vor dem Reisebüro. Das Menschenknäuel an der Ampel drängte über den Zebrastreifen in den Feierabend. Michael ließ sich im Strom vorantreiben. Seine Hand ruhte auf dem Ticket in der Manteltasche. Viel zu überlegen gab es jetzt nicht mehr.
Im Bekanntenkreis hatte sich schnell herumgesprochen, dass Michael ein Jahr auf Mallorca verbringen wollte. Freunde, Bekannte und Leute, die er kaum oder nur vom Hörensagen kannte, riefen an und beglückwünschten ihn. Ebenso seine Kollegen. Ermutigungen, Schulterklopfen und freundliche Ratschläge wurden dem Reisenden mit auf den Weg gegeben.
Plötzlich stellte sich heraus, wie viele Mallorca-Fans es in der Bekanntschaft gab. Sogar sein Steuerberater, der trockene Schleicher, kam ins Schwärmen und beschwor die Bucht von Pollença als den Ort seiner Träume.
»Seit vierzehn Jahren mache ich dort in einem kleinen Haus Urlaub. Port de Pollença kenn’ ich noch als kleines Fischerdorf. Warum haben wir nie darüber gesprochen?«
Die Post vom Finanzamt würde er ihm im Sommer persönlich vorbeibringen. »Aber vielleicht kaufen Sie sich da was, wie die vielen anderen Kollegen, die ich betreuen darf?« Ein Haus auf Mallorca – das beste Invest, zu dem er im Augenblick raten könne. Michael versuchte, noch einen Blick auf das Familienfoto seines Ratgebers zu werfen. Die Rückseite des Rahmens auf dem Schreibtisch kannte er seit Jahren. Jetzt musste er sich für die Vorderseite interessieren, um zu sehen, welcher Besuch ihn da im Sommer auf Mallorca erwartete.
Auf diese Weise erhielt der Reisende in den nächsten Wochen von überall her Adressen, und dann bekam er sogar den Zweitschlüssel für ein Haus an der Nordwestküste von den Möllers aus Düsseldorf, mit denen er nun wirklich nicht gerechnet hatte.
»Fühlen Sie sich dort ganz zu Hause«, sagte Petra Möller, als sie ihn bei einem Abendessen in Bonn mit dem Schlüssel überraschte. »Bedienen Sie sich im Weinkeller! Die Weine in den Holzkisten lassen Sie aber bitte stehen. Trinken Sie die nicht. Mein Mann versteht sich als Sammler. Da ist er ganz pingelig. Rufen Sie Antonia, unsere Putzfrau, an. Wir freuen uns, wenn das Haus bewohnt wird. In der Zeit vom 23. Dezember bis zum 10. Januar sind wir leider selber auf der Insel. Aber bis dahin haben Sie sicher etwas gefunden.«
Petra Möller lächelte ihm aufmunternd zu: »Michael – da unten werden Sie schnell Anschluss finden. Keine Sorge!«
So viel freundliche Anteilnahme war erstaunlich. Wer machte sich hier Sorgen? Wollten sie ihn nicht gehen lassen, oder waren sie so irritiert, dass sie den Ausbrecher im Blick behalten wollten?
Einen Schlüssel musste er auch abgeben, den zur Wohnung seiner Freundin Christiane. Die hatte erst sehr spät von seinen Plänen gehört – und nicht einmal von ihm. Sicher war es die gibbelige Petra, die sich aus Langeweile in jedermanns Schicksal einmischen musste. Eine menschliche Nachrichtenbörse und ein inoffizielles Eheinstitut für das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Der Abend mit Christiane war das traurige Ereignis in der Kette fröhlicher Abschiede. Vor zwei Jahren war er mit ihr einfach ausgerissen. Über Nacht die Koffer gepackt und über die Alpen ab nach Italien. Damals kannten sie sich gerade mal drei Monate, die Fotografin und der Herr Korrespondent. Sie hatten gemeinsam an einem Buch Raumschiff Bonn gearbeitet. Christiane entwickelte die Fotos in ihrem Atelier. So war er in ihre Dunkelkammer geraten, wollte ihr nur mal bei der Arbeit über die Schulter blicken. Schnappschüsse der Bonner Elite schwammen dort im Fixierbad, geheimnisvoll beleuchtet vom Rotlicht der kleinen Kammer: Minister, die beim Bundespresseball ihre Frauen zum Schautanzen ausführen. Das geile Grapschen am kalten Buffet, und immer wieder Würdenträger und glitschige Lobbyisten, deren Begleitungen teuren Schmuck über gerösteten Dekolletés zur Schau trugen. Christiane hatte ein Auge für den Moment, in dem die Kontrolle über die Gesichter verloren ging. Dann drückte sie auf den Auslöser, und man sah Gesichter voller Traurigkeit und Einsamkeit, arme reiche Leute. Sie sah Bilder von Geschichten, die Michael so ähnlich erlebt hatte. In dem bleiernen Schwarzweiß, zu dem sich die Menschen im Entwickler aufbauten, wirkten sie wie Zombies, die sich nach Leben und Wärme sehnten. Die Krankheit der Politik, die Seuche des Zynismus hatten viele von ihnen gezeichnet.
»Es ist schwer, in dieser Stadt davon nicht infiziert zu werden«, hatte er ihr gesagt, während sie ihr Panoptikum auf die Leine hängte.
»Wenn du jahrelang beobachtest, wie hinter den Kulissen die Strippen gezogen werden, welch ein Personal hier zunehmend Hauptrollen spielt …« Sie sah ihn an, und was er sagen wollte über Hochstapler in Politik und Journalismus, vom neuen Typ des Operettenmenschen war nicht mehr notwendig.
Sie hatten dann das große Glück in ihrem Sommer in Italien: Lucca, Florenz, Siena, unter den Klängen seiner Musikkassetten flog der Wagen über die Hügel der Toskana bis nach Elba. Wo sie auch landeten – es war schön, es gab immer ein Zimmer, das frei war, und an jedem Abend fand sich eine Trattoria, in der man auf das freundlichste mit Pasta und Vino Bianco bewirtet wurde. Das Land schien auf sie nur gewartet zu haben.
»Michi – mio amore«, sagte Christiane immer wieder, fast sang sie es in sein Ohr, so hochgestimmt waren sie damals.
Michael konnte in diesen Wochen alles, was hinter ihm lag, abstreifen, wenn sie sich beide am Tag voller Begeisterung für die Schönheit der Landschaft und der Städte treiben ließen und sich sicher waren, dass ihnen auch die Nacht gehörte. Das Leben trug ihn damals so hoch oben auf der Welle, dass er mit Christiane zum ersten Mal von seiner Jugend sprechen konnte.
Er war auf dem kleinen Gutshof seines Onkels im Rheinland aufgewachsen. Seine Mutter hatte sich 1945 aus dem Osten zu ihrem Bruder gerettet. Als der Vater zwei Jahre später aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, war er ein gebrochener Mann. Düstere Erinnerungen an einen cholerischen Mann, der Mitte der Fünfzigerjahre plötzlich an einem Herzschlag starb, überschatteten Michaels frühe Jahre in seinem Paradies: Der Hof mit den Pferden, die Wiesen, Wälder und Bäche waren sein Reich für Abenteuer aller Art. Im Frühling Treckerfahren mit den Landarbeitern, im Sommer Erdbeeren in den Plantagen und hoch oben auf dem Leiterwagen zum Dreschen, im Winter auf den zugefrorenen Weihern Schlittschuhlaufen. So hätte es weitergehen können: ein Leben lang. Aber alles zerbrach in seiner Erinnerung an einem Tag. Gerade mal zehn Jahre alt, saß er neben seiner Mutter im Zug und fuhr über die belgische Grenze in die Stadt Brüssel. Ganz anders als die geschminkten Trümmerstädte zu Hause war diese Stadt mit ihren breiten Boulevards unvorstellbar vornehm und fremd zugleich. Neun Jahre Verbannung in einem Internat lagen vor ihm. Jemand hatte den Teppich weggezogen und darunter eine Falltür geöffnet. Vor allem in den ersten Monaten war es schrecklich, auch weil der kleine Michael, »le Boche«, sich in Belgien schämen sollte, für das, was Deutsche in den Jahren der Besatzung dort angerichtet hatten. Der Boche musste sehr schnell ihre Sprachen lernen, Französisch und Flämisch. Anfangs wurde er nachts auf dem Zimmer verprügelt, bis er im Internat das Boxen lernte. Er ging täglich zum Training, und aus dem schmächtigen Deutschen wurde ein Kämpfer. Einmal hatte er seiner Mutter in einem Brief auf die Frage nach dem Leben in der fremden Welt geantwortet: »Ich lach’ mir einen Ast und setz’ mich drauf.« Aber es war eben nichts mehr wie vorher gewesen. Niemals würde er den Tag vergessen, als er vor dem riesigen Gebäude mit den vielen Zimmern allein stehen gelassen wurde. Lange nicht. Er hatte es nie ganz verwunden und seitdem nie darüber gesprochen. Bis zu dem Tag, als er Christiane kennenlernte.
»Bella mia«, Küsse unterm Sternenzelt, und immer wieder das Staunen über den Zauber der Nähe und Berührungen. Unverschämt war sie und frei, das war die Faszination, die von dieser Frau ausging, in einsamen Badebuchten fiel sie über ihn her. Und Michael lebte in diesen Tagen in einer anderen Welt, ihrem Kontinent aus Rausch, Kitsch und Glück, sodass er sich zu fragen begann, wie er von dort jemals heimfinden sollte in irgendeinen Alltag, in sein Bonner Büro. Christiane duldete keine anderen Menschen in ihrem Zauberland. Sie war die Göttin, die dann in der Folgezeit auch am Rhein unerbittlich jeden mit Eifersucht verfolgte, der sich zwischen sie stellen wollte. Freunde, Termine und Dienstreisen fragte sie argwöhnisch auf möglichen Verrat ab.
An den Wochenenden wurde gekocht. Mit Musik, rotem Tüll über den Stehlampen, ihren strahlenden Augen und der bebenden Stimme – »Michi! Mio amore!« – konnte sie einen so besonderen Raum im Alltag herstellen, dass Michael wie ein Süchtiger immer wieder hinauf in ihre Dachwohnung stieg. War erst die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, verschwand für beide die Welt draußen zu einem grauen Nichts. Mitgerissen von ihrem großen Schwungrad an Leidenschaft, holte sie ihn hoch, brachte sein Herz auf Tempo und ließ seinen Atem laufen. Das Besondere und Einmalige des Moments, gerade der einen Berührung eben, dieser erste Kuss jetzt und hier – das Spiel gelang ihnen immer wie eine erste Begegnung. Er kannte sie von den vielen Nächten zuvor, und dennoch gab es immer wieder ein erstes Mal. Er ahnte, dass es ein langes Spiel war, und er wollte es so. Aber Christiane verlangte Ewigkeit. Sie hatte ja recht – man muss es wenigstens einmal im Leben versuchen. Ihr Wunsch nach Nähe, andauernder Nähe und fester Bindung erschreckte Michael immer mehr. Er konnte nur das weitergeben, was er selber in seinem Leben erlebt hatte – unverbindliche Freundlichkeit und ein großes Misstrauen. Und jede Menge Bühnenbau. Es war dann wohl sein böser, zergliedernder Blick auf die Inszenierung, die in diesen luftleeren Raum die Bedenken hereinholte, sodass allmählich die Unschuld verloren ging und er immer deutlicher als Schauspieler mit Maske und Text diese Bühne betrat, um das aufregende Finale auf ihrem Lager, überwölbt von künstlichen Orangenbäumen und Hibiskusblüten, so lange wie möglich en suite zu spielen. Für einige Monate sollte er dann damals den Kollegen in Brüssel vertreten. Er nahm die Aufgabe dankbar an. Nach seiner Rückkehr hatte er sie dann weniger oft gesehen. Einmal, bei einem Geschäftsessen in einem Restaurant, hatte er sie am Nebentisch übersehen und bekam sofort ein Ungewitter von mediterranen Ausmaßen mit Blitz und Wirbelsturm vor Ort über den Kopf, sodass er sich monatelang in diesem Lokal nicht mehr sehen ließ. Aber das Band zu Christiane war immer noch fest geknüpft: Das Finale fand wieder hoch oben in ihrem Atelier statt.
Nun saß sie beim Griechen Michael, dem Verräter, gegenüber. Sie war ruhig, nur an der Eiseskälte in ihren Augen und am Zittern ihrer Hände spürte Michael etwas von dem Herzbeben, das er bei ihr ausgelöst hatte. »Das war’s ja dann wohl«, sagte sie nur trocken, als Michael nach langem Hin und Her mit der Wahrheit über Mallorca herausgerückt war. Dann verlangte sie ihren Schlüssel und verließ noch vor dem zweiten Gang das Lokal. Für Christiane war es die Trennung. Das Ende aller Versuche mit diesem unsteten Reisenden, der sich am liebsten in Hotels aufzuhalten schien. Er hätte sich gerne alle Optionen offengehalten. War das alles wirklich so dramatisch? Andererseits hatte sie recht. Ihre Wohnung war keine Pension und sie – Christiane – nicht sein Zimmermädchen. Und was Liebe ist, »wirkliche Liebe«, davon verstand er anscheinend nichts. So saß er nun allein beim Griechen, und die ewige Jiddelmusik in dieser vergipsten Grotte ging ihm noch mehr auf die Nerven als an anderen Tagen. Sie würde sich zu trösten wissen, hatte Christiane ihn zum Abschied deutlich wissen lassen. Als er es am Abend vor der Abreise noch einmal oben an ihrer Klingel versuchen wollte, öffnete schon einer der Burschen aus dem Verlag. Knechte, die schon immer um sie herumgeschwänzelt waren, hatten endlich ihre Tür aufbekommen.
»Sag ihm, dass ich beschäftigt bin. In der Dunkelkammer«, rief sie aus der Tiefe des Ateliers.
Als er vorbei an dem Kerl ins Atelier vorgedrungen war, sah er, wie sie schweigend eine Schublade öffnete und einen Stoß Fotos herausnahm, die sie in Italien aufgenommen hatten. Dann marschierte sie mit bösem Schmunzeln zum Küchentisch, auf dem die kleine silberne Spaghettimaschine stand, die sie sich damals aus Lucca mitgebracht hatte. Sie nahm das erste Foto und drehte den Traum vom Glück durch den Wolf: Christiane und Michael im Schatten eines Hotelgartens. Ein Kuss mit Selbstauslöser in schönem Schwarzweiß kam als feine Spaghettini am Ende der Maschine wieder zum Vorschein. Ihre lachenden Gesichter auf Elba, das gelungene Portrait von Michael an einer Quelle mit Weinlaub im Haar – ein Foto nach dem andern zerschnetzelte sie so vor seinen Augen. Dann verpackte sie die Luftschlangen ihrer Geschichte in einem kleinen Müllsack, reichte ihm das Päckchen und zeigte ihm den Ausgang. Michael hörte noch, wie sie den Schlüssel im Schloss drehte.
Der LTU-Tristar war fast ausgebucht. Oktober, die Zeit der Kegelclubs, die mit ihrer Clubkasse durchbrannten. Einmal im Jahr. Es gab offenbar ein stillschweigendes Abkommen, auch die Frauen hatten ihre Kegelwoche. Urlaub von der Ehe.
Michael war zwischen sie geraten. Aufgekratzt liefen sie in den Gängen umher, als ob sie im Zug reisten. Einige Residenten, die in der Maschine saßen, erkannte man am Dauerbraun und dem kleinen Gepäck. Ein Herr in einer roten, wattierten Weste wies schon mit seinem aufgenähten Golfschläger auf seine Absichten hin. Mit einem Handbuch der Golfplätze Mallorcas bereitete er sich auf den Viersterneurlaub vor.
Eine Gruppe von zwanzig bis fünfundzwanzig Frauen fiel durch ein besonderes Erkennungszeichen auf: An einer Kordel um den Hals trugen sie alle eine Muschel. Pilger vielleicht, dachte Michael, und da tauchte auch schon vor ihm der Herr Pfarrer auf, der von Reihe zu Reihe seine Schäfchen besuchte und mit seiner Videokamera von der ersten Stunde an Erinnerungen einsammelte.
»Mia! Hierher! Heinrich, guck doch mal ins Video.« Dem Dialekt nach kamen sie aus dem Sauerland. Und dann hatte Hochwürden Michael entdeckt.
»Herr Weibling! Ich kenn’ Sie doch vom Fernseher.«
»Weidling«, korrigierte Michael noch, da blickte er schon in das Rotlicht.
»Ich darf doch mal«, entschuldigte sich Hochwürden leutselig, »Sie sind das ja gewohnt!«
Michael schlug seine Zeitung auf. Er wollte endlich raus aus diesem katholischen Video, das bald in irgendeiner Kirchengemeinde abgespielt würde.
»Danke!« Er winkte ab. »Jetzt ist’s doch genug.« Michael setzte sich die Kopfhörer auf und drehte mit dem Regler an der Armlehne den geschwätzigen Justus Frantz und sein notorisches Klassikprogramm auf null. Hochwürden kurvte nach vorne zum Cockpit, und Michael warf einen Blick auf die Zeitung.
Das Titelfoto zeigte den Kanzler beim Staatsbesuch. Michael schlug die Augen zu. Fast musste er dem Mann auf dem Foto dankbar sein. Es war genau vor vierzehn Tagen, als ihn das Leben durch einen kleinen Zufall dazu zwang, endlich Bilanz zu machen.
Die Szene im Bonner Studio war schon eingeleuchtet, aber der Kanzler – leicht verspätet – saß noch in der Maske. Vor ihm kniete Michael mit seinem Fragezettel, und während sein prominenter Gesprächspartner hergerichtet wurde, erläuterte er seinen Fragenkomplex noch einmal. Der Kanzler hörte nur mit mäßigem Interesse zu und unterbrach dann ungeduldig:
»Wie viel haben wir denn eigentlich?«
»Fünf dreißig, vielleicht sechs Minuten«, sagte Michael und fügte hinzu: »Ich werd’ gleich noch mal die Regie fragen.« Er wollte gerade zur Tür raus, als ihm die Maskenbildnerin nachrief:
»Sind die Hände im Bild?«
»Selbstverständlich!« Und schon legte der große Politiker brav seine Pranken auf den Schminktisch, damit sie mit Make-up behandelt und dem ewigen Sommerbraun der Politiker im Gesicht angepasst werden konnten. An den Händen erkennt man immer ihr wahres Alter, dachte Michael, als er ins Studio ging. Erst wenn wir ihnen ihre Furchen in den Gesichtern zugeschmiert haben, wenn alles auf Hochglanz poliert und ins helle Licht der Studios getaucht ist, wenn sie dann elektronisch abgetastet und von uns rausgeputzt werden – ja dann sehen sie alle wie kleine, unschuldige, rosige Marzipanschweinchen aus. Er hatte sich in seinen Vitrasessel gegenüber dem Kanzlerplatz fallen gelassen. Seit zwanzig Jahren saß er in solchen Sesseln, neben ihm das Glas Wasser, und wartete auf das Rotlicht der Kamera. Eine merkwürdige Arbeit, simpel und ohne großes Geheimnis, wenn man erst einmal über Jahre seine Brückenköpfe in den Parteizentralen und Ministerien aufgebaut hatte und von dort in dieser ständigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit immer wieder signalisiert bekam, zu welchen Fragen welcher Politiker zu haben war. Ja, manchmal hatte er wegen dieser Beziehungen auch als Erster ein Thema ausgraben und als News verkaufen dürfen. Mit der immer heftiger werdenden Konkurrenz zum privaten Fernsehen hatte das allerdings in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Sein Sender war nicht mehr die erste Adresse.
Er war damals, in den turbulenten Tagen des Misstrauensvotums gegen Willy Brandt, nach Bonn gekommen, hatte die Kanzlerschaft Helmut Schmidts begleitet und die langen Jahre des Kanzlers Kohl reportiert. Diese Wechsel auf der Bonner Bühne waren ihm immer notwendig und selbstverständlich vorgekommen, sie machten das Ganze auch interessant. Aber in den letzten Jahren hatte sich ein großer Mehltau auf seine Arbeit und sein Interesse an der Politik gelegt. Es gab nur noch ein Zentrum der Macht, das in dieser kleinen Stadt funktionierte, das waren der Kanzler und das Kanzleramt. Das Fernsehen hatte sich in den letzten Jahren grundlegend verändert – bis hin zur Banalität. Die Politik, das Fernsehen, auch Michaels Lebensgefühl veränderten sich in diesen Jahren. Eine große Langeweile hatte in seinem Leben Platz genommen, und gerade während der aufregenden Monate der deutschen Vereinigung war es ihm aufgefallen. Für einen Moment war es damals noch einmal wie zu Beginn seiner Arbeit gewesen: Unangemeldet konnte er mit laufender Kamera in Amtsstuben eindringen oder vor dem Fernsehen flüchtende Minister der Modrow-Regierung auf der Straße stellen. Aber bald war ihm auch das langweilig geworden. Vor ihnen musste man sich ja nicht fürchten. In Bonn war alles beim Alten geblieben, auch in den neuen Bundesländern war bald das große Arrangement in Gang – und er war nur einer der vielen Statisten auf der Fernsehbühne, die anderen die Stichworte für ihre kleinen und großen Auftritte lieferten. Auch die Frechheiten, die er sich bewahrt hatte, seine kecken Nachfragen, für die er bekannt war, ließen das Spiel nur noch echter erscheinen. Die Regie zählte über Lautsprecher die Sekunden bis zum Beginn des Interviews herunter: Countdown bis zum Rotlicht. Dann trug Michael artig seine erste Frage zu den Kosten der Deutschen Einheit vor. Er kannte die Antwort schon im Voraus, aber heute beobachtete er mit ungewöhnlichem Interesse die Varianten, mit denen der Kanzler seinen angestaubten Ideen Glanz und Frische zu geben versuchte. Und seltsam – je länger er zuhörte und zu verstehen suchte, desto weniger begriff er, was der Mann vor ihm sagen wollte. Einschläfernd deckte der Kanzler Michael mit seinem weichen Dialekt und einem Bündel unwiderstehlicher Plattheiten zu. Allmählich wurde ihm ganz dumpf im Kopf. Die Digitaluhr unter dem Monitor zählte erbarmungslos die Sekunden der Sendung herunter: 4-46,4-45, 4-44, 4-43. Michael spürte mit einem leichten Schrecken, wie ihn eine fremde Kraft allmählich aus der Szene »Interview mit dem Kanzler« herauszog. Der Kanzler war die Macht, und es ist gemütlich, sich der Macht hinzugeben. Stichworte zu liefern, die mit anerkennendem Lächeln belohnt und in besonderen Fällen mit der Namensnennung »Sie fragen zu Recht, Herr Weidling« zurückgespielt wurden. Er war darauf trainiert, sich diesem Sog zu widersetzen. Aus der Nähe betrachtet schwitzte die Macht, sie lispelte und zeigte in dem improvisierten Allerlei immer wieder Angriffspunkte, wenn man sich konzentrieren könnte, ja wenn man nicht so unendlich müde wäre. Michael hatte plötzlich die Kontrolle über die Situation verloren. Er war ausgestiegen, und so sehr er sich bemühte, er fand keinen Weg zurück in die Sendung, die er sonst wie im Schlaf kontrollierte. Eigentlich »von Weidling«, dachte er noch, als von der Regie die Einblendung seines Namens herausgenommen wurde, aber ich habe ja in den verrückten Sechzigerjahren auf mein kleines »von« verzichtet. Der da würde darüber lachen. Tatsächlich lächelte der Kanzler, als er herübersah, und hinter ihm fuchtelte aufgeregt der Aufnahmeleiter mit den Händen.
Sein Blick hatte sich vor dem Interview plötzlich verengt. Wie durch einen Trichter hatte er nur noch den Mund des Kanzlers gesehen, der sich öffnete und schloss und wieder öffnete … Luftblasen wie bei einem Karpfen, aber jetzt blieb der Mund geschlossen, und es wurde ganz still im Studio. Michael spürte wohl, dass er nun irgendetwas fragen sollte, damit der Karpfen weiterhin seine Luftblasen ablassen konnte. Was war es nur? Er kramte nach seinem Zettel in der Jackentasche. Sein Blick fiel auf den Monitor vor ihm. Dort saß er – ein Mittvierziger in einer Zweiereinstellung neben dem Bundeskanzler. Mit dem Wechsel der Einstellungsgröße fuhr die Kamera näher an ihn heran, die beigefarbene Hornbrille passte doch vorzüglich zu seinem dunkelblonden Haar. Einige graue Strähnen waren schon sichtbar und gaben der Person etwas von britischem Understatement. Wer ist dieser Mann, fragte sich Michael erstaunt, als die Regie seinen Namen einblendete. Michael WEIDLING.
Der Gau, hatte er gedacht, das ist der Gau. Wie oft hatte er sich in den ersten Jahren davor gefürchtet, aber die Routine hatte ihn das vergessen lassen. Jetzt war es wieder da. In einer Livesendung mit dem Kanzler hatte er einen Blackout, der einfach nicht aufhören wollte. Endlich kam die Erlösung: Wie von fern hörte er die Stimme des Kanzlers. »Wenn Sie mich fragen würden, Herr Weidling, wie ich vor vier, fünf Jahren darüber gedacht habe, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen …« Der Politprofi hatte die Sendung an sich gerissen, und wie so oft stellte er sich selber die Fragen, die er gerne beantworten wollte.
Zwei Stunden später, kurz vor Mitternacht, saß Michael immer noch in seinem Büro. Nach der Sendung hatte Werner, der Regisseur, ein alter Freund, noch mal den Kopf zur Tür hereingesteckt: »Mach dir nichts draus, Michael, wie man’s auch dreht und wendet, am Ende hat es sich versendet.«
Er blickte in die Dunkelheit auf die Lichter des langen Eugen, das niedliche Provinzpanorama der alten Bundeshauptstadt. Ein Luxusgetto, hatte er gedacht, aber wenn ich jetzt nicht aufstehe, hab’ ich hier lebenslänglich.
Es war dann einfacher gewesen, als er gedacht hatte. Der Sender hatte ihm ein Jahr unbezahlten Urlaub zugestanden, und Michael wusste, dass dieses Arrangement nun als Lex Weidling die Runde machte.
»Meerstern, ich dich grüße. O Maria hilf!« Das Kirchenlied der katholischen Pilgergruppe brachte Michael in die Gegenwart zurück. Hochwürden hatte sich auf seinem Sitz umgedreht und dirigierte die trostreichen Gesänge während der Landung. Die Kegelbrüder prusteten vor Lachen. Der Malermeister aus Meschede strahlte seine Frau an, und beide klatschten begeistert. Sie waren froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Dieser Applaus, der sich in einer Welle von hinten nach vorne im Flugzeug ausbreitete, ließ Michael etwas tiefer in den Sessel rutschen. Es war ihm peinlich. Aber warum eigentlich? Es waren doch auch seine Zuschauer, die da klatschten, seine Einschaltquote, darüber hatte er sich nie Illusionen gemacht. Sie waren nicht die Vielflieger – wie Michael und seine Kollegen, die mit den Gebühren dieser Menschen Flüge, Reisespesen und Hotels bezahlten.
Über vierzehn Millionen Menschen werden jährlich nach Mallorca geflogen. In der Hauptsaison landen an manchen Tagen bis zu fünfhundert Flugzeuge. Mehr als in Frankfurt oder New York. An diesem dritten Oktober waren es nur noch hundertfünfzig Landungen, und die Maschine war an diesem Sonntagabend das letzte Flugzeug aus Deutschland. Michael war überrascht. Kaum, dass er sich im Terminal die Zigarette angezündet hatte, setzte sich bereits das Laufband in Bewegung. Auf einem der Gepäckwagen schob er seine beiden großen Koffer zum Taxistand vor dem Flughafengebäude. Auf der Gangway war ihm ein heißer Wind ins Gesicht geschlagen. Hier war die Luft jetzt schon etwas klarer, und er freute sich auf den Moment, in dem er – endlich auf der Finca angekommen – diese ganz eigene Luft Mallorcas atmen und fühlen durfte. Das war eine der Erinnerungen an die Insel von einem viele Jahre zurückliegenden Urlaub, die er nicht hatte vergessen können.
L’heure bleue, die Blaue Stunde, wenn er aufs Meer geschaut und diese unvergleichlich seidenweiche Luft auf seiner Haut gespürt hatte. Nur zwei Flugstunden vom Ruhrgebiet entfernt, und eine völlig andere Welt.
»Taxi, señor?« Michael nickte, und im Nu hatte der kleine drahtige Spanier die Koffer hochgerissen und auf dem Dachgepäckträger verzurrt. »A dónde vamos, señor?« Michael suchte vergeblich den Zettel mit der Adresse.
»Einen Moment – Momento«, er bemerkte, dass ihn seine Spanischkenntnisse sofort im Stich ließen. Man lernt in Deutschland immer die falschen Vokabeln. Der Fahrer hatte inzwischen das Taxi gestartet, war aus der Reihe gefahren und wartete auf Anweisung. Michael kramte verzweifelt in seinen Taschen und in seiner Erinnerung … »Luck?!« glaubte er sich zu erinnern.
»Monasterio Luck?«, schlug der Taxifahrer vor und reichte ihm eine Liste mit sämtlichen Fahrzielen und Preisen auf der Insel herüber. Michael fuhr mit dem Zeigefinger über das Alphabet der Liste und fand den Ort. Mit dem Finger zeigte er auf die Zeile.
»Este Lluc es mi destinación!«
Endlich war es wieder da, sein bisschen Spanisch. Es liegt in der Luft, das hatte er doch immer gesagt. Michael rutschte entspannt in den Sitz, kurbelte das Fenster herunter und ließ den Fahrtwind über Kopf und Haare streichen. Das Flughafengebäude verschwand in der Dunkelheit. Ein schöner Spätsommertag war in eine lauwarme Nacht übergegangen. Sicher noch zweiundzwanzig Grad, dachte Michael noch, bevor ihm die Augen zufielen. Im Rückspiegel sah der Taxifahrer, wie sein Fahrgast eingeschlafen war. Gente loca, estos extranjeros. Trabajan todo el año como locos y quieren recuperarse en una semana o dos. Verrückte Leute, diese Ausländer. Arbeiten das ganze Jahr und wollen sich in einer oder zwei Wochen erholen. Ihm konnte es recht sein. Aber es war schon eine verdrehte Welt. Man konnte sich doch nirgendwo besser erholen als zu Hause. Darüber hatte er sich oft mit seinen Kollegen unterhalten, wenn sie in der Reihe am Flughafen warteten. Aber er hatte Glück, dieser alemán wollte nicht nach Arenal oder Paguera. Immerhin, eine 30-Minuten-Fahrt.
Als Michael die Augen aufschlug, fuhr das Taxi schon eine Zeit lang hinter einem seltsamen Umzug her.
2.Der falsche Ort, der richtige Mann: Toni und Llucmajor
Am Ende des Sommers, wenn die Touristen die Insel verlassen haben, kehren auch die Bewohner wieder zu ihrem normalen Leben zurück. Es ist dann die Zeit der firas, eine Mischung aus Landwirtschaftsausstellungen und Volksfesten. An diesem ersten Sonntag im Oktober wurde in Llucmajor die fira de tardor, das große Herbstfest der Stadt, gefeiert. Stiere, Kühe, Schafe und sogar Hunde wurden auf Wagen durch die Stadt gezogen. Bauern im Sonntagsanzug auf den Traktoren zeigten ihre Tiere in einem Wettbewerb um die beste Zucht vor.
Die Stiere auf dem Wagen, hinter dem Michaels Taxi nun Schritt fahren musste, trugen noch die farbigen Preisrosetten mit dem roten Band. Die fröhliche Menschenmenge vor und hinter den Wagen brachte das Taxi bald zum Stehen. Es war ein Fest ganz nach dem Geschmack der Mallorquiner: Feuerwerk, Tanz, Kapellen auf den Plätzen, Essen und Trinken in allen Bars und Häusern. Ein ständiges Kommen und Gehen, begleitet von Erzählungen und Gelächter. Das erste große Beisammensein der Einheimischen zu Beginn des Herbstes.
Der Taxifahrer hatte Michael noch den Weg zum Marktplatz gezeigt. Mit seinen beiden Koffern schob er sich nun dicht an den Häusern vorbei durch diesen späten Karneval.
Plötzlich fühlte sich Michael ganz verloren. Niemand beachtete den Fremden, der mit seinen Koffern mitten in diesem bunten Treiben auf dem Marktplatz stand. Dabei hatte er gerade zwischen den spanischen Geldscheinen den Zettel mit der Anschrift gefunden. Lluc-Alcari stand darauf und das Hotel Costa D’or, wo ihn an der Rezeption Pepe erwarten würde, um ihn zur Finca der Möllers zu fahren. Nichts war an diesem Ort so, wie es ihm die Freunde seiner Bekannten geschildert hatten. Dieser Marktplatz hier schien so groß wie das ganze Lluc-Alcari. Er bereute es, sich so früh von seinem Taxifahrer verabschiedet zu haben. Michael stand vor einer Bar. Auf einer Leuchtreklame las er Bar Colón. Ein großer Wartesaal mit raumhohen, offenen Doppelflügeltüren, verschlossen nur durch Perlenvorhänge, durch die die Menge herein- und herausschob. Er steuerte mit seinen Koffern auf die große Theke zu, die die ganze rechte Seite des Lokals begrenzte, und bahnte sich den Weg zum Telefon, das er wie einen Rettungsanker ergriff. Er wählte die Rufnummer des Hotels, die er auf seinem Zettel notiert hatte, und dann war alles klar, er war im falschen Ort gelandet, und Pepe würde am nächsten Mittag zwischen zwölf und eins wieder auf ihn warten. Die Umstehenden hatten ihm mittlerweile erklärt, wo er sich befand: Llucmajor. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Es war genau das andere Ende der Insel. Michael war wütend über den Streich, den er sich selbst gespielt hatte. Niedergeschlagen saß er auf seinen Koffern, als ihm ein Glas Rotwein gereicht wurde.
»Salud caballero.« Er sah ein fröhliches Lachen über sich.
»Muchas gracias, señor«, kramte er in seinem Spanisch, »si yo puede oferecer a usted un asiento« und wies mit einladender Geste auf den zweiten Koffer. Wahrscheinlich der einzig freie Platz in diesem Bienenkorb. Tatsächlich nahm der Mann mit den Jeans und dem gestreiften Hemd die Einladung an.
»Ustedes se van o vienen?« – Kommen Sie oder gehen Sie?, fragte er. »Ich bin gekommen und muss wieder gehen. Ich bin am falschen Ort.« Michael hatte sich ins Französische gerettet und war über die Antwort erstaunt. »Llucmajor c’est toujours le bon endroit et surtout aujourd’hui!«
Damit hatte er nicht gerechnet. »Michael aus Deutschland«, stellte er sich vor, um noch irgendetwas zu sagen.
»Toni aus Llucmajor«, war die Antwort.
»Merci, Toni«, Michael hob das Glas, trank es in einem Zug aus und fühlte sich schon nicht mehr ganz so verloren wie einige Minuten zuvor. Irgendwie war die heitere Zuversicht, die von diesem Mann ausging, ansteckend. Zwischen dem grauen Dreitagebart und den kurz geschnittenen, grau melierten Haaren lachten ihn ein paar Augen an, die viel jünger waren, als der Mann sein mochte. Kein Bauer, kein Kaufmann, ein Rechtsanwalt vielleicht, dachte Michael, und irgendwie schien es ihm, als ob von diesem Mallorquiner mit dem Lausbubengesicht voller guter Laune etwas ausging, das die Probleme, die er mit seinem Koffer in diese Bar geschleppt hatte, lösen würde. Aber das waren vielleicht nur der leichte Nebel, der vom Rotwein in seinen Kopf gestiegen war, und die Erleichterung, denn bald hatte man schon das dritte Glas miteinander geleert. Toni hatte sich den Zettel angesehen, die Geschichte verstanden und war kurz verschwunden. Als er wiederkam, hatte er zwei Stücke »coca de trampó« in der Hand, eine Art Blechkuchen mit Paprika, Zwiebeln und Petersilie belegt.
»Wir Mallorquiner trinken nicht, ohne zu essen, Michael.« Als sie wieder auf den beiden Koffern saßen, stellte sich Toni noch einmal vor. Er war Architekt in Llucmajor, und er war auch schon einige Male in Deutschland gewesen.
»Ein biesgen Deutsch kann ich«, sagte er. Michael erzählte, teils in holprigem Spanisch, teils in Französisch, wie er hierhergekommen war.
Immer wieder wurde Toni von Freunden begrüßt, die sich zu ihnen stellten und immer wieder lachend auf Michaels Unglück anstießen, denn Toni konnte nicht oft genug die Geschichte der Verwechslung zwischen Llucmajor und Lluc-Alcari erzählen. Man beglückwünschte Michael geradezu zu dieser Verwechslung. Hier, so sagten alle, war Michael wirklich in Mallorca. Lluc-Alcari war schließlich nur ein Touristennest oben im Norden, bei den verschrobenen Bergbewohnern, die jeden Quadratmeter Land an extranjeros und forasteros verscherbelten.
»Todo el invierno sin sol en la costa del norte«, Toni musste Michael immer wieder das Mallorquín seiner Freunde übersetzen. »Den ganzen Winter ohne Sonne da oben, das ist sehr schlecht, muy mal – da verliert man die gute Laune – du kennst doch das Buch ›Ein Winter auf Mallorca‹ von George Sand, die haben sich auch den falschen Ort ausgesucht.«
Toni sprach mit seinen Freunden Mallorquín. Michael blieb dabei außen vor, seine spanischen Vokabeln boten ihm keinen Eintritt in diese Welt. Es klang eher nach Französisch, und manchmal verstand er über diese Brücke das eine oder andere Wort. »Com va això« zum Beispiel klang doch ganz ähnlich wie »comment ça va«, und der »vi« war genau der Wein, den er aus Frankreich kannte. Später erklärte ihm einer von Tonis Freunden: Das mallorquín war eine eigene, mediterrane Sprache. Ihm wurde bald klar, dass man mit dem castellano, dem Spanischen, diese Insel und ihre Menschen niemals verstehen würde. Das Mallorquín war der Schlüssel, und zwei Worte und eine Redewendung hatte er schließlich an diesem Abend schon gelernt. Nach und nach waren die Gäste der Bar Colón nach Hause gegangen, und Michael, der mit Toni noch immer auf den Koffern saß, sah auf die Uhr. Mitternacht war lange vorbei.
»No te preocupes, mach dir keine Sorgen«, sagte Toni. Ein Satz, den Michael noch oft auf der Insel hören sollte, eine Art Grundmelodie des Alltags. Aber in dieser Nacht, als er diese Worte zum ersten Mal hörte, war der Trost nötig. Und wirklich, Toni hatte schon alles arrangiert.
»Wir nehmen noch einen letzten Wein, dann fahre ich dich ins Es Recó de Randa, ein kleines Hotel mit einem guten Restaurant einige Kilometer von hier entfernt in Randa. Dort ist schon ein Zimmer für dich bestellt.«
Als Michael bezahlen wollte, winkte Lorenzo, der Wirt hinter der Bar, nur ab.
»Ya está pagado!« Merkwürdig, dachte er, alles arrangiert, alles bezahlt.
Als Michael am nächsten Morgen die Fensterläden seines Zimmers aufstieß, traf ihn das helle Licht der Morgensonne wie ein Blitz. Der gute Landwein der letzten Nacht brachte sich noch einmal in Erinnerung. Bald hatte er sich aber an das helle Licht gewöhnt und erkannte zuerst am Horizont eine bewaldete Hügelkette, die an einigen Stellen den Blick bis aufs Meer freigab. Davor lagen grüne Felder, frisches Grün, vom ersten Regen im Herbst gewachsen. Sie wechselten zu roten Äckern, auf denen Bauern mit Traktoren die ersten Furchen zogen. Direkt vor ihm lag der kleine Ort Randa. Er blickte auf rotgelbe Ziegeldächer, die von der Kirche mit einem Turmdach, das einem Helm glich, überragt wurden. Stimmen und Geräusche aus dem Dorf vermischten sich mit dem an- und abschwellenden Geräusch der Traktoren in der Ferne und drangen zu ihm herauf.
Unter seinem Fenster war eine Terrasse eingedeckt und lud zum Frühstück ein. Was für ein Platz, dachte Michael, als er den ersten heißen café con leche trank. Der Kellner hatte ihm dazu eine ensaimada gebracht, das leichte, frische Schmalzgebäck, das ausgezeichnet zum Kaffee schmeckte.
Dann hörte er einen Wagen vorfahren und erkannte Tonis Stimme an der Rezeption, genau das fröhliche, etwas raue Lachen, das ihn durch die letzte Nacht getragen hatte. Eigentlich hatte er das nicht ernst genommen, Tonis Versprechen, zu später Stunde, aber nun war er wirklich gekommen, um ihn nach Lluc-Alcari zu fahren, wo Pepe auf ihn wartete. Die beiden großen Koffer konnten sie nur mit Mühe in Tonis altem Alfa Romeo unterbringen. Eine abenteuerliche Kiste, verstaubt und voller Beulen. Mindestens fünfzehn Jahre alt, und jedes Jahr davon konnte man deutlich erkennen. Michael wollte eigentlich eine Freundlichkeit anbringen: »Tolles Modell, Veloce Sprint, wenn man den restaurieren würde – ein Wertgegenstand.«
Toni staunte: Unter keinen Umständen würde er auch nur einen duro, ein Fünf-Peseten-Stück, in so einen Schrotthaufen investieren: »Solange er anspringt, fahre ich noch damit, dann kommt er weg.«
»Dann ist er nicht mehr zu verkaufen.«
»Ich will ihn nicht verkaufen, er wird nur abgestellt.« Damit war das Thema besprochen.
Der schwarze Alfa rollte den Berg von Randa herunter in Richtung Algaida, wo sich nach einer letzten Erhebung vor ihnen das flache Land öffnete. Große Fincas, landwirtschaftliche Betriebe, fruchtbares Land, das andere Mallorca, von dem Michael eigentlich nicht viel wusste. Er kannte nur die schönen Postkartenbilder, die sein Sender den Zuschauern so oft als Zwischenschnitt zum geheimnisvollen Mallorca, untermalt von mallorquinischer Folklore, verkauft hatte.
»Das ist das eigentliche Mallorca, das Herz der Insel, da kommen wir alle her – davon leben wir«, sagte Toni.
»Die Leute, die ich hier kenne«, sagte Michael, »kaufen nur Häuser mit Meerblick, am liebsten direkt am Strand.«
Toni lachte: »Den Strand auf Mallorca haben die extranjeros entdeckt. Für uns war das El Arenal, der Sand, die Wüste. Das war der Erbteil für den Jüngsten oder für den Taugenichts der Familie, das Grundstück am Meer. Unfruchtbares Land, nicht zu gebrauchen. Der Streifen Sand mit der garriga, da ist niemand hingegangen.« Aus dem Wagen konnte Michael kaum über die Natursteinmauern sehen, die rechts und links den engen, alten Fahrweg begrenzten. Johannisbrotbäume, seltener Olivenbäume, ragten über die Mauern und warfen ihre Schatten auf die Straße. In der nächsten Kurve trat Toni auf die Bremse. Eine Ziegenherde zog meckernd über die Straße. Ihre hellen Glöckchen läuteten noch aufgeregter, als der ca de bestiar, ein großer mallorquinischer Schäferhund, sie zusammentrieb. Toni bot Michael eine Zigarette an, und während er ihm Feuer gab, sagte er: »Du glaubst mir wohl die Geschichte mit dem Strand nicht? Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, da fuhr ich mit meinem Großvater noch mit der Eselskarre von Llucmajor nach Ses Covetes ans Meer zum Fischen. Das Boot unserer Familie lag in einer der covetes, die kannst du heute noch sehen. Den Tag werde ich nie vergessen, ich war damals sechs oder sieben Jahre alt. Wir fuhren gerade durch den Wald vor den Dünen, da liefen uns ein paar Kinder entgegen, die riefen: ›Da sind Leute am Strand. Da sind Leute am Strand!‹. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Wir sind dann sofort hingelaufen, und da lagen schon zwanzig Kinder in den Dünen auf dem Bauch und beobachteten, was sich unten am Meer abspielte. Ich weiß noch, wie mein Großvater sagte: ›Deben ser ingleses.‹ Er glaubte, es waren Engländer, er hatte sie wohl an der Sprache erkannt. Tatsächlich hatten sich drei, vier Leute am Strand niedergelassen. Sie saßen da unter Sonnenschirmen auf Handtüchern, hatten Lunchpakete dabei. Wir kannten ja das Picknick nur vom Land und fragten uns, ob die sich im Platz geirrt hatten, dort, in der heißen Sonne, in dem glühenden Sand. Ich hab’ damals den Großvater gefragt, was die da machen. ›Das sind Touristen‹, sagte er. Damals habe ich das Wort ›Tourist‹ zum ersten Mal gehört. Als sie dann tatsächlich ins Meer gegangen sind, um zu schwimmen, sind wir Kinder alle aufgesprungen und haben vor Vergnügen getanzt und gejohlt. Die Engländer haben sich wahrscheinlich über uns genauso gewundert.«
»Schau dir heute, vierzig Jahre später, Arenal an!«, sagte Michael. »Du hast damals einen Blick in die Zukunft getan.«
»El Arenal, das heißt bei uns ›der Sand‹, und für mich bleibt das auch so. Mich wirst du nicht am Strand und nicht schwimmen sehen. Sand bleibt Sand!«
»Goldener Sand«, lachte Michael, als Toni den Gang einlegte und wieder Fahrt aufnahm.
Sie hatten Algaida hinter sich gelassen und waren auf die Hauptstraße nach Palma eingeschwenkt, um nach einigen Kilometern rechts auf die große Bergkette, die Serra de Tramuntana