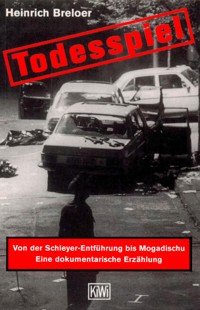22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das atemberaubende Porträt des jungen Thomas Mann im Kampf um Katia Pringsheim, geschrieben von der Filmikone Heinrich Breloer (»Buddenbrooks«, »Die Manns«)
Heinrich Breloer hat mit seinem TV-Mehrteiler »Die Manns« unser Bild von Thomas Mann geprägt wie niemand sonst. Marcel Reich-Ranicki bezeichnete die Filme als »Glanzstück« und »Höhepunkt der deutschen Filmkunst«.
In »Ein tadelloses Glück« erzählt Breloer nun die ereignisreiche Vorgeschichte aus den Jahren vor Beginn des Ersten Weltkriegs: Von Thomas Mann als ehrgeizigem jungen Schriftsteller, der mit den »Buddenbrooks« einen ersten Erfolg, aber noch nicht das gesellschaftliche Ansehen erreicht hat, von dem er träumt. Dem schmerzlich bewusst ist, dass es dafür die Ehe bräuchte und dass seine Sehnsucht nach dem Anblick männlicher Schönheit ein Geheimnis bleiben muss. Erst als Thomas auf Katia, die Tochter der jüdisch-großbürgerlichen Familie Pringsheim, trifft, ist ihm klar: Die oder keine! Allein mit ihr, das spürt er, kann ihm der Aufstieg gelingen. Doch um Katia für sich zu gewinnen, begibt Thomas sich auf ein glattes gesellschaftliches Parkett.
In »Ein tadelloses Glück« schildert Heinrich Breloer faktengestützt und mit großer erzählerischer Verve die miteinander verwobenen Schicksale von Thomas Mann und Katia Pringsheim so lebendig und unmittelbar wie nie zuvor. Dabei greift er zurück auf Jahrzehnte an Recherchen und Interviews mit den Mitgliedern und dem Umfeld der Familie Mann und lässt uns die Mitglieder der wohl bekanntesten deutschen Familie des 20. Jahrhunderts mit völlig neuen Augen sehen.
Das literarische Ereignis zum 150. Geburtstag von Thomas Mann!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Ähnliche
Das atemberaubende Porträt des jungen Thomas Mann, geschrieben von der Filmikone Heinrich Breloer (»Buddenbrooks«, »Die Manns«)
Heinrich Breloer hat mit seinem TV-Mehrteiler »Die Manns« unser Bild von Thomas Mann geprägt wie niemand sonst. Marcel Reich-Ranicki bezeichnete die Filme als »Glanzstück« und »Höhepunkt der deutschen Filmkunst«.
In »Ein tadelloses Glück« erzählt Breloer nun die ereignisreiche Vorgeschichte: Vom Aufstieg Thomas Manns, seiner Liebe zu Männern, seinem Werben um Katia Pringsheim und dem deutsch-jüdischen Bündnis ihrer Familien in den entscheidenden Jahren vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Mit seinem einzigartig szenischen Erzählstil zeigt Heinrich Breloer Katia und Thomas in ihrem Kampf um Kunst, die Liebe und das Überleben so lebendig und unmittelbar wie nie zuvor.
Millionen Menschen haben begeistert die »Die Manns« gesehen – nun schreibt Heinrich Breloer mit historischer Genauigkeit und großem erzählerischem Verve in »Ein tadelloses Glück« das packende Vorspiel dieser Geschichte.
Heinrich Breloer, geboren 1942, zählt zu den bedeutendsten Film- und TV-Autoren Deutschlands und wurde für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet, darunter mit acht Grimmepreisen, dem Emmy und dem Deutschen Fernsehpreis. In der öffentlichen Wahrnehmung ist er mit den Manns so stark verbunden wie wenige andere. Für seine Verfilmung der Buddenbrooks und die mehrteilige Verfilmung der Familiengeschichte »Die Manns«, sowie für seine bereits erschienenen Bücher über die Manns hat er nicht nur mit Golo Mann, sondern auch mit zahlreichen Weggefährten und Nachkommen ausführliche Interviews geführt, ist in den Nachlass eingetaucht und heute mit der gesamten Familiengeschichte bestens vertraut. Heinrich Breloer lebt in Köln.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
HEINRICH BRELOER
Ein tadelloses Glück
Der junge Thomas Mann und der Preis des Erfolgs
DVA
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Im vorliegenden Text verknüpft der Autor seine eigenen Ausführungen mit Originalpassagen aus den Werken Thomas Manns und Briefwechseln sowie ausgewählter Sekundärliteratur zu dessen Werken. Dies geschieht als bewusst komponierte Hommage und als Ausdruck der Wertschätzung für Thomas Mann. Die hierfür verwendete zitierende Kulturtechnik des Pastiches ist ein prägendes Element des zeitgemäßen kulturellen Schaffens und aufgrund bewusster Entscheidung des Europäischen Gesetzgebers nach § 51a UrhG gestattet.
Copyright © 2024 by Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Regina Carstensen
Mitarbeit: Rainer Zimmer, Cristina Herbst
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagabbildung: »Sommertag in der Stadt« von Ludwig Grieb (bearbeitet)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32196-3V002
www.dva.de
Für Monika
Als Mensch war Thomas Mann versiegelt und ließ niemanden in sein Herz blicken. Mit virtuoser Disziplin hielt er eine Fassade aufrecht, ohne die zu leben er unerträglich gefunden hätte. Nur im Werk war er frei, nur hier teilte er sich mit, auch seine Geheimnisse, geschützt durch die indiskrete Diskretion der Kunst. Die Biografie seines Herzens steht verzaubert in seinen Dichtungen.
Hermann Kurzke, Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk
Eingeschlossen wären diese Tagebücher … die versiegelt, und erst 20 Jahre oder 25 nach meinem Tode, der »Forschung« zugänglich würden. Heitere Entdeckungen dann, in Gottes Namen. Es kenne mich die Welt, aber erst, wenn alles tot ist.
Thomas Mann, Tagebuch 13. X 1950
Inhalt
Vorweg
Puppentheater
Vatertod
Deklassiert
Blick in den Abgrund
Vernichtung geheimer Aufzeichnungen
Glückskind
Frau Senator in München
Bauernball
Das Mädchen in der ersten Reihe
In der Tram
Wonnen der Gewöhnlichkeit
Im Vorübergehen
Das Arrangement
Auftritt im Palais
Der große Ball, der Traum
Bella figura
Theaterblut
Der musikalische Zwilling
Der Spieler und der Sonnenschein
Eifersucht
An der Tür zur Bühne
Teegesellschaft im Palais
Klarheit und Jähzorn
Werbende Worte ans Krankenbett
Beim Propheten
Katia unerreichbar
Spiel um Geld und Glück
Große Aussprache
Zwei Brüder auf dem See
Der geheimnisvolle Herr Flechtheim
Die Jagd nach Liebe
Familienkonferenz
Verfluchter Vampir
Puppenspiel im Englischen Garten
Aussprache
Eine Erzählung, eine Huldigung
Der Antrag
Ein anderer Tag
Bedenkzeit
Entschließungsangst
Sommer in Heringsdorf
Miemchen und die Ehe
Eroberung aus der Ferne
Auf dünnem Eis
Der Nerv der Dinge
Lesereise
Lorbeer in Lübeck
Die unaufhaltsame Katastrophe
Hochzeit im Palais
Flitterwochen in der Schweiz
Gefälschte Wechsel
Material aus der Muschelkiste
Götterkinder
Hure im Hemdchen
Der Prinz und die Dollarprinzessin
Verloren in der Pampa
Eine Liebe verschwindet
Zyankali
Ein strenges Glück
Tod in Venedig
Epilog
Literatur
Vorweg
Meine ersten Schritte in den Lebensraum der Familie Mann konnte ich als junger Dokumentarfilmer 1983 für den NDR und WDR gehen: Treffpunkt im Unendlichen. Die Lebensreise des Klaus Mann brachte mich mit den noch lebenden Mitgliedern der Familie, mit Monika und Golo, und ihren Freunden zusammen. Über fünfzig Freunde und Bekannte aus dem Umfeld der Manns habe ich über die Jahre besucht und unsere Gespräche Bild und Ton aufgezeichnet.
Thomas Mann war Ende der Siebzigerjahre ganz in den Hintergrund geraten. Eigentlich tot und begraben im Regal. Autoren hatten damals ihre Leistung zum Klassenkampf darzustellen. Als ich 2001 mit meinem Redakteur Horst Königstein den großen Dreiteiler Die Manns – Ein Jahrhundertroman als Montage mit Spielszenen und Dokumentarmaterial drehen durfte, hatten wir unseren Beitrag geleistet, diese Lage zu verändern. Marcel Reich-Ranicki nannte den Film »Ein nationales Ereignis. Heinrich Breloers Fernsehfilm bedeutet Thomas Manns endgültige Heimkehr«, schrieb er in der FAZ. Eine Kritik allerdings konnte sich Reich-Ranicki nicht verkneifen: Er meinte, ich hätte Thomas und Heinrich Mann als »liebe Onkels« dargestellt. »Der Film hat zwei Raubtiere gezähmt.«
Das große Erlebnis für mich war, dass ich die vielen Menschen dieser Familie mit ihren sehr verzweigten Lebensreisen aus dem Nazi-Reich ins Exil und zurück nach Europa kennenlernen und befragen konnte. Auch Elisabeth Mann Borgese war nun dabei, die jüngste und liebste Tochter von Thomas Mann, die in Kanada zu Hause war. Sie erzählte uns von München, zeigte uns ihre Schule, berichtete, wie sie mit ihren Eltern ins Exil nach Amerika ging. Es war für mich ein Wunder, ihr so nah zu kommen, so offen über so viel Unerzähltes mit ihr sprechen zu können. Unterwegs zur Familie Mann, ein Film in drei Teilen, zeigte die Begegnungen mit Medi, wie sie in der Familie genannt wurde.
Es gab Tage, an denen ich Thomas und Katia Mann in Los Angeles in ihrem Bungalow gegenübersaß und ihnen bei ihren Erzählungen über das Drama ihrer hochbegabten Kinder zuhörte. In einem billigen Hotelzimmer sah ich im Dunkeln, wie Klaus und sein Geliebter Curtis nackt in leidenschaftlichen Umarmungen im Liebesrausch versunken waren. Aber ich sah ihn auch in seiner Pension in Cannes, wie er das Röhrchen mit den Schlaftabletten im Wasserglas auflöste, um sich von dieser Welt zu erlösen.
Als Thomas Mann den charmanten Jungen, Kläuschen Heuser, Monikas Sylter Sommerbekanntschaft, nach München in seine Wohnung eingeladen hatte, konnte ich es so arrangieren, dass der Gang des geliebten Gymnasiasten im Arbeitszimmer des Zauberers so verlief, dass er Thomas Mann fast vor sich hertrieb. Wir hatten all die Räume für diese Reise in die Vergangenheit in den Studios wiederaufgebaut. Aufgebaut und voll eingerichtet.
In Los Angeles war seine Villa, der für ihn erbaute Bungalow in Pacific Palisades, noch zu besichtigen. Seine kluge Sekretärin Hilde Kahn-Reach, mit ihrem wundervollen Gedächtnis, führte uns durch das Haus. Sie durfte die Texte seiner Romane als Erste lesen und in ihrer Küche auf einer deutschen Reiseschreibmaschine abtippen. Sie war ihm nah und vertraut. Was für ein Glück in der Fremde! Wir sprachen darüber in dieser Villa. Wie er aus seinem Vatikan wie ein Gott in seinem hellen Anzug die Treppe herunterkam ins Arbeitszimmer. Solche Beschwörungen, die Toten aus ihrem Reich zurückzurufen, wollte ich den Zuschauerinnen und Zuschauern anbieten, damit sie den Manns nahekommen konnten.
Mit dieser Haltung habe ich auch die Szenen in dem hier vorliegenden Text geschrieben. Distanz und gesteuerte Nähe, das war die Grundlage für die Kommunikation mit dem Meister. So erzählte es mir Hilde Kahn-Reach. Dieser Text zeigt die Familie aus der Nähe. Das macht sie nicht weniger sympathisch. Ganz im Gegenteil.
Alle meine Filmerzählungen zeigten diese Familie in ihrem Leben nach dem Ersten Weltkrieg. Die wichtigen Jahre davor, die Zeit, in der die Weichen gestellt wurden, die Jahre, in denen Thomas Mann sich entschieden hatte, um Katia Pringsheim zu werben, sein Abschied aus der Boheme, die Übernahme der neuen Rolle als ordentlicher Mann und Familienvater mit sechs Kindern, die Enthüllung seiner erotischen Fantasien ins Homoerotische und die gleichzeitige Verhüllung im Text, das war der unerzählte Teil in meiner Filmbiografie, eine dramatische Geschichte, die hier folgt. Mit einem Wort: Becoming Thomas Mann.
Es ist ein faktengestützter Text, weil sämtliche Dialoge auf Recherchen, Dokumenten und Gesprächen beruhen, zugleich sind sie gelegentlich frei erfunden. Ich habe mir damit die Freiheit des romanesken Erzählens genommen, habe Orte, Menschen und Begegnungen nicht immer haargenau nach Tag und Stunde eingehalten. Zwischen der naturalistischen Genauigkeit und dem verdichteten Erzählen gibt es Gewinne, auf die ich nicht verzichten wollte.
Puppentheater
Tommy zog die Fenstervorhänge zu, so dicht, dass kein Tageslicht von der Welt da draußen in seine verzauberte Welt hier eindringen und ihn stören konnte. Das Puppentheater hatte er schon auf dem Tisch aufgebaut. Eine kleine Petroleumlampe ließ die farbige Zeichnung auf dem Vorhang lebendig werden; sie stammte von seinem Bruder Heinrich, dem Vorbesitzer der Bühne. Tommy griff in eine große Hutschachtel, nahm ein paar Pappfiguren heraus und begrüßte sein Ensemble.
»Guten Abend, meine Herrschaften. Wohlauf allerseits? – Willkommen, Herr Müller-Grangé!«
Die Figuren hatte er selber hergestellt, kleine Holzstützen auf der Rückseite halfen ihnen, aufrecht stehen zu bleiben. Einer der Darsteller sang sich ein, die Koloraturen herauf und herunter – natürlich nur, soweit die Stimme des Regisseurs das hergab; der Stimmbruch stand Tommy noch bevor.
»Hören Sie nur, Fräulein Delmas, Herr Müller-Grangé übt seine Stimme. Gut so. Sehen Sie, er ist auch schon im Kostüm. Prinz Tamino, wie er leibt und lebt. Und wie höflich er ist!«
Damit machte der Prinz Tamino einen Diener vor dem Fräulein Delmas, der Pamina der heutigen Aufführung. In diesem Moment pfiff auch schon jemand das Flötenmotiv des Vogelfängers.
Tommy setzte sich auf einen Hocker hinter dem Theater, sodass er das Geschehen auf der Bühne bequem in Augenhöhe leiten und lenken konnte. Er beugte sich nach vorn und streckte den Kopf auf die Bühne, um den Vorhang ein klein wenig anzuheben und in den dunklen Zuschauerraum zu blicken. »Wir sind heute nicht übel besetzt«, teilte er seinen Darstellern mit. »Begeben Sie sich in Ihre Garderoben. Ich werde gleich das Klingelzeichen ertönen lassen.«
Mit einem Löffel in einem leeren Glas gab er das Klingelzeichen. Einen Moment angespannte Stille. Er hob den Taktstock, und damit wurde er ganz zum Dirigenten. Er hatte das schon häufig im Stadttheater gesehen, so auch im Lübecker Tivoli. Er schlug den Takt und summte den Anfang der Ouvertüre: »Taaa … ta-taaa … ta-taaa …«
Dabei zog der den Vorhang an zwei Schnüren in die Höhe. Ein prächtiger Prospekt zeigte, geheimnisvoll beleuchtet, eine Waldlichtung mit wilden Felsen im Hintergrund. Mit seinem Taktstock schob der Dirigent den Prinzen Tamino auf die Bühne. »Zu Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich verloren!« Dabei zurrte er eine schreckliche grüne Schlange hinter der Figur des Pamino her, und die Oper nahm ihren Fortgang.
Als die drei Damen, die Dienerinnen der Königin der Nacht, die den holden Jüngling gerettet hatten, folgte – heißa, hopsasa! – der Auftritt Papagenos in seinem lustigen Kostüm. Tommy pfiff die Melodie »Der Vogelfänger bin ich ja / Stets lustig …«. Weiter kam er jedoch nicht. Ein Windzug wehte den Prinzen Tamino um. Hinter Tommys Rücken hatte jemand die Tür geöffnet, ein stattlicher Herr trat ein, mit einem sehr ernsten Gesicht und einem Papier in der Hand, das genau wie ein Schulzeugnis aussah. Auch seine Stimme klang düster und drohend.
»Mein Sohn, du machst mir wenig Freude!« Kein Zweifel, die Person, die dort in der Tür stand und in den dunklen Theatersaal blickte, das war der Vater. Ebenso zweifelsfrei hatte er gerade das Zeugnis gründlich gelesen, das der junge Theaterdirektor mittags seiner Mutter anvertraut hatte.
»Dein Zeugnis, deine Leistungen haben sich nicht verbessert. Mangelhaft! Mangelhaft! Ungenügend!« Mit jeder Zensur schlug Thomas Johann Heinrich Mann mit der rechten Hand auf das scheußliche Papier. »Eine Schande ist das. Eine Schande für den Sohn des Senators Mann! Der Schüler Thomas Mann kann nicht in die höhere Klasse versetzt werden. Er hat mangelhafte Kenntnisse in der Mathematik. Der Sohn des Finanzsenators kann nicht einmal rechnen!« Er legte dem Sohn das Zeugnis wenig achtsam auf die kleine Bühne; den Vogelfänger hatte Tommy in seiner Hand geborgen.
Der Vater drehte das Licht der funzeligen Bühnenlampe aus. Dann öffnete er die Vorhänge, sodass krasses hartes Tageslicht ins Zimmer brach. Und dabei folgte fast sachlich das Urteil: »Jetzt ist Schluss mit dem Firlefanz, ein für alle Mal. Du bist vierzehn Jahre alt. Was soll aus dir einmal werden? Willst du mir das mal sagen? Vielleicht ein Zigeuner im grünen Wagen? So wirst du es im Leben niemals zu etwas bringen. Ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sollst du werden, kein … Bajazzo!« Damit knallte er die Tür zu.
Tommy war während der Standpauke des Vaters aufgestanden. Mit gesenktem Kopf hatte er das Gewitter über sich hereinbrechen und vorüberziehen lassen. Aufseufzend versuchte er, sich wieder zu sammeln. Dabei hörte er die Stimme seiner Mutter vor der Tür; anscheinend hatte sie den Wutausbruch ihres Mannes von dort aus mit angehört.
»Henry, bitte, sei nicht so streng mit dem Jungen. Tommy hat nun einmal viel Fantasie und dazu eine besondere musikalische Begabung.«
Tommy lächelte gerührt in sich hinein. Die gute Mama …
»Begabung? Musikalisch? Gut und schön – für den Feierabend. Theater, Pappfiguren, die singen. Narrenpossen. Wie seine Gedichte, die er Julia und Carla vorliest und mit denen er renommiert. Schluss damit. Unterstütze ihn nicht auch noch in seinen ergebnislosen Träumereien.« Beim Weggehen der Eltern hörte Tommy noch eine ernstere Drohung. »Das muss sich ändern. Er muss sich ändern! Höchste Zeit, dass mein Herr Sohn den Ernst des Lebens kennenlernt.«
Thomas ging ans Fenster und öffnete einen Flügel. Da unten, durch das Grün des alten Walnussbaums, sah er den silbrigen Strahl des Springbrunnens. Wie schön das gleichmäßige Plätschern des Wassers auf dem Brunnenstein zu ihm herauf klang. Dort unten war immer ein guter Platz zum Ausruhen, zum Träumen.
Noch viel schöner aber waren die Tage am Meer, in Travemünde an der Ostsee. Bald würde es wieder Sommer sein, und die großen Ferien würden ihm eine unendlich lange Kette von wunderbaren Tagen am weißen Strand direkt am Meer schenken, nur hingegeben dem rauschenden Gleichklang der Wellen. Und außerdem würde er hier nicht von den nörgelnden, schimpfenden Stimmen der Lehrer belästigt, die ihm im Katharineum das Leben versauerten. Er würde frei sein, für viele Tage und zunächst endlos scheinende Wochen, die er nur für sich allein hatte. Da konnte man im sommerlichen Duft des Buchsbaums auf den Stufen des Musiktempels sitzen und dem Kurorchester lauschen. Dabei hatte man das Vergnügen, den kleinen Kapellmeister Heß mit seinen langen Haaren zu beobachten, wie er mit seinem Zauberstab in wilden Bewegungen die Musiker dirigierte, die dann auf seine Blicke hin getreu seinen Kommandos die Musik direkt in ihn hinein spielten.
Das alles war lebendig in seinem Herzen, und er konnte zu diesen Stunden hinabtauchen wie zu einem Schatz, der tief in ihm aufgehoben war. Dieses Sommerparadies am Meer war für ihn ein Refugium, ein Zufluchtsort für seine empfindliche Seele, wie auch der Platz am Brunnen unter dem alten Walnussbaum, wie auch sein Zimmer, wenn er allein war mit seinem Puppentheater.
Doch jetzt gab es Wichtigeres zu tun. Tommy schloss das Fenster und zog die Vorhänge wieder zu. Er zündete die kleine Lampe an der Bühne wieder an, dann begab er sich zur Tür und drehte den Schlüssel herum. Er setzte sich auf seinen Hocker hinter der Bühne und stellte seine Darsteller von Neuem auf – bis auf die schreckliche Schlange, die war und blieb ja tot.
»Meine Herrschaften, ich bitte um Entschuldigung für die Störung. Unser Prinzipal hat ein Machtwort gesprochen, Sie haben es ja gehört. Bitte sehr, wir spielen weiter.« Er ging mit dem Gesicht ganz dicht an die Püppchen heran und sprach mit übertriebener Theaterstimme die Begrüßung zwischen Tamino und Papageno weiter, als wäre nichts geschehen.
»Sag mir, du lustiger Freund, wer du seist?«, fragte der edle Prinz. Und in einer anderen Tonlage antwortete der leichtfertige Papageno: »Wer ich bin? Ein Mensch wie du.«
»Mein Vater ist ein Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht«, erwiderte Tamino stolz, »darum nennt man mich Prinz.«
Tommy nahm das Zeugnis von der Bühne, es lag im Weg. Einen Moment lang war er versucht, es in die Flamme der Theaterlampe zu halten, doch an solch einen Akt der Auflehnung war natürlich nicht zu denken. Er konnte es dem Vater ja nicht einmal sagen, dass er nicht rechnen lernen wollte, keine Geografie, kein Latein – dass der ganze langweilige Schulkram ihn längst nicht mehr interessierte. Er hatte etwas anderes vor mit seinem Leben, etwas, das nicht mit dem Verkauf von Gerste, Roggen und Weizen zu tun hatte, so viel stand fest. Was genau ihm stattdessen vorschwebte – er wusste es nicht.
Er blickte auf sein Puppentheater, er hörte den Gesang. »Dies Bildnis ist bezaubernd schön …« Der Applaus des Publikums rauschte auf. Tommy spürte instinktiv, dass es dieses andere Leben da draußen gab. Eine andere Welt, erfüllt von Fantasie, Magie und Zauber. Und tief im Innern fühlte er die Sicherheit, dass er irgendwann einmal den Eingang in diese Welt finden würde.
Vatertod
In den frühen Morgenstunden des 1. Juni im Jahr 1891 fuhren in Lübeck zwei Kutschen vor das Haus in der Beckergrube 52. Frau Senator Mann erwartete sie schon. Sie stand oben am Fenster und sah mit sorgenvollem Gesicht auf die beiden Herren, die zuerst ausgestiegen waren und mit ihren großen Arzttaschen auf das Haus zugingen. Es waren Dr. med. Möhlenbach und sein Assistent Dr. Weber. Möhlenbach hatte sich einen guten Ruf als Chirurg erworben. Allerdings gab es zurzeit leider noch kein Krankenhaus mit einem Operationsraum in der Hansestadt. Man musste sehen, wie sich ein Eingriff im Wohnhaus der Familie Mann organisieren ließ, zu der der Chirurg und seine Helfer in die Beckergrube kamen. Ein zusätzlicher Assistent und zwei Krankenpflegerinnen entstiegen der zweiten Kutsche. Gemeinsam mit einem Diener trugen sie noch mehr Taschen und einiges Gerät ins Haus – alles, was für solch eine Operation notwendig war.
»Eine Tasse Tee werden Sie doch noch vor der Operation mit mir trinken?« Mit diesen Worten schenkte Julia Mann den Ärzten vom frisch aufgebrühten Tee ein, den sie über den braun funkelnden Brocken Kandiszucker goss, sodass man das leise Knacken hören konnte, mit dem der Zucker auf den Tee reagierte.
Dr. Möhlenbach sah, wie die Hand der Frau Senator leicht zitterte und sie Schwierigkeiten beim Einschenken hatte.
»Wie geht es denn unserem Patienten, dem Herrn Senator, heute früh?«
»Er ist ganz gefasst und voller Vertrauen in seine Ärzte. Er wurde ja vor der Operation auf Diät gesetzt, und mit Ihrem Schlafmittel hat er eine gute Nacht verbracht. Er wartet im Schlafzimmer auf Ihren Besuch.«
»So soll es sein. Ich werde zu ihm gehen und ihn noch etwas vorbereiten.«
Dr. Weber begab sich hinüber in den Ballsaal, den man leer geräumt hatte, denn hier sollte der Eingriff stattfinden.
»Wir haben versucht, alles so herzurichten, wie Sie es angeordnet haben«, beteuerte Julia ängstlich. Der Arzt registrierte, wie die Furcht und Sorge vor dem Ungewissen einer Operation die Frau Senator schneller atmen ließ. Er lächelte beruhigend.
»Wissen Sie, wir sind nicht mehr die Steinschneider, wie sie drüben auf Ihrem schönen Marktplatz noch vor Zeiten aufgetreten sind, um ihre Künste ohne Betäubung an ihren Patienten vorzuführen. Wir haben modernste Instrumente, wir haben das Wissen, wir haben die Erfahrung. Und vor allem haben wir das Chloroform, mit dem wir die Patienten in einen tiefen Schlaf versetzen. Blasensteine, die sehr wahrscheinlich die starken Schmerzen verursachen, die Ihrem Herrn Gemahl in den vergangenen Wochen so sehr zusetzten, die habe ich schon öfter aus der Blase gefischt. Es ist zwar nicht gerade eine Routineoperation, aber auch keine ganz große Sache. Der Herr Senator hat mit seinen einundfünfzig Jahren noch eine sehr gute Konstitution. Es ist nur ein kleiner Schnitt notwendig. Wir vernähen nach dem Eingriff die Wunde, und um die Mittagszeit ist schon wieder alles vorbei. Wer weiß – in einem Vierteljahr haben Sie bestimmt alles vergessen.«
»Sagen Sie das bitte auch gleich noch einmal meinem Mann. Es ist so tröstlich, wenn gerade Sie das zur Sprache bringen. Wissen Sie, unser ältester Sohn, der Heinrich, ist zurzeit noch in Berlin. Er hospitiert dort in einem Verlag, bei einem Herrn Fischer. Bislang habe ich ihn nicht herbestellt.«
»Um Gottes willen, Frau Senator, wo denken Sie hin! Für so einen Eingriff muss doch Ihr Ältester nicht aus dem fernen Berlin anreisen!« Dr. Möhlenbach nahm einen letzten Schluck vom süßen Tee und machte sich anschließend, geleitet von Julia, auf zu seinem Patienten, dem Finanzsenator.
Im Ballsaal des vornehmen Bürgerhauses war der Billardtisch ins Licht der großen, bis zum Boden reichenden Fenster gerückt und mit frisch gebügeltem weißem Leinen ausgelegt worden. Auf kleineren Tischen stapelten sich ebenfalls frische Leinentücher, und die Assistenten ordneten die Instrumente für die Operation griffbereit an. In der Küche stand bereits ein Kessel mit heißem Wasser auf dem Herd.
Als Julia sich schließlich unmittelbar vor der Operation von ihrem Ehegatten verabschiedete, erinnerte er sie nochmals daran, dass sich sein Testament oben in seinem Sekretär in einer Mappe befände, Wandschneider würde dann das Nötige veranlassen, sie kenne ja die Zuverlässigkeit seines langjährigen Mitarbeiters.
»Sehen Sie, Dr. Möhlenbach, so ist er, der Kaufmann und Finanzsenator. Alle Möglichkeiten sind immer eingerechnet!«, sagte Julia. Und an ihren Mann gewandt, fügte sie hinzu: »Henry, wir sind alle bei dir. Wenn du aus deiner Narkose aufwachst, stehen wir alle an deinem Bett, die beiden Mädchen und unser Tommy. Und freuen uns, dass alles gut überstanden ist.«
Die Operation hatte bereits begonnen, da kam Julia Mann mit ihrer ältesten Tochter, die Julia hieß wie sie und nur Lula genannt wurde, ein weiteres Mal an der Tür zum Ballsaal vorbei. Carla, die Jüngere, erst neun Jahre alt, stand neugierig und unerschrocken am Türspalt und sah zu, was da passierte. Der Chirurg und die beiden Assistenten hatten ihre weißen Kittel übergestreift. Sofort zog die Mutter ihre Tochter weg von der Tür. Als sie selber in den Ballsaal blickte, entdeckte sie im Licht des frühsommerlichen Vormittags den Senator auf dem Billardtisch. Ganz mit einem weißen Laken war er abgedeckt. Über Nase und Mund befand sich eine Art Drahtsieb mit Mulleinlage, die Maske für das Chloroform.
Als Dr. Weber die ersten Tropfen des Narkosemittels auf die Maske fallen ließ, zog Julia die Tür zu. Draußen hörte sie noch, wie der Chirurg ihren Mann bat, mit dem Zählen zu beginnen. Ganz schwach vernahm sie: »Eins … zwei … drei.« Bald wurde das Zählen immer leiser, und als es komplett aussetzte, zeigte es schließlich den Ärzten an, dass der Patient das Bewusstsein verloren hatte.
Jemand, der das alles nur von ferne beobachtet hatte, war Thomas. Es waren gerade noch fünf Tage bis zu seinem sechzehnten Geburtstag. Nun schloss Tommy sich eng an seine Mutter an und ging mit ihr in den Salon mit dem kleinen Flügel. Sie wollten hier gemeinsam warten, bis die Mediziner ihnen das Ergebnis verkündeten. Lula und Carla hatte die Mutter auf ihr Zimmer geschickt.
Am Klavier schlug Julia zart einige Töne an, die Tommy sofort erkannte. Es war ein Lied, das sie ihrem Zweitältesten schon oft vorgespielt hatte. Ganz ruhig sprach er die ersten Zeilen mit: »Am Brunnen vor dem Thore, / da steht ein Lindenbaum: / Ich träumt’ in seinem Schatten / So manchen süßen Traum. / Ich schnitt in seine Rinde / So manches liebe Wort …«
Während die Mutter weiterspielte, entfernten sich Tommys Gedanken vom Wanderer, der sich da gerade an eine glückliche Vergangenheit erinnert, als er seine Heimat auf immer verlässt. Es waren eigentlich keine Gedanken mehr, was ihn jetzt erfüllte, war vielmehr ein allumfassendes Gefühl wehmütiger Traurigkeit. Doch ehe sich diese Stimmung verfestigen konnte, setzte abermals die Angst um den Vater ein, und nun sah er diese Angst auch im Gesicht der Mutter. Sie war am Schluss der Schubert-Melodie angelangt und sang die letzte Strophe ausdrucksvoll und leise mit ihrer schönen Stimme: »Und seine Zweige rauschten, / Als riefen sie mir zu: / Komm her zu mir, Geselle, / Hier findst Du Deine Ruh’!«
Dann war es ganz still. Als sie Tommy anschaute, lächelte er ein wenig. Dennoch schimmerten bei ihr Tränen in den Augen, so wie wohl auch bei ihm.
Dr. Möhlenbach hatte den erforderlichen Schnitt nahe der Harnröhre getan, um dort jenes sinnreiche chirurgische Werkzeug einzuführen, mit dem der schmerzhafte Blasenstein entfernt werden sollte. Er öffnete den Schnitt etwas, ging noch näher mit seinen Augen heran – und sah, was er sah.
»Herr Collega …«
Dr. Weber konnte die Diagnose seines Chefs nur bestätigen. Hier ging es nicht mehr darum, einen Blasenstein zu entfernen. Der Krebs hatte sich ganz offensichtlich durch die Blasenwand gefressen und in den Unterbauch vorgearbeitet, Prostata, Harnleiter, Samenstrang und was sich sonst noch in der Gegend befand waren entweder schon befallen oder höchst gefährdet. Da war nichts mehr zu machen; um das zu erkennen, musste man nicht einmal den Schnitt erweitern. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Patient das Zeitliche segnen würde.
»Vernähen Sie den Schnitt, Weber. Ich gehe rüber zur Frau Senator.«
Als es an der Tür klopfte, erschraken Mutter und Sohn zunächst, obwohl sie die Ankunft von Möhlenbach ja erwartet hatten. Der Chirurg trat ein und setzte sich unaufgefordert an den Tisch. Mit einem Blick lenkte Julia ihren Sohn aus dem Zimmer.
Dr. Möhlenbach machte es kurz: »Keine guten Nachrichten, Frau Senator.«
Julia schlug die Hände vors Gesicht. »Um Gottes willen, reden Sie, Herr Doktor!«
Der Chirurg berichtete, was sie gesehen hatten. Es war der Krebs, überall schon und nicht mehr aufzuhalten.
»Gibt es denn wirklich keine Hoffnung?«
Dr. Möhlenbach schüttelte den Kopf. »Leider inoperabel, Frau Senator.«
Und dann die letzte bange Frage: »Wie lange? Wie viel Zeit geben Sie meinem lieben Mann noch?«
Der Arzt hob ratlos die Schultern. »Einige Monate, vielleicht ein Jahr.«
Julia griff zum Taschentuch und hielt es sich vors Gesicht. »Warum?«, schluchzte sie. »Er ist doch noch so jung. Und die fünf Kinder! Unser Jüngster ist gerade erst ein Jahr auf der Welt!«
Der Chirurg legte beruhigend seine Hand auf ihren Arm. »Es ist beschlossen da oben. Der Krebs – dagegen ist bislang kein Kraut gewachsen. Und schon gar nicht, wenn er so weit fortgeschritten ist. Da endet auch unsere Kunst. Er soll sich schonen, die Tage mit seiner Familie verbringen und sich Zeit für den Abschied nehmen. Wir packen drüben ein. Ich schaue noch einmal nach Ihrem Herrn Gemahl, wenn er aus der Narkose erwacht ist.«
Im Haus ging man fortan auf leisen Sohlen. Der Senator wanderte als Gezeichneter im Garten umher, von Tag zu Tag schwächer werdend. Der kluge und verantwortungsvolle Thomas Johann Heinrich Mann hatte selbstverständlich schon frühzeitig sein Testament gemacht und hinterlegt. Zwei Tage vor der Operation hatte er diese letztwillige Verfügung ein weiteres Mal bestätigt und einige Bemerkungen eher familiärer Art hinzugefügt. Als er sich nach vier Wochen von den Folgen des Eingriffs einigermaßen erholt zu haben schien, änderte er sein Testament erneut. Dabei ordnete er, der in seinen Entscheidungen in erster Linie vom Kopf, von der Vernunft geleitet wurde, auch die Abläufe seines Abschieds von der Welt im Einzelnen. »Der Sarg für mich soll wie der meiner lieben Mutter sein. In den Sarg will ich gelegt werden, das Haupt ein wenig nach rechts geneigt, wie schlafend. Ein kleines Kreuz aus Holz oder Elfenbein in der rechten Hand, die linke Hand leise darangelegt. Keine Blumen in den Händen und kein Falten der Hände. Bekleidet will ich sein mit einem weißen Sterbehemde aus Seide, oder wie der Gebrauch ist.«
Heinrich Mann sen. hatte sich damit abgefunden, dass seine Tage gezählt waren. Gern wäre er noch viele Jahre bei seiner Familie und in der Firma geblieben, nun aber sah er, dass es endgültig Abschied zu nehmen galt. Das fiel ihm nach und nach etwas leichter, weil die Schmerzen immer weiter zunahmen und mitunter, wenn die Wirkung des Opiums nachließ, unerträglich wurden.
Jetzt saß er, eine Decke über die Knie ausgebreitet, in einem Lehnstuhl im Herrenzimmer und sann vor sich hin. Ein kurzer Anfall, eine Erschütterung durchlief ihn bei der Vorstellung, wie die Familie um ihn herumstehen und ihn im Totenhemd betrachten würde. Tränen standen in seinen Augen.
In diesem Moment steckte Tommy seinen Kopf durch den Türspalt. »Störe ich?«
»Nein, komm einmal her. Gib mir deine Hände.« Der Senator betrachtete sie. »Die feinen Hände deiner Mutter. Von ihr hast du dein träumerisches Gemüt, ich habe dich manchmal dafür gescholten. Folge nicht etwa Heinrichs Irrweg in eine literarische Tätigkeit. Wähle einen praktischen Beruf. Von deinem Vater hast du sicher auch etwas geerbt, das du in dir trägst. Schau mit deinem Verstand auf die Welt, nicht nur mit deiner Fantasie. Weißt du, ich fühle es ganz deutlich: Meine Kraft geht davon. Wenn ich dir doch etwas davon hätte mitgeben können …«
Er blickte seinen Sohn an, und Thomas bemerkte, dass in die Augen des Vaters etwas Trübes, Verletzliches gekommen war, wie auch seine Stimme einen weichen Klang angenommen hatte. So hatte er seinen Vater noch nie erlebt, so hatte der sich niemals vorher zeigen können.
Dann ergriff der Vater ein weiteres Mal seine Hände und hielt sie einen Augenblick fest. »Und an eines denke immer. Man soll unseren Namen, den Namen Mann, in Lübeck stets mit Achtung aussprechen.«
»Ja, Papa.«
»Schau mich an.«
Thomas tat wie ihm geheißen. Er wollte sich ja bemühen, dachte er, wenn er auch gegenwärtig nicht wusste, wie er diesen Auftrag erfüllen konnte.
Der Senator steckte sich eine Zigarette an. »Jetzt stell dich vor die Tür und lass niemanden herein. Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun.«
Aus Thomas könnte vielleicht doch etwas Anständiges werden, dachte der Senator, als er wieder allein war. Wenn natürlich auch nie und nimmer sein Nachfolger, ja, nicht einmal ein tüchtiger Geschäftsmann. Aber Heinrich … Er erhob sich aus dem Lehnstuhl und ging schmerzgekrümmt hinüber zu seinem Sekretär. In dessen verschließbarem Geheimfach befanden sich in einer schlichten Mappe das Testament und der Zusatz mit den Familienangelegenheiten. Nachdem er alles an sich genommen hatte, ließ er sich wieder in seinem Stuhl nieder. Er schlug die Mappe auf und las den Zusatz. »Den Vormündern mache ich die Einwirkung auf eine praktische Erziehung meiner Kinder zur Pflicht. Soweit sie es können, ist den Neigungen meines ältesten Sohnes Heinrich zu einer s.g. literarischen Tätigkeit …«
»So genannt«, wiederholte der Senator höhnisch. Literatur, das war doch nichts Ernsthaftes! »… s.g. literarischen Tätigkeit entgegenzutreten. Zu gründlicher, erfolgreicher Tätigkeit in dieser Richtung fehlen ihm m. E. die Vorbedingnisse, genügendes Studium und umfassende Kenntnisse. Der Hintergrund seiner Neigungen ist träumerisches Sich-gehen-Lassen und Rücksichtslosigkeit gegen andere, vielleicht aus Mangel am Nachdenken.«
War das nicht vielleicht etwas zu starker Tobak? Das hörte sich ja fast wie ein Vaterfluch an! Aber es stimmte, und es musste in dieser Deutlichkeit gesagt werden, sonst würde man es schnell vergessen. Es war doch nur zum Besten Heinrichs, der so aus der Art geschlagen war. Man musste wenigstens zu verhindern versuchen, dass er sich sein Leben ruinierte und elend zugrunde ging. Wenn es nicht sowieso schon zu spät war. Mit Thomas gab es solche Schwierigkeiten, Gott sei Dank, nicht, der hatte nie derart gegen ihn, gegen die Ordnung der Väter, rebelliert. Einen gewissen Hang zu Träumereien hatte er zwar auch, aber das war sicher nur der schlechte Einfluss des großen Bruders und würde sich gewiss von allein legen, wenn der Ernst des Lebens erst einmal an ihn herantrat.
»Mein zweiter Sohn ist ruhigen Vorstellungen zugänglich, er hat ein gutes Gemüt und wird sich in einen praktischen Beruf hineinfinden. Von ihm darf ich erwarten, dass er seiner Mutter eine Stütze sein wird«, hatte er geschrieben. Das walte Gott.
Und die anderen? »Julia, meine älteste Tochter, wird strenge zu beobachten sein. Ihr lebhaftes Naturell ist unter Druck zu halten.« Ja, Lula lässt sich viel zu sehr von ihren Gefühlen leiten, überlegte er. Von wem sie das wohl hatte?! Sie konnte sogar manchmal trotzen. Bei einer erwachsenen Frau konnten daraus zerstörerische Leidenschaften werden. So etwas konnte man nur mit äußerstem Druck klein halten! Und dafür war ihre Mutter genau die Falsche.
»Carla ist m. E. weniger schwierig zu nehmen und wird neben Thomas ein ruhiges Element bilden.« Auch hier: Das walte Gott! Und schließlich der Kleine. »Unser kleiner Vikko – Gott nehme ihn in seinen Schutz. Oft gedeihen Kinder späterer Geburt geistig besonders gut – das Kind hat so gute Augen.« Wirklich ein lieber kleiner Kerl, dachte der Vater.
Doch es ging noch weiter im Text. »Allen Kindern gegenüber möge meine Frau fest sich zeigen und alle immer in Abhängigkeit halten. Wenn je sie wankend würde, so lese sie König Lear.« Da hatte er es ihr noch mal gegeben. Da sie doch immer so gern las … Und seinen Shakespeare, den kannte er schließlich auch. Mit dem Abhängig-Halten dürfte es ihr ja nun, mit dem Neuen Testament, nicht allzu schwerfallen.
Nein, besser konnte er das nicht machen. Mit Gottes Hilfe. Er legte das Blatt zurück in die Testament-Mappe und brachte sie unter äußerster Kraftanstrengung zurück in das Geheimfach. Das konnte nun alles zum Amtsgericht, möglichst bald.
So hatte Senator Mann nach vernünftigen Regeln über sein Vermögen verfügt und nach bestem Wissen und Gewissen für die Zukunft seiner Familie gesorgt. Diese noch viele Jahre nach seinem Tod unumstößlich gültigen Bestimmungen kontrollierten wie mit unsichtbarer Hand die Bewegungen seiner Frau und seiner Kinder.
Zurück in seinem Lehnstuhl, griff Heinrich Mann sen. nach dem Fläschchen mit den Opiumtropfen. Noch konnte er sich das Schmerzmittel selbst verabreichen, wenn es unbedingt notwendig war. Aber nicht mehr lange.
Das Dampfross rollte zischend unter das einfache, schmutzige Glasdach des Lübecker Bahnhofs. Fetzen von dunklem Rauch ballten sich in Klumpen unter den Stahlträgern und waberten dann, vom Wind zerrissen, in Fetzen hin und her. Die Räder quietschten schrill auf den Schienen, bis endlich der Zug mit seinen Wagen erster, zweiter und dritter Klasse zum Stehen kam. Ein junges Mädchen im weißen Kleidchen lief aufgeregt die Holzklasse entlang. Dabei hielt es ihr flaches Strohhütchen fest, unter dem sein blondes Haar hervorquoll und im Wind wehte. Dann stürzte es auf einen jungen Mann zu, der gerade dem Waggon entstiegen war, und fiel ihm direkt in die Arme.
»Heinrich, wie gut, dass du nach Hause gekommen bist!« Auf Carla, deren zehnten Geburtstag man im vorigen Monat der Umstände halber nicht gefeiert hatte, machte der doppelt so alte Bruder mit seinem kurz geschnittenen Haar, rank und schlank in einem tadellosen Anzug, mit einer Zeitung unter dem Arm, einen recht weltmännischen Eindruck. Eine Reise von Berlin über Hamburg nach Lübeck war für die kleine Schwester, die kaum aus ihrer Heimatstadt herausgekommen war, ein unvorstellbares Abenteuer.
Nach meiner Ansicht ist es geraten, dass du recht bald kommst, um, falls es nötig ist, ihm noch die Hand zu reichen, und ihm mit uns allen nahe zu sein. Das hatte die Mutter Heinrich geschrieben, und ihm war sofort klar gewesen, dass es mit seinem Vater zu Ende ging. So hatte er gleich bei Samuel Fischer, in dessen Verlag er volontierte, um Urlaub nachgesucht und war mit der nächsten Gelegenheit in Richtung Lübeck abgefahren.
»Moin, Herr Heinrich! Hebt Se een goode Fahrt hat?« Der Hausdiener Johann, den Julia Mann zur Begleitung ihrer Tochter mit an den Zug geschickt hatte, nahm Heinrichs Koffer entgegen und packte ihn auf den kleinen Rollwagen. So traten sie auf den Bahnhofsvorplatz, wo die Droschken auf Kundschaft warteten.
»Wir gehen zu Fuß«, sagte Heinrich.
»Ja, das gefällt mir. Dann sehen die Nachbarn, wie ich meinen großen Bruder aus Berlin am Bahnhof abgeholt habe.«
Vom Vorplatz schritt man direkt auf das Holstentor zu. Davor musste die äußere Holstenbrücke über den Stadtgraben überquert werden, die im Volksmund wegen ihres Figurenschmucks von alters her »die Puppenbrücke« hieß. Wie eine von Wassern umgebene Schildkröte lag nun das Panorama von Lübeck vor ihnen, mit den eng geduckten, spitzgiebeligen Häusern, den auf- und absteigenden Straßen und Gassen, überragt von den sieben spitzen Kirchtürmen, die über den gekrümmten Buckel hinausragten. Auf Heinrich, der noch das Bild von Berlin vor Augen und vor der Seele hatte, der riesigen Reichshauptstadt, die er erst vor ein paar Stunden verlassen hatte, wirkte die Heimat seltsam klein und eng. Er hatte schon gewusst, warum er hier rauswollte.
Aber augenblicklich wurden sie mitgezogen von den anderen Passanten: Kindermädchen mit und ohne Wagen, Lastträger, Damen unterwegs zu Besorgungen, auch ein Radfahrer, einige Uniformen, Bauern mit ihren Handkarren – all das und noch mehr zog durch den Bogen des mächtigen Holstentors über eine zweite Brücke, die über die Trave direkt in die Innenstadt führte.
Diesem Weg folgten sie aber nicht, sondern bogen gleich nach links ab auf die Straße An der Untertrave. Hier ging man direkt den Fluss entlang mit seinem Gewirr von Masten und Segeln, die im Wind hin und her schaukelten. Vom Holstenhafen her sahen sie die dunkle Wolke eines Dampfboots, und sie hörten sein fernes Tuten. Heinrich zog die Luft tief durch die Nase ein. Dieses Gemisch aus Fisch, Petroleum, Teer und faulem Wasser. Er nickte Carla und Johann zu: »Dat is ja man mine Heimat. Büschen lütt, aber ganz putzig.«
»Den Düwel ook. Uns Plattdütsch hebbt se den junge Herrn in’n fine Berlin noch nich afwöhnt.«
»Dor bin ick ok mit groot worn, Jehann. Dor will ik al bi blieven.«
Und schon waren sie an der Beckergrube angelangt, einer breiten Straße mit Trottoir und Gaslaternen.
»Und wenn ich mal nach Berlin komme, um dich zu besuchen, wie ist das dann für mich?«, fragte nun Carla.
»Du kriegst anfangs den Mund nicht zu. Allein schon, wie lange es dauert, wenn der Zug mitten durch dieses Häusermeer bis zum Lehrter Bahnhof rattert, wenn du aus Richtung Hamburg kommst. Sonst landest du an einem anderen Bahnhof, es gibt für jede Himmelsrichtung einen. Manchmal fährst du auf Stelzen, sodass du fast den Menschen im zweiten Stock in die Küche gucken kannst.«
Zwischen den Straßen Ellerbrock und Fünfhausen sah Heinrich dann die Nummer 52, sein Elternhaus in der Beckergrube. Das Theater lag einige Häuser weiter und die Börse gegenüber. Der Senator hatte damals zwei Häuser, die dort zuvor gestanden hatten, niederreißen und auf dem Doppelgrundstück das große schöne Heim für sich und die Familie errichten lassen.
Nun stand Heinrich mit seiner Schwester vor dem Elternhaus, in dem oben hinter einem der Fenster sein Vater im Sterben lag. Er sah, dass über die Straße Stroh aufgeschüttet war wie ein Teppich. Carla erklärte es dem Bruder, als der erstaunt die Augenbrauen hob. »Man soll im Haus nichts vom Getrappel der Pferde hören, nicht das Rollen der Wagenräder. Er soll beim Sterben nicht gestört werden.«
Vor dem Haus blickte Heinrich sorgenvoll hoch zum Fenster des Zimmers, in dem er den Vater vermutete. »Wir hatten in der letzten Zeit viel Ärger miteinander. Ich wollte unbedingt von der Dresdner Buchhandlung weg. Das waren dort alles Banausen, und ich kam überhaupt nicht mit ihnen zurecht. Das passte Vater natürlich gar nicht, und er reiste extra zu mir, um mir die Leviten zu lesen. Da hatte ich mich aber Gott sei Dank schon beim Fischer Verlag in Berlin beworben, der mich auch haben wollte. Aber das weißt du sicher schon alles. Und in Berlin ist es überhaupt großartig. Du kannst dir das gar nicht vorstellen.«
»Es war so langweilig ohne dich«, sagte Carla. »Bitte, erzähl von Berlin!«
»Kein Vergleich zu Lübeck. Das ist hier in der Nacht doch ein totes Kaff, ein finsteres Loch.«
»Aber in Berlin?« Carla war so neugierig.
»In Berlin, mein liebes Schwesterlein, da kannst du nachts auf der Straße die Zeitung lesen! Und die Leute sind unterwegs. Unzählige Theater und nicht nur eines wie hier. Und erleuchtete Restaurants und Cafés, Kneipen an jeder Ecke sowieso …«
»Erzähl weiter!«
Aber dazu war jetzt keine Zeit mehr. Sie mussten hinauf, die Mutter und die Geschwister begrüßen. In der Diele stand wie stets der ausgestopfte Bär mit den ausgestreckten Pfoten und dem Tablett für die Visitenkarten. Heinrich fuhr ihm zur Begrüßung mit der Hand über den Kopf.
»Was den Bären angeht, da habe ich noch eine Überraschung für dich«, sagte Carla. Und nachdem Heinrich die anderen begrüßt hatte bis auf den Vater, dem es gerade wieder sehr schlecht ging, zeigte Carla ihm auf seinem Zimmer ein Foto, wie sie träumerisch den Sibirischen Braunbären umarmt. »Für dich. Eine Erinnerung an deine Schwester, wenn du wieder in Berlin bist.«
Heinrich betrachtete das Bild von ihr mit dem Tier. »Unser hübscher Meister Petz. Aber sag mal, was ist da passiert? Hast du dich etwa in einen Bären verliebt?«
Carla hatte ihre Antwort sofort parat. »Falls du es wirklich nicht weißt: Das Biest ist ein verzauberter Prinz!«
Dann kniete Heinrich schließlich am Bett des Vaters, um ihm zum Abschied die Hand zu küssen. Der Todkranke war nicht mehr imstande, zusammenhängend und vor allem deutlich zu sprechen. Heinrich meinte, unter mancherlei Unverständlichem ein schwaches »Ich will dir doch nur helfen …« vernommen zu haben. Er ergänzte das für sich, gegen alle Wahrscheinlichkeit, mit »… ein Schriftsteller zu werden«. So war er versöhnt.
Als es sehr bald darauf wirklich zu Ende ging, stand die ganze Familie um das Sterbebett des Senators, wie es angemessen war. Thomas beobachtete bei aller Betroffenheit und Trauer sehr aufmerksam, was da passierte. Als der Hauptpastor von St. Marien vor dem Sterbenden auf dem Boden kniete und nicht aufhören wollte mit seinen lauten Gebeten, bekam er mit, wie der Vater dazwischen erkennbar ein »Amen« sprach. Er wusste, dass es »Schluss jetzt!« bedeuten sollte. Der eifrige Geistliche ließ sich dadurch aber nicht aufhalten. Seine Mutter, die sich am Kopfende des Betts befand, glaubte während der sich endlos lang dehnenden Zeit des Wartens auf das Unvermeidliche aufgeschnappt zu haben, wie der sterbende Senator in Fieberträumen noch an einer Sitzung teilnahm und bekanntgab: »Meine Herren, am 13. um halb sechs werde ich eine Inspektionsreise antreten!«
So kam es dann auch. Der Finanzsenator Thomas Johann Heinrich Mann starb am Nachmittag des 13. Oktober 1891 um fünfeinhalb Uhr. Er wurde aufgebahrt, wie er es angeordnet hatte: das Haupt ein wenig nach rechts geneigt wie schlafend. Sein letztes Hemd war aus weißer Seide wie gewünscht.
Man bestattete ihn mit einem Pomp, wie ihn die Stadt lange nicht gesehen hatte. Hinter dem Sarg ging die Familie. Thomas sah nur wenige Schritte vor sich den schwarz gelackten, reich verzierten Totenwagen und, unter einem Hügel von Kränzen, den messingbeschlagenen Sarg mit der Leiche des Vaters.
Es war gar nicht so lange her, erst im Mai des vergangenen Jahrs, da hatte er das hundertjährige Jubiläum seiner Firma »Joh. Siegm. Mann, Commissions- und Speditionsgeschäfte« gefeiert. Mit Stolz hatte man bei der »Jubelfeier« auf diese hundert erfolgreichen Jahre zurückgeblickt. Die Stadt war damals im Fahnenschmuck erstrahlt. Thomas hatte die lange Reihe der Gratulanten und Deputationen gesehen, wie sie Blumenkränze und mancherlei Geschenke ins Haus trugen und dem Firmenchef überreichten. Sein Vater war eine hochgeachtete und geschätzte Persönlichkeit gewesen. Der Jubilar hatte die feierlichen Worte und das fröhliche Gelächter genossen, während reichhaltig Getränke ausgeschenkt wurden. Es waren dieselben Menschen, die jetzt mit der Familie den Sarg auf dem Weg zum Friedhof begleiteten. In der langen Prozession folgten der Bürgermeister, die Bürgerschaft sowie die Honoratioren und die Kaufleute. In den Kleidern ihrer Berufe: die Kapitäne, Matrosen, Kornträger, Speicherarbeiter. Tommy hatte den Eindruck, dass eine ganze Stadt, die Stadt seines Vaters, ihn zu Grabe tragen wollte.
Die Arbeit des Senators hatte den Nerv der Gesellschaft getroffen, das Geld der Hansestadt und die Steuern der Bürger. Thomas konnte es manchmal sehen, wenn der Vater zwischen den salutierenden Infanteristen vorbei ins Rathaus gegangen war und dabei den Zylinder gelupft hatte und, wenn er wieder aus der Senatssitzung kam, ebenso salutierend verabschiedet wurde. War Thomas mit dem Vater in der Stadt ein Stück des Weges gegangen, zogen in den Straßen Bekannte, Bürger und Arbeiter ihre Zylinder, Hüte oder Mützen vom Kopf.
»Tack ok, Herr Senata!«
Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieses Glanzes war auf die gesamte Familie gefallen. Doch Thomas wusste, dass er diesem weltgewandten Mann, der sein Vater war, niemals im Geschäft würde nachfolgen können. Und er wollte das auch gar nicht.
Eine Ehrenkompagnie der Lübecker Garnison war auf dem Friedhof ebenfalls zugegen. Und zum letzten Mal salutierten die Infanteriewachen am Grab des Senators, wo nun der Sarg in die Grube gelassen wurde. Als Tommy mit einer kleinen Schaufel etwas Erde darauf warf, hörte er den dumpfen Rums, mit dem sie auf ihm landete.
Als er nach den Feierlichkeiten wieder zu Hause in seinem Zimmer war, beschäftigte ihn ein Gedanke, der in dieser Stunde in ihm reifte: Wie seltsam ist es doch, dass ein Mensch auf dem Höhepunkt seines Lebens schon gezeichnet sein kann vom Untergang, der in Gestalt einer noch unsichtbaren Krankheit in ihm lebt. So etwas zu fühlen und zu durchdenken, war ihm wichtiger als alle Formeln und Vokabeln, die man für die Schule lernen musste.
Deklassiert
Was der Fortgang des Vaters wirklich für die Familie Mann bedeutete, wurde allen erst in dem Augenblick deutlich, als am 21. Oktober 1891 vor dem Amtsgericht der Hansestadt Lübeck in öffentlicher Sitzung die Testamentseröffnung in der Erbsache des seligen Thomas Johann Heinrich Mann stattfand. In der kargen Amtsstube saßen der Amtsrichter und ein Beisitzer, etwas abseits der Gerichtssekretär Propp. Gegenüber, hinter einem Tisch, die Witwe Julia Mann mit ihren beiden älteren Söhnen Heinrich und Thomas. Hinten im Raum einige Zuhörer, die etwas genauer wissen wollten, was der vornehme Herr Senator da wem vermacht hatte.
Julia tupfte sich mit einem Spitzentaschentuch die immer noch tränengeröteten Augen. Der Gerichtssekretär las routiniert vor, was der Verblichene verfügt hatte. »Paragraph 1: Ich hebe mein im Jahre 1879 errichtetes Testament hiermit wieder auf.« Julia erschrak einen Moment – davon hatte sie nichts gewusst. Doch sie beruhigte sich sofort wieder, als Propp fortfuhr: »Paragraph 2. Zu Erben meines Nachlasses ernenne ich: 1. meine liebe Frau Julia, geb. Bruhns, und 2. meine fünf Kinder.« So war es richtig, so war es gut. Wie es dann weiterging, verstand sie beim ersten Anhören nicht so recht, es ging ihr alles viel zu schnell.
»Paragraph 3. Meiner lieben Frau vermache ich die Nutznießung meines Vermögens. Bei Verheirathung einer unserer Töchter kann sie ihnen eine Aussteuer von je bis 25 000 Courantmark geben. Ebenso kann sie unseren Söhnen bei ihrer Etablirung und wenn solche unter Bedingungen geschehen, welche ihr und den etwaigen Vormündern entsprechend erscheinen, eine Aussteuer von je 25 000 Courantmark auszahlen.
Paragraph 4. Alsbald nach meinem Ableben soll mein unter der Firma Joh. Siegm. Mann geführtes Handlungshaus in Liquidation treten. Nach geschehener Liquidation soll die Firma im Firmenregister gelöscht werden.«
Das hatte sie nicht gewusst. Julia Mann war viel zu entsetzt, um noch einen klaren Gedanken zu fassen. So konnte sie dem nicht mehr genau folgen, was nun an Einzelheiten der Firmenauflösung folgte: dass der Mitinhaber Eschenburg die Abwicklung übernehmen sollte, dass auch die Speicher am Hafen, der »Walfisch«, der »Adler«, die »Linde« und so weiter, mitbetroffen seien … Ehe sie sich einigermaßen sammeln konnte, folgte schon der nächste entsetzliche Schlag. »Paragraph 7. Mein sub Numero 52 in der Beckergrube gelegenes Wohnhaus soll innerhalb eines Jahres nach meinem Ableben verkauft werden.«
Julia war vollends am Boden zerstört. Sie konnte kaum noch ertragen, was die Stimme des Gerichtssekretärs weiter völlig unbeteiligt vortrug. Es ging da jetzt um die Legate, Spenden für den Museumsfonds, die Kaufleute-Witwen-Kasse, 3000 Mark für die Kornträger-Krankenkasse und so weiter, sogar 5000 für die Heizung von St. Marien waren dabei. Von ihrem Geld. Da spielte es kaum noch eine Rolle, dass ihr lieber Gemahl ausgerechnet diesen unangenehmen, völlig ungeistigen Krafft Tesdorpf zum Testamentsvollstrecker bestimmt hatte.
Als die Sitzung beendet und die Gültigkeit des Testaments besiegelt war, zog sich das Gerichtspersonal zurück – es hatte seine Schuldigkeit getan. Die letzten Zuschauer verließen kopfschüttelnd und tuschelnd den Raum. Als Julia aufstehen wollte, musste sie sich erst einmal aus Schwäche auf den Tisch stützen. Thomas wollte ihr behilflich sein, da trat Herr Krafft Tesdorpf hinzu, stolz in seiner neuen Würde als vom seligen Herrn Senator eingesetzter Testamentsvollstrecker. Tesdorpf gehörte einer angesehenen, weitverzweigten Lübecker Familie an und betrieb zusammen mit seinem Bruder eine weithin geachtete Weinhandlung. Er war ein ansehnlicher Herr und hatte mit dem Verblichenen auf besonders gutem Fuß gestanden. Nachdem er der Witwe nochmals sein tiefstempfundenes Beileid ausgesprochen und sein Bedauern darüber ausgedrückt hatte, ihr nur unter so traurigen Umständen behilflich sein zu können, klärte er sie zunächst darüber auf, wie sie in Zukunft zu ihren Kindern stünde.
»Allein als Frau dürfen Sie die Vormundschaft über Ihre Kinder nicht selber ausüben, so sind die Gesetze nun einmal. Ihr seliger Herr Gemahl wusste das, deshalb hat er zwei Vormünder bestimmt. Denen müssen Sie über die Entwicklung Ihrer Kinder Rechenschaft ablegen, bis sie volljährig sind.«
»Muss ich das tun?«, fragte Julia ungläubig.
»Das ist die Rechtslage.«
»Und was war das eben mit unserem Haus? Das hat er doch erst vor sieben Jahren erbaut? Verkaufen?«
»Ihr seliger Herr Gemahl hat mir testamentarisch den bindenden Auftrag erteilt, Ihr Wohnhaus innerhalb eines Jahres zu veräußern.«
»Und wo sollen wir dann hin, um Himmels willen?«
»Wie Sie vielleicht wissen, gehört der Firma eine kleine Villa draußen vor dem Burgtor, die ist für Sie durchaus angemessen. Die Söhne sind ja bald aus dem Haus, und zu größeren Geselligkeiten dürfte es wohl kaum noch Anlass geben.«
»Und was hat es genau mit den Zinsen auf sich?«
»Nutznießung heißt, dass Sie und die Ihren nur die Zinsen aus dem Vermögen Ihres seligen Herrn Gemahls erhalten, nicht das Vermögen selbst.«
»Ich muss also nun bei Ihnen um meinen Lebensunterhalt betteln? Das kann doch nicht der Wille meines lieben …« Julia schluchzte auf.
»So würde ich das nicht ausdrücken«, entgegnete der Testamentsvollstrecker eisig. Er wendete sich ab und suchte seine Unterlagen zusammen. Als Julia einen Moment hilflos dastand und sich dann zur Tür wandte, um zu gehen, wollte Heinrich sie am Arm hinausgeleiten. Doch Tommy hielt ihn am Ärmel zurück.
»Du, Heinrich, ich weiß, so etwas fragt man eigentlich nicht in so einem Moment. Aber … haben wir nun eigentlich was geerbt?«
»Ja, schon. Eine Aussteuer wie Lula und Carla. Aber erst, wenn dieser Tesdorpf entschieden hat, dass wir …«, und er buchstabierte es höhnisch, »e-ta-bliert genug sind. Bis dahin nur eine Rente aus dem Vermögen. Das Vermögen liegt fest, da kommt niemand ran.«
Die Frage, die ihn am meisten bewegte, stellte Thomas zuletzt: »Sind wir jetzt frei?«
»Ich gehe zurück nach Berlin, da wird mir keiner reinreden können. Ich muss das unbedingt: lesen, viel lesen, schreiben und vor allem leben.«
»Ich muss wohl erst einmal irgendwie die Schule beenden.«
Heinrich legte brüderlich tröstend seine Hand auf Tommys Schulter. »Aber das Lesen und Schreiben, das kann dir niemand verbieten.«
»Ja, schreiben wie du.«
»Nein, Tommy – schreiben wie du. Und leben, das gehört unbedingt auch dazu.«
Das Letzte war gerade gesprochen, als die beiden Brüder schnell der Mutter folgten, um sie zu stützen.
Wenn eine große Persönlichkeit von der Bühne abtritt, gibt es neben dem Schmerz um den Verlust auch immer das Gefühl von beginnender Freiheit. Es atmet sich freier in der Luft, ohne den Druck und die Kontrolle von oben. Es lebt sich freier und ungenierter. Ohne die Aufsicht konnte daraus aber leicht ein gefährliches Verbummeln entstehen. Es kam ja nicht mehr darauf an. Auf der anderen Seite wuchs die Hoffnung, dass man wachsen könnte, herauswachsen aus einer Enge, die man nun nicht mehr brauchte. Im Innern war der Abstand von der engen Welt in Lübeck schon da. Wenn er nun noch größer wurde, konnte der Mut dazukommen, etwas Großes zu wagen, das in den schmalen Gassen nicht gelingen konnte.
Thomas wusste, dass er es mit der Schule nicht mehr ernsthaft zu tun haben würde. Er würde die Zeit bis zum Einjährigen einfach absitzen. Er würde dem Katharineum keinen Ärger machen, und das Katharineum würde ihn, der als ernsthafter Schüler längst aufgegeben war, in Ruhe lassen. Er hatte Besseres mit seinem Leben vor als das, was dort auf dem Stundenplan stand. Es lebte ein Traum von Größe in ihm. Wie das gelingen konnte, ahnte er kaum. Es würde etwas mit dem Schreiben zu tun haben, mit seinen Gedichten und Geschichten, die erst nach und nach entstehen konnten. Alles das lag noch im Nebel vor ihm. Gestalten und Geschichten waren in diesem bislang nicht recht zu fassen und zu formen. Es könnte aber gelingen, das sagte ihm sein Gefühl. Das Schicksal – oder besser: das Lebensglück – war auf seiner Seite. Und da war noch etwas, das er spürte: die Kraft seiner Fantasie!
Julia durfte also mit ihrer Familie noch ein Jahr in der Beckergrube wohnen bleiben. Heinrich zog es sofort wieder nach Berlin.
Gottes Segen ruhte auf den Seinen. Sie lebten in der Gnade des Herrn. Das hatten sie, Julia und ihre fünf Kinder, gespürt, als der Senator noch lebte. Ein Jahr später, im Oktober 1892, waren all der Glanz, alles Ansehen, alle Würde restlos verschwunden. Niemand zog mehr die Mütze vom Kopf, kaum noch ein Handschlag, selten ein freundlicher Gruß. Der Pfarrer in der Kirche sprach von »dieser verrotteten Familie«. Was auch immer es schon früher an Anzeichen von Nachlassen, Gefährdung oder gar Versagen in Firma und Familie gegeben haben mochte – bisher war es übersehen oder freundlich zugedeckt worden. Jetzt wurde der Vorhang unerbittlich weggezogen. Es herrschte Kälte, fast Verachtung. Es war ein Absturz ohnegleichen. Julia fühlte sich nicht mehr frei, nicht mehr wohl in dieser Stadt, denn ein Jahr nach dem Tod des Senators und der Auflösung der Firma war das Ansehen der Familie verloren.
Blick in den Abgrund
Als Treffpunkt hatten sie den Bahnhof verabredet. Für Otto Grautoff war es der weitaus längere Anmarsch gewesen. Nun wartete er am Hauptausgang darauf, dass sein Freund und Klassenkamerad Thomas endlich zwischen den Droschken, die hier auf ihre Kundschaft warteten, auftauchen würde.
Otto war ein Jahr jünger als Tommy. Als dieser im Katharineum ein Schuljahr wiederholen musste und in der Klasse von Otto landete, freundeten sich die beiden an. Dann hatte es Otto so eingerichtet, dass er die zwei weiteren Male, die Thomas noch sitzen blieb, auch nicht versetzt wurde. Auf diese Weise konnte er mit dem Freund immer in derselben Klasse bleiben. Ottos Vater war ebenfalls vorzeitig gestorben. Der erfolglose Landkarten- und Buchhändler hatte 1889 einen Bankrott hingelegt, der Senator Mann hatte ihn seinem Sohn Heinrich zur Warnung als »einen Vernichteten« gezeigt. Ein halbes Jahr nach dem Tod des Senators hatte der Buchhändler Grauthoff unter nicht bekannten Umständen seinem Unglück selbst ein Ende gemacht. Seine Witwe musste danach ihre beiden Söhne mit Französischunterricht durchbringen. Otto hatte sich übrigens nie über die Schwelle von Thomas’ Vaterhaus gewagt.
Doch das gab es ohnehin nicht mehr. In dem kleinen Sommerhaus vor dem Burgtor, das ihnen vom Testament des Vaters beschert war, konnten und wollten sie nicht heimisch werden. Bereits nach sechs Monaten, im Mai 1893, zog es Julia mit ihren Kindern nach München. Nur Tommy hatte man, damit er die Schule irgendwie zu Ende brachte, in Lübeck zurückgelassen. Er wohnte zur Pension bei Professor Hempel nahe der Kirche St. Lorenz, über den Stadtgraben hinaus, kurz hinter dem Bahnhof.
Gerade als Thomas sich den Schienen der Eisenbahn näherte, die aus dem Bahnhofsgebäude hinaus vor die Stadt führten, sah er, wie die Lokomotive sich unter Dampfwolken, Schnaufen und Stöhnen vor das Panorama der Stadt schob, den kleinen Buckel mit den sieben Kirchtürmen und den spitzgiebeligen Bürgerhäusern. Thomas hatte Otto schon von Weitem erkannt, wie er ihn, unruhig auf und ab gehend, mit seinen kurzsichtigen Augen nach ihm ausspähend, auf dem Bahnhofsvorplatz erwartete. Ohne sich sonderlich zu beeilen, ging er auf ihn zu. Als Otto ihn endlich erkannte und ihm freundlich entgegenlächelte und -winkte, hob Tommy nur kurz die Hand, und der Freund folgte ihm schnurstracks auf seinem Weg am Bahnhof vorbei über die Puppenbrücke mit ihren acht mythologischen Steinfiguren. Ein Flussgott für die Trave, eine weibliche Figur für die Eintracht im Innern, eine andere mit dem Ölzweig für den Frieden nach außen und so weiter, vor allem aber der für die Hansestadt Lübeck wichtigste Gott Merkur, der nicht nur als Götterbote bekannt war, sondern vor allem als Gott der Kaufleute und, nebenbei und nicht ganz zufällig, auch der Diebe. Hier stand er also als überlebensgroße Statue auf dem Brückengeländer.
»Mit prall gefülltem Geldbeutel in der Hand, aber kein Geld für ’ne Büx«, kommentierte Thomas im Vorübergehen. Tatsächlich zeigte der Gott den Vorübergehenden den nackten Hintern.
»Wenn ich das Geld hätte, wüsste ich schon, wo ich mich einkleiden lassen würde«, erwiderte Otto, und Tommy verstand sofort, was die Halbwaise damit meinte. Aber da konnte er auch nichts machen.
Thomas und Otto, welch ungleiches Paar das war, konnte man auf den ersten Blick sehen: der nach wie vor adrett gekleidete Thomas und sein Freund in einer beinahe schäbigen, an versteckter Stelle sogar geflickten Jacke undefinierbarer Farbe und in abgetragenen braunen Schuhen. Seiner Mutter fehlten die Mittel, ihm und seinem Bruder etwas Neues zu kaufen. Otto war vom Wuchs her etwas kleiner und gedrungener, meist trug er eine Brille vor den leicht hervorquellenden Augen. Er musste einige schnelle Schritte zulegen, um an die Seite seines Freundes zu gelangen. Otto war der Unterlegene, denn er liebte. Tommy blieb stets der Überlegene, der ihm seine Nähe gewährte – oder auch nicht. Denn er konnte hochmütig sein und den Kleineren fast so etwas wie Verachtung spüren lassen. In letzter Zeit hatte Otto manchmal den Eindruck, es sei Thomas peinlich, mit ihm zusammen gesehen zu werden. Er schien sich immer mehr von ihm zurückzuziehen. Die Gesellschaft seiner adligen Mitschüler war ihm anscheinend wichtiger, darunter die jungen Grafen Vitzthum, Rantzau und Reventlow. Von Williram Timpe ganz zu schweigen, der neuen Flamme Tommys, dem Sohn des Oberlehrers Timpe, dieses Musterschülers mit den attraktiven blaugrauen Kirgisenaugen direkt über den hohen Backenknochen. Der hatte Tommy einmal einen Bleistift geliehen, einen Crayon, den man aus einer Silberfassung herausschieben konnte, wenn die Spitze abgenutzt war. Thomas, der ihn bis dahin nur von ferne bewundert hatte, hatte all seinen Mut zusammengenommen und Williram einfach gefragt, ob er ihn sich einmal ausleihen dürfe. Er hatte, als er ihn dann schüchtern zurückgegeben hatte, andachtsvoll die Schnitzel vom Anspitzen des verehrten Gegenstands in einem Schreibtisch aufbewahrt. Ob er sie da wohl noch hatte? Diese Geschichte lief nun schon seit über einem Jahr.
Sie gingen auf das Holstentor zu, bogen aber hinter der Puppenbrücke rechts ab, die Treppen hinunter an den Stadtgraben und danach direkt in die Wallanlagen, eine Hügelkette, gebildet aus den ehemaligen Verteidigungsstellungen der Stadt. Als man einstmals nicht mehr übersehen konnte, dass die Kanonen über die Wälle hinweg direkt in die Stadt schießen konnten, hatte man die Festungsbauwerke zu einem Park umgestaltet. Nun waren es Hügel mit einem Kranz bewaldeter Spazierwege, mit den schönsten Ausblicken auf die gegenüberliegende Altstadt. Im Lauf der Jahre hatten sich aber auch viele kleine Nebenwege, Schleichpfade und kleine Lauben im Dickicht gebildet, Verstecke, wenn man so etwas denn aufsuchen wollte. Auf einer Bank in diesem Teil der Anlagen ließen sich die beiden nieder.
»Hast du es dabei?«, fragte Tommy.
»Ja, im Schulranzen!« Otto war stolz, dass er gerade dieses Buch aus dem Nachlass seines bankrotten Vaters gerettet hatte. Es war ein wissenschaftliches Werk. Psychopathia sexualis stand auf dem Titelblatt, der Untertitel lautete Mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Es war eine klinisch-forensische Studie, aus der Praxis hervorgegangen. Als Verfasser war ein Dr. Richard von Krafft-Ebing genannt, seines Zeichens ordentlicher Professor für Psychiatrie und Nervenkrankheiten an der k. u. k. Universität Wien. Ganz unbestreitbar eine Kapazität allerersten Ranges auf dem neuen Fachgebiet. Krafft-Ebing versuchte aus vielen Fallstudien ein wissenschaftliches Beschreibungs- und Erklärungssystem abzuleiten, das Licht in das Dunkel der verpönten und verbotenen Gefühle und Sexualpraktiken bringen sollte. Die in dem Buch ungeschönt wiedergegebenen Berichte aus der heimlichen Lebenswirklichkeit homosexueller Männer aller gesellschaftlichen Schichten waren es, was die beiden Schüler anzog, fesselte und erstaunte. Hier bekamen sie unverstellte Einblicke in ein wichtiges Stück der Realität, das man sonst sorgsamst vor ihnen verbarg. Und jenseits des in ihrem Alter selbstverständlichen Interesses für alles Sexuelle betraf es sie ganz besonders, was hier abgehandelt wurde: Thomas und Otto hatten schon vor Jahren bemerkt, dass ihre Empfindungen Knaben und Mädchen gegenüber nicht dem entsprachen, was man allgemein von ihnen erwartete. Otto hatte das Buch in einen dicken Schutzumschlag aus Packpapier eingeschlagen, damit keine unbefugten Augen sehen konnten, welch hoch gefährlicher, höchst unanständiger Inhalt sich hinter der unscheinbaren Oberfläche eines medizinischen Lehrbuchs verbarg.
»Hast du schon drin gelesen?«