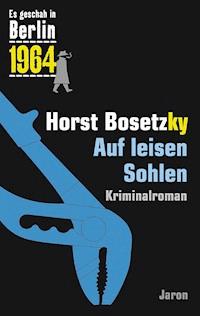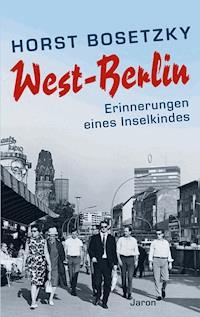4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Horst Bosetzky – unter dem Kürzel "-ky" auch als Krimiautor ein Begriff – hat mit ›Brennholz für Kartoffelschalen‹ den Roman der Nachkriegszeit geschrieben. Mit dem Jungen Manfred, seiner Familie und seinen Klassenkameraden läßt Bosetzky eine fast schon vergessene Welt wieder lebendig werden – eine karge und oftmals bedrohliche Welt, aber auch eine Welt voller Aufregung und unwiederbringlicher Abenteuer. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Ähnliche
Horst Bosetzky
Brennholz für Kartoffelschalen
Roman eines Schlüsselkindes
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine Mutter, die mir – wie vieles – auch dieses Buch verzeihen wird, denn: »Wer seine Mutter liebt, ist nie ein böser Mensch.«
(Alfred de Musset)
Paß auf deine Schlüssel auf!
Manfred Matuschewski zog seine Wohnungsschlüssel aus dem Hemd und prüfte, ob die Strippe noch in Ordnung war. Aus einer Art braunem Packpapier zusammengezwirbelt, löste sie sich immer auf, wenn er übermäßig schwitzte.
Nein, heute hielt sie mal. Als er in sein Hemd hineinsah, bemerkte er, daß sich die Haut gerötet hatte. Das passierte öfter, wenn ihm die Schlüssel unters Hemd rutschten und dort scheuerten.
Die Deutschstunde bei Frau Fahlenberg war nicht übermäßig spannend, und nach einiger Zeit hörte er gar nicht mehr hin, sondern polkte den Schmutz aus den Rillen seiner beiden Schlüssel und träumte dabei von Schmöckwitz, wie es wohl sein würde, mit dem eingemotteten Boot seiner Eltern, der Snark, über den Seddin-See zu paddeln.
Da bist du noch zu klein zu!
Die war’n ja blöde alle! Bald war er neun Jahre alt und hätte mit einem Faltboot die ganze Spree rauf- und runterfahren können.
»Manfred, träume nicht schon wieder!«
»Ich hab ja zugehört!«
»Was haben wir denn gemacht?«
»Die lustige Geschichte aus dem Telegraf mit den ganzen Karten …«
Frau Fahlenberg sah ihn an. »Kannst du das bitte noch einmal wiederholen …?«
»Also, da war mal … nein …« Manfred bekam einen roten Kopf. Er hatte ganz sicher den Ehrgeiz, zu den besten Schülern zu gehören und überall Erster zu sein, aber es fiel ihm schwer, aufmerksam, ergeben und fleißig zu sein, ein rechter Stolz der Lehrer, und sich beim Lernen zu quälen, das schaffte er nie. Entweder etwas flog ihm zu, oder er ließ es eben bleiben. Hausarbeiten waren etwas für die, die zu dumm waren, es auf Anhieb zu kapieren.
»Ihr solltet doch zu Hause aufschreiben, was ich gestern vorgelesen habe …«
Manfred starrte auf seine nackten Zehen, die alle zehn vorn aus seinen abgelatschten braunen Halbschuhen herausschauten. Die Kappen waren abgeschnitten worden, damit er sie den Sommer und den Herbst ’46 über noch mal tragen konnte. »Das hab ich vergessen …«
»Diese Schlüsselkinder«, stöhnte Frau Fahlenberg. »Aber, Manfred, merk dir mal: Nur wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen. – Bimbo, du …!«
»Der Küchenzettel.« Peter Stier, den sie alle Bimbo nannten, weil er sie an einen kleinen Elefanten erinnerte, hatte natürlich am Vortage alles schön brav und sauber zu Papier gebracht und las es jetzt fehlerfrei ab. »Man macht mit der Kohlenkarte ein mäßiges Feuer, nimmt die Fettkarte, brät damit die Fleischkarte und schlägt – sofern vorhanden – die Eierkarte hinzu. Kartoffel- und Gemüsekarte werden abgekocht und dazu gereicht. Zum Nachtisch brüht man die Kaffeekarte heiß auf, süßt mit der Zuckerkarte und taucht die Brotkarte hinein. Danach wäscht man sich die Hände mit der Seifenkarte und trocknet diese mit eventuell vorhandenen Bezugsscheinen ab.«
»Bravo!« sagte Frau Fahlenberg, doch Manfred wußte genau, daß Bimbos Eltern bei dieser Geschichte kräftig mitgeschrieben hatten. Das klang alles ganz nach Bimbos Vater, der Schupo war. Manfreds eigener Vater hätte das, wäre er denn dagewesen, sicherlich viel besser gemacht.
Die Klasse döste vor sich hin, und Frau Fahlenberg schüttelte den Kopf. »Gott, wenn ich euch sehe, dann muß ich immer an meinen Garten denken: wie da ein Haufen Schnecken unter einem Kohlblatt sitzt.«
Das war die richtige Assoziation für Jünne, der stets den meisten Hunger hatte. »Kohldampf!« schrie er.
Und die Götter schienen nur auf dieses Stichwort gewartet zu haben, denn plötzlich wurde – ohne daß vorher angeklopft worden wäre – die Tür aufgerissen, und sie hörten das, wovon sie schon seit dem Morgen immer wieder geträumt hatten:
»Die 3c zum Nachschlag!«
Ein langer Latsch hatte das in ihr Klassenzimmer geschrien, ohne sich im mindesten um die Lehrerin zu kümmern. Und ehe Frau Fahlenberg auch nur einmal Atem holen konnte, war die Meute ihrer fünfunddreißig Jungen auch schon losgebrochen und stürzte auf den Flur hinaus. Wild schwärmende Hummeln waren sie jetzt, keine Schnecken mehr. An der Spitze die beiden, die bei solchen Sachen stets den richtigen Animus hatten, Kuki und Dieter Purwin, das Kochgeschirr in jeder Stunde griffbereit. Hinterhertraben hingegen mußten Opa Waller, Bimbo und einige andere, die ihre Behältnisse an den gußeisernen Garderobenhaken hängen hatten.
Manfred hatte seinen Essensträger neben sich auf dem Fensterbrett stehen gehabt und steckte jetzt mittendrin im dicksten Haufen, trat anderen in die Hacken, als sie die Treppen hinunterfegten, und wurde getreten, konnte zwar Krücke mit einem Ellenbogenstoß am Überholen hindern, wurde aber selber wenig später von Hotte Rüscher so weit nach außen abgedrängt, daß er den schmalen Eingang zum Essenskeller verfehlte und hilflos an der Stahltür kleben blieb.
Es war nicht ratsam, zu den Letzten zu gehören, denn oft verschätzte sich Frau Pahl unten am Kübel in der Menge des noch zu vergebenden Essens.
Die Schulspeisung, im Herbst 1946 von den Besatzungsbehörden ins Leben gerufen, war in jenen Jahren das Schönste, was es in und an der Schule gab, und wenn zum Nachschlagfassen aufgerufen wurde, dann war das so, als wären Weihnachten und Ostern auf denselben Tag gefallen.
0,15 Reichsmark täglich für einen halben Liter Essen.
Gries mit Trockenfrüchten gab es heute, und Frau Pahl rührte den himbeerroten, blassen Pamps mit einer langen Kelle mehrmals um, um das Dicke nach oben zu holen, die halben Aprikosen. Himmlisch roch das, und die Jungen leckten sich die Lippen wie die Pawlowschen Hunde, stießen fast den Kübel vom Hocker, so heftig kämpften sie.
»Richtig hinhalten!« schrie sie und meinte die Behälter der Acht-, der Neunjährigen, die immer wieder, wenn ein weiteres Gefäß scheppernd in die Lücke fuhr, auseinandergetrieben wurden wie die Kugeln beim Lochbillard.
Kukis Vater war schon aus der Kriegsgefangenschaft zurück, und sein Sohn hatte dessen Wehrmachtskochgeschirr geerbt. Dieter Purwin dagegen streckte der Pahl eine alte Sammelbüchse hin, Winterhilfswerk 1941 (»Und Dein Opfer für’s WHW?«), in die sein Opa oben zwei Löcher gebohrt und ein Stückchen Strippe hindurchgezogen hatte. Olle Krücke war mit seiner stark angerosteten »Kasttrolle« erschienen, einer Kasserolle, Opa Waller mit einem henkellosen Milchtopf und Vietzich (Horst Mühlich, der es nicht schaffte, die Zahl 40 richtig zu sprechen) mit einem in der Hasenheide gefundenen Stahlhelm, den sie ihm zu Hause ein wenig zurechtgehämmert hatten.
Manfred war stolzer Besitzer eines Essensträgers aus dünnem und mit schwarzen Pockennarben übersätem Aluminiumblech, das seine Kohlenoma neulich bei einem AEG-Arbeiter gegen eine dochtlose Petroleumlampe eingetauscht und ihm geschenkt hatte. »Da, du alter Scheesenbeutel!«
Welch Manna da im schäbigen Kübel! Die meisten hatten nichts weiter im Magen als eine Scheibe klitschigen Brotes, zu Hause auf der Herdplatte geröstet und eßbar gemacht, allerhöchstens eine Messerspitze Margarine draufgestrichen, oder aber einen Teller voll Roggenmehlsuppe, Tapetenkleister. Und nun dieser herrliche Brei hier, der süß war, der schmeckte, der satt machte. Sie alle hätten baden mögen in dieser rosa Pampe, gespendet von den Amerikanern, denselben womöglich, die ihnen zwei Jahre vorher als Air-Force-Flieger Bomben auf den Kopf geschmissen hatten.
Heute war ein Glückstag, und alle kriegten noch was ab. Die einen fraßen alles gleich in sich hinein, Jünne zum Beispiel, Günther Hahn, mit zehn viel älter als sie und weitaus stärker, immer bedrohlich, oder Kuki, der ihr Kleinster war und so gerufen wurde, weil er, Pech für ihn, Kukowski hieß. Andere wieder teilten sich planvoll ein, was sie im Napfe hatten. Ein paar Löffelvoll gleich im Keller runtergeschlungen und das andere dann im Verlaufe ihrer letzten Stunde. Die dritte Gruppe wiederum hatte Weisung von zu Hause, den Nachschlag mitzubringen; meist gab es da eine Oma, die sterbenskrank auf irgendeinem Sofa lag, oder einen großen Bruder, einen Vater oder Onkel, die halbverhungert aus dem Krieg gekommen waren und nun wieder hochgepäppelt werden mußten.
Bei Manfred war es so, daß seine Mutter heute ihren ersten Arbeitstag hatte, zum erstenmal nach Ende des Krieges wieder am Schalter ihrer Krankenkasse saß, der VAB. Mit einer Mohrrübe aus Schmöckwitz war sie morgens losgezogen sowie einer Klappstulle, die ein wenig nach Melasse schmeckte. Da hatte er ihr hoch und heilig versprochen, seinen Nachschlag mitzubringen, wenn es denn welchen geben sollte.
In der nächsten und letzten Stunde mußte Frau Fahlenberg zum Impfen. Alle mußten sie sich ständig impfen lassen, schrecklich. Der Rektor selber machte Unterricht, Herr Schaller.
»Achtung, Kohlenklau kommt!« schrie Dieter Purwin, den sie an der Tür als Wache aufgestellt hatten.
Den richtigen »Kohlenklau«, den kannten sie alle noch von den Plakaten her, die den Krieg überdauert hatten. Es war ein kugelrundes schwarzes Männchen, unrasiert und häßlich wie die Nacht, ein Rattengesicht mit zwei riesigen Raffzähnen, einem eklig weit aufgerissenen rechten Auge, zwei Riesennasenlöchern mit einem unappetitlichen Bart darunter, einer Schiebermütze auf dem Kopf und einem Rucksack rechts über der Schulter. Die mit dem besten Gedächtnis, Riese & Rose beispielsweise, kannten noch den Text:
DA IST ER WIEDER!
Sein Magen knurrt, sein Sack ist leer,
und gierig schnüffelt er umher.
An Ofen, Herd, an Hahn und Topf,
an Fenster, Tür und Schalterknopf
holt er mit List, was Ihr versaut.
Die Rüstung ist damit beklaut,
die auch Dein bißchen nötig hat,
das er jetzt sucht in Land und Stadt.
FASST IHN!
Schaller also mit seinem Bulldoggengesicht war für die Kinder nur »der Kohlenklau«, hatte es schwer mit ihnen, war ein gänzlich unbegabter Pädagoge, nach oben gekommen, weil ein Teil der Kollegen entweder gefallen war oder aber noch in ferner Kriegsgefangenschaft weilte und der andere aufgrund seiner ehemaligen NSDAP-Mitgliedschaft aus dem Schuldienst entlassen worden war. Hilfslehrer und Hilfslehrerinnen gab es viele, doch Schaller schaffte es schnell, ihnen ihr großes Engagement wieder zu nehmen, zumal wenn sie sich nicht jetzt schon von den Kommunisten distanzierten.
Kohlenklau hatte die Angewohnheit, die meisten seiner Sätze mit einer schwer wiederzugebenden Silbe zu beenden, einem Ausruf, der die Kinder wohl aus ihrer Lethargie hochreißen sollte, aber zugleich auch eine Frage war, ob sie wohl – »Gut aufgemerkt!« – den Sinn seiner Worte mitbekommen hätten.
»Groß-Berlin hat zwanzig Bezirke – né …!? Zwei im französischen Sektor, vier im britischen, sechs im amerikanischen und acht im russischen – né …!? Wir hier in Neukölln, wir sind im vierzehnten Bezirk und im amerikanischen Sektor – né …!?« Das né, ein verschlucktes »nicht wahr«, kam so heraus, als würde er nett oder Nemesis sagen wollen, aber mittendrin im Wort schlagartig haltmachen müssen. »Bis 1912, né, da hieß unser Neukölln, na …?«
»Rixdorf!« rief Werner Riese, mit Wolfgang Rose zusammen, Riese & Rose, Musterschüler der 3c.
»Rixdorf, né …!?« echote Manfred.
Schaller gab sich alle Mühe, es noch nicht zu hören, und fuhr mit seiner Heimatkundestunde fort, indem er vom Hermannplatz aus, einem dicken Punkt an seiner Tafel, mit einem letzten Kreidestrich zwei breite Linien ostwärts zog. »Hier haben wir unsere beiden Hauptstraßen – né …!?«
»Die Sonnenallee, né …!?« sagte Manfred zu Dieter Purwin, der, trotz der Hungerjahre dick und rosig, neben ihm döste.
Diesmal hörte Schaller es und schrie sofort: »Das war doch wieder dieser Matuschewski, né …!?« Und er kam auf Manfred zugeschossen, packte und beutelte ihn. »Du schreibst zu Hause hundertmal: Ich soll meinen Lehrer nicht nachäffen!«
»Ja«, sagte Manfred mit der nötigen Demut, um dann wirklich ganz kleinlaut zu fragen: »Aber kann ich nicht lieber ’ne Stunde nachsitzen dafür …?«
Da bekam er so furchtbar eine geballert, daß sein Kopf bis zu Dieter Purwins Schulter rüberflog, denn der Rektor hatte Manfreds unbewußtes ’ne nicht als die landesübliche Verkürzung für »eine« – eine Stunde –, genommen, sondern als eine erneute und noch viel schlimmere Provokation einer Amtsperson.
»So was Dreibastiges, né …!?« schimpfte Schaller, als er wieder vorne war. »Aber ich werd’ euch schon wieder auf Vordermann bringen!«
Manfred rieb sich die schmerzende Backe. »Ich wollte doch nur …«
»Auch noch Widerrede! Los, ab in die Ecke!«
So verbrachte Manfred den Rest der Stunde in der Ecke vorne rechts, zwischen Klassenschrank und Tür, den Rücken zur Klasse, das Gesicht, das voller Tränen war, an den gefährlich losen Putz gepreßt.
Aber das Absurde war, daß er liebend gerne bis zum Abend hier gestanden hätte, denn dieses kleine Elend ließ ihn um so stärker an das viel größere denken, das ihn bald erwartete: nach Hause in die leere, in die dunkle Wohnung zu kommen. Er hatte eine Wahnsinnsangst davor.
Er war zu beliebt, als daß die anderen ihn gehänselt hätten, auch war es, wenn Kohlenklau einen von ihnen erwischte, wie die Verleihung einer Nahkampfspange, und dennoch weinte er. Seine Mutter! Wenn die davon erfuhr, war wieder Polen offen.
Mach nur weiter so, solange Vati noch weg ist!
Womit hab’ ich das nur verdient!?
Wenn du dich nicht besserst, kommst du eben in die Erziehungsanstalt!
Er hatte im Luftschutzkeller gesessen, als nebenan die Häuser in sich zusammengestürzt waren, er war auf dem Dorfe, als man sie evakuiert hatte, von Tieffliegern angegriffen und beschossen worden, er hatte die letzten Kämpfe und den Einmarsch der Roten Armee überlebt, doch das alles war an sich kaum schrecklich für ihn, auch nicht, daß sie noch immer nicht wußten, ob der Vati noch lebte, voller würgendem Schrecken war allein diese Drohung: … dann kommst du eben in die Erziehungsanstalt. Er wußte nicht, was das war, aber ahnte er es? Hatte er es unbewußt mitbekommen, wenn sein Vater BBC hörte und dann sagte, daß sie, bei den Anteilen jüdischen Bluts, das sie hatten, die nächsten wären, die die Nazis ins KZ stecken würden?
Die Erziehungsanstalt, eine maßlose Angst.
Die Schulglocke, das Schrillen, es erlöste ihn, der Lärm der Kameraden, die mit ihren schäbigen Ranzen nach draußen drängten.
»Manne, spielste mit?«
»Watten?«
»Köppen!«
»Habtan Ball?«
»Nehm wa olle Krücke seinen.«
»Der is kaputt!«
»Meina is noch beim Hausmeesta, den hatta mir doch inne jroßen Pause abjenommn!«
»Los, jehn wa’n holn!«
Manfred wurde von Bimbo und Kuki in die Mitte genommen, und ab ging es zur Wohnung des Hausmeisters, der einarmig war und mit Kohlenklau unter einer Decke steckte.
Diesmal aber bekamen sie ihren Ball anstandslos zurück, denn Frau Fahlenberg war schon unten gewesen und hatte zu ihren Gunsten interveniert.
Ein Ball war ein unglaublicher Wertgegenstand. Einen zu haben, war mit einem hohen Maß an Seligkeit verbunden. Manfred hatte seinen Tennisball bei seiner Tante Gerda in einem alten Schrank gefunden. Seine Lieblingstante, die hatte immer so schön nach Parfüm geduftet, und vor dem Krieg war er morgens immer zu ihr ins Bett geklettert.
Was v.Chr. und n. Chr. hieß, wußte Manfred nicht, und es hatte auch nicht die geringste Bedeutung für ihn, die einzige Zäsur, die für ihn zählte, war »vor dem Krieg« und »nach dem Krieg«. Vor dem Krieg, da war hier alles noch ganz gewesen, und alle hatten genügend zu essen und zu heizen gehabt. Vor dem Krieg, da hatten alle noch in schönen Häusern gewohnt und waren verreist. Vor dem Krieg, da hatten auch alle noch gelebt. Onkel Gerhard zum Beispiel, Tante Gerdas Mann. Der war Journalist gewesen, und Tante Gerda hatte ausgesehen wie ’ne Schönheitskönigin. Sogar Tennis hatten die gespielt!
Jetzt war der Onkel Gerhard tot, gefallen, und Tante Gerda war irgendwo da hängengeblieben, wo jetzt die Polen waren. Ausgebombt worden war sie auch, und der Rest ihrer Sachen und Möbel stand draußen in Schmöckwitz, in der Laube und im Schuppen. Und da hatte er auch den Tennisball gefunden.
Sie spielten Köppen, und zwar zu viert. Kuki und er in der einen, Jünne und Uwe in der anderen Mannschaft. Sie standen jeweils zu zweit in einem Tor, dessen Pfosten ihre aufgetürmten Ranzen waren. Abstand voneinander sechs Meter etwa. Nun galt es, den kleinen Ball mit einem kräftigen Kopfstoß ins Tor der anderen zu befördern, die natürlich versuchten, den Einschlag mit allen Mitteln, sprich Körperteilen zu verhindern. Da der Ball vom Angreifer nur mit dem Kopf getroffen werden durfte und der hier bei den Neuköllner Jungen nichts anderes war als der »Kopp«, hieß das Spiel bei ihnen eben Köppen. Man konnte es ebenso als Einzel wie auch als Doppel spielen, wobei ihnen letzteres im allgemeinen mehr Spaß bereitete, weil es, wenn sich zwei zugleich nach dem heranzischenden Ball warfen und den dann auch noch verfehlten, immer mächtig turbulent zuging. Wenn man den vom Gegner geköpften Ball zurückköpfen konnte, gab es eine Art Elfmeter, das heißt, man durfte sich, war man selber mit dem Köppen dran, schon an der Mittellinie aufstellen.
»Los, anfangen!«
Uwe warf den Ball einen guten Meter hoch in die Luft und riß dann, als er wieder nach unten kam, den zurückgedrehten Kopf mit einer derart abrupten Bewegung herum, daß Manne und Kuki der schmutzig-grauen Filzkugel nur noch staunend hinterhersehen konnten.
»Tooor!«
»Neun-sieben!« schrie Uwe Bachmann, denn es kamen gerade ein paar Mädchen vorüber, und er war doch der Schönste von allen. Acht, neun Jahre später sollten sie sich streiten, mit wem er denn wohl mehr Ähnlichkeit hätte, mit Curd Jürgens oder Jean Marais.
Kein Wunder allerdings, daß er weit weniger spillrig und spack aussah als all die anderen, nicht so wie Braunbier mit Spucke, vom Purwin mal abgesehen, denn er war mit seinen Eltern gerade aus dem britischen Sektor gekommen, aus Spandau, und da hatte es eine große Verschickungsaktion nach Ostfriesland gegeben, die »Aktion Storch«.
Manfred und Kuki begannen sich zu streiten.
»Du holst jetzt den Ball!«
»Nee, war doch uff deine Seite, wo’a drinne wa’!«
»Los, da hinten am Zaun liejta!« Manfred stieß Kuki in die angegebene Richtung. Doch der hatte sich schon wie ein Terrier in Manfreds blauen Pullover verbissen und wollte ihn, den Kopf als Rammbock nutzend, zu Boden bringen.
»Los, Manne, ran, jib’s ihm!« schrien Uwe und Jünne.
Doch Manfred stand nur da wie gelähmt, denn ausgerechnet jetzt mußte die Karrassen an ihrer Schule vorbeikommen, Frau Karras, auch aus der Ossastraße 39, und wenn die auf der Treppe seine Mutter traf, dann gab die das sofort weiter, daß er sich wieder mal rumgeprügelt hatte.
Mach deine Sachen nicht kaputt, es gibt jetzt nichts zu kaufen!
Nach der Schule kommst du sofort nach Hause und treibst dich nicht wieder rum!
Was wußte er von den Ängsten und Nöten seiner Mutter? Nichts.
Mach nur weiter so!
Da keifte die Karras auch schon los, daß sie alles seiner Mutter erzählen werde, wie er die Kleineren wieder verprügelt hätte, ihr eigener Enkel traute sich ja kaum noch in die Schule.
Manfred machte sich von Kuki los und holte den Ball, war so wütend, daß er drei Tore hintereinander köpfte und sie doch noch zehn zu sieben siegten.
»Wat machen wa nu?«
Sie standen in der Rütlistraße, nahe ihrer Schule, und hatten die ganze Straßenbreite, die Bürgersteige wie den Fahrdamm zum Spielen, denn ein Auto kam hier kaum vorbei, Menschen auch nicht viele, denn rechts gab es bis zur Ossastraße hin nichts als Lauben und links lediglich den Bretterzaun vor einem »Autohof«, der zur Zeit total verödet war.
»Mein Schlüssel, Mann …!?«
Automatisch war sein Griff zum Hals gegangen, wie alle zehn Minuten, doch diesmal war die alte braune Strippe, an dem sie eben noch gehangen hatten, nicht mehr da.
Panik.
Schlimmer als damals, als Tiefflieger sie beschossen hatten.
Suchende Blicke aufs Kopfsteinpflaster runter. Lieber Gott, laß ihn da liegen! Doch keine Spur von seinen Schlüsseln.
Paß auf deine Schlüssel auf! Verlier nicht immer alles!
Wenn das so weitergeht mit dir, kommst du eben in die Erziehungsanstalt!
Da stand er da und heulte, und seine Klassenkameraden lachten nicht einmal, denn sie alle waren auch schon wegen irgendwelcher verlorengegangener Sachen fürchterlich verdroschen worden. Adolf Feiler zum Beispiel hatte sich gar nicht mehr nach Hause getraut, als ihm neulich auf dem Schulhof sein Essensträger geklaut worden war.
Manfred wünschte sich nur noch das eine, daß sich die Welt in dieser Sekunde zu drehen aufhörte, alles Leben einfror, ein Ende hatte.
Sein Freund Werner Ritter war es dann, der die Rettung brachte.
»Mensch, kiek doch mal uff’m Bauch nach …!«
Und richtig: Im ausgebeulten Hemd, vom Gürtel am Herabrutschen gehindert, steckten die Schlüssel, der längliche für das Türschloß oben und der kurze dicke, der Drücker.
Manfred machte einen weiteren Knoten in seine Strippe, und die Schlüssel kamen wieder um den Hals.
Inzwischen war eine Horde etwa gleichaltriger Jungen vom Schulhof gekommen, von Kohlenklau vertrieben, der das Geknödle herzlich haßte, und wollte ausgerechnet da ihr Fußballspiel fortsetzen, wo die andere Gruppe gerade beim Köppen war.
»Los, macht ’ne Fliege!« rief Wölfchen Karras, Enkel der Karrassen aus Manfreds Haus. »Wir sind zehne, ihr nur viere!«
Die beiden Parteien formierten sich schon, die Schlacht mußte jeden Augenblick beginnen. Die Folgen waren abzusehen: blutige Nasen, zerrissene Hosen, Dresche zu Hause. Andererseits: Wer sich nicht dauernd mit anderen prügelte, der war kein richtiger Junge.
Es ging los, indem man sich gegenseitig verhöhnte.
»Ihr seid ja zum Scheißen zu dämlich!«
»Und ihr könnt nich weiter denken, als ’n Bulle pißt!«
Und plötzlich hatte Kutte Lehmann einen grauen Pflasterstein vom Boden aufgehoben und schmiß ihn in Richtung Manfred, Uwe, Kuki und Jünne. Der Stein prallte aufs Pflaster, sprang mehr als einen Meter hoch und verfehlte Manfred nur um Haaresbreite.
Jetzt mußte es losgehen, doch da wurde Kutte von hinten gepackt, herumgerissen und kräftig gebeutelt.
»Du hast wohl den Verstand verloren, was!«
Frau Fahlenberg, vom Impfen zurück, hatte im letzten Augenblick Schlimmes verhindert.
»Könnt ihr nicht alle zusammen was spielen?«
Sie versprachen es und einigten sich nach einigem Hin und Her auf Wer hat Angst vorm schwarzen Mann. Frau Fahlenberg sah zu.
Kutte war der »schwarze Mann« und stand in der Mitte der Straße, während sich die anderen alle am Rinnstein aufgebaut hatten und warteten.
»Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?« schrie Kutte.
»Niemand!« brüllten sie.
»Und wenna kommt?« fragte Kutte.
»Dann kommta ebent!«
Damit liefen alle zum gegenüberliegenden Bürgersteig, und Kutte versuchte, einen von ihnen dadurch zu fangen, daß er ihm mit der Hand einen Schlag versetzte, irgendwohin. Ausgerechnet Manfred erwischte es als ersten, und er mußte beim zweiten Versuch mit Kutte zusammen den Jäger machen. Sieger wurde schließlich Jünne.
Beim zweiten Mal spielten sie das Ganze in der Variante Fischer, wie tief ist das Wasser, wobei Frau Fahlenberg Manfred zum ersten Fischer bestimmte.
»Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?« schrien die anderen.
»Hundert Meter!« rief Manfred, wobei die Zahl keine Rolle spielte.
»Wie komm wa’n rüber?«
»Auf einem Bein hopsen«, bestimmte er und bemühte sich im folgenden, einen der Hopsenden zu fangen und zu seinem Gehilfen zu machen.
Die meisten fanden aber, daß sie für diese Spiele schon zu groß waren beziehungsweise daß das eher etwas für die Mädchen war, und kaum war ihre Klassenlehrerin wieder verschwunden, ging der Streit von neuem los, denn die große Frage war, wer mit wem in welcher Mannschaft spielen wollte, spielen sollte. Fußball natürlich, watten sonst!? Jeder wollte gewinnen, jeder versuchte, mit den Stärksten in einer Mannschaft zu spielen, mit Kutte etwa, Jünne, Klaus Zeisig oder Krücke, vielleicht noch mit Manne, Dieter oder Hotte Rüscher, auf keinen Fall jedoch mit Bimbo, Vietzig, Werner Riese oder Pille Schönlein, denn die waren zwar sehr willig, aber dennoch große Flaschen, was das Fußballspiel betraf.
Schließlich kam man dahingehend überein, Kutte Lehmann und Krüger – olle Krücke – wählen zu lassen. Die stellten sich nun auf, reichliche fünf Meter voneinander entfernt, und setzten, abwechselnd immer, ein Bein vors andere. Tip-top hieß diese Art der Mannschaftswahl und war eine sehr bewährte Art, Konflikte zu lösen, hatte aber, so geregelt sie schien, dennoch zwei erhebliche Mängel. Zum einen blieben die nicht am Tip-top beteiligten Jungen für ein, zwei Minuten unbeschäftigt, und es gab immer einen unter ihnen, der sich den Ball jetzt blitzschnell untern Nagel riß und mit einigen anderen unkontrolliert zu kicken begann.
Diesmal war es Günther Halke, und dessen Versuch, zu Opa Waller zu flanken, endete damit, daß Krücke angeschossen wurde und strauchelte, das Tip-top-Verfahren also neu eröffnet werden mußte.
»Du Arschloch, du!« schrie Kutte, der sich schon als Sieger gewähnt hatte. »Ball her!«
Er griff sich den Ball, der entgegen seiner landläufigen Definition alles andere war als rund, fast nur noch aus grob aufgenähten Flicken bestand und furchtbar eierte, insbesondere wenn er länger als fünf Minuten nicht frisch aufgepumpt beziehungsweise aufgeblasen worden war. Blase und Lederhülle waren noch getrennt voneinander im Handel, das heißt, die Blase aus rotem Gummi, die aussah wie eine Wärmflasche, mußte durch einen länglichen Schlitz in die Lederhülle gesteckt und dann mit Hilfe eines angegossenen Schniepels aufgeblasen werden. Das konnte natürlich per Luftpumpe geschehen, aber an einer solchen fehlte es zumeist, so daß der Mitspieler mit dem größten Lungenvolumen in die Pflicht genommen werden mußte. Kutte oder Jünne Hahn zumeist. War die Blase ausreichend mit Luft gefüllt, wurde der Schniepel abgeklemmt, mit einer kleinen Strippe zugebunden und in den Ball bugsiert, dessen Lederhülle zu guter Letzt mittels eines Lederriemchens von Schnürsenkelstärke und -länge wie auch einer Schusteraale zugeschnürt wurde. Diese Prozedur dauerte gut und gerne zehn Minuten, machte sie aber alle auf das Spiel erst richtig heiß. Der Ball stammte, obwohl manche das bestritten, sehr wohl aus dem laufenden Jahrhundert, hatte aber schon – so um 1905 herum – bei der Gründung des ersten BBC Südost eine Rolle gespielt. Manfreds früh verstorbener Großvater war dabeigewesen und hatte ihn mit nach Schmöckwitz genommen und dort als Reliquie seiner Jugendzeit gelagert – bis ihn sein Enkel bei der Verfolgung einer flüchtigen Jungratte durch Zufall entdeckt hatte.
Es folgte ein neuer Versuch der beiden ausgewählten Mannschaftskapitäne, sich das Recht der ersten Wahl per Tip-top-Sieg zu sichern. Nun schafften sie es tatsächlich, sich ordnungsgemäß bis auf eine Distanz von etwa anderthalb Metern zu nähern; Kutte mit seinen ausgelatschten Stiefeln Marke Kindersarg und olle Krücke mit seinen weinroten Mokassins, von seiner Oma aus dem dünnen Leder selbst genäht, das sein Bruder vor Tagen aus einem U-Bahnsitz herausgeschnitten hatte.
Jetzt aber wurden sie sehr heftig mit dem zweiten Problem konfrontiert, das nun mal im Tip-top-Ritual verborgen war: Nur ganze Füße oder auch halbe? Sieger war nämlich der, der seinen Schuh als letzter in die Lücke setzen konnte, die zwischen den beiden Kontrahenten zwangsläufig blieb.
Kutte hatte seinen rechten Stiefel vor den linken gesetzt, den Hacken fest gegen dessen Spitze gepreßt, und olle Krücke mußte nun versuchen, seinen linken Mokassin noch dazwischenzubekommen.
Ging aber nicht, was so klar wie Kloßbrühe war.
»Nimmste ’n halben, det jeht noch!« schrie Manfred, der ganz auf Seiten von Karl-Heinz Krüger war.
»Det war nich ausjemacht vorher!« protestierte Wölfchen Karras, der Kuttes Parteigänger war.
Krücke Krüger schaffte es zwar, seinen Schuh quer in die Lücke zu zwängen, doch Kutte weigerte sich strikt, dieses hinzunehmen. Eher neigte er dazu, die große Schlacht endlich zu schlagen.
Doch die Mehrheit der Jungen wollte dann doch lieber Fußball spielen als sich kloppen, und so wurde nach langem Palaver mehrheitlich entschieden, daß nun beim nächsten Anlauf auch halbe Füße zählen sollten, aber keine viertel, also nicht die senkrecht aufgestellten Schuhspitzen.
Jetzt klappte es tatsächlich, Kutte gewann und wählte sich Jünne dazu, dabei schon in Jubel ausbrechend, denn sie galten als ungemein gefährliches Duo.
Manfred hoffte, daß sich Krücke nun bei seiner ersten Wahl für ihn entscheiden würde, und war dann ziemlich traurig, als er nach langem Zögern Klaus Zeisig zu sich rüberzog. Fehlte bloß noch, daß er jetzt bei Kutte spielen mußte.
Laß dich bloß mit dem nicht ein! Was der immer für Ausdrücke hat! Und sein Vater, das ist vielleicht ’n Schubiak!
Doch Manfreds Angst war gänzlich unbegründet, denn Kutte entschied sich zuerst für Wölfchen und dann für Uwe, während Krücke ihn dann doch, wenn auch erst nach dieser Pflaume von Werner Riese, in seine Mannschaft berief.
Immerhin war es ihm erspart geblieben, als einer der letzten bedript herumzustehen, dem Spott der anderen preisgegeben, denn irgendwann einmal kamen die beiden Kapitäne zu dem Schluß, nun stark genug zu sein und keinen mehr zu brauchen, wußten aus leidvoller Erfahrung, daß manche Klassenkameraden, spielten sie mit, den eigenen Sieg aufs höchste gefährdeten, ihnen bei ihren Slalomläufen ständig im Wege standen und Mal für Mal nichts als Selbsttore schossen.
So rief denn Kutte auch bald: »Den Rest, den könnta ham!«
Doch Krücke tippte sich nur an die Stirn. »Du hast se wohl nich mehr alle!«
Nun ging der Streit schon wieder los, diesmal um die Verteilung der Übriggebliebenen, als da waren: Bimbo, Vietzig, Halke, Pille Schönlein und Opa Waller.
Bimbo löste das Problem auf seine Weise, erklärte, nicht mehr mitspielen zu wollen, und trottete fröhlich nach Hause, mochte lieber Schularbeiten machen und auf seinem Harmonium neue Lieder üben. Mit seinen schlabbernden Hosen aus grünem Wehrmachtstuch verschwand er hinten in der Weserstraße – ein liebenswertes Elefantenbaby.
Die anderen vier blieben hartnäckig dabei, mitmachen zu wollen, und wurden nach längerer Debatte beiden Mannschaften zu gleichen Teilen zugeschlagen.
Nachdem auch noch die Frage geklärt worden war, wer denn den Anstoß haben sollte (»Wir natürlich!« – »Nee, mittem Fennich!«), konnte es endlich losgehen.
Kutte zu Kuki, der zurück zu Wölfchen, Paß zu Uwe, Flanke und Kopfballtor durch Kutte. Jubel bei den einen, Wutausbrüche bei den anderen.
»Werfen mußte dir!« schrie Krücke seinen Torwart an, Horst Rüscher, der Kuttes »Bombe« nur noch verdattert nachgeblickt hatte.
Das war das Kriterium dafür, ob ein TW, Torwart also, gut war oder nicht: Stand er bloß herum und streckte seine Arme aus, wenn ein Ball aufs Tor geflogen kam – oder hechtete er der heraneiernden Kugel mutig entgegen? Tat er es, so hatte er neben dem Beifall seiner Kameraden in der Regel auch noch zerschundene Knie und Ellenbogen zu verzeichnen, Schürfwunden, die dann fürchterlich eiterten und seine Mutter zur Verzweiflung brachten.
Hotte also hatte sich nicht zu werfen gewagt und mußte nun zur Strafe bis weit hinten zur Weserstraße traben, um den durchgelassenen Ball wieder zu holen.
Abschlag vom rechten Pfosten, einem Gebilde aus Krückes und Manfreds Schulmappen sowie ihren noch gefüllten Essensträgern.
Gegenangriff durch Krücke Krügers Mannschaft. Manfred schlug den Ball zu Werner Riese, und der ließ ihn nur abtropfen, so daß Krücke zu einem seiner berühmten Dribblings ansetzen konnte. An Kuki zog er elegant vorbei, dann an Wölfchen und Uwe, schaffte es sogar, Kutte auszutricksen, indem er ihm den Ball schnell durch die weitgespreizten Beine spielte, doch dann kam überraschenderweise Opa Waller auf ihn zugelaufen, die größte Krampe weit und breit, und schlug den von Krücke leicht gelupften Ball mit seiner rechten Hand ins Aus, das heißt in die angrenzenden Lauben hinein.
»Elfer!« schrie Kutte.
»Quatsch, das is doch unsa Torwart!«
»Aba nich so weit vorm Tor, da isset Hand!«
Was tun, einen Schiedsrichter hatten sie ja keinen. Krücke beharrte auf seinem Elfmeter, Kutte dagegen wollte nichts anderes hinnehmen als einen Einwurf.
Manfred schaffte es schließlich, Kutte dahin zu bringen, für diesmal nachzugeben.
»Mensch, gönn uns doch den Elfer, ihr seid ja sowieso die Stärkeren!«
Da Opa Waller das nicht schaffte, mußte Wölfchen statt seiner über den Zaun klettern, um den Ball zurückzuholen, und entging dem Krückstock eines erbosten Invaliden, der um seinen Grünkohl fürchtete, nur durch schnellen Rückzug.
»Ick sach det euerm Rektor, da könnta Jift druff nehm’n!«
Unbeirrt von diesen und ähnlichen Zurufen, hämmerte Krücke dem Gegner den Ball zum 1:1 ins Tor; da nutzte es auch nichts, daß man Opa Waller schnell herausgenommen und durch Kutte selbst ersetzt hatte.
Manfred war nicht gerade ein begnadeter Fußballer. Schnell war er zwar, aber ziemlich ungelenk, Turnen Fünf. Selten gelang es ihm, sich bis zur Nähe des gegnerischen Tores durchzufummeln, schaffte er es aber wirklich einmal, dann folgte zumeist keine Bombe oder Granate, sondern nur ein mattes Schüßchen, denn, wie hatte sein Vater immer gesagt: Ein Spatz hat Beene, bloß Waden hat er keene.
Dennoch, heute war schon sein erster Schuß ein voller Erfolg, denn der Ball traf Kohlenklau, der sich gerade, die abgewetzte Aktentasche in der Hand, nach Hause absetzen wollte, mitten ins Kreuz.
»Wer war das!?«
Natürlich keiner. Großes Schweigen.
»Entschuldigung, Herr Rektor!« sagte Werner Riese. Er konnte das tun, denn er war jenseits jeden Verdachts.
»War doch keene Absicht bei …!« ergänzte Pille Schönlein.
Kohlenklau-Schaller sah sie der Reihe nach an, und sein Blick hakte sich an denen fest, die ihn am meisten an die Hitlerjugend-Zeit erinnerten: Hotte Rüscher, Peter Grau und Manfred auch. Schlanke, blonde Jungen mit kurzen Haaren. Sein Gesicht verzog sich, wurde böse-inquisitorisch, und die drei schwitzten vor Angst, bekamen scharlachrote Flecken am Hals und hinter den Ohren.
»Ach was, ihr könnt doch nichts dafür …!« sagte Schaller schließlich, drehte sich um und verschwand zur Sonnenallee hin, der früheren Braunauer Straße, zu Zeiten des Führers nach seinem Geburtsort benannt.
Manfred ahnte dunkel, warum der Mann ihn haßte, hing doch alles irgendwie mit den Nazis und dem Krieg zusammen, und er erinnerte ihn irgendwie an seinen Onkel Berthold, der zwölf Jahre im KZ gesessen hatte.
Weiter im Spiel. Zu ihrer großen Überraschung war ihnen ja der Ball nicht abgenommen worden.
Kutte, Jünne und Uwe spielten nun so toll wie ihre Helden von Schalke 04: Kalwitzki, Szepan und Kuzorra. Die, ihren Schalker Kreisel und den legendären 9:0-Sieg über Admira Wien im Jahre 1939 hatten sie neulich einmal in einer alten Wochenschau gesehen. Sie führten schließlich 9:6, und bis zehn gingen alle ihre Spiele. Nach Zeit zu spielen, ging nicht, denn sie alle hatten keine Armbanduhr, und die große Schuluhr war, ebenso selbstverständlich, noch immer kaputt.
Kutte, der große Sturmtank, war wieder durchgebrochen und von Werner Riese mit einer ungeschickten Bewegung zu Boden gerissen worden. Elfer natürlich.
Man beschloß, Hotte Rüscher aus dem Tor herauszunehmen und an seiner Stelle Manfred einzusetzen, denn der hatte neulich im Spiel gegen die Großen der 4 b glänzend gehalten.
Manfred bezog seinen Posten auf der Torlinie, dem schwarzen Strich, der sich ergeben hatte, nachdem sie mit den Schuhspitzen den Sand und Dreck zwischen den Pflastersteinen herausgekratzt hatten, und er bückte sich katzenhaft-lauernd nach unten.
»Konzentrier dir, Manni!« schrie Krücke. Kuttes Schuß kam, sollte, von Manfred aus gesehen, flach am rechten Pfosten vorbei über ihre Torlinie flitzen, unhaltbar sein. Doch Manfred hatte die richtige Ecke gerochen, kippte gedankenschnell nach unten weg, peng, wie eine Holzfigur auf’m Rummel, ließ zugleich den rechten Arm nach draußen zucken und bewirkte damit dreierlei: erstens daß der Ball abgelenkt wurde und meterweit das Tor verfehlte. Zweitens daß die beiden hingepackten Ranzen mit großer Wucht in Richtung Rinnstein rutschten, und drittens schließlich daß sein Essensträger im hohen Bogen durch die Gegend flog und dann beim Aufprall auf das Stuckerpflaster prompt den stets zu lockeren Deckel einbüßte.
»Nein, nicht doch!«
Im Nu hatte sich der ganze schöne Inhalt auf die Straße ergossen, und wie zum Hohn platschte der zurückprallende Ball auch noch in die nahrhaft-süße rosa Pampe rein.
Manfred blieb da liegen, wo er lag, wollte nie mehr aufstehen. Alles dahin. Nichts für seine Mutter, wenn sie abends ausgehungert von der Arbeit kam.
Werner Ritter war es dann, der ihm wieder auf die Beine half.
»Kriegste meinen Nachschlag, wenn de mir deinen Magneten dafür jibst …!«
»Ja, mach ick.«
Manfreds Vater hatte, bis er eingezogen worden war, in den letzten Kriegstagen noch, beim RPZ gearbeitet, dem Reichspostzentralamt, und in seiner Freizeit fleißig Radios gebastelt. Von den übriggebliebenen Lautsprechern hatte Manfred inzwischen die Magnete abmontiert, kleine Hufeisen, um dafür begehrte Dinge einzutauschen, zum Beispiel ein paar Schienen für seine Eisenbahn oder geeignete Halmafiguren für seine diversen Fußballmannschaften, die er auf dem Teppich um den Berliner Meistertitel kämpfen ließ. Schmerzlich nun, daß er einen dieser Magneten für Werner Ritters Nachschlag opfern mußte, aber unmöglich für ihn, seiner Mutter nichts mit nach Hause zu bringen.
Tauschen war ohnehin die große Leidenschaft seiner Klassenkameraden wie der Jungen auf der Straße. Erst gestern hatte er erhebliche Teile seines Stabilbaukastens gegen eine alte Ritterburg getauscht. Von den Eltern war das Tauschen in der Regel streng verboten worden, doch das interessierte im Zweifelsfalle keinen, und wenn der Befehl kam: »Los, geh runta, das tauschste sofort wieder zurück!«, dann war das immer verlorene Liebesmüh. Was wußte seine Mutter schon, welchen Wert für ihn ein altes Kugellager hatte: Da waren Dutzende von kleinen Stahlkugeln drin, die sich wunderbar als Bälle für seine hölzernen Teppichkicker eigneten. Mußte sie ihm deswegen eine runterhauen, weil er Dieter Purwin ein solches Kugellager gegen seinen alten Roller abtauschen wollte? Sicher, der war von seiner heißgeliebten Tante Gerda, hatte aber Räder aus Holz, die furchtbar eierten, mehr oval waren als rund. Außerdem waren das ja die allerersten Verse gewesen, die er gelernt hatte: Tausche abgelegte Braut gegen ein Pfund Sauerkraut. Oder: Tausche Pythonschlange gegen Blutwurst, möglichst lange.
Nun, das Tauschgeschäft Magnet gegen Nachschlag war schnell erledigt, noch bevor Kutte seine Truppe mit dem zehnten Tor endgültig zum Sieg geschossen hatte. Und nun gingen sie wirklich alle nach Hause.
Von seinen Klassenkameraden wohnte glücklicherweise auch Kuki in der Ossastraße, und deshalb war es nicht ganz so gefährlich, an der Jansastraße vorbeizulaufen. Davor hatte Manfred immer einen riesigen Bammel, denn mit der Jansa-Clique hatte sich die Ossa-Clique erst letzte Woche fürchterlich geschlagen; einem aus der Gruppe hatten sie das Schlüsselbein gebrochen. Oder doch das Nasenbein? Egal, die Rache der Besiegten war zu fürchten.
Doch diesmal gab es keinen, der ihnen irgendwo aufgelauert hätte. Sie kamen von der Weser- in die Weichselstraße. Eine Menge Flußnamen gab es hier in Neukölln; dichtebei noch die Fulda- und die Elbe-, die Werra-, Inn- und Donaustraße. Da war es logisch, daß sie die kleine Ossastraße, die zwischen der Weichsel … und der Fulda … lag – das angehängte …straße verschluckten sie meist –, nach einem Nebenfluß der Weichsel benannt hatten. Kein Schwein kannte ihn, nur die Ossastraßen-Kinder. So was lernte man bei Halli-hallo, jenem sehr beliebten kombinierten Fang- und Ratespiel, wo einer, wenn er an der Reihe war, einem anderen den Ball zuwarf und dabei schnell eine Frage stellte, zum Beispiel: »Ein Fluß in Westpreußen mit O…?« Wenn das Wort geraten war, warf man den Ball so kräftig auf den Boden, daß er hochsprang, und lief dann weg. Wußte einer die richtige Antwort, rief er »Halt!«, und der Fragesteller mußte stehenbleiben und die Hände so vor den Bauch halten, daß sie einen offenen Kreis bildeten. Schaffte der andere es, den Ball in diesen offenen Kreis zu werfen, durfte er als Nächster eine Frage stellen.
Ossa also, Ossastraße.
Obwohl sie keine vier mal hundert Meter maß, zerfiel sie bei den Jungen dennoch geographisch in drei Teile, die allerdings auf keiner Karte so hießen: Die große Ossastraße, das war das Stück zwischen Fulda- und Weichselstraße, und zweimal die kleine Ossastraße, das heißt, die beiden Sackgassen, die sich jenseits der beiden genannten größeren Straßen noch ein Stückchen in die angrenzenden Laubenkolonien hineinschoben. Fulda-/Ecke kleine Ossastraße, da war dann auch, was das Spielen und Stromern betraf, der schönste Spielplatz, den es gab: eine Riesenruine. Zu ihrem Leidwesen fanden sich in ihrer Gegend nicht viele davon, und sie mußten manchmal ganz schön wandern, um mitzuerleben, wenn wieder eine eingerissen wurde.
Sie trabten nun Richtung Ossastraße, machten nur noch kurz halt bei Heidt, dem Laden an der Ecke vor ihnen, wo es Schreib- und Spielwaren gab, vor dem Krieg jedenfalls gegeben hatte. Die ehemaligen Schaufenster waren mit Brettern vernagelt, verglast war lediglich ein Stückchen von Handtuchgröße. Und sosehr man sich auch die Nase an dem bißchen Scheibe plattdrückte, drinnen war nichts als ein staubiges Tuch zu entdecken, auf dem ein paar Schreibhefte lagen, die Kornfelder, Garben und Traktoren zeigten.
Dennoch: Ein Laden war für Manfred das Größte, was es gab. Dazustehen, Dinge zu verkaufen. Zu Hause hatte er einen wunderschönen Kaufmannsladen, von seinem Urgroßvater, der Kunsttischler war, vor Jahrzehnten gebastelt. Der große Traum seines Lebens war es, einmal einen richtigen Laden zu haben, ein Geschäft. Er bewunderte und glorifizierte sie alle: Rausch, den Schlächter, und Tietz, den Frisör, beide noch in der Weichselstraße, oder Kuschel, den Blumenhändler Weichsel-/Ecke Ossastraße, und dann in seiner Straße selber: Frau Scheinert, Zigarren/Zigaretten, Wolter, der Schuster, Kunitz, der Bäcker, mit Vornamen Alfons, Fischer, Obst und Gemüse, Elektro-Krause an der Ecke Fuldastraße. Nicht zu vergessen Kraft, der in seinem Seifenladen die größte Attraktion weit und breit zu bieten hatte: eine elektrische Rolle, und im eigenen Hause Fräulein Krahl, Milch-Butter-Käse.
Er träumte öfter davon, deren Sohn zu sein; es mußte herrlich sein, aufzustehen, nur ein paar Schritte zu gehen und dann gleich vorne im Laden zu sein, ein bißchen Wurst naschen, sich eine Schrippe nehmen oder ein paar Bonbons.
Kuki schlug vor, einen kleinen Umweg zu machen und die Ossastraße quasi von hinten zu betreten, von der Fuldastraße her, denn im Hause an der Ecke, da, wo der Blumenladen war, wohnte Norbert, und der hatte versprochen, sie heute mächtig zu vermöbeln. Norbert nahm einen, den er nicht leiden konnte, preßte ihn gegen die Wand und schlug so lange auf ihn ein, bis er zusammensackte. Seine Eltern waren tot, und seine Oma wurde nicht mehr mit ihm fertig, ließ sich ihren Enkel aber auch nicht nehmen. Norbert quälte sie, schlug sie, klaute ihnen die Spielsachen und machte ihnen alles kaputt, was sie sich bauten, und sie hatten ihm alles zu geben, was er haben wollte: Groschen, Murmeln, Bälle und so weiter.
Doch sie hatten Glück, Norbert war nirgendwo zu sehen.
»Paß uff, der hat sich wieda im Hausflur vasteckt …«, fürchtete Kuki.
Manfred machte sich klein und hoffte mit demselben Fatalismus, den vor kurzem noch die Erwachsenen im Luftschutzkeller zeigten, daß er noch mal verschont bleiben würde.
Sie kamen glücklich zur Mitte der Straße, zur Nummer 39, und Kuki, der ein paar Häuser weiter wohnte, stob davon; sein großer Bruder schrie bereits nach ihm, wo er denn so lange bliebe.
Manfred stand alleine da, verloren, ein Häufchen Elend.
Seine Mutter steckte in der Krankenkasse, Kilometer entfernt, seine beiden Großmütter noch weiter weg. Sein Vater saß irgendwo in Rußland in der Kriegsgefangenschaft, und das war für ihn gänzlich außerhalb der Welt.
War denn sicher, daß seine Mutter noch lebte? Vielleicht war das auch nur ein Vorwand, daß sie wieder arbeiten wollte, vielleicht saß sie längst im Zug und fuhr weit weg …?
Er hatte nicht mehr die Kraft, den Hausflur zu durchqueren, mußte sich auf den Rinnstein setzen, den Essensträger abstellen. Ein Stückchen Mauerstein fand sich, und er malte ein Häuschen aufs Pflaster, aus dessen Schornstein viel Rauch nach oben stieg.
Hinter ihm trafen sich vier Frauen vor Fräulein Krahls Laden, begannen zu reden und zu tratschen, versperrten auch den Hauseingang daneben.
»Haben Sie schon gehört«, sagte Frau Lewandowski, »hier in der Fuldastraße hat sich wieder ’ne junge Frau das Leben genommen, einfach Schluß gemacht, den Gashahn aufgedreht!«
»Wennse ma bloß alleene bei druffjehn würden, dann wärt ja jut!« fiel Frau Roggensack ein, ihre Hauswartsfrau. »Aba nee: Da jibt det ja meistens noch ’ne Explosion, und andre jehn mit hops!«
»Wieda een Essa wenija …«, brummte die Karrassen und klopfte sich auf ihre Hüften. »Man is ja bloß noch Haut und Knochen!«
Manfred staunte. Für ihn war die Olle imma noch janz schön fett.
»Morjen jeh ick bei meine Schwäjerin«, sagte Frau Roggensack. »Die ham ’n Karnickel jeschlachtet; da jibt et endlich wieda mal wat richtijet zu präpeln!«
»Passen Sie bloß auf«, wurde sie von Frau Reinicke daraufhin gewarnt, »man weiß ja nie genau, was man da auf dem Tisch hat: Ist es nun ein Stallhase, oder ist es ein Stück von einem Gaul, der irgendwo notgeschlachtet worden ist …? Oder ist es sogar einer, mit dem sie gestern noch nach Kartoffeln angestanden haben …!?«
»Ja, ja …!« seufzte Frau Lewandowski. »Es soll’n ja Tag für Tag Menschen spurlos vaschwinden, vor allem Kinder …«
Manfred hatte das Gefühl, daß um ihn herum alles dunkel wurde und von oben, von den Dächern herab, ein großer Rüssel herunterkam und ihn hineinsaugte in ein schwarzes Nichts, dahin, wo nichts mehr war, wo er nichts mehr fühlte, keine Angst mehr und auch keine Freude.
Da gab es kein Entrinnen.
Er wollte aufspringen und Frau Lewandowski fragen, ob er mit ihr mitkommen könnte, doch er traute sich nicht.
Du gehst mit keinem mit!
Warum denn nicht?
Es gibt so viele Menschen heute, die mit Kindern ganz was Schlimmes anstellen!
Kutte hatte heute morgen in der Klasse erzählt, bei ihnen im Block sei ein Junge verschwunden und dann hätten sie ihn in die Wurstmaschine gesteckt.
Manfred beschloß, so lange hier draußen auf dem Kantstein sitzenzubleiben, bis seine Mutter von der Arbeit kam; hier auf der Straße war er noch am sichersten. Zu essen hatte er ja. Und Schularbeiten konnte er zur Not noch später machen. Die Strafarbeit, hundertmal: »Ich soll meinen Lehrer nicht nachäffen!«
Warten mußte er ja sowieso, bis Frau Roggensack verschwunden war, denn an der traute er sich nur im äußersten Notfalle vorbei, seit sie ihn in Verdacht hatte, ihr eine Stinkbombe in den Keller geworfen zu haben. War er aber nicht gewesen, er hatte nur das Stückchen alten Film gespendet, das man dazu brauchte. Sein einer Großvater war mal im Nebenberuf Filmvorführer gewesen, und draußen bei seiner Schmöckwitzer Oma, da lag noch einiges an alten Filmrollen im Schuppen. Man mußte einen halben Meter von diesem Zelluloid nehmen, ganz fest wickeln und dann Zeitungspapier rummachen wie bei einem Knallbonbon. Wenn das dann kurz angezündet und schnell wieder ausgetreten wurde, gab es gewaltig Rauch und Gestank.
An Frau Roggensack konnte er sich also nicht wenden und sie bitten, ihn mit nach oben zu nehmen, auch nicht an die Karrassen, denn die würde ihn nur wieder an den Ohren reißen und dann loskeifen: »Wenn du dich noch einmal an meinem Wölfchen vergreifst, dann schlage ich dich windelweich!«
Blieb also doch nur wieder Frau Lewandowski, die mit ihnen auf einer Treppe wohnte, auf derselben Etage also. Aber die mußte noch zu einer Stelle, wo sie einen Interzonenpaß beantragen konnte.
So saß Manfred mehr als eine Stunde vor dem Hauseingang und hatte Angst hineinzugehen. Garantiert stand da einer und fing ihn weg. Den Arm um den Hals, bis er keine Luft mehr kriegte, und dann ab in die Wurstmaschine.
Das ist doch alles gar nicht wahr!
Wenn nun aber doch …?
Von unten wurde es nun ziemlich kalt. Erkält dir nicht die Nieren! Das war es aber nicht, was ihn schließlich doch zum Aufstehen und Hinaufgehen brachte, es war vielmehr die Tatsache, daß er nun ganz dringend einen Haufen machen mußte. An einen Baum puschen, das ging ja noch an, aber sich in seinem Alter jetzt hier hinzuhocken und zu kacken, nee! Blieb ihm also nur die Wahl, sich entweder in die Hosen zu machen oder aber nach oben auf die Toilette zu gehen.
Um die Haustür aufzudrücken, mußte er sich mit seiner ganzen Kraft dagegenwerfen. Sie war nicht nur aus schwerem Holz gefertigt, sondern an ihrer oberen Kante auch mit einem Schließzylinder versehen, der sie ständig an den Rahmen preßte und nur schwer zu überwinden war. Das obligatorische Tür zu! war eigentlich überflüssig.
Manfred hatte also einige Mühe, sich in den Hausflur zu quetschen. Ein extra Schlüssel war noch nicht vonnöten, den hatte er auch gar nicht, durfte ihn nur abends nehmen, wenn er späte Gäste runterbringen mußte. Das Hantieren mit diesem Durchsteckschlüssel war dann jedesmal eine entsetzliche Sache; aber noch hatten sie ja frühen Nachmittag.
Er schritt also durch den Flur des Vorderhauses Ossastraße 39 und hatte dabei in dessen Mitte fünf, sechs Stufen hinaufzusteigen, eine Art Podest zu erklimmen, von dem aus man die beiden Parterrewohnungen wie auch die Treppe nach oben erreichte. Da hing dann auch der Stille Portier, die traditionelle Tafel mit den Namen aller Hausbewohner. Natürlich auch O.Matuschewski, Gartenhaus, 3 Treppen, Mitte links. Der Garten, der aus dem proletarischen Hinter- ein gutbürgerliches Gartenhaus machen sollte, bestand aus ein paar räudigen Büschen und einem ewig eingehenden Laubbaum, der von einigen für eine Linde, von anderen wieder für eine Eberesche ausgegeben wurde.
Da hatte doch eben etwas geraschelt …!?
Manfred verhielt und lauschte. Schon immer hatte er gewußt, daß hinter den beiden Mauervorsprüngen links und rechts jemand auf ihn lauerte. Etwa ein Mann mit einem großen schwarzen Tuch in der Hand. Das bekam er dann um den Kopf geworfen, so daß er nicht mehr schreien konnte.
Laß dich von keinem ansprechen, geh mit keinem mit. Da sind überall Männer, die Jungens mit zu sich nach Hause nehmen und sie …
Frau Reinicke war es dann, die oben aus der Tür kam und schnell nach unten lief, ihn damit rettete. Er machte artig einen leichten Diener und grüßte so, wie Omas und Mütter es wünschten. »Guten Tag, Frau Reinicke …«
»Guten Tag, Manni.«
Manfred machte ihr Platz und sprang sogar nach unten, für sie die Haustür aufzureißen.
Hätte er das nicht getan, wäre diese kleine Missetat seiner Mutter bei der nächstbesten Gelegenheit ganz sicher hinterbracht worden und hätte ihm wieder einen Tadel eingetragen.
Aber abgesehen davon, es gehörte sich ganz einfach so, daß man den Leuten aus dem Vorderhaus mit Respekt entgegentrat. Die hatten ja sogar eine Badewanne. Ganz abgesehen mal vom Balkon nach vorne raus. Kein Zweifel, daß sie allesamt was Besseres waren, Frau Zech, Frau Reinicke und wie sie alle hießen.
Ein wenig noch unter Frau Reinickes Schutz schaffte er es dann, den Vorderhausflur ohne Zögern zu durchqueren, kam glücklich auf den Innenhof hinaus, der nichts anderes war als eine enge graue Schlucht. Hinter sich hatte er die rückwärtige Fassade des Vorderhauses, vier Stockwerke plus Parterre, und vor ihm ragte sein Hinter- oder Gartenhaus hoch in den märkisch-blauen Himmel, von genau derselben Höhe. Deutlich erkannte er die letzten Tomaten oben auf ihrem Balkon, ganz rechts außen, da wo schon der Giebel des Quergebäudes vom Nachbarhaus begann. Der schloß ihren Hof nach Osten hin ab, während man in der anderen Richtung, da es dort keine Seitenflügel mehr gab, über viele Grundstücke hinweg bis zur Weichselstraße blicken konnte.
Da die vier eckigen Müllkästen für die zwei Dutzend Mietparteien nicht reichten, glich der Hof in seinem hinteren Teil, da wo es zu den Kellerräumen ging, so ziemlich einer kleinen Müllhalde.
Kein Grund für Dieter Zettgries, den Jungen in der Wohnung unter ihnen, nicht auf einem der Müllkästen zu sitzen und S-Bahn zu spielen. Täuschend ähnlich ahmte er das immer höher werdende Brummen der anlaufenden Motoren nach, bis er dann, nach einer gewissen Leer- und Auslaufphase, seinen Vollring dadurch zum Stehen brachte, daß er am Griff des benachbarten Müllkastens riß und gewaltig Bremsluft herauszischen ließ.
»Neukölln! Neukölln! Ring über Treptower Park, Ostkreuz und Schönhauser Allee. Nach Grünau 13. Uhr 10 vom selben Bahnsteig. Einsteigen, bitte!«
Manfred ließ sich das nicht zweimal sagen und sprang auf den äußeren der Müllkästen, nahm es sogar hin, für diese Fahrt einen eisernen Reichspfennig bezahlen zu müssen.
Dieter Zettgries war die Rettung! Die leere Wohnung oben, unheimlich und drohend. Aber wenn er Dieter Zettgries zum Spielen mitnahm, dann war ja alles halb so schlimm.
Du bringst mir keinen mit rauf, wenn ich nicht da bin!
Ach was!
Doch es wurde nichts mit seinem schönen Plan, denn wenig später kamen Dieter Zettgries’ Eltern, um ihn mit aufs Feld zu nehmen, wie sie ihren kleinen Garten in einer Britzer Laubenkolonie immer nannten.
Manfred nahm jetzt seinen ganzen Mut zusammen, um nun auch noch den zweiten Hausflur zu passieren. Solange er auf dem Hof unten stand, war er sicher, denn da hörten ihn die Leute, wenn er schrie. Wenn er nun die Tür zum Hinterhaus, die viel popliger war als die vorne an der Straße, mit einem kleinen Hölzchen festklemmte, dann konnten sie es auch hören, wenn er oben auf der Treppe war. Er tat es, und es machte ihm die ersten Schritte in den dunklen Schlauch hinein wesentlich leichter.
Ein schneller Druck auf den Schalter, und es knackte auch irgendwo in der Wand, doch da die Glühbirne oben an der Decke natürlich wieder mal im Eimer war, nutzte es wenig.
Vor ihm auf halber Treppe war ein kleines Fenster offen, und dessem Lichtfleck strebte er entgegen. Links und rechts hinter den Türen hörte er Stimmen und Schritte, und er war sich eigentlich sicher, daß eine von ihnen gleich aufgehen mußte. Da wohnten Leute, die seiner Mutter sehr suspekt vorkamen. Da gab es Andeutungen, die ihn an die Schauergeschichten aus Grimms Märchen erinnerten.
Wenn die Tür aufging, packten sie ihn und zerrten ihn nach drinnen, um ihn zu schlachten.
Er kriegte keine Luft mehr, wie ein Taucher tief unter Wasser. Oben das rettende Licht.
Er stolperte und fiel, gab sich schon verloren, raffte sich noch einmal hoch und erreichte das Fenster, steckte schweratmend den Kopf ins Freie hinaus.
Nun war das Schlimmste überstanden, vorerst einmal, denn im ersten Stock wohnte zwar Frau Karras, doch die war ja weg, und außer ihr noch Dehnhardts, die er nicht zu fürchten brauchte. Mit Horst Dehnhardt spielte er des öfteren, und Uschi war seine Freundin vom Luftschutzkeller her; sein Bärchen hieß seitdem wie sie.
Es gab immer vier Parteien pro Treppe, doch die anderen, die noch hier wohnten, interessierten ihn nicht.
Im zweiten Stockwerk residierte die Hauswirtin, und die lauerte immer wie eine Spinne im Netz auf ihn, weil er ständig irgend etwas ausgefressen hatte. Doch die Roggensack war ja ebenfalls noch unterwegs, konnte also nicht herausgeschossen kommen und ihn anbrüllen: Auf dem Hof wird nicht gespielt! Oder: Wenn du noch mal ’ne brennende Zeitung aus’m Fensta werfen tust, dann is aba der Jrüne da! Womit sie den Schutzmann meinte.
Auf dem Absatz zwischen dem zweiten und dem dritten Stock machte er abermals Pause, denn dicht neben dem Fenster war vor kurzem ein Flatschen Putz von der Decke gefallen, und da galt es nun, die kleinen Brocken nach unten in den zweiten Hof zu werfen, wo die Klopfstangen standen und Piepenburg seine Kaninchenställe stehen hatte. Dahinter kam dann, von einer Mauer begrenzt, ein Hof und, hinten am Weichselplatz gelegen, ein großes Fabrikgebäude aus gelbem Backstein, das Kraatzer oder so gehören sollte, ihrem Hauseigentümer, bei dem sie allmonatlich ihre Miete abzuliefern hatten.
Das Treppenfenster hatte den Krieg ohne großen Schaden überstanden, zeigte sich noch immer fast feudal mit buntem Glas in Blei, war nur rechts oben mit einem Stückchen Drahtglas und unten links mit einem dicken Brett geflickt.
Manfred machte Zielübungen, versuchte, ins schlammige Quadrat des ehemaligen Feuerlöschbeckens zu treffen, und hatte so viel Erfolg, daß er in seiner zweiten Serie den großen Hauklotz anpeilte.
So versunken war er in sein Spiel, daß es ihn fast aus dem Fenster warf, als plötzlich ein paar Stufen unter ihm Frau Roggensack loszudonnern begann.
»Hörste wohl uff, du Drecksack, du! Immer Steine uff die Karnickelställe schmeißen, wa!? Wenn ick deine Mutta sehe, do, dann kannste aba …!«
Manfred konnte gerade noch nach oben entkommen, ehe er gleich auf der Stelle ’n paar geknallt bekam.
Frau Roggensack schickte ihm noch einige laute Worte hinterher, die seine maßlose Verkommenheit betrafen, dann zog sie sich in ihre Wohnung zurück.
Auf dem letzten Treppenabsatz stank es fürchterlich, denn Erich Lewandowski saß wieder auf dem Klo und zeigte an, daß er Wirsingkohl gegessen hatte. Immer eine Mietpartei pro Stock hatte nur eine Außentoilette, und insbesondere die Männer, sofern es welche gab, liebten es, dort stundenlang mit einer alten Zeitung zu sitzen.
Endlich stand Manfred nun vor ihrer Wohnungstür, 3 Treppen, Mitte links. Alle hatten eine Klingel aus Messing, die aussah wie ein antiker Türklopfer. Darüber waren dann die Namensschilder angeschraubt. Ihres war ebenfalls aus Messing, und die Buchstaben O. MATUSCHEWSKI waren sauber eingraviert und mit schwarzer Farbe ausgegossen worden. O-Punkt war sein Vater, Otto. Vorne rund, hinten rund, in der Mitte wie’n Pfund. Das doppelte kleine »t« sah immer aus wie ein Pfundzeichen, wie man es überall noch finden konnte, obwohl sie lieber »ein halbes Kilo« statt »ein Pfund« sagen sollten. So Frau Fahlenberg, bei der sie immer »Mit uns zieht die neue Zeit« singen mußten. Aber sonst war die schon dufte, die Klassenlehrerin.
Gott sei Dank, die Schlüssel hingen vollzählig unterm Hemd.
Zuerst war oben mit dem langen Chubbschlüssel das Zuhaltungsschloß zu öffnen, dann unten mit dem kleinen Drücker die letzte Sperre zu beseitigen. Nun konnte er die mittelbraun lasierte Tür nach innen aufstoßen und über den Korridor hinweg zur Küche sehen.
Er zögerte. In der Küche war nichts zu erkennen, was irgendwie auffällig war. Alles stand auf seinem Platz. Auch keinerlei Geräusche, sosehr er auch lauschte. Dabei hätte er um seine einzige und letzte Weiche wetten mögen, daß hinter der Tür jemand stand und auf ihn wartete. Sicherlich ein Einbrecher, den er überrascht hatte. Mit einem Messer in der Hand oder einer Axt. Oder … Er erinnerte sich an das, was seine Tante Claire neulich erzählt hatte, als sie sich alle sicher waren, er schliefe schon ganz fest.
»… auf dem Apanderplatz wird eine junge Frau von einem Mann angesprochen, dem sie beide Beine amputiert hatten. Ob sie nicht so nett sein könnte, diesen Brief bei seiner Mutter abzugeben. Eine Adresse in Kreuzberg, Wrangelstraße. Die Frau ist nie wieder gesehen worden. Das war ganz sicher eine Fleischerei, wo der sie hingeschickt hat, und am nächsten Tag ist sie dann sicher als Rollbraten verkauft worden oder in der Wurstmaschine gelandet. Am besten sollen ja Kinder schmecken …«
Manfred blieb wie angewurzelt stehen.
Frau Schlicht von über ihnen kam die Treppe herunter und fragte ihn, warum er denn nicht hineinginge.
»Weil meine Schuhe noch so dreckig sind …«, sagte er.
»Das ist brav von dir!« lobte sie ihn. »Und du bist so tapfer und schaffst jetzt alles ganz alleine …«
»Ja …«
Nun konnte Manfred nicht anders, als hineinzugehen. Er warf die Tür mit einem lauten Knall hinter sich zu und lief sofort zum Küchenfenster, um es aufzureißen. Wenn er jetzt um Hilfe schrie, hörten sie ihn wenigstens.
Die Mappe flog auf den Kohlenkasten, der Essensträger mit dem Nachschlag kam auf den Gasbratofen.
Ein paar Graupen gab es warm zu machen, doch ehe er sich darum kümmern konnte, mußte er noch seinen Haufen machen. Zum Glück war mal keine Stromsperre, und er konnte sich das Licht anknipsen.
Ihre kleine Toilette lag in dem schmalen Streifen, den die Architekten zwischen ihrer Wohnung und der Wohnung Mitte rechts freigelassen hatten. Über einen abgeknickten Zugang war sie vom Korridor her zu erreichen, faßte nicht mehr als eine alte Kommode und das sehr kompakte, aber immerhin schon freistehende Klosett. In den Seitenflügeln, Hinterhäusern und Quergebäuden zerfielen die Menschen, das hatte er schon lange durchschaut, in drei verschiedene Gruppen: Am niedrigsten standen die, die ihr »Kackhaus« auf dem Hof oder auch auf halber Treppe hatten. Dann kamen die, die zwar eine Innentoilette besaßen, aber sich nur auf ein unförmiges Kasten- oder Plumpsklo niederlassen konnten, und ganz oben in der Wertungstabelle waren jene einzuordnen, die ein freistehendes Klo aus Porzellan vorzuzeigen hatten. Die aber wiederum waren ein Nichts gegen alle Vorderhausbewohner, die ein Badezimmer ihr eigen nennen durften.
Manfred klappte die braune Brille hoch, deren schlecht verleimtes Sperrholz schon manchen Splitter zeigte, und hatte Mühe, seine Backen so aufkommen zu lassen, daß es nicht piekte. Nach erfolgter Verrichtung blieb er noch ein Weilchen sitzen und las in den alten Zeitungen, die sich vor ihm auf der Kommode angehäuft hatten. Auf Anraten seiner Schmöckwitzer Oma hielten sie sich die Berliner Zeitung.
Sieben Kriegsverbrecher waren mit dem Flugzeug von Nürnberg nach Berlin gebracht worden. Rudolf Heß, der Stellvertreter des Führers, Walther Funk, Erich Raeder, Albert Speer, Baldur von Schirach, Konstantin Freiherr von Neurath und Karl Dönitz, der Großadmiral. Einige der Namen kannte er schon, denn seine Mutter und seine Schmöckwitzer Oma hatten in letzter Zeit stundenlang vor dem Radio gehockt und sich angehört, wie es da beim Nürnberger Prozeß zugegangen war.
Doch Manfred interessierte es viel mehr, was es denn Neues vom Fußball gab. Die alten Vereine waren ja noch immer verboten, und es gab nur Stadtteilmannschaften, die in bunt zusammengewürfelten Staffeln ihre Meisterschaft nach einem System austrugen, das er nicht ganz kapiert hatte. Lange Zeit hatte ja Neukölln in der Staffel D geführt, dann aber hatte es ein Unentschieden gegen Niederschöneweide gegeben und anschließend gegen Prenzlauer Berg-West sogar die erste Niederlage. Manfred hatte fast alle Mannschaften im Kopf. Da waren beispielsweise Reinickendorf-Ost, Friedrichsfelde, Berlin-Schillerpark und Borsigwalde (Staffel A), Gesundbrunnen und Oberschöneweide (Staffel C), Johannisthal, Niederschöneweide, Adlershof, Nordbahn und Weißensee (Staffel D). Der Bezirk Neukölln hatte neben der Mannschaft Neukölln auch noch Rixdorf im Rennen.
Die Berliner Zeitung wußte über beide Teams leider nichts Neues zu berichten. Also zerlegte er sie. Einen Teil zerriß er zu handlichen Stücken, gerade groß genug, sich damit den Po zu wischen, den anderen Teil, insbesondere die Ränder, legte er beiseite, um nachher die Strafarbeit auf ihnen zu machen.