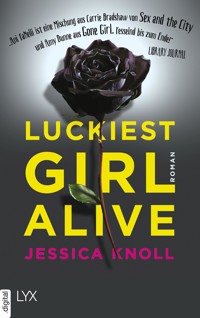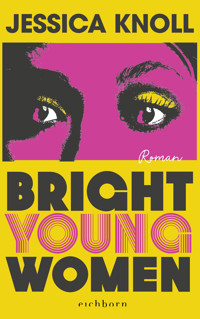
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Samstag im Jahr 1978 in Florida: Mitten in der Nacht dringt ein Mann in ein Studentinnenwohnheim ein. Er geht von Zimmer zu Zimmer und tötet mehrere Bewohnerinnen. Schon bald wird er als einer der bekanntesten Serienmörder der USA bekannt sein. Doch er wurde bei seiner Tat beobachtet.
Die Überlebenden, darunter Hauptzeugin Pamela Schumacher, wird diese Nacht für immer verändern. Sie sind alle zum Opfer geworden. Aber sie erzählen hier ihre Perspektiven, sie bleiben Herrinnen ihrer Geschichten. Und sie jagen den Täter auf eigene Faust - gegen Widerstände aus Justiz und Polizei; gegen die öffentliche Meinung, die den Serienmörder idolisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorintitlepageImpressumWidmungMontclair, New Jersey, Tag 15.825Tallahassee, Florida1, 4. Januar 1978, Sieben Stunden vorher15. Januar 1978, Fünf Minuten vorher15. Januar 1978, 3:39 UhrVier UhrFünf UhrAcht UhrZehn UhrNeunzehn UhrJacksonville, Florida, 2021, Tag 15.826Tag 1Issaquah, Washington, Winter 1974Tallahassee, 1978, Tag 2Issaquah, Washington, Winter 1974Jacksonville, Florida, Tag 6Tallahassee, 2021, Tag 15.826Issaquah, Winter 1974Tallahassee, 1978, Tag 8Issaquah, Winter 1974Aspen, 1978, Tag 12Aspen, Winter 1974Aspen, 1978, Tag 12Aspen, Winter 1974Aspen, 1978, Tag 13Tallahassee, 2021, Tag 15.826Aspen, Winter 1974Tallahassee, 1978, Tag 14Issaquah, Winter 1974Tallahassee, 1978, Tag 15Issaquah, Frühling 1974Tallahassee, 1978, Tag 35Issaquah, Sommer 1974New York City, 1979, Tag 445Issaquah, Sommer 1974Tallahassee, 1979, Tag 467Tallahassee, 2021, Tag 15.826Issaquah, Sommer 1974Miami, 1979, Tag 540Issaquah, 14. Juli 1974Miami, 1979, Tag 540Tallahassee, 2021, Tag 15.826Miami, 1979, Tag 541Miami, 1979, Tag 542Miami, 1979, Tag 548Issaquah, 2021, Tag 15.858Issaquah, 14. Juli 1974New Jersey, 2019, Tag 14.997Issaquah, 2021, Tag 16.145DanksagungÜber dieses Buch
Ein Samstag im Jahr 1978 in Florida: Mitten in der Nacht dringt ein Mann in ein Studentinnenwohnheim ein. Er geht von Zimmer zu Zimmer und tötet mehrere Bewohnerinnen. Schon bald wird er als einer der bekanntesten Serienmörder der USA bekannt sein. Doch er wurde bei seiner Tat beobachtet. Die Überlebenden, darunter Hauptzeugin Pamela Schumacher, wird diese Nacht für immer verändern. Sie sind alle zum Opfer geworden. Aber sie erzählen hier ihre Perspektiven, sie bleiben Herrinnen ihrer Geschichten. Und sie jagen den Täter auf eigene Faust – gegen Widerstände aus Justiz und Polizei; gegen die öffentliche Meinung, die den Serienmörder idolisiert.
Über die Autorin
Jessica Knoll war Redakteurin bei der Cosmopolitan und arbeitet nun bei dem Frauenmagazin Self. Sie ist in einem kleinen Vorort von Philadelphia aufgewachsen und lebt inzwischen mit ihrem Mann in New York.
JESSICA KNOLL
BRIGHTYOUNGWOMEN
Roman
Aus dem Englischen vonJasmin Humburg
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der englischen Originalausgabe:»Bright Young Women«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2023 by Jessica Knoll
Published by arrangement with Marysue Rucci Books, an Imprint of Simon amp; Schuster, LLC, New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werks für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Helen Heidkamp, Köln
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde nach einem Design von Kaitlin Kall
Umschlagmotiv: Design: © Kaitlin Kall | © EyeEm /Alamy Stock Photo |© Tom Kelley Archive/getty-images
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6459-9
eichborn.de
Für C – ohne dich hätte ich den letzten Satz nicht schreiben können.
PAMELA
Montclair, New JerseyTag 15.825
Du erinnerst dich vielleicht nicht an mich, aber ich habe dich nie vergessen. So beginnt der Brief, der in einer Schönschrift verfasst wurde, wie man sie heute nicht mehr in der Schule lernt. Voller Verwunderung lese ich den Satz ein zweites Mal. Es ist dreiundvierzig Jahre her, dass ich dem Mann begegnet bin, den selbst die Leitmedien als den All-American Sex Killer bezeichnet haben, und vor ebenso langer Zeit wurde mein Name zu einer Fußnote der Geschichte.
Ich hatte nur einen flüchtigen Blick auf die Adresse geworfen, bevor ich den Fingernagel unter die Lasche des Briefumschlags gleiten ließ, doch jetzt halte ich ihn eine Armlänge von mir entfernt und spreche den Namen der Absenderin laut aus, mit Nachdruck; als hätte mir jemand die gleiche Frage zweimal gestellt, obwohl er meine Antwort schon beim ersten Mal gehört haben musste. Die Briefeschreiberin irrt sich. Ich habe sie ebenfalls nie vergessen, auch wenn die Erinnerung an sie mit einem Ereignis verwoben ist, das ich zu gern aus meinem Gedächtnis streichen würde.
»Hast du was gesagt, Herzchen?« Meine Sekretärin rollt auf ihrem Schreibtischstuhl zu meiner offenen Bürotür, wo sie den Kopf schief legt und mich beflissen ansieht. Janet nennt mich Herzchen, manchmal sogar Kleine, obwohl sie nur sieben Jahre älter ist als ich. Wenn jemand sie als meine Verwaltungsassistentin bezeichnet, presst sie die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Für diese Art der neumodischen Überheblichkeit hat sie nicht viel übrig.
Janet sieht zu, wie ich das dunkelblau umrandete Papier umdrehe und abwechselnd auf die Vorder- und Rückseite schaue, wodurch ich einen leichten Windstoß erzeuge, der meinen Pony kurz aufflattern lässt. Es muss aussehen, als würde ich mir, der Ohnmacht nah, Luft zufächeln, denn sie eilt zu mir, und ich spüre ihre Hand auf meinem Rücken. Sie macht sich an ihrer Lesebrille zu schaffen, die an einer mit Strass besetzten Kette um ihren Hals baumelt, und streckt dann ihr spitzes Kinn über meine Schulter, um den bemerkenswerten Inhalt des Briefes lesen zu können.
»Der ist vor knapp drei Monaten verschickt worden«, sage ich mit aufsteigender Wut. Dass die Frauen, die es zuerst erfahren sollten, es doch immer zuletzt erfuhren, war der Grund dafür, dass mein Arzt mir schon in den 1980er Jahren zu einer salzarmen Ernährung geraten hatte. »Warum sehe ich den erst jetzt?« Was, wenn ich zu spät bin?
Janet funkelt das Datum an. 12. Februar 2021. »Vielleicht ist er beim Sicherheitsdienst hängen geblieben.« Sie tritt an meinen Tisch und findet den Umschlag auf der Schreibtischunterlage aus Kunstleder, die teurer aussieht, als sie tatsächlich war. »Ja.« Sie tippt mit ihrem gerade gefeilten Nagel oben links auf die Absenderadresse. »Kommt aus Tallahassee. Den haben die Sicherheitsleute ganz sicher geprüft.«
»Scheiße«, sage ich lahm. Ich stehe auf, und wie damals, in dieser Nacht, bewegt sich mein Körper plötzlich, ohne dass mein Kopf eine bewusste Entscheidung trifft. Ich packe meine Sachen ein, obwohl es erst kurz nach Mittag ist und ich um sechzehn Uhr eine Mediationssitzung habe. »Scheiße«, sage ich noch einmal, denn der tyrannische Teil von mir hat beschlossen, dass ich nicht nur meinen Nachmittagstermin absagen werde, sondern mir auch ganz sicher noch eine Strafgebühr einhandle, weil ich morgen früh um sechs nicht zu meinem Spinningkurs erscheinen werde.
»Was kann ich für dich tun?« Janet sieht mich mit einer Mischung aus Sorge und Resignation an, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe – dieser Blick, den die Leute dir zuwerfen, wenn das Allerschlimmste eingetreten ist und es im Grunde nichts gibt, was man für dich oder irgendwen tun kann, denn einige von uns sterben nun mal jung und auf unbequeme Weise, und du kannst nicht vorhersagen, ob du nicht vielleicht die Nächste bist, und ehe man sich versieht, blicken sowohl Trauernde als auch Tröstende mit leeren Augen in den Abgrund. Ich funktioniere instinktiv, obwohl es schon acht Präsidenten her ist. Drei Amtsenthebungsverfahren. Zwei gefallene Türme. Eine Pandemie. Facebook. Tickle Me Elmo. Eistee vonSnapple. Sie konnten den Eistee von Snapple nie probieren. Aber gleichzeitig ist es nicht in einer längst vergangenen Zeit passiert. Wenn sie überlebt hätten, wären sie jetzt so alt wie Michelle Pfeiffer.
»Ich glaube, ich fliege nach Tallahassee«, sage ich fassungslos.
Tallahassee, Florida14. Januar 1978Sieben Stunden vorher
Samstagabends ließen wir unsere Türen offen stehen, wenn wir uns zurechtmachten. Mädchen betraten die Zimmer mit einem Outfit und kamen mit einem kürzeren wieder heraus. Die Flure waren eng und voll wie die Gänge auf einem Schiff der Navy, überall wurde besprochen, wer was wo vorhatte und mit wem. Der Dunst von Haarspray und Nagellack wurde zu unserer persönlichen Ozonschicht, die Hitzewellen der Föhne ließen das Quecksilber in dem analogen Thermometer an der Wand vier, manchmal sogar fünf Grad nach oben wandern. Wir öffneten die Fenster, um frische Luft hereinzulassen, und machten uns über die Musik in der Bar nebenan lustig; samstags war Disco-Nacht, das war etwas für alte Leute. Statistisch gesehen war es doch unmöglich, dass etwas Schlimmes passierte, während Barry Gibb mit seiner charakteristischen Fistelstimme Stayin’ Alive sang, aber wir sind wohl das, was Mathematiker als Ausreißer bezeichnen.
Ich hörte ein Klopfen an meiner Tür, begleitet von einer gespielt schüchternen Stimme. »Es könnte sein, dass es heute noch schneit.« Ich blickte von meinen Plänen für unsere ehrenamtliche Arbeit auf, die mein gebrauchtes Schreibpult bedeckten, und sah Denise Andora mädchenhaft mit brav vor dem Körper verschränkten Fingern im Türrahmen stehen.
»Netter Versuch.« Ich lachte. Denise hatte es auf meinen Lammfellmantel abgesehen. Auch wenn der Winter 1978 bereits eine solche Kälte in den Nordwesten Floridas getrieben hatte, dass die Azaleen an der Grenze zu Georgia erfroren waren, war es hier nie kalt genug für Schnee.
»Bitte, Pamela!« Flehend faltete Denise die Hände und wiederholte ihr immer dringlicher werdendes Anliegen über die rot lackierten Fingernägel hinweg. »Bitte. Bitte. Bitte. Ich hab nichts anzuziehen.« Zum Beweis drehte sie sich um die eigene Achse. Ich kann mich nur so genau an ihre Kleidung an diesem Abend erinnern, weil sie später in der Zeitung beschrieben wurde: dünner Rollkragenpullover, in die Jeans mit Druckknöpfen gesteckt, Gürtel und Stiefel aus kastanienbraunem Wildleder, Opalohrringe und ihr geliebtes silbernes Bettelarmband. Meine beste Freundin war gefühlte zehn Meter groß und wog weniger als ich in der Grundschule, aber inzwischen hatte ich meinen Neid so gut im Griff wie meine Migräne. Die Schmerzattacken überkamen mich immer dann, wenn ich sah, wie Denise die Aufmerksamkeit von Männern suchte.
»Gib dir einen Ruck.« Sie stampfte zaghaft mit dem Fuß auf. »Roger hat rumgefragt, ob ich heute Abend auch komme.«
Ich legte den Bleistift aus der Hand. »Denise«, sagte ich mahnend.
Ich hatte schon längst zu zählen aufgehört, wie oft Denise und Roger Schluss gemacht hatten, nur um sich dann nachts wieder über den Weg zu laufen und sich nach viel lauwarmem Bier und langen, liebestollen Blicken die ganzen boshaften Dinge zu verzeihen, die sie zu- und übereinander gesagt hatten. Doch die letzte Trennung hatte sich nicht wie eine Trennung angefühlt, sondern vielmehr wie das Zerschneiden mithilfe eines schmutzigen Küchenmessers, wodurch Denise sich buchstäblich infizierte, fast eine Woche lang nichts bei sich behalten konnte und sogar wegen Dehydrierung ins Krankenhaus musste. Als ich sie dort abholte, schwor sie mir, sie sei für immer mit Roger fertig. Ich hab zur Sicherheit zweimal auf die Spülung gedrückt, hatte sie mit einem schwachen Lächeln gesagt, während ich ihr aus dem Krankenhausrollstuhl und ins Auto half.
Denise zuckte jetzt mit den Schultern, gab sich plötzlich verdächtig desinteressiert und schlenderte zu meinem Fenster hinüber. »Es sind ja nur ein paar hundert Meter bis zur Party. Und für heute Nacht sind zehn Zentimeter Schnee angesagt. Ich werde ein bisschen frieren, aber« – sie legte den Hebelverschluss um, schob das Fenster nach oben und hinterließ dabei einen Handabdruck auf der Scheibe, zu dem es schon bald kein lebendiges Gegenstück mehr geben würde – »vielleicht kann Roger mich dann aufwärmen.« Sie wandte sich mir zu, stand mit durchgedrückten Schultern im eiskalten Zimmer. Denise ließ ihren BH in einer Schublade verstauben, es sei denn, ihre Eltern kamen am Wochenende zu Besuch.
Ich konnte spüren, wie meine Willenskraft zu bröckeln begann. »Versprichst du mir, ihn danach zur Reinigung zu bringen?«
»Jawohl, Ma’am, Pam Perfect, Ma’am.« Denise schlug militärisch die Hacken zusammen. Pam Perfect war ihr ironischer Spitzname für mich, abgeleitet von der beliebten Fernsehwerbung, in der eine Frau mit fransigem Pony von pflanzlichem Kochspray schwärmt, mit dem sie Zeit, Geld und Kalorien sparte. Mit PAM, flötet sie, während sie einen silbrig geschuppten Fisch von der Pfanne auf den Teller gleiten lässt, wird ihr Abendessen immer Pam Perfect.
Denise war meine erste Freundin an der Florida State University, aber in letzter Zeit schienen wir uns festgefahren zu haben. Vetternwirtschaft war immer schon die Fäulnis im Kern der studentischen Verbindungen gewesen, und ehemalige Vorsitzende hatten sich bei einigen Mitgliedern streng an die Regeln gehalten, während ihre Freundinnen sich alles erlauben durften. Als ich mich für die Position aufstellen ließ und die Wahl gewann, erwartete Denise, dass ich sie mit Nachsicht behandeln würde. Stattdessen war ich so fest entschlossen, es besser zu machen als meine Vorgängerinnen und eine faire, unparteiische Vorsitzende zu sein, dass Denise mehr Verwarnungen kassiert hatte als irgendjemand sonst in diesem Quartal. Jedes Mal, wenn sie die Montagsversammlung unseres Hauses schwänzte oder einen ehrenamtlichen Auftrag verschob, schien sie es darauf anzulegen, von mir rausgeschmissen zu werden. Auf die anderen Mädchen wirkten wir vermutlich wie zwei Hirsche, die ihre Geweihe mit gesenkten Köpfen ineinander verhakt hatten. Unsere Schatzmeisterin, eine brünette Finalistin des Miss-Florida-Wettbewerbs, die schon als Kind in Franklin County das Jagen gelernt hatte, meinte dazu, eine von uns müsse sich unterwerfen, bevor wir feststeckten und man uns nur noch mithilfe einer Säge trennen könnte. Sie habe das schon in freier Wildbahn erlebt.
»Du kannst den Mantel nehmen«, lenkte ich ein.
Denise hüpfte mit so kindlicher Freude zu meinem Kleiderschrank, dass ich mir vorkam wie ein alter Hausdrache. Genießerisch ließ sie ihre Arme in den mit Seide gefütterten Mantel gleiten. Dank meiner Mutter, die schon immer eine große Leidenschaft für solche Dinge hatte, besaß ich wunderschöne Kleidungsstücke, die sich wie eine zweite, weichere Haut anfühlten. Vielleicht hätte ich mich auch mehr für Mode interessiert, wenn mir Kleidung nur halb so gut stehen würde wie Denise. Ich hatte jedoch ein rundes, irisches Gesicht, das meiner Figur gänzlich widersprach. So war das bei mir – ich hatte keinen Körper, sondern eine Figur. Die Kluft zwischen den sommersprossigen Apfelbäckchen und den Proportionen eines Pin-up-Girls war so extrem, dass ich oft das Gefühl hatte, mich dafür entschuldigen zu müssen. Ich sollte hübscher sein oder weniger hübsch, je nachdem, wer mich gerade ansah und wohin derjenige schaute.
»Kannst du das Fenster zumachen, bevor du gehst?« Ich schlug mit der flachen Hand auf meinen Schreibtisch, als ein Windstoß durch das Zimmer ging und meine farblich sortierten Kalenderblätter aufzuwirbeln drohte.
Denise ging zurück zum Fenster und inszenierte eine übertriebene Show, drückte und ächzte, als müsse sie all ihre Kraft aufwenden. »Es klemmt«, sagte Denise. »Du kommst wohl besser mit, bevor du hier erfrierst, während du die dreiunddreißigste Blutspendeaktion planst. Was wär das für ein Ende.«
Ich seufzte, allerdings nicht, weil ich mich danach sehnte, auf eine laute Studentenparty zu gehen, und es mir nicht erlauben konnte, weil ich tatsächlich die dreiunddreißigste Blutspendeaktion organisieren musste. Ich seufzte, weil ich nicht wusste, wie ich Denise klarmachen sollte, dass ich nicht gehen wollte, dass ich mich an einem Samstagabend nirgendwo wohler fühlte als an meinem zerkratzten Schreibtisch, während sich vor meiner offenen Tür das Getümmel und Getöse von achtunddreißig Mädchen abspielte, die sich aufbrezelten, und ich das Gefühl hatte, meinen Job erledigt zu haben, wenn alle am Ende der Woche die Musik aufdrehten, Mascara auftrugen und sich gegenseitig über den Flur hinweg ärgerten. Was ich da alles mitbekam. Wie unglaublich fies wir zueinander sein konnten. Der einen wurde geraten, sich die großen Zehen zu rasieren, der anderen, sie solle niemals in der Öffentlichkeit tanzen, wenn sie den Wunsch habe, sich irgendwann fortzupflanzen.
»Ohne mich hast du mehr Spaß«, lautete meine dürftige Antwort.
»Weißt du, eines Tages«, sagte Denise und schloss nun wirklich das Fenster, während ihre langen dunklen Haare nach hinten geweht wurden wie das Cape einer Superheldin, »wirst du Hängetitten haben, und dann wirst zu zurückblicken und dir wünschen –«
Denise unterbrach sich selbst mit einem Kreischen, das mein Nervensystem mittlerweile kaum mehr als solches wahrnahm. Wir waren einundzwanzigjährige Studentinnen in einem Verbindungshaus; wir kreischten nicht, weil etwas schrecklich Schlimmes passiert war, sondern weil wir samstagsabends ausgelassen und übermütig waren. Inzwischen hasse ich den Tag, auf den die meisten Leute sich die ganze Woche über freuen, und der uns Spaß, Freiheit und Sicherheit vorgaukelt.
Zwei unserer Verbindungsschwestern schleppten keuchend ein in Laken gewickeltes Etwas von der Größe eines Filmplakats über die Rasenfläche vor unserem Haus. Ihren Wangen sah man die Kälte und die Anstrengung an, ihre Pupillen waren geweitet, als wären sie auf der Flucht.
»Helft uns«, riefen sie Denise und mir zu, halb lachend, halb schnaufend, als wir bei ihnen auf dem Rasenstück vor dem Haus ankamen, an dessen Rändern rosafarbenes Haargras gepflanzt worden war, um die Stammgäste der Bar nebenan davon abzubringen, auf unserem Grundstück zu parken. Diese natürliche Grenze funktionierte so gut, dass keiner der Studenten, die vor Ladenschluss noch schnell einen Happen im nahe gelegenen Imbiss essen wollten, sie überschritten hätten, um mit anzupacken.
Ich stellte mich vor die Fracht, ging in die Hocke und war bereit anzuheben, doch Denise steckte bloß zwei Finger in den Mund und stieß einen ohrenbetäubenden Pfiff aus, woraufhin zwei Typen, die gerade durch eine Gasse neben unserem Haus gehen wollten, abrupt stehen blieben. Keine Gartengestaltung der Welt konnte verhindern, dass andere Leute unsere Abkürzung mitbenutzten, und ich konnte es ihnen nicht verdenken. Die Häuserblocks in Tallahassee waren so lang wie die Avenues in New York City. Denise liebte es, dass ich solche Dinge wusste.
»Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen.« Denise warf ihr dunkles, seidenweiches Haar nach hinten, das sie stundenlang in Form gebracht hatte, und schob ihre Hüfte raus, wie die Anhalterin, von der jeder Mann träumt.
Ich sah die abgekauten Fingernägel eines Jungen an der Unterseite unserer geheimen Lieferung, wenige Zentimeter neben meinen eigenen Händen, und das Gewicht wurde mir abgenommen. Ich übernahm das Kommando und dirigierte die Helfer drei Stufen hinauf und dann – vorsichtig, ein bisschen nach links, nein, das andere Links! – durch die Flügeltür am Eingang. Sie war erst vor Kurzem kornblumenblau gestrichen worden, passend zu den Streifen auf der Tapete im Foyer, wo sich in diesem Moment alle versammelten – die Mädchen, die in der Küche Popcorn machen wollten, die Mädchen, die es sich im Gemeinschaftsraum auf der Couch gemütlich machen und aufgenommene Folgen der Seifenoper Jung und Leidenschaftlich schauen wollten, die Mädchen, die ausgehen wollten und mit Lockenwicklern im Haar ihre frisch lackierten Nägel trocken pusteten. Sie wollten den Grund für all die Aufregung sehen und gleichzeitig einen prüfenden Blick auf unsere Handlanger von der Straße werfen, die mindestens acht Jahre älter waren als wir, aber nicht älter als die Professoren, die uns regelmäßig zum Abendessen einluden.
Es wurde diskutiert, was als Nächstes passieren sollte. Denise war dafür, dass die Helfer es nach oben trugen, doch die einzigen Männer, die das Obergeschoss betreten durften, waren Familienmitglieder am Umzugstag und der Hausmeister, wenn es etwas zu reparieren gab.
»Hab dich doch nicht so, Pamela«, sagte Denise. »Wenn wir es hier unten stehen lassen, holen sie es sich zurück, bevor wir den Handel abschließen können.« Auch wenn die Fracht in ein Laken gewickelt war, wussten wir, dass es sich dabei um eine gerahmte Fotosammlung unserer liebsten Studentenverbindung handelte, auf der die Mitglieder eines Jahrgangs, alle mit ernstem Blick und in Anzug und Krawatte, zu sehen waren. In der Mitte prangte ihr Wappen mit der Klapperschlange und dem Doppelschwert. Seit Monaten ging es hin und her, ein Haus stahl die Fotosammlung des anderen und hinterließ dabei ein rußiges Rechteck an der Wand, das sich nicht einmal mit reinem Ammoniak entfernen ließ.
Denise starrte mich mit funkelnden, schwarz umrandeten Augen an, die zu sagen schienen: Hab dich. Über ein Jahrzehnt später, als ich schließlich selbst Mutter war, erkannte ich diesen Trick wieder – nach einer verbotenen Sache zu fragen, wenn Menschen anwesend waren, die wollten, dass man diese Sache bekam. Ich konnte nicht Nein sagen, es sei denn, ich wollte als böse alte Hexe dastehen.
Aus den Tiefen meiner Kehle stieg ein verächtlicher Ton auf. Was fiel ihr ein.
Denise ließ enttäuscht die Mundwinkel hängen. Auch diesen Blick kannte ich. So sah sie mich immer an, wenn sie mir als Vorsitzende unseres Hauses begegnete, nachdem sie mich lange nur als Freundin gesehen hatte.
»Man on the floor!«, brüllte ich, und Denise packte meine Schultern und schüttelte mich mit gespielter Empörung. Ich hatte sie fast gehabt. Wir wurden von den anderen Mädchen mitgerissen, die sich wie ein Fischschwarm nach oben bewegten, wie eine dynamische Einheit, die auf der Treppe schmaler wurde, am Treppenabsatz wieder Form annahm und sich in den engen Fluren erneut in die Länge zog. Dabei sangen wir »Man on the floor«, aber nicht im Gleichklang, denn jede Stimme stand im rauen Wettstreit mit den anderen. Es gab da dieses Lied von Paul McCartney – Band on the Run –, bei dem eine meiner Kommilitoninnen, niemand konnte sich erinnern, wer genau, immer »Man on the Run« verstanden hatte, und irgendwann war daraus der Insiderwitz »Man on the floor« geworden. Die Melodie hatte sich so sehr in unseren Köpfen festgesetzt, dass jemand sie am nächsten Morgen vor sich hin summte, als wir wie betäubt im Esszimmer zusammensaßen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich jede Menge Männer im Obergeschoss, einige in blauer Uniform, andere in weißen Laborkitteln, die Verantwortlichen in Zivilkleidung, wo sie blutige Quadrate aus dem Teppich schnitten und mit der Pinzette Zähne vom Boden sammelten. Und dann fing jemand an, die Zeile in voller Lautstärke zu singen – »man on the floor, maaaaaan on the floor!« –, und wir brachen in Gelächter aus, in echtes, aus dem Bauch aufsteigendes Gelächter, sodass einige unserer uniformierten Besucher in ihren Bewegungen innehielten und uns finstere, vorwurfsvolle Blicke zuwarfen, in denen nur wenig Verständnis lag.
Das Bild wurde in Zimmer vier transportiert, in dem die Mädchen wohnten, die den Raub abgewickelt hatten. Unsere Handlanger schauten sich skeptisch in dem beengten Quartier um, bevor die Tür mit dem Fuß zugestoßen wurde und sie das wertvolle Stück an eines der Betten lehnten. Wenn man das Zimmer nun betreten wollte, musste man sich seitwärts durch die Tür quetschen, und selbst das hätte ich nicht geschafft, nicht mit meiner Figur.
»Habt ihr keinen Dachboden oder so was?«, fragte einer der Typen.
Den hatten wir, doch die Fotosammlung im eigenen Zimmer war wie ein Hirschgeweih an der Wand, erklärte Denise. Die ersten flachbrüstigeren Mädchen drängten sich bereits durch die halb offene Tür, um Fotos von den Heldinnen in Zimmer vier zu schießen, die sich grinsend neben ihrer Beute aufstellten, mit wallenden Haaren und Pistolen-Fingern wie die drei Engel für Charlie. In wenigen Stunden würde er versuchen, in dieses Zimmer einzudringen, jedoch an dem Widerstand des Jahrgangs 1948 hinter der Tür scheitern – ich kann mich genau erinnern, dass es die Fotosammlung aus diesem Jahr war, die die Mädchen hatten mitgehen lassen, kann die geölten Frisuren und Hornbrillen noch vor mir sehen. Nur wegen eines albernen Streichs arbeitet Sharon Selva heute als Kieferchirurgin in Austin, und Jackie Clurry ist Professorin für Geschichte an genau der Universität, auf deren Campus im Winter 1978 Angst und Schrecken herrschten.
Denise schnappte sich entschlossen eine kleine bernsteinfarbene Lampe, die auf einem Stapel alter Zeitschriften stand, schraubte den Schirm ab und zog das Kabel lang, um sich vor das Bild zu hocken und mit der nackten Glühbirne an der Oberfläche entlangzufahren wie eine Schatzsucherin mit einem Metalldetektor. Ehrfürchtig schüttelte sie den Kopf. »Sogar die Bilder aus den Vierzigern haben bei denen Museumsqualität!«, rief sie mit ehrlich empfundener Entrüstung in der Stimme.
Seit zwei Jahren hatten wir die Jungs aus dem Turq House – benannt nach der türkisen Farbe der Fensterläden und Türen – in dem Glauben gelassen, sie wären Teil eines klassischen Spielchens unter Freunden, das schon seit Generationen in Verbindungshäusern gespielt wurde. Was sie nicht wussten, war, dass wir das hochwertige Glas ihrer Fotosammlungen gegen das Akrylglas von unseren austauschten, bevor wir einen Handel vorschlugen. Denise war diese Ungleichheit aufgefallen, als wir im zweiten Studienjahr waren.
Das Glas ist umwerfend, hatte sie gehaucht, und die älteren Mädchen hatten gelacht, denn Robert Redford war umwerfend, aber Glas? Die kleine Denise war mit uns zur Fotowand marschiert und hatte uns auf die Unterschiede aufmerksam gemacht – Seht ihr, wie ausgeblichen unsere Bilder sind? Die Studenten im Turq House verwendeten echtes Glas, teures Glas wie im Museum, das ihre Fotografien vor schädlichen Einflüssen, wie Sonnenlicht und Staubmilben, schützte. Denise studierte sowohl Kunst als auch Moderne Sprachen im Hauptfach – Ersteres war immer der Plan gewesen, für Letzteres hatte sie sich im Sommer entschieden, nachdem sie im Tallahassee Democrat gelesen hatte, dass man in St. Petersburg, Florida ein hochmodernes Salvador-Dalí-Museum errichten wolle. Denise hatte sich sofort für ein zweites Hauptfach eingeschrieben, Moderne Sprachen mit Schwerpunkt Spanisch, den Sommer nach ihrem zwanzigsten Geburtstag auf dem Campus verbracht und währenddessen die Leistungspunkte von zwei Jahren nachgeholt. Dalí würde höchstpersönlich anreisen, um das Museumspersonal auszuwählen, und Denise wollte ihn in seiner Muttersprache beeindrucken. Es überraschte kaum jemanden, doch als sie sich schließlich trafen, war er absolut hingerissen und bot ihr einen Job als stellvertretende Galeristin an, den sie direkt nach ihrem Abschluss würde antreten können.
»Ich wage zu bezweifeln, dass es denen überhaupt auffallen würde …« Mehr hatte Denise damals nicht gesagt, denn sie wusste, dass es ihr als Frischling in der Verbindung nicht zustand, den Vorschlag zu machen.
Es gab und gibt noch immer viele Unterschiede zwischen Verbindungen für Studenten und Verbindungen für Studentinnen, doch der größte, über den unsere Vorsitzende damals oft sprach, lag in der Art und Weise, wie ehemalige Mitglieder sich für ihre Organisation einsetzten. Männliche Verbindungshäuser bekamen seit Generationen stärkere finanzielle Zuwendungen als die Verbindungshäuser der Frauen. Insgesamt gab es bei den Männern neuere Möbel, topmoderne Klimaanlagen und, »wie unser Adlerauge Denise Andora kürzlich herausgefunden hat«, sagte sie in einer Besprechung, »sogar besseres Glas als bei uns«.
So einigten wir uns stillschweigend auf diese List, und Gerüchten zufolge wird sie noch heute angewandt.
Denise tippte mit ihren langen Nägeln gegen das robuste Antireflexglas und stöhnte geradezu erotisch auf. »Mein Gott, das ist gut«, sagte sie.
»Möchtest du lieber mit dem Glas allein sein, Denise?«, fragte Sharon mit todernster Miene.
»Scheiß auf Roger.« Denise setzte einen nassen Kuss auf die durchsichtige Oberfläche. »Dieses Glas und ich werden zusammen ein langes und glückliches Leben führen.«
Manchmal, wenn ich ein ungünstiges Ergebnis vor Gericht erziele, wenn Gerechtigkeit mir doch bloß wie ein Trugschluss vorkommt, denke ich daran, dass Salvador Dalí sechs Stunden vor dem Moment starb, an dem der Mörder von Denise zum elektrischen Stuhl geführt wurde. Am 23. Januar 1989, ihr könnt das nachschlagen. Der Tod des weltberühmten, exzentrischen Künstlers stellte sicher, dass die Hinrichtung irgendeines Arschlochs mitten in Florida nicht die Schlagzeile des Tages war. Dessen beraubt, schlurfte er bereits als toter Mann zum Stuhl. Er wollte ein Spektakel, und zwar mehr als seine eigene Freiheit, mehr als die Chance, sich an mir für das zu rächen, was ich getan hatte. An Tagen wie diesen stelle ich mir gern vor, dass Denise dort oben, wo auch immer die wahrhaft großartigen Frauen hingehen, wenn sie sterben, ihre Finger im Spiel hatte und so seinen Tod überschattete, wie er es mit ihrer viel zu kurzen Zeit hier auf der Erde getan hatte. Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Das haben uns die gerissenen Frauen in Jung und Leidenschaftlich beigebracht.
»Die Zukunft – darauf hat sie sich sehr gefreut.«
– Tante eines der Opfer an der Florida State University, 1978
15. Januar 1978Fünf Minuten vorher
Es muss mehr als ein Hungergefühl gewesen sein, das mich geweckt hatte, aber damals wollte ich bloß nach unten gehen, mir ein Erdnussbuttersandwich machen und dann einfach weiterschlafen.
Ich rollte mich aus dem Bett, streckte mich und ächzte, als ich mich in dem kleinen, ovalen Spiegel sah, den ich an meine Zimmerwand geklebt hatte. Ich war in meinen Klamotten eingeschlafen und hatte ein Kursbuch als Kopfkissen benutzt. Nachdem ich den fertigen Plan für die ehrenamtliche Arbeit an das schwarze Brett vor den Waschräumen gepinnt hatte, war ich zur Lektüre für den Montagskurs – Politische Ideengeschichte Amerikas – übergegangen, und nun zierte der schwache Abdruck des Verfassungszusatzes für die Gleichberechtigung der Frauen meine Wange. Ich rieb kräftig mit dem Handballen darüber, doch die Worte von Alice Paul hielten sich wacker.
Als Vorsitzende des Hauses hatte man den Vorteil, allein in dem großen Zimmer mit Balkon über dem Haupteingang wohnen zu dürfen, aber das war auch schon alles. Das Erkerfenster, die Privatsphäre, verleiteten einige Mädchen dazu, sich für die Position aufzustellen, bis sie darüber nachdachten, wie viel undankbare Arbeit dies zusätzlich zum eigentlichen Studium bedeutete. Für mich war es umgekehrt. Die Sitzungen, Haushaltsplanung und Management, das Vermitteln wegen jeder noch so kleinen Beleidigung – das war es, was den Posten für mich so attraktiv machte. Bei zu viel Freizeit verfiel ich schnell in Depressionen, und mir graute es davor, auszugehen, Typen kennenzulernen und dergleichen. Mithilfe meiner Figur hatte ich mir bereits im ersten Studienjahr einen respektablen Freund gesichert, und auch wenn mein Herz nicht gerade lichterloh brannte, wenn ich ihn küsste, hatte ich ihn aus Gründen der Zweckmäßigkeit dennoch behalten.
Der Kronleuchter im Eingangsbereich war mit einer Zeitschaltuhr verbunden und erlosch automatisch um einundzwanzig Uhr. Doch als ich um kurz vor drei Uhr morgens aus meinem Zimmer kam, war das Foyer in gleißend helles Licht getaucht. Bis heute kann sich das niemand erklären, aber dieser Kronleuchter hat mir das Leben gerettet. Wäre ich vor meinem Zimmer nach rechts abgebogen und den schmalen Flur zur Hintertreppe entlanggegangen, die wir nachts üblicherweise benutzten, wäre ich nicht zurückgekehrt.
Ich stieg die Haupttreppe hinunter und ließ eine Hand über das schmiedeeiserne Geländer gleiten, das zu den ältesten und hübschesten Elementen im Haus gehörte. Im Foyer angekommen, drückte ich einige Mal auf den Lichtschalter, was jedoch nichts nützte. Gedanklich setzte ich den Punkt auf meine ewig lange Liste für den nächsten Morgen: Gleich den Hausmeister anrufen, bevor die Ehemaligen eintreffen, damit –
Steh da nicht bloß so rum, schrie eine Frauenstimme. Tu was. Tu endlich was!
Irgendwo hörte ich ein Glas zerspringen. Dann noch eines. Und noch eines.
Ich blickte auf meine Füße in den Hausschuhen aus Kord, die ich in der Nacht zum letzten Mal tragen würde, und sah, wie sie sich auf die Unruhe zubewegten, die aus dem hinteren Teil des Hauses zu kommen schien. Doch selbst als ich den Gemeinschaftsraum betrat und feststellte, dass es bloß der Fernseher war, den eine meiner Mitbewohnerinnen vergessen hatte auszuschalten und auf dem eine alte Folge der Serie I Love Lucy lief, in der Lucy ihrem Mann Ricky verschiedene Gegenstände reicht, die er anstelle ihres Gesichts zerschmettern kann, wusste ich – etwas stimmte nicht.
Trotzdem ging ich durch den Raum, knipste alle Lampen aus und sammelte die Teller mit klebrigen Schokoladenkuchenresten von Jerry’s zusammen, die auf dem Couchtisch standen. Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich eine Person bin, die nur weinen kann, wenn sie wütend ist. Der Empfang für die Ehemaligen sollte pünktlich um neun Uhr morgens beginnen, und die Mädchen hinterließen hier so ein Chaos?
Mein Zopf hatte sich im Schlaf gelöst, und ich musste mir immer wieder die Haare aus dem Gesicht wischen, bis ich bemerkte, dass es an der eiskalten Luft lag, die durch den Raum zog. Ich lehnte mich ein Stück zurück, um durch den Rundbogen zum Hintereingang spähen zu können, und entdeckte die offene Tür. Diese beschissenen Kleinkinder, dachte ich, weil es mir automatisch durch den Kopf gegangen wäre, wenn nicht ein Teil von mir bereits geahnt hätte, dass sich in diesem Moment etwas Unaussprechliches über mir abspielte. Diese beschissenen, betrunkenen Kleinkinder, dachte ich noch einmal, blendete mich damit selbst, klammerte mich an die letzten Sekunden der Normalität, bevor –
Ein dumpfer Aufprall. Der dumpfe Aufprall.
Ich hielt inne. Hörte auf, mich zu bewegen. Zu atmen. Zu denken. Mein Körper schien alle Funktionen herunterzufahren, um die Energie in meine Ohren umzuleiten. Oben waren hastige Schritte zu hören. Jemand rannte in einer entsetzlichen, unmenschlichen Geschwindigkeit durch den ersten Stock.
Es war, als wäre ein Magnet an diesen Füßen befestigt und ich eine Münze, die davon mitgezogen wurde – vorbei an unserer Fotogalerie, dem halbherzig verputzten Riss in der Decke, bis zu der Stelle zwischen der Garderobe und der Lamellentür zur Küche, wo die Schritte verstummten und ich stehen blieb. Ich verharrte im Schatten der Haupttreppe und blickte direkt auf die Haustür, die sich genau vier Meter vor mir befand. Ich hatte vier Meter fünfzig geschätzt, doch als der Detective nur eine Stunde später das Maßband zur Hilfe nahm, erfuhr ich, dass der Abstand zwischen ihm und mir doch etwas geringer gewesen war.
Der Kristallkronleuchter bewegte sich sacht, strahlte aber entschlossen weiter. Als der Mann die Treppe herunterkam und durch das Foyer eilte, hätte er eigentlich schwer zu sehen sein müssen. Doch der Kronleuchter stand mir bei, indem er mir einen klaren und unverstellten Blick auf ihn erlaubte, wie er da in gebeugter Haltung und mit einer Hand am Türknauf stand. In der anderen Hand trug er so etwas wie einen kleinen Baseballschläger, dessen Ende mit dunklem Stoff umwickelt war, der sich zu wölben und zu winden schien. Ich sah Blut, doch diese Erkenntnis ließ mein Gehirn noch nicht zu. Er trug eine Wollmütze, bis über beide Augenbrauen heruntergezogen. Seine Nase war spitz und gerade, seine Lippen schmal. Er war jung und schlank und gut aussehend. Diese Tatsache lässt sich nicht bestreiten, auch wenn es mich ärgert.
Für einen kurzen, köstlichen Moment war ich wütend. Ich erkannte den Mann an der Tür. Es war Roger Yul, der Immer-mal-wieder-Freund von Denise. Ich konnte nicht fassen, dass sie ihn heimlich mit nach oben genommen hatte. Das war ein schwerwiegender Verstoß gegen die Hausordnung. Ein Grund zum Rauswurf.
Doch dann sah ich, wie sich jeder Muskel im Körper des Mannes anspannte, als spürte er, dass er beobachtet wurde. Langsam drehte er den Kopf und stierte wie ein Raubtier auf einen Punkt über meiner Schulter. Ich war wie gelähmt von dieser überwältigenden Angst, die mich noch immer in meinen Albträumen heimsucht, mich im Nacken packt und den Schrei in meiner staubtrockenen Kehle erstickt. Wir standen beide dort, wachsam und regungslos, bis mich eine Welle der Erleichterung überrollte, als mir klar wurde, dass er mich im Schatten der Treppe gar nicht sehen konnte, sodass ich ihn sah, aber selbst unbemerkt blieb.
Es war nicht Roger.
Der Mann öffnete die Tür und verschwand. Bei unserer nächsten Begegnung würde er Anzug und Krawatte tragen, sowohl Groupies als auch die New York Times auf seiner Seite haben, und auf die Frage nach meinem derzeitigen Wohnsitz wäre ich gesetzlich verpflichtet, ihm meine Privatadresse zu nennen. Einem Mann, der fünfunddreißig Frauen ermordet hatte und zweimal aus dem Gefängnis ausgebrochen war.
Ich machte mich auf den Weg zu Denises Zimmer, um ihr die Leviten zu lesen. Später würde ich es der Polizei, dem Gericht, Denises Eltern und mir selbst nie hinreichend erklären können. Obwohl ich sicher war, einen fremden Mann an der Tür gesehen zu haben, hatte ich trotzdem nicht sofort zum Hörer gegriffen und die Polizei angerufen, sondern war wieder nach oben gegangen, um Denise zurechtzuweisen.
Als ich im ersten Stock ankam, stolperte eine Kommilitonin namens Jill Hoffmann aus Zimmer sechs und lief vornübergebeugt in Richtung der Waschräume. Sie war wohl betrunken und musste sich übergeben.
Ich rief ihren Namen, und Jill drehte sich ängstlich um, als befürchtete sie, sie könnte Ärger bekommen, wenn jemand sah, wie sich das Fleisch von ihrer rechten Gesichtshälfte schälte und den Wangenknochen freigab, den es laut Modemagazinen mit Rouge zu betonen galt. Sie versuchte zu sprechen, doch ihre Zunge ging im strömenden Blut unter.
Ich rannte den Flur entlang, ruderte wie wild mit den Armen und bemühte mich krächzend, die anderen zu wecken. Eines der Mädchen steckte den Kopf durch die Tür und fragte mit trüben Augen, ob das Haus in Flammen stehe. Ich schob Jill in die Arme des Mädchens und wies sie an, die Tür hinter sich abzuschließen. Aus dem Augenwinkel sah ich eine andere Bewohnerin in Jills Zimmer gehen und hörte sie nach einem Eimer rufen. Mir kam in den Sinn, dass wir uns besser daran machen sollten, die Blutflecken zu entfernen, die Jill auf dem Teppich hinterlassen hatte, bevor sie antrockneten, und dieser Gedanke kam mir in dem Moment völlig logisch vor.
Ich öffnete die Tür zu Zimmer zwölf auf der rechten Seite des Flurs und rief den Mädchen zu, sie sollten die Polizei rufen. Als sie nach dem Grund fragten, musste ich kurz nachdenken. Ich kann mich nicht erinnern, den folgenden Satz gesagt zu haben, aber dem Autor eines der weniger reißerischen True-Crime-Bücher zufolge tat ich es. »Jill Hoffmann wurde leicht verletzt«, soll ich mit ruhiger Stimme gesagt haben. Anschließend ging ich ohne Eile zu den Waschräumen, holte einen Eimer unter der Spüle hervor und betrat damit Jills Zimmer, um die Flecken aus dem Teppich zu schrubben.
Das Zimmer war nass, Jills Laken getränkt in einer dunklen, öligen Flüssigkeit, die gelben Vorhänge waren dermaßen blutbespritzt, dass sie schwerer an ihren Haken hingen als noch vor siebzehn Minuten. Ihre Zimmergenossin Eileen saß auf ihrem Bett, hielt sich das geschundene Gesicht und stöhnte leise näselnd Mama. Eileen war eine treue Anhängerin der Radioshow von Pastor Charles Swindoll, und auch wenn ich kein bisschen religiös war, hatte sie mich angefixt. Er sagte immer, das Leben bestehe zu zehn Prozent aus den Dingen, die einem widerfahren, und zu neunzig Prozent aus der Art, wie man damit umgeht.
Ich drückte Eileen den Eimer unter das Kinn und löste ihre Hände vom Gesicht. Tropfen aus Blut und Speichel klatschten auf den Metallboden des Eimers, es hörte sich tatsächlich so viel dicker an als Wasser.
»Halt fest«, sagte ich zu einem Mädchen aus dem ersten Jahr, das mir in das Zimmer gefolgt war. Sie wandte würgend das Gesicht ab, aber sie hielt den Eimer für Eileen, bis der Krankenwagen kam. »Sie darf sich nicht die Hände vors Gesicht halten, sonst erstickt sie.«
Auf dem Flur bog ich links ab und ging in Richtung meines Zimmers. Es war wie bei unserer Montagsversammlung. Durchgezählt wurde immer von vorn.
Die meisten Mädchen schreckten aus dem Schlaf hoch, als ich ihre Türen aufriss und das Licht anschaltete, verdeckten ihre Augen mit den Händen und fuhren sich mit den Zungen über die spröden Lippen. Auch wenn sie irritierte Grimassen zogen, waren sie immerhin unversehrt. Irrsinnigerweise fragte ich mich, ob es einen Streit zwischen Jill und Eileen gegeben haben könnte, ob die Sache vielleicht aus dem Ruder gelaufen war. Doch dann erreichte ich Zimmer acht. Hier wohnte ein Mädchen namens Roberta Shepherd. Ihre Zimmergenossin war an diesem Wochenende zum Skifahren verreist, und im Gegensatz zu den anderen stöhnte und ächzte Robbie nicht, als ich das Licht anmachte und ihren Namen rief.
»Robbie«, wiederholte ich in dem Ton einer alten Hauslehrerin, über den sich alle hinter meinem Rücken lustig machten. »Tut mir leid, aber du musst aufwachen.« Ich betrat das Zimmer, wobei mein Mut durch Adrenalin ersetzt wurde. Doch wie sich herausstellte, musste ich gar nicht mutig sein. Robbie lag auf der Seite und schlief, die Decke war bis zum Kinn hochgezogen. Ich ging auf sie zu, berührte ihre Schulter und sagte, dass Jill und Eileen verletzt waren und die Polizei jeden Moment da sein würde.
Als sie noch immer keine Reaktion zeigte, drehte ich sie auf den Rücken, und da entdeckte ich das dünne rote Rinnsal auf dem Kissen. Nasenbluten. Ich tätschelte tröstend ihre Schulter, während ich ihr versicherte, ich sei dafür früher auch anfällig gewesen, wenn ich mich zu sehr aufregte.
Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts ein polternder, brüllender Mann in Uniform neben mir auf. Sanitäter! Hol den Sanitäter! Ich trat auf den Flur, war im ersten Moment verwirrt und dann erbost. Wie kam dieser Mann dazu, mich in meinem eigenen Haus anzuschreien?
In der kurzen Zeit, die ich in Robbies Zimmer verbracht hatte, schien der Flur sich in eine surreale Zwischenwelt verwandelt zu haben, in der das Knistern von Funkgeräten zu hören war und es vor fliegengewichtigen Campus-Polizisten wimmelte, die kaum älter waren als wir. Die Mädchen trugen Wintermäntel über ihren Nachthemden. Jemand behauptete steif und fest, der Iran habe uns bombardiert.
»Da kommt ein komischer Geruch aus Denises Zimmer«, berichtete Bernadette, unsere Miss Florida und als Schatzmeisterin gleichzeitig meine Stellvertreterin. Gemeinsam gingen wir den Flur hinunter und wichen zwei nutzlosen Polizisten aus, die uns überrascht ansahen. Ich fragte mich, ob Denise möglicherweise vergessen hatte, ihre Farbpalette wegzuräumen, bevor sie abends ausgegangen war. Das kam manchmal vor, und der Geruch waberte dann durch das Zimmer wie austretendes Gas.
Denise hasste es, wenn man ihr sagte, was sie zu tun hatte. Sie war dickköpfig und talentiert und eitel und empfindsam. Unsere Freundschaft hatte die Position, die ich freiwillig übernommen hatte, nicht überlebt. Eine Position, in der es meine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass alle nach den Regeln spielten, egal für wie sinnlos und veraltet Denise sie halten mochte. Trotzdem liebte ich sie. Trotzdem wollte ich, dass sie das große, eindrucksvolle Leben führen konnte, das für sie bestimmt war, auch wenn ich akzeptieren musste, dass es darin wahrscheinlich keinen Platz für mich geben würde.
Als ich ihr Zimmer betrat, wusste ich es. Ich wusste es. Ich war nur nicht darauf vorbereitet gewesen, sie so früh zu verlieren. Denise lag auf der Seite, die Decke war bis über die Schulter hochgezogen. Im Zimmer musste es an die dreißig Grad warm sein, und es hing ein ekelhafter Toilettengeruch in der Luft.
Bernadette hielt mich fest und sagte, ich solle auf den Sanitäter warten, doch ich schüttelte sie ab. »Sie hat einen tiefen Schlaf«, beharrte ich mit erstickter, zorniger Stimme. Was auch immer Bernadette andeutete, was auch immer sie dachte – sie lag falsch.
»Bin gleich zurück«, sagte Bernadette und schlug sich den Ellbogen am Türrahmen an, bevor sie über den Flur rannte.
Als hätte sie bloß darauf gewartet, mit mir allein zu sein, schoss Denises Hand senkrecht in die Luft, ein steifarmiger Gruß. »Denise!« Mein Lachen klang gestört, das nahm ich selbst wahr. »Du musst dich anziehen«, sagte ich. »Alarmstufe rot. Hier laufen überall Polizisten rum.«
Ich ging zu ihr, und auch wenn ich mir weiterhin einredete, sie würde bloß schlafen, verstand ich doch genug, um sie in die Arme zu nehmen. In ihrem dunklen Haar hingen Holzstückchen, doch im Gegensatz zu Jills und Eileens Haaren war es trocken und weich. Ich strich darüber und forderte sie noch einmal auf, sich anzuziehen. Sie hatte nicht einen Kratzer im Gesicht. Es wäre Denise wichtig gewesen, so makellos von uns zu gehen.
Ich schlug die Bettdecke zurück – ihr musste schrecklich heiß sein – und sah, dass sie zwar noch ihr Lieblingsnachthemd trug, ihre Unterhose jedoch zusammengeknüllt neben einer Haarspraydose der Marke Clairol auf dem Boden lag. Ich begriff nicht, was ich sah, aber der Sprühkopf war mit einer dunklen Masse verklebt, an der drahtige Haare hingen, die man sonst vor einem Strandbesuch zwischen den Klingen des Rasierers findet.
Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter, sie schob mich beiseite, und vor mir stand wieder dieser Mann, der mich kurz zuvor angebrüllt hatte. Er zog Denise aus dem Bett und legte sie auf den Boden. Ich sagte ihm, wie sie hieß und dass sie eine Latexallergie habe. Deswegen musste sie immer genau prüfen, welche Farben sie in ihrem Zimmer aufbewahren konnte.
»Gut zu wissen«, sagte er, und ich verzieh ihm, weil er so sanft mit Denise umging, als er ihre Nase zuhielt und sein Gesicht über ihres legte. Sie schlief noch, aber sobald sie aufwachte, würde ich ihr erzählen, dass der Mann, der sie gerettet hatte, gut aussehend war und keinen Ehering trug. Vielleicht würde das die Kennenlerngeschichte der beiden sein, und ich würde sie eines Tages auf ihrer Hochzeit zum Besten geben.
15. Januar 19783:39 Uhr
Der Polizist im ersten Stock befahl uns, nach unten zu gehen, und der Polizist unten befahl uns, wieder in den ersten Stock zu gehen. Oben begegneten wir einem weiteren Beamten, der uns mit gereizter Stimme aufforderte, in einem Teil des Hauses zu bleiben und die Abläufe nicht zu stören, also entschied ich, dass wir uns in mein herrschaftliches Zimmer zurückziehen sollten.
Mein Zimmer hatte bodentiefe Doppelfenster, die sich direkt über den bronzefarbenen griechischen Buchstaben an unserem Eingang befanden. Wenn die Vorhänge zurückgezogen waren, konnte man den hell gepflasterten Gehweg überblicken, auf den Denise zu Beginn des Semesters mit Kreide den Namen unserer Verbindung geschrieben hatte.
Ein Mädchen griff nach dem Schleuderstab am Vorhang, und blaues und rotes Licht flutete den Raum. »Da kommt noch ein Krankenwagen«, sagte sie überflüssigerweise.
Einige weitere Mädchen traten ans Fenster, um selbst einen Blick nach draußen zu werfen. Es waren ungefähr dreißig Personen in meinem Zimmer zusammengepfercht, und der Geruch – nach Nachtcreme und Bieratem – hat sich für immer in mein olfaktorisches Gedächtnis eingebrannt.
»Drei Krankenwagen.«
»Sieben Streifenwagen.«
»Ich seh nur sechs.«
»Nur sechs. Da fühl ich mich gleich viel besser.«
Bernadette und ich schwärmten aus, liefen das Zimmer systematisch ab und sammelten so viele Informationen wie möglich. Wer hatte etwas gesehen. Etwas gehört. Eine meiner Verbindungsschwestern meinte, es sei ein Raubüberfall gewesen und wir sollten nachsehen, ob der Fernseher noch da sei. Eine andere war sich sicher, dass die Sowjets auf uns geschossen hatten und jetzt Krieg herrschte. »Ich glaube, das ist es nicht«, sagte ich und tätschelte sanft ihr Knie.
Bernadette und ich setzten uns zusammen, um uns auszutauschen. Normalerweise trug sie bereits morgens sorgfältig ihren glänzenden kirschroten Lippenstift auf, wenn sie noch im Bademantel war und Lockenwickler im Haar hatte. Es verwirrte mich, ihren blassen Mund zu sehen, und ich konnte spüren, dass sie sich ohne ihr charakteristisches Rot unwohl fühlte. Sie biss sich immer wieder auf die Unterlippe, was ihr kurzzeitig Farbe verlieh. Sie trug noch immer die bestickte Bluse, die sie am Abend ausgesucht hatte. Dieses Detail war enorm wichtig.
»Ich konnte sie nicht ausziehen«, sagte Bernadette und zeigte auf den Knopf an ihrer Bluse. Ich beugte mich zu ihr und nahm den Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger. Die glitzernde Verzierung hatte sich im Knopfloch verhakt. »Ich habe Robbie um Hilfe gebeten. Sie hat so eine besondere Stoffschere.« Robbie studierte Modedesign. »Sie hat rumgenörgelt, dass es drei Uhr nachts sei, und ich habe auf ihren Wecker geschaut, weil ich wusste, dass sie übertreibt. Ich hab gesagt, es ist erst zwei Uhr fünfunddreißig, Robbie. Und sie meinte, willst du jetzt meine Hilfe oder nicht?« Bernadette atmete ungläubig aus. »Wann ist das passiert? Warum habe ich nichts gehört? Es war alles in Ordnung. Als ich ging. Es war alles gut.«
»Wir besuchen sie im Krankenhaus, sobald die uns hier rauslassen«, versprach ich. Alles, was ich an diesem Morgen versprach, schien möglich zu sein, jetzt wo ich die Chance gehabt hatte, Erkundigungen einzuholen. Ein Fremder war in unser Haus eingedrungen, vermutlich um etwas zu stehlen, war einigen der Mädchen begegnet und in Panik verfallen. Einbrüche waren keine Seltenheit. Niemand hatte uns etwas antun wollen, und auch wenn Jill und Eileen verletzt worden waren, sah es sicher schlimmer aus, als es war. So wie man sich beim Duschen manchmal mit dem Rasierer in den Knöchel schnitt und es blutete, als hätte man die Hauptschlagader erwischt. Etwas anderes war kaum vorstellbar, denn sonst hätten wir, wie Bernadette meinte, irgendetwas gehört. Ich wischte mir die Hände an den Oberschenkeln ab, meine Sorgen zerstreuten sich vorübergehend.
Es kam mir vor, als säßen wir schon Stunden in meinem Zimmer, doch es konnten nicht mehr als zwanzig oder dreißig Minuten gewesen sein, denn die Vögel hatten noch nicht zu zwitschern begonnen, als ein neuer Polizist die Tür öffnete. Wir waren inzwischen wie benommen, völlig apathisch, doch sobald ein Außenstehender das Zimmer betrat, rieben sich alle die Augen und richteten sich konzentriert auf. Wir waren es gewohnt, Besprechungen abzuhalten oder uns für Ankündigungen zu versammeln, doch der Polizist schien überrascht, dass wir ihm augenblicklich unsere volle Aufmerksamkeit schenkten. Er zögerte eine ganze Weile, wie von einer Art Lampenfieber befallen.
»Gibt es Neuigkeiten?«, soufflierte ich. Er nickte mir zu, dankbar für die Erinnerung an seine Aufgabe. Er war groß und hatte eine breite Brust, ein junger Typ mit Dienstmarke, dessen Stimme allerdings kraftlos war. Wir mussten uns anstrengen, um zu verstehen, was er sagte.
»Es sind jetzt viele Leute im ersten Stock, und sie werden noch eine ganze Weile hier sein. Am besten zieht ihr nach unten um.«
Ich hob die Hand, nicht um aufgerufen zu werden, sondern um deutlich zu machen, dass ich sprechen würde. So lief es auch in den Sitzungen unseres Hauses ab. Wer etwas zu sagen hatte, meldete sich kurz, aber niemand wurde drangenommen. Wir saßen ja nicht im Seminar und waren hier keine Studentinnen. Ich betonte gern, dass wir Partnerinnen waren, die gemeinsam die Geschäfte des Hauses leiteten. »Was ist mit den anderen Mädchen?«, fragte ich. »Wie geht es ihnen?«
»Sie sind ins Krankenhaus gebracht worden.«
»Alle?«
Er nickte, sein Gesicht glänzend und aufrichtig.
Die Erleichterung gab mir Halt. Nicht, weil es die Antwort war, die ich hören wollte, sondern vielmehr, weil es überhaupt eine Antwort war. In dem Monat voller Unsicherheit, der auf uns zukommen würde, sehnte ich mich, sehnten wir uns alle nach Klarheit. Was war passiert? Wer war der Täter? Was sollten wir jetzt tun?
»Wann können wir unsere Eltern anrufen und ihnen erzählen, was passiert ist?«, fragte ich.
Der Polizist verzog nachdenklich den Mund. »In ungefähr einer Stunde vielleicht? So lange wird es in etwa dauern, bis wir die Fingerabdrücke von allen genommen haben.«
Die Mädchen brachen ihr Schweigen, ihre Fragen und Einwände flogen wild durcheinander, waren aber mehr als berechtigt. Ich ließ sie gewähren, sie hatten es verdient, sich kurz Luft zu machen. Ich stand auf, bewegte mich in die Mitte der Gruppe und allmählich verstummten alle. »Sie nehmen unsere Fingerabdrücke?«, fragte ich in dem ruhigen, aber besorgten Ton einer Sprecherin. »Warum?«
»Wir nehmen immer die Fingerabdrücke von allen.«
»Wer sind alle?« fragte ich schnippisch, meine Geduld schwand.
»Jeder an einem Tatort. Nicht nur die Angreifer.«
»Die Angreifer? Heißt das, es waren mehrere?«
»Was? Nein. Vielleicht. Das wissen wir nicht.«
»Also haben Sie die Person, die das getan hat, noch nicht gefasst?«
»Unsere Leute sind noch auf der Suche.«
Frustriert kniff ich mir in die Nasenwurzel. »Kann wenigstens jede von uns in ihr eigenes Zimmer gehen und sich umziehen, bevor wir runtermüssen?«
»Nein«, sagte er. Als die Beschwerden der Mädchen auf ihn einprasselten, man könne doch unmöglich ohne Hose vor all den Männern herumspazieren, zog er die Schultern ein, trat den Rückzug an und gab uns fünf Minuten, um uns zu sammeln.
»Ihr könnt euch so viel von mir ausleihen, wie ihr wollt«, sagte ich. Ich wollte gerade zum Kleiderschrank gehen, dessen Inhalt immer so verlockend für die eine Person gewesen war, die nicht bei uns sein konnte, doch ein Klopfen an der Tür ließ mich innehalten.
Ein weiterer Polizist steckte den Kopf zur Tür herein. »Welche von euch hat ihn gesehen?«
Ich drehte mich um. »Das war ich.«
»Kommen Sie bitte mit«, sagte der Polizist.
»Übernimmst du hier, während ich weg bin?«, fragte ich Bernadette. Sie nickte, die nackten Lippen entschlossen zusammengepresst.
Ich beeilte mich, wollte unbedingt helfen, damit alles geklärt war und ich zu Denise ins Krankenhaus fahren und schnellstmöglich wieder zurück sein konnte, um aufzuräumen, bevor die Ehemaligen eintrafen. Ich könnte meinen Freund anrufen! Brian nutzte jede Gelegenheit, um den Erstsemestern in seiner Verbindung etwas zu tun zu geben, und sie könnten im Haus klar Schiff machen, während die Mädchen duschten und sich anzogen. Die Ehemaligen wären sicher schockiert, wenn ich ihnen von dem Ereignis erzählte – offenbar ein versuchter Einbruchsdiebstahl –, aber umso beeindruckter, dass wir den Empfang trotzdem möglich gemacht hatten. Ich stellte mir vor, wie sie dem Dachverband berichten würden, dass die Verbindungsmitglieder an der Florida State University trotz eines schrecklichen Martyriums Haltung bewahrt hatten. Ich folgte dem Polizisten voll glühender Hoffnung nach unten.
Vier Uhr
Seine Nase. Letzten Endes ging es nur um die Nase. Sie war sein markantestes Merkmal, und ich konnte sie der Kunststudentin, die sich freiwillig für die Anfertigung eines Phantombildes gemeldet hatte, am besten beschreiben. Gerade und spitz zulaufend, wie der Schnabel eines urzeitlichen Raubvogels. Schmale Lippen. Ein kleiner Mann. Siebzehn Monate später würde ich es auskosten, diese Beschreibung in einem Gerichtssaal wiederholen zu dürfen. Ich hatte es so satt, von allen zu hören, wie gut aussehend er war, und kein Mann wird gern klein genannt.
Die Mütze, die er trug, bedeckte seine Ohren und die Augenbrauen. Die Kunststudentin, deren Name Cindy Young war, hatte Schwierigkeiten mit der Mütze und griff zweimal zum Radierer. Beim ersten Versuch sah sie aus wie eine Badekappe, beim zweiten wie ein Helm. »Normalerweise zeichne ich besser«, sagte sie mit Schweiß auf der gerunzelten Stirn. Wie ich, wie alle unter diesem Dach, war sie eine Perfektionistin, deren Hand zu sehr zitterte, um ihre eigenen hohen Erwartungen zu erfüllen.
»Schauen wir uns das mal an«, murmelte Sheriff Cruso, als er sich auf das Sofa im Salon setzte und sich über die Zeichnung beugte. Zur Unterstützung saß ich neben Cindy auf dem Fußboden, mit meinen Beinen unter dem Couchtisch und dem Rücken am berüschten Bezug des Sofas. Sheriff Crusos Knie war direkt neben meinem Gesicht, und es war unerhört, wie sehr mich seine Nähe anmachte. Ich mochte Sex nicht einmal. Denise sagte, das liege nicht an mir, sondern an Brian.
Sheriff Cruso reichte die Zeichnung an Detective Pickell »wie Eispickel« weiter, der hinter dem Sofa stand. »Schauen Sie sich das mal an«, sagte er. Pickell und Cruso schienen ungefähr gleich alt zu sein – jünger als ein Sheriff und ein Detective in meiner Vorstellung sein sollten –, und obwohl Cruso Schwarz war, hatte er offensichtlich das Sagen. Das war höchst ungewöhnlich in den Siebzigern, nicht nur in unserer Gegend, sondern überall. Seit Generationen waren die Sheriffs in den Südstaaten weiße Männer mittleren Alters mit schlechter Schulbildung, die Verfechter des Status quo. Doch als die Kriminalität in ländlichen Gegenden anstieg und sich der Blick auf das Thema Rassismus veränderte, tendierte die Wählerschaft zu jüngeren, gebildeteren Kandidaten. Cruso hatte Kriminologie an der Florida Agricultural and Mechanical University studiert und war der erste Schwarze Sheriff in Leon County. New York City würde diesen Meilenstein erst im Jahr 1995 erreichen.
Detective Pickell hielt das Bild unter eine der Tischlampen, um besser sehen zu können. »Das ist gut, Cindy.«
»Kann ich mir jetzt die Hände waschen?«, fragte Cindy. Sie hatte ihre kohlegeschwärzten Hände am Rand des Couchtisches abgelegt, um die cremefarbenen Möbel im Salon nicht zu beschmutzen. Wir machten uns noch Sorgen um das hübsche Sofa in diesem hübschen Raum, während Jills Blut oben durch die Matratze gesickert war und später sogar die Sprungfedern rosten lassen würde.
»Nur zu.« Cruso tippte sich an die Polizeimütze. Dann sagte er an Pickell gewandt: »Können Sie prüfen, wie weit wir sind, damit Miss Schumacher uns durchs Haus führen kann?«
Pickell verschwand in Richtung Foyer, wobei er einen großen Bogen um die Mädchen machte, deren Fingerabdrücke man im Esszimmer genommen hatte und die nun vor dem Badezimmer im Erdgeschoss anstanden. Sie verbargen ihre Gesichter, damit die Polizisten sie nicht weinen sahen, und ruinierten die Ärmel meiner Pullover. Die Presse würde später schreiben, man hätte unser Schreien bis nach draußen gehört – was längst nicht ihre schlimmste Lügengeschichte war, sie ärgerte mich aber trotzdem sehr. Wir übten uns in kontrolliertem Entsetzen, was mich damals mit Stolz erfüllte. Ich dachte, wenn wir schon eine solche Situation durchmachen mussten, würde sich wenigstens jeder daran erinnern, wie stark und tapfer wir dabei gewesen waren. Damals galt man als stark und tapfer, wenn man seine Probleme nicht zur Schau stellte. Aber die Leute schrieben über uns, was sie wollten, ohne jede Rücksicht auf die Wahrheit. Rückblickend hätte ich einfach alle schreien lassen sollen.
Sheriff Cruso schaute mich an und schenkte mir ein aufgeschlossenes Lächeln. Dieser Mann war wirklich gut aussehend, im Gegensatz zum Angeklagten, der bloß gut aussah für jemanden, der abscheuliche Dinge getan hatte. Sheriff Cruso war weit über ein Meter achtzig groß, hatte eine wohlgeformte, männliche Kinnpartie, aber engelsgleiche Wangen. Bald würde ich feststellen, dass er immer Cowboystiefel trug.
»Also, dieser Roger Yul. Was ist das für ein Typ?«
Ich hatte Sheriff Cruso und Detective Pickell die Wahrheit gesagt: dass ich im ersten Moment so überrascht gewesen war, mitten in der Nacht einen Mann in unserem Haus zu sehen, dass ich kurz dachte, es sei Denises Ex-Freund Roger.
Ich befand mich im Vorbereitungsstudium für Jura, war die Tochter eines der besten Anwälte für Gesellschaftsrecht in New York City und hatte schon das eine oder andere über strafrechtliche Ermittlungsverfahren aufgeschnappt. Ich wusste, dass Gesetzeshüter darauf trainiert waren, ihrem Instinkt zu vertrauen, aber ich hatte fälschlicherweise angenommen, sie hätten ein Gespür für seelische Feinheiten, für die Massen an Neuronen und chemischen Botenstoffen, die im Kopf zusammenprallen, wenn einem der Boden unter den Füßen wegbricht.
»Roger ist so ein typischer Kerl, der sich nicht festlegen will«, erwiderte ich so geduldig, wie ich konnte. »Aber es war nicht Roger, den ich an der Tür gesehen habe.«
»Was meinen Sie damit?«, fragte Sheriff Cruso und ignorierte den zweiten Teil meiner Antwort komplett. »Sich nicht festlegen.«
Ich wollte seufzen und mit den Beinen strampeln wie eine Zweijährige, die einen Wutanfall hatte. Sie verschwenden meine Zeit, Ihre Zeit, so viel Zeit! Gehen Sie da raus, und finden Sie den Typen mit der spitzen Nase und dem schicken Mantel!
Doch ich bewahrte Haltung. »Manchmal will er mit Denise zusammen sein, und manchmal will er lieber Single sein. Aber wie schon gesagt, es war nicht Roger, den ich an der Tür gesehen habe.«
»Und momentan?«, bohrte Sheriff Cruso weiter. »Will er mit Denise zusammen sein oder nicht?« Er lächelte mich an, nach dem Motto Tu mir den Gefallen, aber ich kaufte es ihm nicht ab. Die meisten Männer konnten mich nicht ausstehen.
»Sie hat vor den Weihnachtsferien Schluss gemacht, und jetzt ist es ziemlich offensichtlich, dass er sie zurückhaben will. Verraten Sie Denise nicht, dass ich das gesagt habe. Sie hält sich eh schon für die Größte.« Ich rollte mit den Augen und hoffte, Sheriff Cruso würde verstehen, dass ich ihm nicht das Leben schwer machen wollte. Die Menschen in meinem Umfeld hatten immer das Gefühl, ich würde ihnen das Leben schwer machen, und vielleicht stimmte das sogar. Aber Sheriff Cruso lachte nicht. Da war diese Pause, als ich Denise erwähnte. Er blinzelte und reagierte leicht verzögert.
Detective Pickell kam zurück. »Wir können jetzt die Begehung machen. Aber, Pamela, Sie müssen bitte erst Ihre Hausschuhe ausziehen, damit sich Ihre Fußabdrücke nicht mit denen des Einbrechers mischen.«
Ich zog meinen Fuß zu mir heran und betrachtete die blutbefleckte Sohle des Hausschuhs mit der Neugier einer Archäologin. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst gewesen, dass ich einen Hohlfuß hatte.
Gemeinsam gingen wir zur Hintertür und verfolgten von dort meine Schritte zurück. An der Stelle, wo ich den dumpfen Aufprall über mir gehört hatte, markierte Pickell den Teppich mit einem schwarzen Stück Klebeband. Ein weiteres klebte er auf die Stelle im Foyer, von wo aus ich gesehen hatte, wie der Einbrecher die Treppe herunterkam und an der Haustür stehen blieb. Man sagte uns, wir sollten die Klebestreifen nicht entfernen, bis man uns die Erlaubnis dafür erteilen würde, doch es kam nie jemand, um uns die Erlaubnis zu erteilen, und niemand machte sich auch nur die Mühe, uns anzurufen. Kurz bevor sich alle in die Sommerferien verabschiedeten, riss ich sie in stummer, blinder Wut vom Boden.
Ich musste mich genau dort hinstellen, wo ich den Mann beobachtet hatte, und mit dem großen Zeh das Maßband fixieren. An der Haustür schaute Pickell auf das Ende in seiner Hand und verkündete: »Vier Meter.«
Sheriff Cruso nickte zufrieden, als habe sich sein Verdacht bestätigt. »Das ist ziemlich weit weg, wenn es dunkel ist.«
»Aber es war nicht dunkel.« Ich zeigte auf den Kronleuchter, meinen wertvollen Beistand.
»Mitten in der Nacht herrschen hier trotzdem nicht die besten Lichtverhältnisse«, sagte Sheriff Cruso, obwohl er damit offensichtlich falsch lag. Wir mussten beide die Augen zusammenkneifen, während wir zum Kronleuchter schauten. »Und ich will Ihren ersten Eindruck nicht zu früh vom Tisch wischen.«
Es kann Spaß machen, überzeugend zu argumentieren, obwohl man falsch liegt. Das hat mein Vater immer gesagt, oder vielmehr gemahnt. Wenn man das Zeug dazu hat, einen Rechtsstreit zu gewinnen, sollte man seine Fähigkeiten als guter Anwalt oder gute Anwältin nicht nur weise, sondern auch ethisch korrekt einsetzen.
Aber überragende Anwälte, fügte er immer mit einem Augenzwinkern hinzu, wissen, wann der Zeitpunkt für einen Kompromiss gekommen ist.