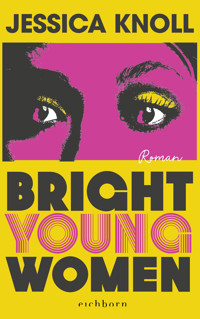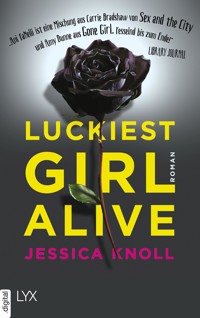
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ink.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
IHR PERFEKTES LEBEN
IST EINE PERFEKTE LÜGE
Ani FaNelli müsste die glücklichste Frau der Welt sein: Sie hat einen glamourösen Job, trägt die neueste Designerkleidung und wird in wenigen Wochen ihrem gut aussehenden, adeligen Verlobten auf einer sündhaft teuren Hochzeit das Jawort geben.
Anis Leben ist perfekt. Fast.
Denn Ani hat ein Geheimnis. Ein dunkles, brutales Geheimnis, das sie seit ihrer Jugend verfolgt. Jetzt hat es sie eingeholt. Und es droht, ihre perfekte Bilderbuchwelt für immer zu zerstören.
Der Bestseller aus den USA!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Danksagung
Die Autorin
Impressum
JESSICA KNOLL
Luckiest Girl Alive
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Kristiana Dorn-Ruhl
Zu diesem Buch
Ani FaNelli hat es endlich geschafft. Ihr Leben erscheint wie aus einem Bilderbuch: Sie hat einen glamourösen Job beim angesehensten Frauenmagazin der USA, trägt die neueste Designerkleidung, wohnt in einem hippen New Yorker Penthouse und wird in wenigen Wochen ihrem adeligen Verlobten auf einer sündhaft teuren Hochzeit das Jawort geben. Eigentlich müsste sie die glücklichste Frau der Welt sein. Doch Anis perfektes Leben ist nichts weiter als eine perfekte Lüge. Denn sie hat ein Geheimnis. Ein dunkles und schmerzhaftes Geheimnis, das weit zurück in ihre Vergangenheit reicht. Jetzt hat es sie eingeholt und droht, all das ans Licht zu bringen, was hinter Anis akribisch errichteter Fassade schlummert. Ani könnte ihr Schweigen brechen und endlich ihre Version der Geschehnisse von damals erzählen. Doch damit würde ihre perfekte Bilderbuchwelt wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Und sie würde all das zerstören, wofür sie in den letzten Jahren so hart gekämpft hat.
Allen TifAni FaNellis dieser Welt.
Ich weiß.
1
Ich betrachtete das Messer in meiner Hand.
»Das ist das Shun. Liegt viel leichter in der Hand als das Wüsthof, nicht wahr?«
Prüfend fuhr ich mit dem Finger über die Schneide. Der Griff war angeblich schweißabweisend, fühlte sich jedoch rasch feucht an in meiner Hand.
»Ich denke, dieses Modell passt besser zu jemandem mit Ihrer Statur.«
Ich sah zu dem Verkäufer hoch und wappnete mich gegen das Wort, das Leute immer benutzen, wenn sie kleine Frauen beschreiben, die lieber als dünn gelten würden.
»Zierlich.« Er lächelte, als hätte er mir ein Kompliment gemacht. Hätte er mir wirklich schmeicheln wollen, hätte er mich schlank, elegant, anmutig genannt.
Eine im Hautton etwas hellere Hand als meine erschien in meinem Blickfeld und wollte nach dem Messer greifen.
»Darf ich?«
Ich blickte zu dem dazugehörigen Mann auf – meinem Verlobten. Verlobung. Das Wort machte mich nervös, wenn auch nicht ganz so nervös wie Hochzeit. Dieses Wort zwängte mich in ein Korsett, das mir die Luft aus den Lungen trieb und die Kehle zuschnürte. Ich könnte einfach beschließen, nicht loszulassen, und die aus Nickel und Edelstahl geschmiedete Klinge (das Shun, weil es mir besser gefiel) geräuschlos in seinen Bauch treiben. Der Verkäufer würde vermutlich nur ein würdevolles »Oh!« von sich geben. Schreien würde die Mutter, die hinter ihm stand. Auf dem Arm trug sie ein Baby mit verkrusteter Nase. Man sah ihr förmlich an, dass Langeweile und Drama in ihr eine explosive Mischung bildeten. Sie würde den Reportern, die alsbald den Tatort stürmen würden, in tränenreicher Hysterie die Attacke schildern. Ich übergab das Messer, ehe mein Körper, der ohnehin ständig in Alarmbereitschaft war, auf Autopilot umschaltete und mich blind zustechen ließ.
»Ich freue mich riesig«, sagte Luke, als wir in einem Schwall eiskalter Klimaanlageluft aus dem Williams-Sonoma-Kaufhaus auf die 59th Street hinaustraten. »Und du?«
»Diese Rotweingläser sind toll.« Ich verschränkte meine Finger mit seinen, um ihm zu zeigen, dass ich es ernst meinte. Was mich allerdings störte, war das Konzept der »Sets«. Wir würden unweigerlich mit sechs Brottellern, vier Salatschüsseln und acht Esstellern enden, und ich käme nie dazu, sie zu einer richtigen kleinen Porzellanfamilie zu ergänzen. Sie würden auf der Küchentheke einstauben, während Luke immer wieder anbot, sie wegzuräumen, woraufhin ich »Noch nicht« fauchte, bis ich eines Tages, lange nach der Hochzeit, unvermittelt den manischen Drang verspüren würde, mit dem unvollständigen Ensemble in die Stadt zu fahren, bei Williams-Sonoma einzufallen wie Martha Stewart auf Kriegspfad, nur um festzustellen, dass sie das Design »Louvre«, das wir uns vor Jahren ausgesucht hatten, nicht mehr führen.
»Wollen wir Pizza essen gehen?«
Luke drückte lachend meine Hand. »Wo steckst du das nur alles hin?«
Meine Hand verkrampfte sich in seiner. »Wahrscheinlich liegt’s an dem vielen Work-out. Ich komme um vor Hunger.« Mir war noch schlecht von dem turmhoch mit Cornedbeef und Käse belegten Reuben-Sandwich, das ich zu Mittag gegessen hatte.
»Wie wär’s mit Patsy’s?« Ich tat, als sei ich in diesem Moment erst auf die Idee gekommen. Dabei träumte ich schon lange von einem Stück Pizza von Patsy’s, von weißen Käsefäden, die lang und länger wurden, ohne abzureißen, sodass ich sie zwischen die Finger nehmen und abziehen musste und mir auf diese Weise eine Extraportion Mozzarella vom Nachbarstück stibitzen konnte. Seit letztem Donnerstag schwebte dieses Bild vor meinem inneren Auge. Da hatten wir beschlossen, uns am Sonntag endlich um unsere Hochzeitsliste zu kümmern. (»Die Leute fangen an zu fragen, Tif.« – »Ich weiß, Mom, wir machen das schon.« – »Es sind nur noch fünf Monate bis zur Hochzeit!«)
»Ich hab keinen Hunger«, sagte Luke achselzuckend. »Aber wenn du unbedingt möchtest.«
Der allzeit gutmütige Luke.
Hand in Hand überquerten wir die Lexington Avenue und wichen einem Grüppchen Frauen mit starken Beinen in weißen Läufershorts und festem Schuhwerk aus, deren Tüten all die Schätze enthielten, die Victoria’s Secret in der Fifth Avenue führte, in Minnesota aber nicht; ebenso eine Truppe von Long-Island-Girls, um deren honigfarbene Waden sich die Riemchen ihrer Gladiatorsandalen rankten wie Lianen um einen Ast. Sie sahen Luke an, dann mich, ohne den geringsten Ausdruck von Zweifel. Ich hatte alles darangesetzt, eine ebenbürtige Rivalin zu werden, eine Carolyn Bessette für John F. Kennedy Junior. Wir bogen links in die 60th Street ein, um uns dann nach rechts zu wenden. Es war noch vor siebzehn Uhr, als wir am Restaurant ankamen. Die Tische waren gedeckt, aber unbesetzt. Die New Yorker Hipster saßen um diese Tageszeit noch beim Brunch. Früher gehörte ich da auch dazu.
»Draußen?«, erkundigte sich die Empfangskellnerin. Als wir nickten, nahm sie zwei Speisekarten von einem Tisch und bedeutete uns, ihr zu folgen.
»Für mich bitte ein Glas Montepulciano.«
Die junge Frau hob indigniert die Augenbrauen. Mir war klar, was sie dachte – es ist nicht mein Job, Bestellungen anzunehmen –, doch ich lächelte sie nur liebenswürdig an. Bin ich etwa nicht supernett? Ist Ihr Verhalten nicht total albern? Sie sollten sich wirklich was schämen.
Sie wandte sich an Luke. »Und für Sie?«
»Nur Wasser.«
Als sie sich zum Gehen wandte, sagte er zu mir: »Ich verstehe nicht, wie du bei dieser Hitze Rotwein trinken kannst.«
Ich zuckte die Schultern. »Weißwein passt einfach nicht zu Pizza.«
Weißwein gönnte ich mir nur an Abenden, wenn ich mich leicht und hübsch fühlte. Wenn ich in der Lage war, den Abschnitt »Pasta« auf der Karte zu übergehen. Im Women’s Magazine hatte ich einmal Tipps dazu gegeben: »Laut einer Studie ist man mit seiner Menüauswahl eher zufrieden, wenn man die Speisekarte sofort nach dem Auswählen zuklappt. Also wählen Sie die gegrillte Seezunge und schließen Sie sofort die Karte, ehe Sie mit den Penne à la Wodka zu flirten beginnen.« LoLo, meine Chefin, hatte das Wort »flirten« unterkringelt und dazugeschrieben: »Sehr witzig.« Ich hasse gegrillte Seezunge.
»Was müssen wir denn noch erledigen?« Luke lehnte sich zurück und verschränkte die Hände am Hinterkopf, als wolle er Sit-ups machen. Er hatte keine Ahnung, dass er mit dieser Frage vermintes Terrain betrat. In meinen braunen Augen gerann Gift, das ich jedoch rasch wegzwinkerte.
»Alles Mögliche.« Ich zählte an den Fingern auf: »Alles, was mit Papier zu tun hat – Einladung, Speisekarte, Programmheft, Tischkarten und so weiter. Ich muss jemanden finden, der mir Haare und Make-up machen kann, und die Brautjungfernkleider aussuchen. Außerdem müssen wir noch mal ins Reisebüro – ich will wirklich nicht nach Dubai. Ich weiß …« Ich hob die Hände, bevor Luke etwas erwidern konnte. »Wir können nicht die ganze Zeit auf den Malediven verbringen. Man kann nicht endlos am Strand herumliegen, ohne durchzudrehen. Aber könnten wir nicht ein paar Tage in London oder Paris dranhängen?«
Luke nickte mit konzentrierter Miene. Er hatte das ganze Jahr über Sommersprossen, doch Mitte Mai erreichten sie seine Schläfen, wo sie bis Thanksgiving blieben. Es war mein vierter Sommer mit Luke, und jedes Jahr aufs Neue beobachtete ich, wie sich die Goldpünktchen auf seiner Nase durch all die guten, gesunden Freiluftaktivitäten – Laufen, Surfen, Golf, Kiteboarding – vervielfachten wie Krebszellen. Eine Zeit lang hatte er mich mitgeschleppt. Seine Begeisterung für Bewegung und Endorphine war der reinste Terror. Nicht einmal der schlimmste Kater konnte ihn davon abbringen. Früher hatte ich mir meinen Wecker samstags auf 13 Uhr gestellt. Luke fand das süß. »So klein, und so ein Schlafbedürfnis«, sagte er immer, wenn er mich am Nachmittag wachkuschelte. Klein. Auch so eine Beschreibung, die ich hasste. Was musste ich denn noch alles tun, um »dünn« genannt zu werden?
Irgendwann bekannte ich Farbe. Es ist gar nicht so, dass ich mehr Schlaf brauche als andere, ich schlafe nur nicht, wenn andere Leute schlafen. Ich kann mir nicht vorstellen, zur gleichen Zeit in Bewusstlosigkeit zu versinken wie alle anderen. Richtigen Schlaf – nicht diese verkniffene Form von Ruhe, an die ich mich während der Woche gewöhnt habe – finde ich nur, wenn die Sonne sich im One World Center spiegelt, sodass ich mich im Bett umdrehen muss, wenn ich Luke höre, wie er in der Küche herumhantiert und Omelettes aus Eiweiß macht, oder wenn die Nachbarn darüber zanken, wer zuletzt den Müll rausgebracht hat. Banaler Alltag, so öde, dass er unmöglich stören kann. Erst dann kann ich richtig schlafen.
»Wir sollten uns vornehmen, jeden Tag eine Sache zu erledigen«, beschloss Luke.
»Luke, ich erledige drei Sachen am Tag.« Da war eine Schärfe in meiner Stimme, die ich mir eigentlich abgewöhnen wollte. Außerdem hatte ich kein Recht dazu, schnippisch zu sein. Ich hätte eigentlich drei Dinge am Tag erledigen müssen, stattdessen saß ich wie gelähmt vor meinem Computer und machte mir Vorwürfe, weil ich nicht drei Dinge am Tag erledigte, wie ich mir vorgenommen hatte. Doch weil das viel anstrengender und zeitintensiver war, als drei verdammte Dinge zu erledigen, hatte ich Anspruch darauf, wütend zu sein.
Mir fiel eine Sache ein, mit der ich tatsächlich gut in der Zeit lag. »Hast du überhaupt eine Ahnung, wie oft ich in dem Laden war, wo unsere Einladungen gedruckt werden?«
Ich hatte die Frau – eine zierlichen Asiatin, deren nervöse Unterwürfigkeit mich zur Weißglut brachte – mit tausend Fragen bombardiert: Würde es billig aussehen, wenn man die Einladungen im Reliefdruck druckt, die Antwortkarten aber nicht? Würde man merken, wenn wir die Adressen auf den Umschlägen von einem Kalligrafen schreiben, die Einladungskarten aber in einem Scriptfont drucken ließen? Ich hatte panische Angst aufzufliegen. Seit sechs Jahren lebte ich nun in New York, und es fühlte sich immer noch an wie ein Studium im Fach »Mühelos reich wirken«, Dissertation zum Thema: »Und das in New York City«. Im ersten Semester hatte ich gelernt, dass die Jack-Rogers-Sandalen, die zu Collegezeiten das Größte waren, mich sofort als beschränkten Kleinstadt-Blaustrumpf verrieten. Ich suchte mir neue Grenzen und warf meine goldenen, silbernen und weißen Flipflops in den Müll. Das Gleiche passierte mit den kleinen Coach-Baguette-Handtaschen (ging gar nicht). Und schließlich kam mir die Erkenntnis, dass Kleinfeld, ein New Yorker Klassiker, den ich immer für glamourös gehalten hatte, nur eine zweitklassige Brautkleiderfabrik war, die von Landeiern und Vorstädtern bevorzugt wurde. Ich entschied mich für eine kleine Boutique in Meatpacking mit behutsam dekorierten Roben von Marchesa, Reem Acra und Carolina Herrera. Und dann diese düsteren, überfüllten Clubs mit ihren fleischigen Türstehern und roten Seilen, in denen zu Tiësto mit den Hüften gepumpt wurde? So verbrachte man seinen Freitagabend nicht, wenn man als New Yorker was auf sich hielt. Nein, man saß in einer ordinären Bar im East Village, bestellte Endiviensalat für sechzehn Dollar und spülte ihn mit Wodka-Soda runter. Dazu trug man billig wirkende Rag & Bone-Booties für 495 Dollar.
Ich hatte sechs Jahre gebraucht, um dorthin zu gelangen, wo ich jetzt stand. Mein Verlobter arbeitete im Finanzwesen, ich war auf Du und Du mit der Inhaberin des Locanda Verde, und ich trug die neueste Chloé-Tasche am Handgelenk (keine Céline, aber immerhin stolzierte ich nicht mit einer monströsen Louis Vuitton durch die Gegend, als wäre sie das achte Weltwunder). Sechs Jahre hatten mir genügt, um dieses Handwerk zu erlernen. Doch eine Hochzeit zu planen ist eine ganz andere Nummer. Man verlobt sich im November, hat einen Monat Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dann stellt man fest, dass das Blue-Hill-Restaurant im Stone Barn Center – wo man eigentlich feiern wollte – renoviert worden ist und der neueste Hit ohnehin ehemalige Bankgebäude sind, die zwanzigtausend Dollar Miete pro Tag kosten. Es bleiben einem zwei Monate Zeit, um Hochzeitsmagazine und Blogs zu studieren, sich mit den schwulen Kollegen vom Women’s Magazine zu beraten und zu erfahren, dass trägerlose Brautkleider widerwärtiges Mittelmaß sind. Inzwischen waren es noch drei Monate, bis es so weit war, und ich hatte immer noch keinen Fotografen gefunden, der keine Braut mit Schmollmund in seinem Portfolio hatte (schwieriger, als es klingt), keine Brautjungfernkleider, die nicht aussahen wie Brautjungernkleider, und keinen Floristen, der mir außerhalb der Saison Anemonen besorgen konnte, weil Pfingstrosen einfach was für Dilettanten waren. Eine falsche Entscheidung, und jeder würde durch das dezente Bräunungsspray hindurch die billige Italo-Tussi erkennen, zu doof, um Salz und Pfeffer zusammen zu reichen. Ich dachte, mit achtundzwanzig müsste ich nicht mehr ständig versuchen, mich zu beweisen, und könnte mich endlich entspannt zurücklehnen. Stattdessen wurde der Kampf mit zunehmendem Alter immer blutiger.
»Du hast mir immer noch keinen Kalligrafen besorgt«, sagte ich, im Stillen nicht unzufrieden, weil ich dadurch mehr Zeit hatte, die scheue Schreibwarenhändlerin zu quälen.
»Ich arbeite dran«, erwiderte Luke seufzend.
»Wir können die Karten nicht rechtzeitig rausschicken, wenn du dich nicht diese Woche darum kümmerst. Ich bitte dich schon seit einem Monat darum.«
»Ich habe viel zu tun!«
»Ach, denkst du, ich nicht?«
Zanken ist so viel scheußlicher als ein erhitzter Streit, bei dem Geschirr fliegt. Danach hat man nämlich Sex auf dem Küchenboden und Abdrücke von Porzellanscherben mit Louvre-Ranken auf dem Rücken. Kein Mann reißt einem die Kleider vom Leib, wenn man ihn anzickt, weil er die Klospülung nicht betätigt hat.
Ich ballte die Fäuste und spreizte dann meine Finger ab, als könnte ich so meine Wut wegschleudern wie Spiderman seine Netzfäden. Sag’s halt.
»Tut mir leid.« Ich seufzte so erbarmungswürdig wie möglich. »Ich bin einfach erschöpft.«
Eine unsichtbare Hand fuhr über Lukes Gesicht und wischte seinen Unmut weg.
»Warum gehst du nicht zum Arzt? Du solltest dir wirklich Ambien oder so verschreiben lassen.«
Ich nickte, als würde ich den Vorschlag überdenken, doch Schlaftabletten sind nichts anderes als Schwäche in Knopfform. Was ich wirklich brauchte, waren die ersten beiden Jahre meiner Beziehung, die kurze Schonfrist, als mir, verwoben mit Luke, die Nacht entglitt und ich nicht den Drang verspürte, ihr nachzujagen. Die wenigen Male, die ich aufschreckte, sah ich, dass Luke sogar im Schlaf ein Lächeln im Gesicht trug. Seine Gutmütigkeit wirkte auf mich wie das Insektenspray, das wir im Sommerhaus seiner Eltern in Nantucket benutzten, so stark, dass es die Furcht, diese immerwährende schwelende Vorahnung dämpfte, etwas Schlimmes würde passieren. Doch dann irgendwann – vor etwa acht Monaten, als wir uns verlobten, wenn ich ganz ehrlich bin – kam die Schlaflosigkeit zurück. Ich fing an, Luke wegzustoßen, wenn er mich am Samstagmorgen wecken wollte, um mit mir über die Brooklyn Bridge zu laufen, was wir fast drei Jahre lang jede Woche getan hatten. Luke war kein erbärmlicher verliebter Welpe – er merkte durchaus, was los war, doch erstaunlicherweise band ihn das noch stärker an mich. Als würde er sich vornehmen, mich zurückzugewinnen.
Ich bin keine tapfere Heldin, die so tut, als wisse sie nichts von ihrer stillen Schönheit und ihrem ganz eigenen Charme, doch es gab durchaus eine Zeit, wo ich mich fragte, was Luke eigentlich in mir sah. Ich bin hübsch – nicht ohne dass ich mir Mühe gebe, aber die Voraussetzungen sind gut. Ich bin vier Jahre jünger als Luke, nicht acht, aber immerhin. Außerdem mache ich im Bett gern »seltsame« Sachen. Auch wenn Luke und ich unterschiedliche Definitionen von »seltsam« haben (er: von hinten und an den Haaren ziehen, ich: Elektroschocks an meiner Muschi und Knebel im Mund, um meine Schreie zu dämmen), führen wir nach seinen Maßstäben ein schräges, erfüllendes Liebesleben. Ich erkenne durchaus, was Luke in mir sieht, doch es gibt in der Innenstadt Bars voller Frauen, lauter süße, naturblonde Kates, die für Luke sofort auf alle viere gehen und mit ihrem Pferdeschwanz wedeln würden. Kate ist wahrscheinlich in einem roten Klinkerhaus mit weißen Schlagläden aufgewachsen, das auf der Rückseite keine schäbige Verkleidung hatte wie mein Elternhaus. Allerdings könnte Kate Luke niemals geben, was ich ihm gebe, nämlich den Kick. Ich bin die rostige, bakterienverseuchte Messerschneide, die Lukes ordentlich versäumtes Leben als Star-Quarterback bedroht. Er mag das, die Vorstellung, dass ich ihm gefährlich werden kann. Doch er will nicht wirklich sehen, was ich alles anrichten, was für hässliche Löcher ich reißen kann. Die längste Zeit unserer Beziehung habe ich nur an der Oberfläche gekratzt, ein bisschen mit Druck gespielt. Wie fest kann ich, wie fest muss ich drücken, bis Blut kommt? Ich bin es leid.
Bewusst nachlässig stellte mir die freundliche Empfangskellnerin ein Weinglas vor die Nase. Rote Flüssigkeit schwappte über den Rand und sammelte sich um den Fuß des Glases wie um eine Schusswunde.
»Bitte schön!«, flötete sie und zeigte mir ihr vermutlich gemeinstes Lächeln, das allerdings auf meiner persönlichen Skala noch nicht einmal den Zeiger bewegte.
Und so öffnete sich der Vorhang, und die Scheinwerfer strahlten los: Showtime.
»Oh je!« Ich tippte mir mit dem Finger auf die Schneidezähne. »Ein großes Stück Spinat. Genau hier.«
Die Empfangskellnerin schlug die Hand auf den Mund und lief vom Hals aufwärts tiefrot an.
»Danke«, murmelte sie und entfernte sich.
In der nachlassenden Abendsonne leuchteten Lukes Augen wie zwei blaue Kreise. »Sie hatte doch gar nichts zwischen den Zähnen«, sagte er irritiert.
Bedächtig lehnte ich mich über den Tisch und nahm vorsichtig einen Schluck Wein, um meine weißen Jeans nicht zu gefährden. »Nicht zwischen den Zähnen, aber zwischen den Arschbacken. Andererseits …«
Lukes Gelächter wirkte wie eine stehende Ovation. Beeindruckt schüttelte er den Kopf. »Du kannst ganz schön fies sein, weißt du das?«
»Der Florist wird die Reinigung am nächsten Tag nach Stunden abrechnen. Sie müssen im Vertrag eine Pauschale vereinbaren.«
Montagmorgen. Und natürlich musste ich im Aufzug mit Eleanor Tuckerman, geborene Podalski, fahren, Kollegin beim Woman’s Magazine, die nicht nur von morgens bis abends von meinem Talent schmarotzt, sondern sich außerdem für alles, was mit Heiraten und Etikette zu tun hat, für eine Koryphäe hält. Eleanor hatte vor einem Jahr geheiratet und sprach von dem Ereignis so getragen und pietätvoll, wie man vielleicht über den Elften September oder Steve Jobs Ableben sprechen würde. Ich nehme an, das wird so bleiben, bis sie geschwängert wird und einem zukünftigen Nationalheiligtum das Leben schenkt.
»Wirklich?« Ich schmückte meine Worte mit einem kleinen Japser des Entsetzens. Eleanor ist Ressortleiterin und damit meine Vorgesetzte und außerdem vier Jahre älter als ich. Es ist wichtig für mich, dass sie mich mag, aber dazu braucht es nicht viel. Frauen wie sie wollen nur, dass man sie aus großen, unschuldigen Bambiaugen anschaut und sie um einen klugen Rat anbettelt.
Eleanor nickte feierlich. »Ich maile Ihnen meinen Vertrag, damit Sie sehen, was Sie tun sollten.« Und wie viel wir hingeblättert haben. Das sagte sie nicht, aber genau darum ging es.
»Das wäre unglaublich hilfreich, Eleanor«, schleimte ich und zeigte meine erst kürzlich frisch gebleichten Zähne. Die Aufzugtür öffnete sich und entließ mich mit einem Klingelton nach draußen.
»Guten Morgen, Miss FaNelli.« Clifford zwinkerte mir charmant zu und ließ Eleanor leer ausgehen. Clifford saß seit einundzwanzig Jahren am Empfang des Women’s Magazine und pflegte aus den unterschiedlichsten und absurdesten Gründen eine tiefe Abneigung gegen die meisten Menschen, die tagtäglich an ihm vorbeigingen. Eleanors Verbrechen besteht einerseits darin, dass sie generell schrecklich ist, aber andererseits ließ sie auch einmal eine Mail herumgehen, in der Teeküche stünden Kekse bereit. Clifford konnte die Telefone nicht allein lassen und bat deshalb Eleanor per E-Mail, ihm einen zu bringen, dazu einen Kaffee, der so viel Milch enthielt, dass er die Farbe von Karamell hatte. Eleanor war zufällig in einer Besprechung, und als sie die E-Mail schließlich las, waren die Kekse längst weg. Sie brachte ihm zumindest seinen geliebten karamellfarbenen Kaffee, doch Clifford rümpfte nur die Nase und hat seither keine fünf Worte mehr mit ihr gesprochen. »Die fette Kuh hat den letzten wahrscheinlich selbst gegessen, statt ihn mir zu bringen«, fauchte er mir gegenüber nach dem »Vorfall«. Eleanor ist so magersüchtig wie sonst niemand, den ich kenne, und wir brachen hinterher förmlich zusammen vor Lachen.
»Morgen, Clifford.« Ich winkte leicht, und mein Verlobungsring glitzerte im fluoreszierenden Licht.
»Dieser Rock.« Mit anerkennendem Blick pfiff Clifford auf den Größe-zwei-Lederschlauch, in den ich mich nach der gestrigen Kohlenhydrate-Orgie gezwängt hatte. Das Kompliment war für mich ebenso wie für Eleanor gedacht. Clifford zeigte mit Vergnügen, was für ein Herzblatt er sein konnte, wenn man ihm nicht dumm kam.
»Dankeschön.« Ich hielt Eleanor die Tür auf.
»Scheißtranse«, murmelte sie im Hindurchgehen, gerade so laut, dass Clifford sie noch hören konnte. Dabei blickte sie mich an, um zu sehen, wie ich reagierte. Wenn ich die Bemerkung überging, wäre das ein klares Statement. Wenn ich lachte, Verrat an Clifford.
Ich hob die Hände. »Ach, ich liebe euch beide«, sagte ich laut, um die Lüge möglichst überzeugend klingen zu lassen.
Als die Tür sich geschlossen hatte und Clifford uns nicht mehr hören konnte, informierte ich Eleanor, dass ich auf dem Weg nach unten sei, um ein Bewerbungsgespräch zu führen, und erkundigte mich, ob ich ihr vom Kiosk einen Snack oder eine Zeitschrift mitbringen solle.
»Einen Müsliriegel und die neue GQ, falls sie sie haben.«
An dem Riegel würde Eleanor den ganzen Tag herumknabbern. Eine Nuss am späten Vormittag, zum Mittagessen eine getrocknete Cranberry. Doch sie lächelte mir dankbar zu, und das war genau das, was ich wollte.
Die meisten meiner Kolleginnen würden E-Mails sofort löschen, die mit »Darf ich Sie zum Kaffee einladen?« überschrieben sind und von ehrgeizigen Zweiundzwanzigjährigen kommen, die einerseits hypernervös sind und andererseits ein bedauernswert übersteigertes Selbstbewusstsein haben. Sie sind alle mit Lauren Conrads Reality-Fernsehserie The Hills aufgewachsen und denken: Ich will auch mal bei einer Zeitschrift arbeiten, wenn ich groß bin. Später sind sie dann enttäuscht, wenn sie feststellen, dass ich nichts mit Mode zu tun habe (»Nicht einmal mit Beauty?«, schmollte eine, die Yves-Saint-Laurent-Tasche ihrer Mutter im Arm wie ein Neugeborenes). Mir macht es Spaß, die Mädchen aufzuziehen. »Das Einzige, was ich in meinem Job umsonst bekomme, sind die Druckfahnen von Büchern, drei Monate vor dem Erscheinungstermin. Was lesen Sie denn im Moment?« Dass ihnen daraufhin die Farbe aus dem Gesicht weicht, ist mir Antwort genug.
Das Women’s Magazine hat schon immer Seichtes mit Anspruchsvollem verwoben. Gelegentlich blitzt ernsthafter Journalismus durch, hin und wieder werden Buchauszüge halbwegs renommierter Autoren gedruckt oder eine der wenigen weiblichen Topmanagerinnen vorgestellt, die es geschafft hat, die gläserne Decke zu durchbrechen. Behandelt werden außerdem heikle »Frauenthemen«, sprich Familienplanung und Abtreibung, wobei LoLo sich regelmäßig über das Schubladendenken aufregt: »Männer wollen auch nicht bei jedem Fick ein Kind.« Nichtsdestotrotz sind das nicht die Gründe, warum jeden Monat eine Million Neunzehnjährige die Zeitschrift kaufen. Und es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass ich Texte mit Titeln wie »99 Arten, sein Baguette zu schmieren« verfasse, als dass ich Präsidentenberaterin Valerie Jarrett interviewe. Meine Chefin LoLo – eine schicke, wenn auch geschlechtslose Person mit einer bedrohlichen Ausstrahlung, die mir bestens bekommt, weil sie mir das Gefühl gibt, mein Job sei in ständiger Gefahr und somit bedeutsam –, scheint von mir gleichermaßen angewidert und fasziniert.
Am Anfang wurde ich auf das Thema Sex angesetzt, vermutlich wegen meines Äußeren. (Ich kann zwar inzwischen meinen Busen ganz gut verstecken, aber ich scheine irgendwie etwas Ordinäres auszustrahlen.) Dass ich erst einmal dabei blieb, lag daran, dass ich gut darin war. Über Sex zu schreiben ist gar nicht so einfach, und die meisten Redakteurinnen, Abonnentinnen von Intellektuellenblättern wie The Atlantic, würden sich dazu gar nicht herablassen. Die Damen können gar nicht genug betonen, wie wenig sie über Sex wissen. Als könne man sich nicht gleichzeitig darüber im Klaren sein, wo man seine Klitoris hat, und trotzdem guten Journalismus betreiben. »Was ist BDSM?«, hat mich LoLo einmal gefragt. Obwohl sie die Antwort genau kannte, hat sie vergnügt geschnaubt, als ich ihr den Unterschied zwischen »Dom« und »Sub« erklärte. Doch ich halte mich an ihre Regeln. LoLo weiß genau, dass es nicht an dem Artikel über Emily’s List und deren Kampagne für Abtreibung liegt, dass die Zeitschrift sich wie warme Semmeln verkauft, und sie braucht die Verkaufszahlen für sich ganz persönlich. Es gehen Gerüchte um, sie wolle den Leiter des New York Times Magazine beerben, wenn sein Vertrag ausläuft. »Du bist die Einzige, die Sex witzig und intelligent darstellen kann«, hat sie mir einmal gesagt. »Halte durch. Spätestens in einem Jahr ist es vorbei mit Blowjobs. Versprochen.«
Diese im Scherz dahingesagte Bemerkung war mir ebenso kostbar wie der glitzernde Parasit an meinem Ringfinger. Monatelang dachte ich an nichts anderes. Dann kam Luke mit der Nachricht nach Hause, dass es im Gespräch sei, ihn nach London zu versetzen. Das würde eine bedeutende Erhöhung seines ohnehin schon beachtlichen Bonus nach sich ziehen. Natürlich hätte ich nichts dagegen, irgendwann mal in London zu leben, aber nicht als Anhängsel von Luke.
Er war überrascht, als sich mein Gesicht verfinsterte.
»Du schreibst«, erklärte er. »Das kannst du doch überall tun. Das ist ja das Schöne daran.«
Ich begab mich auf eine Kreisbahn durch die Küche und hob zu meiner Verteidigung an. »Ich will nicht freiberuflich arbeiten, Luke. In einem fremden Land um Aufträge betteln. Ich will eine festangestellte Redakteurin sein.« Ich deutete zu Boden. »Und zwar beim New York Times Magazine.« Ich legte meine gekrümmten Finger aneinander, als hielte ich diese Option in Händen, und schüttelte sie.
»Ani.« Luke umfasste meine Handgelenke und senkte meine Arme an meine Hüften. »Du musst dich endlich davon frei machen. Du musst nicht jedem beweisen, dass du mehr kannst als über Sex schreiben. Ich weiß genau, wie das enden wird: Du arbeitest ein Jahr dort, dann hängst du mir in den Ohren, dass du ein Kind willst, und danach hast du gar keine Lust mehr, arbeiten zu gehen. Lass uns doch mal vernünftig sein. Soll ich – sollen wir …« – er betonte tatsächlich das Wir – »… wirklich diese Chance vergeben, nur um einer Laune nachzugeben?«
Luke findet, dass meine Pläne nicht recht zur typisch amerikanischen Durchschnitts-Kate passen. Ich weiß das. Ich wollte den Ring und die feierliche Hochzeit mitsamt ausladendem Kleid. Ich habe eine teure Dermatologenpraxis in der Fifth Avenue, wo man mir spritzt, was immer ich will, außerdem schleppe ich Luke regelmäßig zu ABC Carpet & Home, um türkise Lampen und antike Beni-Ourain-Berberteppiche zu besichtigen. »Würden die in unserem Foyer nicht toll aussehen?«, frage ich jedes Mal, woraufhin Luke nach einem Blick auf das Preisschild einen Herzinfarkt simuliert. Ich glaube, er verlässt sich darauf, dass ich ihm so lange zusetze, bis er sich nicht mehr gegen das Vaterwerden wehrt, genauso wie es bei seinen Freunden und deren Frauen war. Beim Bier wird er sich darüber beklagen – »Jetzt legt sie schon Tabellen für ihren Zyklus an« –, und sie werden mitfühlend vor sich hin brummen. Kenn ich alles, Kumpel. Doch tief in ihrem Innern sind sie froh, dass jemand sie gezwungen hat, denn sie wollen es auch, möglichst einen Jungen, aber es gibt zur Not ja noch eine zweite Chance, wenn sie den Erben nicht gleich beim ersten Mal zustande kriegen. Nur, Männer müssen das nie zugeben. Luke rechnet nie im Leben damit, mich erinnern zu müssen, dass meine biologische Uhr tickt.
Das Problem ist, ich werde ihn nicht zwingen. Ich finde Kinder viel zu anstrengend.
Allein die Vorstellung, schwanger zu sein, ein Kind zu gebären, versetzt mich in einen Zustand, nicht direkt in Panik, es ist mehr ein Schwindelgefühl, genau wie damals vor etwa vierzehn Jahren, als ich mich plötzlich fühlte, als säße ich auf einem Karussell, das mitten im Schwung abgestellt wird. Es ist, als würde ich nach und nach zum Halt kommen, als würde der Schlag meines Herzens allmählich abebben, während mein Leben seine letzten Runden dreht. All diese Termine, immer wieder Ärzte und Krankenschwestern, die mich betatschen – warum lässt er seine Hand da so lange liegen? Spürt er etwas? Einen Tumor? Vielleicht hört das Drehen ja nie auf. Ich bin ein unerträglicher Hypochonder und kann den geduldigsten Arzt auf die Palme bringen. Ich bin dem Schicksal einmal von der Schippe gesprungen, aber das war nur eine Frage der Zeit, möchte ich ihnen erklären, damit sie verstehen, dass meine Neurose eine reale Ursache hat. Ich habe Luke von dem Schwindelgefühl erzählt und versucht, ihm zu erklären, dass ich besser nie schwanger werde, weil ich mir viel zu viele Sorgen machen würde. Er hat nur gelacht und seine Nase an meinem Nacken gerieben. »Du bist so süß«, hat er geschnurrt. »Dass du dich so um das Baby sorgen würdest.« Ich lächelte nur. Natürlich hatte ich es genau so gemeint.
Mit einem Seufzen drückte ich den Knopf zur Lobby und wartete, bis die Aufzugtür aufglitt. So wie sie nie über Sex schreiben würden, würden sich meine Kolleginnen nie herablassen, solche Anfängerinnen zu empfangen, doch ich finde das überaus unterhaltsam. In neun von zehn Fällen ist sie die Hübscheste ihrer Studentenverbindung, die mit der besten Garderobe und der größten Kollektion von J-Brand-Jeans. Es amüsiert mich immer wieder aufs Neue zu sehen, wie ein Schatten über ihr Gesicht huscht, wenn sie meine Derek-Lam-Hose entdeckt, die locker auf meinen Hüften sitzt, und den nachlässigen Haarknoten in meinem Nacken. Sie wird an ihrem geschmackvollen Empire-Kleid zupfen, das plötzlich matronenhaft wirkt, über ihr übertrieben geglättetes Haar streichen und erkennen, dass sie alles falsch gemacht hat. Vor zehn Jahren noch hätten mir solche Frauen Höllenqualen bereitet, doch heute springe ich morgens freudig aus dem Bett, wenn ich weiß, dass ich an diesem Tag meine Macht über eine von ihnen ausspielen darf.
Die junge Frau, die ich an jenem Morgen treffen würde, war für mich besonders interessant. Spencer Hawkins – ein Name, für den ich morden würde – war Absolventin meiner alten Highschool, der Bradley School, und hatte kürzlich am Trinity College ihren Abschluss gemacht (so wie alle anderen). Sie »bewundere meine Kraft angesichts der Widrigkeiten«. Als wäre ich Rosa Parks oder so was. Aber was soll ich sagen, sie hatte den richtigen Nerv getroffen.
Ich entdeckte sie gleich, nachdem ich aus dem Aufzug getreten war – zerknautsche Lederhose (richtig gut, falls Kunstleder), perfekt abgestimmt mit einer blütenweißen Hemdbluse und scharfen silbernen Highheels, am Arm eine Chanel-Tasche. Wenn nicht ihr Mondgesicht gewesen wäre, hätte ich mich sofort umgedreht und so getan, als würde ich sie nicht kennen. Ich kann nicht gut mit ernsthafter Konkurrenz umgehen.
»Ms FaNelli?«, sagte sie vorsichtig. Mann, ich kann es gar nicht abwarten, eine Harrison zu werden.
»Hallo.« Ich schüttelte ihr so heftig die Hand, dass die Kette an ihrer Handtasche rasselte. »Wir haben zwei Kaffeevarianten zur Auswahl – am Kiosk gibt es Illy, in der Cafeteria Starbucks. Suchen Sie sich was aus.«
»Ich richte mich ganz nach Ihnen.« Kluge Antwort.
»Starbucks kann ich nicht ausstehen.« Ich rümpfte die Nase und machte kehrt. Ihre Absätze klapperten wie wild hinter mir her.
»Guten Morgen, Loretta!«
Am aufrichtigsten bin ich, wenn ich mit der Verkäuferin am Kiosk spreche. Loretta hat am ganzen Körper Narben von schweren Verbrennungen – niemand weiß, woher –, und sie strömt einen starken, säuerlichen Geruch aus. Als sie letztes Jahr anfing, beklagten sich die Leute – so ein enger Raum und dazu noch mit Lebensmitteln. Es sei einfach unappetitlich. Sicher sei es ehrenwert von der Firma, sie einzustellen, aber könne sie nicht vielleicht in der Postzentrale im Untergeschoss arbeiten? Ich habe sogar einmal Eleanor einer Kollegin gegenüber jammern gehört. Seit Loretta am Kiosk stand, war der Kaffee stets frisch, die Milchbehälter waren voll – sogar der mit Sojamilch! –, und die neuesten Ausgaben der Zeitschriften waren kunstvoll auf den Regalen ausgestellt. Loretta liest alles, was sie in die Finger bekommt. Sie verzichtet auf eine Klimaanlage und steckt das gesparte Geld in ihre Reisekasse. Einmal hat sie auf ein Model in einem der Magazine gezeigt und zu mir gesagt: »Ich dachte, das wären Sie!« Ihre Kehle muss ebenfalls verbrannt sein, denn ihre Stimme klingt wie ein rostiges Reibeisen. Sie hatte mir das Foto entgegengeschoben. »Ich hab das Model gesehen und dachte: Das ist doch meine Freundin.« Das Wort schnürte mir die Kehle zu, und ich konnte kaum die Tränen zurückhalten.
Ich lege Wert darauf, diese jungen Frauen zu Lorettas Kiosk zu führen.
»Sie haben also für die Collegezeitung geschrieben?«
Das Kinn in meine Hand gestützt, fordere ich sie auf, mir mehr von ihrer Enthüllungsstory über das Schulmaskottchen zu erzählen und wie latent schwulenfeindlich das Kostüm sei, während ich längst beschlossen habe, erst einmal abzuwarten, wie sie sich Loretta gegenüber verhalten würde, bevor ich darüber entscheide, wie viel Unterstützung sie verdient.
»Guten Morgen!« Loretta strahlte mich an. Es war elf Uhr vormittags, und am Kiosk war nichts los. Loretta las Psychologie heute. Sie senkte das Magazin und offenbarte das rosa-braun-graue Patchwork auf ihrem Gesicht. »Dieser Regen«, seufzte sie. »So wenig ich ihn mag, ich hoffe doch, es regnet die ganze Woche, damit wir ein schönes Wochenende bekommen.«
»Oh ja, nicht wahr.«
Loretta redete mit Begeisterung über das Wetter. In ihrem Land, der Dominikanischen Republik, würde auf den Straßen getanzt, wenn es regnete. Aber nicht hier, sagte sie. Hier sei der Regen schmutzig.
»Loretta, das ist Spencer.« Ich deutete auf meinen frischen Fang. Ihre Nase zuckte, das sprach noch nicht unbedingt gegen sie. Es ist kaum möglich, nicht körperlich auf den Gestank der Hölle zu reagieren. Niemand wusste das besser als ich. »Spencer, das ist Loretta.«
Loretta und Spencer tauschten Nettigkeiten aus. Diese jungen Frauen waren immer höflich, etwas anderes kam ihnen gar nicht in den Sinn. Doch manchmal hatte ihr Verhalten etwas Angestrengtes, das mich misstrauisch werden ließ. Manche versuchten nicht einmal zu verbergen, was für widerliche Kühe sie waren, sobald wir wieder unter uns waren. »Oh mein Gott, hat sie so gestunken?«, sagte einmal eine zu mir, die Hand vor dem Mund, um ein Lachen zu unterdrücken, und rieb dabei verschwörerisch ihre Schulter an mir, als wären wir Freundinnen, die gerade Stringtangas bei Victoria’s Secret geklaut hatten.
»Es gibt Kaffee und Tee, Sie haben die Wahl.« Ich nahm einen Kaffeebecher vom Stapel und ließ einen dunklen Strahl hineinlaufen, während Spencer hinter mir stand und überlegte.
»Der Pfefferminztee ist sehr gut«, schlug Loretta vor.
»Ja?«, erwiderte Spencer.
»Ja«, bestätigte Loretta. »Sehr erfrischend.«
»Wissen Sie« – Spencer schob den Riemen ihrer klassischen Stepphandtasche etwas höher auf ihre Schulter –, »ich trinke normalerweise gar keinen Tee. Aber heute ist es so heiß, dass das richtig verlockend klingt.«
Nun ja. Vielleicht war die ehrenwerte Bradley School inzwischen endlich imstande, ihr hehres Motto auch in die Tat umzusetzen: »Die Bradley School verpflichtet sich zu akademischer Exzellenz und legt Wert darauf, bei allen Schülern Mitgefühl, Kreativität und Respekt zu entwickeln.«
Ich bezahlte unsere Getränke. Spencer wollte übernehmen, doch ich ließ sie nicht. Dabei habe ich diesen wiederkehrenden Albtraum, dass meine Karte abgelehnt wird, dass läppische 5,23 Dollar meine sorgsame Inszenierung platzen lassen: stilsicher, erfolgreich, verlobt – und das alles mit achtundzwanzig. Die American-Express-Rechnungen gingen an Luke, was ich eigenartig fand, wenn auch nicht eigenartig genug, um etwas daran zu ändern. Ich verdiene siebzigtausend Dollar im Jahr. Wenn ich in Kansas City leben würde, wäre ich so was wie Paris Hilton. Und Luke verdient so viel, dass Geld bei uns nie ein Problem sein wird. Und doch ist da immer noch diese tief sitzende Angst vor dem Wort »abgelehnt«, die Erinnerung an meine Mutter, die sich umständlich beim Kassierer entschuldigt, während sie enttäuscht und mit zitternden Händen die Karte zurück in ihre Geldbörse schiebt, zu all den anderen überzogenen Kameraden.
Spencer nahm einen Schluck von ihrem Tee. »Köstlich.«
Loretta strahlte. »Was habe ich Ihnen gesagt?«
Wir suchten uns einen Tisch in der menschenleeren Cafeteria. Regengraues Licht drang durch ein Oberlicht über uns, und mir fiel auf, dass Spencer drei Linien auf ihrer gebräunten Stirn hatte, so fein, dass man sie für Härchen halten konnte.
»Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie sich mit mir treffen wollten«, setzte sie an.
»Selbstverständlich.« Ich trank an meinem Kaffee. »Ich weiß, wie schwer es ist, in dieser Branche einen Fuß in die Tür zu bekommen.«
Spencer nickte heftig. »So schwer. Alle meine Freundinnen sind ins Finanzwesen gegangen. Die hatten schon vor dem Examen jede Menge Jobangebote.« Sie zupfte an ihrem Teebeutelfaden. »Ich bin jetzt seit April auf der Suche, und ich frage mich ernsthaft, ob ich nicht was anderes probieren soll. Einfach nur, damit ich überhaupt Arbeit habe. Das wird allmählich peinlich.« Sie lachte. »Dann könnte ich endlich hierherziehen und nebenbei weitersuchen.« Fragend blickte sie mich an. »Denken Sie, das wäre sinnvoll? Ich fürchte, wenn in meinem Lebenslauf steht, dass ich in einem ganz anderen Gebiet arbeite, stellt mich niemand mehr bei einer Zeitschrift an. Andererseits, wenn ich gar nicht arbeite und zu lange nach einem Job suche, kann ich gar keine Erfahrung vorweisen.« Angesichts dieses hypothetischen Dilemmas seufzte Spencer frustriert. »Was meinen Sie?«
Ich war schockiert, dass sie gar nicht in der Stadt wohnte, in einem Apartment in der 91. Straße, Ecke Erste, bezahlt von Daddy.
»Wo haben Sie Praktikum gemacht?«, fragte ich.
Spencer blickte verlegen an sich herunter. »Gar nicht. Ich meine, schon, aber in einer Literaturagentur. Ich möchte Schriftstellerin werden, das klingt so was von ehrgeizig naiv, genau wie: ›Ich will mal Astronautin werden!‹ Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es anstellen soll. Ein Professor schlug vor, ich solle mich auf der geschäftlichen Seite umsehen, um ein Gespür für das Verlagswesen zu bekommen. Bis dahin war mir gar nicht klar gewesen, dass Zeitschriften – ich liebe Zeitschriften, ich liebe das Women’s Magazine, meine Mutter hatte es schon, da hab ich als kleines Mädchen immer heimlich reingeschaut.« Die Geschichte ist so platt, dass ich nie weiß, ob ich sie glauben soll. »Jedenfalls war mir nie klar, dass das Zeug ja jemand schreiben muss. Dann fing ich an, mich über das Verlagswesen schlauzumachen, und jetzt weiß ich, das, was Sie tun, ist genau das, was ich auch tun will.«
Als sie fertig war, atmete sie schwer. Ganz schön viel Leidenschaft. Gefiel mir aber. Die meisten wollen nur einen Job, bei dem sie mit Klamotten spielen, Promis treffen und regelmäßig in den Boom-Boom-Room-Nightclub gehen können, weil ihr Name auf der VIP-Liste steht. Solche Dinge waren nette Nebeneffekte dieses Jobs, aber für mich war es immer wichtiger gewesen, »von Ani Fanelli« schwarz auf weiß gedruckt zu sehen oder mein Exemplar mit der Bemerkung »Superwitzig« oder »Mal wieder genau den richtigen Ton getroffen« zurückzubekommen. Diese spezielle Seite hatte ich mit nach Hause genommen, wo Luke sie an den Kühlschrank geheftet hatte, als hätte ich eine Eins auf eine Hausarbeit bekommen.
»Nun, Sie wissen, dass Sie, je höher Sie als Redakteurin aufsteigen, immer weniger schreiben und dafür mehr redigieren.«
Das hatte mir mal eine Redakteurin bei einem Bewerbungsgespräch gesagt, und ich hatte mich schwer darüber ereifert. Wer wollte schon auf das Schreiben verzichten, um stattdessen zu redigieren? Heute, nach sechs Jahren im Verlagswesen, ist mir alles klar. Im Women’s Magazine gab es nur begrenzt Raum für rechercheintensive, tiefschürfende Themen. Ich hatte auch keine Lust, meinen Leserinnen ständig zu raten, dass sie, wenn sie mit ihrem Freund ein schwieriges Thema besprechen wollten, sich besser neben ihn setzten als ihm gegenüber. »Experten sagen, Männer sind eher aufnahmefähig, wenn sie nicht das Gefühl haben, frontal angegriffen zu werden – im wahrsten Wortsinn.« Trotzdem hatte es was, den Leuten zu sagen, wo man arbeitete, wenn dann ihre Augen anerkennend aufleuchteten. Genau das brauchte ich jetzt.
»Aber ich sehe dauernd Ihren Namen«, sagte Spencer.
»Tja, wenn Sie ihn nicht mehr sehen, wissen Sie, dass ich den Laden übernommen habe.«
Spencer drehte schüchtern ihren Teebecher zwischen den Händen. »Wissen Sie, als ich Ihren Namen zum ersten Mal im Impressum las, war ich nicht sicher, ob das wirklich Sie sind. Aber dann hab ich Sie im Fernsehen in der Today-Show gesehen. Und auch wenn Ihr Name ein bisschen anders geschrieben ist und Sie irgendwie ganz anders aussehen – also, nicht dass Sie nicht schon immer hübsch waren …« Ihre Wangen überzogen sich tiefrot. »Jedenfalls wusste ich sofort, dass Sie es sind.«
Ich erwiderte nichts. Sie würde schon fragen müssen.
»Haben Sie sich wegen der Ereignisse damals für diesen Beruf entschieden?«, wollte sie leise wissen.
Ich lieferte ihr die Story, die ich immer erzähle, wenn jemand diese Frage stellt. »Zum Teil ja. Ein Professor an der Uni gab mir den Rat, Journalistin zu werden. Dann würden mich die Menschen nach meinen Leistungen beurteilen und nicht nach dem, was sie glauben, über mich zu wissen.« An dieser Stelle zucke ich immer mit den Schultern. »Nicht dass sich die Leute überhaupt an meinen Namen erinnern. Als Einziges fällt ihnen auf, dass ich in Bradley war.« Und jetzt die Wahrheit: Mir wurde schon am ersten Tag der Highschool bewusst, dass mit meinem Namen etwas nicht stimmte. Unter all den Chaunceys und Griers, den schlicht eleganten all-american Kates, gab es keinen einzigen Namen, der auf einen Vokal endete. »TifAni FaNelli« fiel auf wie der niveaulose Verwandte, der beim Familientreffen an Thanksgiving den ganzen teuren Whiskey austrinkt. Wäre ich nicht zur Bradley School gegangen, wäre mir dieser Gedanke nie gekommen. Andererseits, wäre ich nicht an der Bradley gewesen, sondern in meinem Teil von Pennsylvania geblieben, würde ich jetzt vor einer Grundschule in der Schlange der abholenden Autos in meinem geleasten BMW sitzen und mit meinen Frenchnails auf das Lenkrad trommeln. Bradley war wie eine gewalttätige Pflegemutter, die mich zwar vor dem Waisenhaus gerettet hatte, aber nur damit sie mich für ihre kranken, drogenverseuchten Fantasien missbrauchen konnte. Mit Sicherheit hat der Beamte an der Uni beim Lesen meines Namens auf der Anmeldung die Braue gehoben. Ganz bestimmt ist er daraufhin halb von seinem Stuhl aufgestanden und hat seine Sekretärin gerufen: »Sue, ist das die TifAni FaNelli von …«, um sich dann sofort zu unterbrechen, weil er beim Weiterlesen die Bestätigung fand, dass ich Bradley besucht hatte.
Ich wagte nicht, mein Schicksal herauszufordern und mich an einer der berühmten Elite-Unis zu bewerben, doch viele der zweitplatzierten hätten mich mit Handkuss genommen. Mein Essay, der von rosa Prosa und protzigem Pathos nur so strotzte, rührte die Zulassungsbeamten zu Tränen. Ich hatte alles hineingepackt, was ich über dieses grausame Leben wusste, auch wenn ich erst an dessen Anfang stand, und ich hatte ganz bewusst auf die Tränendrüse gedrückt. Und so kam es, dass ich trotz meines Namens, den ich an meiner Highschool hassen gelernt hatte, auf der Wesleyan University in Middletown, Connecticut, genommen wurde. Dort lernte ich Nell kennen, meine beste Freundin, die schönste weiße Angloamerikanerin, die ich kenne und deren giftiger Stachel alle trifft außer mich. Sie – und nicht irgendein kluger Professor – war diejenige, die mir riet, das Tif- fallen zu lassen und mich fortan Ani zu nennen, ausgesprochen »Aani« und nicht »Ännie«, weil das viel zu hemdsärmelig klinge für jemanden, der so von der Welt angewidert sei wie ich. Meine Namensänderung hatte nichts damit zu tun, dass ich meine Vergangenheit verbergen wollte. Ich wollte nur einfach die Person werden, die mir niemals jemand zugetraut hätte: Ani Harrison.
Spencer rückte ihren Stuhl näher an den Tisch und nutzte den Moment der Nähe.
»Ich hasse es, wenn mich Leute fragen, welche Highschool ich besucht habe.«
Das konnte ich von mir nicht behaupten. Es gab Zeiten, da fand ich es toll zu sagen, von welcher Schule ich kam, weil es eine Chance war zu zeigen, wie weit ich es gebracht hatte. Und so zuckte ich nur die Schultern, ohne die Miene zu verziehen. Sie sollte wissen, dass wir nicht zwangsläufig beste Freundinnen werden mussten, nur weil wir von der gleichen Schule kamen.
»Ich habe kein Problem damit. Es macht mich zu dem, was ich bin.«
Spencer wurde plötzlich bewusst, dass sie mir zu nah getreten war und es anmaßend war anzunehmen, wir könnten uns auf Augenhöhe begegnen. Sie lehnte sich zurück und ließ mir meinen Sicherheitsabstand. »Natürlich. Ich würde wahrscheinlich genauso empfinden, wenn ich Sie wäre.«
»Ich mache bei der Doku mit«, erzählte ich, um zu verdeutlichen, wie wenig ich damit ein Problem hatte.
Spencer nickte bedächtig. »Das wollte ich Sie auch fragen. Klar, dass man Sie dabeihaben will.«
Ich sah auf die TAG Heuer an meinem Handgelenk. Seit Monaten versprach mir Luke eine Cartier. »Ich würde sagen, Sie sollten sich auf jeden Fall für ein Praktikum bewerben, auch wenn es nicht bezahlt ist.«
»Wie soll ich denn die Miete aufbringen?«, wollte Spencer wissen.
Ich betrachtete die Chanel-Tasche, die an ihrer Rückenlehne hing. Auf den zweiten Blick fiel mir auf, dass die Nähte sich lösten. Spencer stammte aus altem Geldadel. Vermögen in Treuhandfonds, guter Name, vernünftig großes Haus in Wayne und keinen Cent übrig für den Bettler in der U-Bahn.
»Kellnern oder in einer Bar arbeiten. Oder pendeln.«
»Aus Philadelphia?«
Das war weniger eine Frage als eine Erinnerung daran, wie weit sie es hätte, als sei ich verrückt, überhaupt diesen Vorschlag zu machen. Ich spürte, wie Unmut in mir prickelte.
»Wir hatten schon Praktikantinnen, die aus Washington gependelt sind.« Ich trank langsam einen Schluck Kaffee und sah sie dann mit zur Seite geneigtem Kopf an. »Das sind doch nur zwei Stunden mit der Bahn, oder?«
»Kann sein.« Spencer sah nicht überzeugt aus. Ihre Reaktion enttäuschte mich. Bis jetzt hatte alles ganz gut ausgesehen.
Als Chance zur Wiedergutmachung hob ich die Hände, um an dem Goldkettchen um meinen Hals zu zupfen. Nicht zu fassen, dass ich das Wichtigste vergessen hatte.
»Sie sind verlobt?« Beim Anblick meines ganzen Stolzes weiteten sich Spencers Augen zu Tellern – dem dicken Smaragd, flankiert von zwei blitzenden Brillanten, auf einem schlichten Platinring. Das Stück hatte Lukes Oma – Verzeihung, seiner Mammy – gehört, und als er ihn mir schenkte, schlug er vor, dass ich ihn umarbeiten lassen könnte. »Der Juwelier meiner Mutter meinte, heutzutage seien Ringe mit rundum Brillanten angesagt. Sieht wohl moderner aus.«
Und genau deshalb wollte ich ihn nicht umarbeiten lassen. Nein, ich wollte ihn so tragen wie dereinst die gute Mammy: verspielt, aber dezent. Mit einer klaren Botschaft: Das hier ist ein Erbstück. Wir haben nicht nur einfach viel Geld. Wir hatten schon immer viel Geld.
Ich streckte meine Finger und betrachtete den Ring, als hätte ich ganz vergessen, dass ich ihn trug. »Ach ja, ich weiß. Ich bin offiziell alt.«
»So einen umwerfenden Ring habe ich noch nie gesehen«, staunte Spencer. »Wann ist denn die Hochzeit?«
»Am 16. Oktober.« Ich strahlte sie an.
Hätte Eleanor diese Komödie mit der errötenden Braut gesehen, hätte sie ihren Kopf geneigt und spöttisch gelächelt. Dann hätte sie mich daran erinnert, dass es im Oktober zwar nicht unbedingt regnen müsse, das Wetter jedoch sehr wohl unbeständig sein könne. Ob ich einen Alternativplan habe, falls es regne? Sie habe ja für den Notfall ein Zelt gehabt, und obwohl sie es nicht gebraucht habe, hätte sie allein die Reservierung zehntausend Dollar gekostet. Eleanor hat immer solche Anekdötchen auf Lager.
Ich schob meinen Stuhl zurück. »Ich muss zurück ins Büro.«
Binnen einer halben Sekunde stand Spencer und streckte mir ihre Hand entgegen. »Vielen, vielen Dank, TifAni, ich meine« – sie bedeckte ihren Mund, und durch ihren Körper zitterte ein Geisha-Lächeln – »Ani. Entschuldigen Sie bitte.«
Manchmal fühle ich mich wie eine Aufziehpuppe, als müsste ich hinter mich greifen und meinen goldenen Schlüssel drehen, um zu grüßen oder zu lachen oder was auch immer die soziale Konvention gerade erfordert. Für Spencer brachte ich ein knappes Lächeln zustande. Sie würde meinen Namen nicht noch einmal falsch sagen, nicht nach der Ausstrahlung des Dokumentarfilms, wenn die Kamera auf mein schmerzvolles, aufrichtiges Gesicht zoomt und keinen Zweifel daran lässt, wer ich bin und was ich getan habe.
2
Die Sommerferien vor meinem neunten Schuljahr waren erfüllt von Moms Lobhudeleien über den Speckgürtel von Philadelphia, die sogenannte Main Line. Sie meinte, dort sei alles »upperclass« und wenn ich dort zur Highschool ginge, würde ich aus erster Hand erfahren, wie man in diesen Kreisen lebte. Ich hatte den Ausdruck »upperclass« noch nie gehört, konnte mir aber denken, was sie meinte, weil sie den gleichen frivolen Unterton verwendete wie die Verkäuferin bei Bloomingdale’s, als sie meiner Mutter einen unerschwinglichen Kaschmirschal aufgeschwatzt hatte: »Sieht richtig teuer an Ihnen aus.« »Teuer« war das Zauberwort. Dad war allerdings ganz anderer Ansicht gewesen, als sie ihm das Stück später über die Wange strich.
Ich war bislang auf eine katholische Mädchenschule gegangen, in einer Stadt, die mit dem Main-Line-Adel rein gar nichts zu tun hatte, schon allein deshalb, weil sie rund fünfundzwanzig Kilometer entfernt lag. Nicht dass ich meine Kindheit in einem Slum verbracht hätte. Die Gegend war einfach nur krankhaft bürgerlich und voller aufgedonnerter Hausfrauen, die sich für was Besseres hielten. Damals war ich naiv, ich wusste nicht, dass Geld ein Alter hat und dass alt und abgetragen immer vorzuziehen war. Ich dachte, Reichtum sei ein blitzender roter BMW (geleast) und ein Fünf-Zimmer-Reihenhaus (bis zur Dachrinne verschuldet). Nicht dass wir auch nur annähernd wohlhabend genug gewesen wären, um in einem solchen Wolkenkuckucksheim zu wohnen.
Meine richtige Schulbildung begann am Morgen des 2. September 2001, meinem ersten Tag an der Bradley Highschool in Bryn Mawr, Philadelphia. Dass ich dort, genauer gesagt vor der alten Villa, die den Englisch- und Sprachen-Zweig von Bradley beherbergte, stand und mir die schwitzigen Hände an meiner orangefarbenen Abercrombie-&-Fitch-Cargohose abwischte, hatte ich Marihuana zu verdanken (oder »Hasch«, wenn man so peinlich sein will wie mein Vater). Hätte ich Nein zu Drogen gesagt, wäre ich an diesem Tag ganz normal auf dem Hof der Mount-St.-Theresa-Oberschule aufgelaufen, den kratzigen blauen Kilt zwischen den gebräunten Beinen, die den ganzen Sommer lang in Hawaiianischem Tropenöl mariniert worden waren, und hätte mein mittelmäßiges junges Leben fortgesetzt, das nie mehr geworden wäre als ein Facebook-Klischee, eine Existenz als Abfolge von Fotoalben, die meine Verlobung in Atlantic City dokumentieren, meine Sahnebaiser-Hochzeit und ein kunstvoll drapiertes nacktes Neugeborenes.
Passiert war Folgendes: Meine Freundinnen und ich fanden, zu Beginn der achten Klasse sei es Zeit, einmal Dope zu probieren, und so kletterten wir von Leahs Zimmer aus auf das Dach ihres Hauses und ließen einen durchnässten Joint kreisen. Die Bewusstheit, mit der ich plötzlich alle meine Gliedmaßen spürte – sogar die Fußnägel! –, war so Furcht einflößend, dass ich in Schnappatmung überging und anfing zu weinen.
»Irgendwas stimmt nicht«, brachte ich halb im Scherz unter Keuchen hervor. Leah versuchte, mich zu beruhigen, wurde jedoch bald von einem Lachanfall übermannt.
Schließlich erschien Leahs Mutter, um zu sehen, was los war. Um Mitternacht rief sie meine Mutter an und erklärte in dramatischem Flüsterton: »Die Mädchen sind da in etwas hineingeraten.«
Ich hatte schon seit der fünften Klasse eine Figur wie Marilyn Monroe, und so war allen Eltern sofort klar, dass nur ich hinter unserem Schulmädchen-Drogenring stecken konnte. Bei mir musste man einfach mit Ärger rechnen. Binnen einer Woche rauschte ich in unserem nur vierzig Mädchen umfassenden Jahrgang von ganz oben in der Beliebtheitsskala bis ganz unten. Nicht einmal die Mädchen, die sich die Pommes in die Nase schoben, ehe sie sie aßen, ließen sich herab, mit mir am Mittagstisch zu sitzen.
Die Geschichte sprach sich herum, bis meine Eltern zur Rektorin der Schule einberufen wurden, einem Drachen namens Schwester John, die ihnen ans Herz legte, eine andere Schule für mich zu suchen. Mom brummte den gesamten Heimweg über im Auto vor sich hin und kam schließlich zu dem Schluss, dass sie mich auf eine dieser exklusiven Privatschulen in der Main Line schicken werde. Da hätte ich später bessere Chancen, eine Elite-Uni zu besuchen, was mir wiederum bessere Chancen böte, reich zu heiraten. »Die werden schon sehen«, verkündete sie triumphierend und strangulierte dabei das Lenkrad, als wäre es Schwester Johns Ringernacken.
Ich wartete eine Weile, ehe ich mich zu fragen traute. »Gibt es dort auch Jungs?«
Später in der Woche holte Mom mich vorzeitig von der Schule ab, und wir fuhren die fünfundvierzig Minuten zur Bradley School, der überkonfessionellen privaten Highschool für Jungen und Mädchen mitten im grünen, efeuberankten Main-Line-Bezirk. Der Rektor ließ es sich nicht nehmen, gleich zweimal zu erwähnen, dass J. D. Salingers Frau Anfang des 20. Jahrhunderts die Schule besucht hatte, als Bradley noch ein Mädcheninternat war. Ich beschloss, diese Info im Hinterkopf zu behalten, um sie später in Bewerbungsgesprächen bei potenziellen Arbeitgebern oder Schwiegereltern aus dem Ärmel zu zaubern. »Oh ja, ich habe die Bradley School besucht – wussten Sie übrigens, dass J. D. Salingers Frau dort war?« Es ist absolut in Ordnung, unerträglich zu sein, wenn man weiß, dass man unerträglich ist. So rechtfertigte ich mich zumindest vor mir selbst.
Nach der Besichtigung musste ich einen Eingangstest machen. In einem düster-strengen Besprechungsraum, der an die Cafeteria angrenzte, sollte ich am Kopfende eines majestätischen Tisches Platz nehmen. Auf der Bronzetafel über dem Türrahmen stand: Brenner-Baulkin-Saal. Mir war völlig schleierhaft, wie in dieser englisch-sprechenden Welt jemand Brenner heißen konnte.
Von dem Test weiß ich nicht mehr viel, nur dass ich eine Objektbeschreibung verfassen sollte, bei der das Objekt unbenannt blieb. Ich entschied mich für meine Katze, die von unserer Terrasse gestürzt und als blutiger Fleischklumpen geendet war.
Dass Bradley mit J. D. Salinger protzte, konnte bedeuten, dass man dort auf gequälte Schriftstellerseelen stand, und ich hatte recht. Wenige Wochen später erhielten wir die Zusage, dass ich ein Stipendium bekommen und im Jahrgang 2005 der Bradley School eingeschrieben werden würde.
»Bist du nervös, mein Schatz?«, fragte meine Mutter.
»Nein«, log ich zum Autofenster hinaus. Ich begriff überhaupt nicht, warum sie so ein Aufhebens um die Main Line machte. Für meine vierzehnjährigen Augen sahen die Häuser dort längst nicht so imposant aus wie das rosa Ungetüm, in dem Leah wohnte. Dass guter Geschmack nichts anderes ist als teuer bezahltes Understatement, das musste ich erst noch lernen.
»Du wirst das toll machen.« Mom drückte mein Knie und lächelte, sodass sich die Sonne in ihren feucht geglossten Lippen fing.
Vier Mädchen marschierten in einer Reihe an unserem BMW vorbei, die Rucksäcke mit beiden Gurten fest an ihren schmalen Schultern festgezurrt, mit dicken Pferdeschwänzen, die wippten wie gelber Federschmuck auf einem Spartanerhelm.
»Mom, ich weiß.« Ich verdrehte die Augen, wenn auch mehr für mich als für sie. Es fehlte nicht viel, und ich hätte mich weinend in ihre Arme gestürzt, damit sie mir mit ihren langen spitzen Fingernägeln über die Unterarme fuhr, bis ich Gänsehaut bekam. »Kitzel mich!«, hatte ich immer gebettelt, als ich noch klein war und wir auf der Couch kuschelten.
»Du kommst noch zu spät!« Sie setzte mir einen Kuss auf die Wange, der eine klebrige Spur Lippgloss hinterließ. Dafür erhielt sie ein übellauniges »Tschüss«, in meiner neuen Rolle als Teenager, die ich an jenem Morgen, fünfunddreißig Schritte vom Schultor entfernt, noch probte.
Die erste Stunde fand im Klassenzimmer statt, und schon das fand ich superaufregend, ich doofe Kuh. In meiner alten Schule hatte es weder Klingelzeichen noch Fachlehrer gegeben. Wir waren vierzig Mädchen im ganzen Jahrgang gewesen, die auf zwei Räume aufgeteilt waren. Dort wurde Mathe, Sozialkunde, Naturwissenschaften, Religion und Englisch unterrichtet, und zwar von ein und derselben Lehrerin, und wenn man Glück hatte, war es nicht die Nonne (ich hatte nie Glück). Bei der Vorstellung, dass alle fünfundvierzig Minuten eine Glocke schellte, damit man in einen anderen Raum zu einem anderen Lehrer mit einer neuen Gruppe von Schülern ging, kam ich mir vor, als wäre ich Gaststar in der Serie California High School.
Am meisten jedoch freute ich mich an jenem ersten Morgen auf Englisch, besser gesagt Englisch Leistungsstufe, auch so eine Variante, die es in meiner alten Schule gar nicht gegeben hatte. Meine brillante, hundertfünfzig Wort lange Beschreibung des tragischen Ablebens meiner Katze hatte mir einen Platz in dieser Klasse gesichert. Ich konnte es gar nicht erwarten, mit dem hellgrünen Kugelschreiber loszulegen, den ich im Schulladen gekauft hatte. In Mount St. Theresa hatten wir wie Kindergartenkinder mit Bleistift schreiben müssen, in Bradley dagegen war es egal, womit man schrieb. Es war auch egal, ob man überhaupt mitschrieb, solange man seine Noten hielt. Die Farben der Bradley School waren grün und weiß, und so kaufte ich einen Kuli in den Farben der Basketballtrikots, um meine neue Zugehörigkeit zu demonstrieren.
Englisch Leistung war eine kleine Klasse mit nur zwölf Schülern. Statt in Einzelbänken saßen wir an langen Tischen, die zu einem U zusammengeschoben waren. Der Lehrer, Mr Larson, war »kräftig«, wie meine Mutter abschätzig befand, hatte jedoch dank der zehn Kilo Übergewicht ein freundliches, volles Gesicht mit schmalen Augen und einer leicht aufgewölbten Oberlippe, mit der er aussah, als schmunzele er immer noch über einen Witz, den er am Vorabend bei lauwarmen Bud Light von einem Kumpel gehört hatte. Er trug Hemden in blassen Pastellfarben und hatte schlaffes, hellbraunes Haar, mit dem er für uns ganz klar aussah, als wäre er vor Kurzem selbst noch ein Schüler gewesen und wüsste genau, wo es langgeht. Mein vierzehnjähriger Bauch fand das super. Und nicht nur meiner.
Mr Larson unterrichtete oft im Sitzen, die Beine lang von sich gestreckt, häufig mit einer Hand am Hinterkopf. Dann stellte er Fragen wie: »Warum, glaubt ihr, identifiziert sich Holden mit dem Fänger im Roggen?«
An jenem ersten Tag ließ uns Mr Larson im Raum herumgehen, und wir mussten eine coole Sache erzählen, die wir in den Sommerferien gemacht hatten. Ich war ziemlich sicher, dass er sich diese Übung extra für mich ausgedacht hatte. Die meisten anderen Kinder kamen von der Bradley-Mittelschule und hatten den Sommer vermutlich zusammen verbracht, doch was die Neue gemacht hatte, wusste niemand. Musste ja niemand erfahren, dass ich nichts weiter getan hatte, als mich auf der Terrasse zu sonnen und durch das Fenster Seifenopern zu schauen, schwitzend, eine Außenseiterin ohne Freundinnen. Als ich dran war, erzählte ich, ich sei am 23. August beim Pearl-Jam-Konzert gewesen. Das stimmte zwar nicht, war aber nicht ganz gelogen, denn Leahs Mutter hatte Tickets für uns reserviert, allerdings vor dem Drogenfiasko, also bevor sie endgültig den Beweis dafür hatte, dass ich tatsächlich so ein schlechter Umgang war, wie sie schon immer vermutet hatte. Doch zwischen Leah und diesen neuen Kindern lagen Welten, und ich musste hier Eindruck schinden, also log ich, und ich bin froh, dass ich es getan habe. Meine coole Sache erntete mehrfach anerkennendes Nicken und sogar die Bemerkung »cool« von einem Mitschüler.
Nach diesem Spiel wollte Mr Larson über den Fänger im Roggen sprechen. Das Buch hatten wir über die Sommerferien lesen sollen. Ich hatte das Buch auf meiner Terrasse binnen zwei Tagen verschlungen und dabei auf jeder Seite feuchte Halbmonde hinterlassen. Meine Mutter fragte mich, was ich von der Geschichte hielte, und als ich sagte, ich fände sie zum Totlachen, neigte sie den Kopf und sagte: »Tif, er hat einen schweren Nervenzusammenbruch.« Diese Enthüllung schockierte mich so sehr, dass ich das Buch gleich noch einmal las, voller Sorge, weil mir dieses entscheidende Element entgangen war. Eine Zeit lang fürchtete ich, doch nicht so eine Leuchte in Literatur zu sein, wie ich immer gedacht hatte, doch dann tröstete ich mich damit, dass in Mount St. Theresa die Literatur zugunsten der Grammatik vernachlässigt worden war (weniger Sex und Sünde), ich also folglich nichts dafür konnte, wenn meine Interpretation nicht ganz präzise war. Ich würde das schon noch lernen.
Der Junge, der am nächsten bei der Tafel saß, ließ ein Stöhnen hören. Er hieß Arthur, und das Coolste, was er diesen Sommer gemacht hatte, war eine Besichtigung der New York Times. Nach der Reaktion der Klasse zu urteilen, war das weniger cool als Pearl Jam, aber noch nicht so übel wie eine Vorstellung des Phantom der Oper im Kimmel Center. Selbst ich begriff, dass Derartiges nur cool ist, wenn man es am Broadway sieht.
»So gut hat dir die Geschichte also gefallen?«, scherzte Mr Larson, und die Klasse kicherte.
Arthur wog etwa hundertfünfzig Kilo, und sein Gesicht war von Aknepusteln übersät. Seine Haare waren so fettig, dass sie stehen blieben, wenn er mit der Hand hindurchfuhr, ein schmieriger Bogen vom Haaransatz bis zum Oberkopf. »Kann es wirklich sein, dass Holden so wenig selbstkritisch ist? Er bezeichnet alle als Lügner, dabei ist er selbst der größte.«
»Du bringst einen interessanten Aspekt auf«, sagte Mr Larson ermutigend. »Ist Holden ein verlässlicher Erzähler?«
Es klingelte, ehe jemand die Frage beantworten konnte, und während Mr Larson uns auftrug, die ersten beiden Kapitel von In eisige Höhen