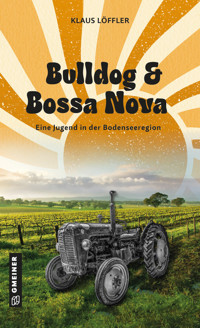
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bodensee-Region, 1965: Fröhliche Traktorenklänge können täuschen. Immer mehr Bauern geraten unter Druck, die Milchwirtschaft aufzugeben. Fleckviehzüchter Anton und die anderen Bauern im Dorf halten dagegen. So schnell lassen sie sich nicht unterkriegen. Sang- und klanglos zu weichen, ist jedenfalls nicht ihr Ding. Ein Truthennen-Halter spielt mit seiner Combo und flotten Melodien zum Tanz auf, während Anton mit seiner Tenorstimme dem traditionellen Gesangverein die Stange hält. Sein 12-jähriger Sohn hört indes lieber Bossa Nova bei Radio Luxemburg. Die Geschichten sind Szenen des Abschieds vom bäuerlichen Leben - und zugleich des Aufbruchs in eine neue Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Löffler
Bulldog und Bossa Nova
Eine Jugend in der Bodenseeregion
Mit Illustrationen von Britta Schneider
Zum Buch
Erzählungen aus der Heimat Bodensee-Region, 1965: Fröhliche Traktorenklänge können täuschen. Immer mehr Bauern geraten unter Druck, die Milchwirtschaft aufzugeben. Fleckviehzüchter Anton und die anderen Bauern im Dorf halten dagegen. So schnell lassen sie sich nicht unterkriegen. Sang- und klanglos zu weichen, ist jedenfalls nicht ihr Ding. Ein Truthennen-Halter spielt mit seiner Combo und flotten Melodien zum Tanz auf, während Anton mit seiner Tenorstimme dem traditionellen Gesangverein die Stange hält. Sein 12-jähriger Sohn hört indes lieber Bossa Nova bei Radio Luxemburg. Die Geschichten sind Szenen des Abschieds vom bäuerlichen Leben – und zugleich des Aufbruchs in eine neue Zeit.
Klaus Löffler ist auf einem Bauernhof (Rengetsweiler) im Hügelland zwischen Bodensee und Donau geboren und aufgewachsen. Nach seinem Jurastudium mit Promotion in Freiburg folgten berufliche Tätigkeiten in Mexico City, Quito, Straßburg, Brüssel und Berlin.
Impressum
Rechtlicher Hinweis: Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Manuel Stöckler
Lektorat: Isabell Michelberger
Layout & Gestaltung: Veronika Buck
unter Verwendung der Fotos von: © Ben Goode, Klaus Löffler
E-Book: Mirjam Hecht
ISBN 978-3-7349-3136-9
SEIN BESTES PFERD
Der bewölkte Maihimmel spannt sich heute wie ein geflecktes Kuhfell über unser Dorf. Es sieht nicht nach Regen aus. Das Frühjahr 1965 geht frei von Kapriolen auf den Sommer zu, obwohl es bei uns oben im Hügelland immer einen Kittel kälter ist als unten am Bodensee.
Am Brunnentrog vor dem Haus schwenke ich gerade eine Milchkanne aus, als mein Vater Anton auf dem Hof den altenKramer »Allesschaffer«in Gang setzt. Der Chef, wie Anton im Ort genannt wird, füttert das robuste Rohölross, Baujahr 39, zuerst mit einem Zündhütchen, spendiert ihm einen halben Eimer Kühlwasser, spuckt in die frisch mit Melkfett eingeriebenen Hände und setzt die Kurbel an. Er dreht das Schwungrad bis zum Anschlag zurück, bevor er es ankurbelt und dem Motor den satten Tock-tock-tock-Ton entlockt, eine Art Erkennungsmelodie für den einsatzbereiten Kramer.
Heute geht’s mit demBulldog, unser Wort für Traktor, ausnahmsweise nicht auf den Acker, sondern zum Autokauf.
Der Chef hat Wind davon bekommen, dass das Frauenkloster im Nachbardorf einen alten, aber gepflegtenVW Käfer mit frischer TÜV-Plakette abstößt. Da will er schnell zugreifen.
Auf dem Weg zum Kloster deutet der Chef an, dass die Schwester Oberin den Verkauf des Gebrauchtwagens persönlich in die Hand nimmt. »Damit du gleich weißt, wo wir dran sind: Die lässt sich nichts billig abhandeln, nixabfuggera.«
Unter ihrer resoluten Regie wird im Frauenkloster mit angeschlossenem Internat für höhere Töchter gelernt, gebetet und gearbeitet. Mit den zehn Geboten, den vier Grundrechenarten und etwas handwerklichem Geschick kommt man dort ziemlich weit.
»Lass dich von der schlichten Tracht einer Ordensschwester nicht täuschen«, rät der Chef. »Darunter verbirgt sich eine russische Prinzessin aus großfürstlichem Haus.«
Als junges Mädchen ist es ihr unter abenteuerlichen Umständen gelungen, den revolutionären Umtrieben der Bolschewisten zu entrinnen. Auf ihre alten Tage steht sie im Ruf einer Ordens- und Geschäftsfrau, die es faustdick hinter den Ohren hat und genau weiß, was sie will.
Minuten später umkreist der Chef mit TÜV-Prüfermiene den zwischen Kloster und Weiher abgestellten VW Käfer, ein taubenblaues Modell »Export« mit verchromten Zierstreifen.
»Damit wir uns gleich richtig verstehen«, sagt die Prinzessin mit russischem Akzent, »Rabatt können Sie hier nicht raushandeln. Das kommt bei mir nicht infrage.« Und mit spöttischem Unterton fügt sie hinzu: »Wir sind hier auf dem Klosterhof, nicht auf dem Viehmarkt.« Ohne eine Antwort abzuwarten, fährt sie fort: »Ich schätze die Bauern und Handwerker, aber ich kenne sie auch.«
Ich weiß das: Mit der Stiefelspitze klopfen sie an die Reifen und meckern über angebliche Mängel. Oha, die Lenkung ist ausgeleiert. Womöglich der Achsschenkelbolzen gebrochen. Oder sie tauchen den Zeigefinger in das kleinste Tröpfchen Öl – ein scheinbar untrügliches Zeichen für Ölverlust, undichten Zylinderkopf und Kolbenfresser.
»Das übliche Nörgeln beim Gebrauchtwagenkauf können Sie sich sparen«, verkündet die Oberin. »Nichts als Bauerntheater, um einen Preisnachlass rauszuschinden. Aber, wem sag ich das!«
Das auffälligste Merkmal der Russen-Prinzessin sind ihre runden, direkt unterhalb der Haube sitzenden Habichtaugen, denen nichts entgeht. Diesen Habichtaugen verdankt die Klosterschule ihren Wohlstand. Minister, Adlige, Fabrikanten, gehobene Kreise – bessere Leit, wie man bei uns sagt – lassen sich das scharfe Auge der Oberin etwas kosten. Denn es wacht über die strikte Trennung zwischen den höheren Töchtern drinnen und den ungehobelten Bauernburschen draußen.
Erst jetzt ruhen die Habichtaugen auf Anton, um zu sehen, wie er reagiert. Bringt der Milchbauer und Viehzüchter überhaupt das nötige Kleingeld auf, um die Karre zu bezahlen?
Gute Frage. Bei den Bauern scheißt der Teufel das Geld nicht auf einen großen Haufen. Alle müssen es mühsam zusammenkratzen.
Der Chef legt alles auf die hohe Kante, was vom Milchgeld übrig ist, verstaut nach und nach (in unserer Sprache: nanderno) große und kleine Scheine in der Schublade seines Nachttisches neben dem Bett und beschwert den langsam anwachsenden Geldstapel mit einer Tokarew, einer Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg mit Sowjetstern auf dem schwarzen Griff.
Lange hat der Chef gezögert, den unter der Russen-Knarre gehorteten Schatz gegen einen fahrbaren Untersatz einzutauschen. Aber heute macht er Nägel mit Köpfen.
Auf die Frage nach dem Bargeld nickt er wortlos und nestelt das abgezählte Geldbündel aus dem Kittelsack, aus der Tasche seiner blauen Wolljacke mit den Hirschhornknöpfen.
Jeder Schein wird einzeln beäugt und nachgezählt. Anton verzichtet auf eine Probefahrt und macht lieber gleich den Sack zu.
Beim Kauf unter Bauern wäre er vorsichtiger: zurückgedrehter Kilometerstand, verheimlichter Kolbenfresser, verkappter Getriebeschaden infolge ruppigen Fahrens, alles dabei. Dagegen sind bei einem Wagen aus zweiter Hand Ordensfrauen mit sanftem Gemüt und entsprechendem Fahrstil einfach die idealen Vorbesitzerinnen. Die Schlüssel wechseln den Besitzer. Und das von der Prinzessin befürchtete Bauerntheater fällt aus.
Auf dem Heimweg fährt der Chef voraus. Ich übernehme zum ersten Mal den Bulldog. Immerhin bin ich schon zwölf. Höchste Zeit, unter die Schlepperfahrer zu gehen. Der Chef hält mich ohnehin für einen Spätzünder. Der Kopf ist willig, aber die Beine sind kurz. Mit den Zehenspitzen komme ich gerade so an Kupplung und Bremse. Bald nehme ich Fahrt auf und streife meine Unsicherheit ab. Der beschwingte Takt des immer schnelleren Tock-tock-tock löst in meinem Kopf ein befreiendes Gefühl aus. Beim Traktorfahren streife ich die Zügel ab. Bei 16 km/h Höchstgeschwindigkeit geht mir, fast schon im Temporausch, ein Cowboy-Gassenhauer durch den Kopf:
Sein bestes Pferd braucht keine Zügel,
es läuft auch so nach Idaho.
Später an diesem Nachmittag steigt der Chef mit dem Sparbuch in der Hand aus dem Klosterkäfer aus und geht auf die Kasse in Meßkirch. Ich schneie hinter ihm drein in den Schalterraum. Er braucht etwas frisches Bargeld, um zu tanken.
Mit vollem Tank will er danach eine erste Runde drehen. Runter nach Überlingen, um zu sehen, ob die kalte Sophie heuer die Obstbauern am Bodensee wieder mal aus ihren Blütenträumen gerissen hat.
Dem frisch gebackenen Autobesitzer wird beim Betreten der Bank eine schlecht gelaunte Miene, eine Zenna, hingehängt. Mehr als ein frostiges »Grüß Gott« ist nicht drin. Ich dachte, die Eisheiligen sind schon vorbei. Aber nein, hier in der Kasse sitzen sie noch. Der D-Mark-Bonifaz hinter dem Schalter macht ein See-gfrörne-Gesicht beim Aushändigen von 50 Mark, aufgeteilt in einen blauen Zehner mit einem Segelschiff und in zwei grüne Zwanziger mit einer Geige als Motiv auf der Rückseite.
Unterdessen entdecke ich im Schalterraum ein Werbeplakat mit dem Spruch: »Landwirtschaft hat Zukunft – mit uns.« Illustriert ist dieses Versprechen mit einem Bäumchen, an dem statt Äpfel oder Birnen Fünfmarkstücke reifen.
Der Chef hat keine Augen für die schöne Geige auf dem Geldschein, er hat nur das Tanken im Sinn. Und das Plakat vom Geld, das auf Bäumen wächst, verstärkt eher sein Misstrauen gegenüber Leuten, die sich als Unterstützer der Landwirte ausgeben und doch als Buckelgräzer, im Huckepack auf dem Rücken der Bauern, ihre Geschäfte machen.
»Hä«, frage ich noch unter der Tür, »warum benehmen die sich so sperrig und tond eckig?«
»Wahrscheinlich ärgern sie sich, weil ich für die als Mikado-Kunde gelte. Ein Autokauf, aber keine Bewegung auf dem Konto.«
Klar. Der Chef hat ja keinen Pfennig Kredit aufgenommen. Nur wenn sich etwas bewegt oder die Finanzierung wackelt, dann zweigt die Bank Gewinn ab.
»Da wird was abgezweigt«, denke ich laut. »Aha, die Zweigstelle …«
»… macht den großen Schnitt mit Wackelkandidaten. Das sind die Bauern, die es nicht schaffen, ihre Kredite rechtzeitig abzustottern.«
Die haben sie echt am Wickel, wie mir scheint. Manchmal wird ihnen der Hof abgfuggeret und unter Wert zwangsverkauft.
Der Chef, das müssten die Eisheiligen in der Zweigstelle inzwischen wissen, traut ihnen nicht über den Weg. Deshalb nimmt er kein Geld auf. Um keinen Preis. It umsVerrecka setzt er seine Unterschrift unter einen Kreditvertrag oder irgendein Papier mit einem Rattenschwanz an Risiken und Zahlungspflichten. Selbst wenn er damit der letzte Bauer im Dorf wäre, der mit dem Bindemäher über den Acker hoppelt und von Hand Garben aufstellt, anstatt einfach den Ottel mit seinem dicken Mähdrescher zu bestellen. Der runde Anton zeigt sich von seiner eckigen Seite.
Das Eckige hat mit einem hundert Jahre alten Vorfall zu tun. Eine alte Geschichte, über die längst Gras gewachsen ist. Sie wird in unserem Dorf erzählt, als wäre sie erst gestern passiert. Vielleicht, weil sie die Leute in den Bauernhäusern, die Baueraleit, damals heftig erschüttert hat. Oder weil sie als zeitlose Warnung zu verstehen ist.
Der Lambert war ein tüchtiger Mann und der reichste Bauer im Dorf. Er wohnte in einem herrschaftlichen Haus in der Ortsmitte. Ihm gehörte auch das Gasthaus Zum Goldenen Hirschen. Der Hirschen hat die Hausnummer 1, die Anfänge reichen 700 Jahre zurück. Lamberts Ruf als Hufschmied reichte weit über das Dorf hinaus. Sogar der Fürst von Sigmaringen ließ von ihm seine Pferde beschlagen. Zum Wirtshaus ließen sich Leute aus der Stadt herkutschieren. Als Bierbrauer war er so erfolgreich, dass er in den Steinbruch am Ortsrand einen Bierkeller für mehrere tausend Maß meißeln ließ. Ein Bauer und Allesschaffer, wie er im Buch steht. Auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft traf ihn mit 35 Jahren der Schlag, und er fiel tot um.
Und auf einen Schlag standen seine drei Töchter Cäcilia, Katharina und Franziska, allesamt noch Schulkinder, als Halbwaisen da. Den Mädchen mit den Rufnamen Cilli, Kätter und Fanni wurde ein Vormund vor die Nase gesetzt. Weshalb die Mutter des traurigen Trios übergangen wurde, bleibt im Dunkeln. Der Vormund stellte sich leider als Bruder Leichtfuß heraus, der leichtsinnig eine Bürgschaft unterzeichnete. Mit Haus und Vermögen der drei Mädchen als Unterpfand. Dann kam, was kommen musste. Der Kumpel, für den der Vormund bürgte, ging mit krummen Geschäften den Bach hinunter. Die Bank griff ohne Skrupel auf die Bürgschaft zu – und die drei Töchter des reichsten Mannes im Ort waren um Haus, Hof und ihr stattliches Erbe geprellt. Am schlimmsten war, dass sie aushausa mussten. Das heißt, man setzte sie von einem Tag auf den anderen vor die Tür ihres Bauernhauses. Die drei kleinen Unglücksraben wurden aus dem Nest gestoßen. Mit einem traurigen Rest an christlicher Barmherzigkeit überließ man ihnen und der Mutter den Platz in dem zum Anwesen gehörenden Speicher, einem bescheidenen Altenteilerhäuschen.
Seit diesem Vorfall haben die Bauern in unserem Dorf keine Angst mehr vor Blitz, Hagel und Ungewitter, sondern nur noch Angst vor dem Aushausen. Aushausa – ein Unglücksrabenwort in der Sprache unseres Dorfs. Je mehr einer an Haus und Hof hängt, desto bedrohlicher erscheint ihm das Gespenst des Aushausens. Anton glaubt nicht an Gespenster – bis auf diese Ausnahme.
Deshalb macht der Chef um Geldhäuser möglichst einen Bogen und zögert größere Anschaffungen hinaus, während ihm kleinere Besorgungen leicht von der Hand gehen.
Für den alltäglichen Bedarf gibt’s zum Glück den Gitschier aus Engelswies. Wofür andere einen Lieferwagen brauchen, reicht dem Stapelkünstler ein Ford Taunus 17M, eine Badewanne mit Kofferraum. Wenn die Wanne voll ist mit Pflugscharen, Drahtkörben (bei uns: Zoina), Gabeln, Besen, Wetzsteinen, Melkeimern und Fleischwölfen für die Hausschlachtung, dann sorgt der Dachständer für Luft nach oben, wo sperrige Schubkarren oder lange Heugabeln ihren Platz finden.
Dem Gitschier reichen für das Verkaufsgespräch drei Wörter. Mit seiner tiefen, tonlosen Stimme fragt er: »Braucht ihr was?«
Letzte Woche ist eine Mistgabel abgebrochen. Als kurz darauf der Ford 17M auf den Hof einbog, ruft Anton: »Gitschier, Euch schickt der Himmel!«
»So hoch würde ich nicht hinausgehen«, widersprach der Götterbote aus Engelswies und fischte in der Badewanne nach dem gewünschten Utensil. »Aber immerhin eine Mistgabel direkt von der Wiese der Engel.«
Anton bezahlt mit Münzen, die er an den vergangenen Sonntagen vorsichtshalber vom Klingelbeutel verschont hat.
Der Chef hat ein etwas unterkühltes Verhältnis zum Geld. Ein Gefühl, das nach meinem Eindruck auf Gegenseitigkeit beruht. Nur an einem Ort geht er Mark und Pfennig freudig entgegen: auf dem Zuchtviehmarkt in Ulm.
Eine Woche nach dem Autokauf fällt bei der Versteigerung der Hammer spät, und er erzielt mit einer trächtigen Kalbin (sprich: Kalberna), gedeckt vom großen Häge, unserem Fleckvieh-Zuchtbullen, einen unerwartet hohen Preis. Vor lauter Freude bringt der glückliche Züchter einen Kasten Goldochsen-Bier heim. Den gibt er nach der Probe des Gesangvereins aus. »Eines können wir Bauern, mirBauera, von den Ulmern lernen«, sagt Anton mit erhobenem Glas in die Runde. »Die wissen, wie man einen Ochsen vergoldet.«
KANN DENN LIEBE SÜNDE SEIN?
Bautz, Deutz, Eicher. So heißen die Propheten einer leichten Zeit auf dem Land.Fahr, Fendt, Hanomag. Jeder Name ein Trompetenstoß gegen Rückständigkeit und Knochenarbeit. Kramer, Lanz, Porsche. Ein neuer Klang über den Feldern. Was nicht mithalten kann, hinterstellig oder gar unmotorisiert ist, wird sang- und klanglos untergehen! Kein Hahn wird danach krähen.
Ohne Krokodilstränen in den Augen der Bauern haben Knechte und Mägde auf Nimmerwiedersehen ihr Ränzlein geschnürt. Alle weg, alle verduftet, alle aufgelöst wie Zuckerwürfel im Kaffee. Nur eine hält sich. Ich kenne sie unter ihrem Übernamen »Truthennen-Magd«.
Ich sitze auf einem Spaltklotz, lasse die Beine baumeln und gucke der Magd beim Füttern der Schnabelwesen zu, denen sie ihren Übernamen verdankt. Mit ihren zerknitterten Hautlappen unter den Schnäbeln stolzieren die Truthühner im Freigehege herum wie Halbstarke mit schlampig gebügelten Schlipsen vor dem Tanzlokal. Die gefräßigen Vögel stimmen piepsend und glucksend einen Freudenkanon an, sobald sich ihre Wirtin mit dem Futtereimer in der Hand dem Gehege nähert. Das Haberfutter, gestreckt mit Klee und Kleie, pickt der gierige Haufen nicht anstandslos auf, sondern liefert zwischendurch, drundetnei, ein Schauspiel mit komischen Verrenkungen, allerlei Schabernack und spitzen Schnabelhieben gegen Futterneider. Dabei verändern sie ihre Farbe, eine Laune der Natur. Kopf und Kragen laufen rot und blau an. Sie treten auf wie tanzende Indianer mit Federschmuck und Kriegsbemalung.
Beim Betrachten der Spaßvögel löst sich die Anstrengung aus dem Gesicht der alten Magd. Und die ernst dreinschauende Alte, die man werktags immer nur in einer mausgrauen Kittelschürze sieht, verwandelt sich für einen schönen Augenblick in eine heitere Kichererbse, in ein fröhliches Kitterfiedla.
Dabei lockert sich ihr ausgebleichtes Kopftuch, unter dem ein Büschel grauer Strähnen zum Vorschein kommt.
Ich sehe, wie sie aus einem nahezu zahnlosen Mund kichert, in dem zwei bernsteinfarbene Beißerchen im Unterkiefer das letzte Aufgebot stellen. Ihr Leben ist praktisch eine dauernde Aufforderung, die Zähne zusammenzubeißen. Wie aber geht es weiter, wenn alle bis auf einen kläglichen Rest ausgefallen sind? Den Luxus eines künstlichen Gebisses kann sich die Magd nicht leisten. Kukident kennt sie wohl nur vom Hörensagen. Suppen und Rühreier lassen sich notfalls schlürfen statt kauen.
Für ein halbes Dutzend Truthennen wird sich die Fütterung gleich als Henkersmahlzeit herausstellen. Schwant den tanzenden Indianern, dass der Bauer bereits das Kriegsbeil ausgegraben hat? Wenn ja, steckt in ihrem Fressverhalten ein Körnchen Galgenhumor. Ich trau’s ihnen zu.
Auf einmal steht die Magd neben mir und fuchtelt mit einem Beilchen, bei uns Schnäker genannt, unter meiner Nase: »Weg da! Der Spaltklotz wird zum Schaffen gebraucht, nicht zum Faulenzen und Maulaffa feulhalta.«
Es fällt ihr schwer, durch die Zahnlücke zu sprechen. Anstelle ganzer Sätze schleudert sie nur einzelne Wörter raus wie ein Kartoffelroder die Knollen: »Mexa, mexa, Truthenna mexa.«
Alles klar. Im Auftrag des Bauern muss sie heute einige Vögel mexa, also schlachten, rupfen, ausnehmen und bratfertig herrichten.
Den ersten hat sie am Schlafittchen gepackt, legt ihn mit der linken Hand auf den Spaltklotz, bekreuzigt sich schnell mit dem Beilchen in der rechten Hand, streicht mit der stumpfen Seite des Schnäkers halb zärtlich, halb heimtückisch über Nacken und Rücken des Opfers und macht es im Handumdrehen mit einem präzisen Hieb einen Kopf kürzer. Minuten später kündet ein Kreis blutiger Truthennenköpfe um den Spaltklotz herum von der Pflichterfüllung der Magd.
»Übung macht den Meister«, ruft die Stimme ihres Herrn, der in diesem Moment mit dem Hofhund bei Fuß aus der Scheune kommt. Es ist ein belgischer Schäferhund mit pechschwarzen Ohren, der auf alles aufpasst. Er verschmäht die frisch am Boden liegenden Köpfe seiner Schützlinge.
»Mein Hund ist ein Belgier – der frisst nur Pralinen«, behauptet grinsend der Bauer, der bis hinunter an den Bodensee unter dem Spitznamen »Rüssel« bekannt ist. Es passt zu seinem schrägen Humor, dass er seinen eigenen Hof mit einer Flasche Sekt auf den Namen »Rüsselsheim« getauft hat. Zudem trägt er am gewöhnlichen Werktag einen schicken Bolero mit schwarzem Futterband. Mit dem lustig-luftigen Hütchen hat er sich den Ruf eines Paradiesvogels unter der grauen Bauernschar eingebrockt.
»Guck mal«, sagt er, »wie geschickt die Magd mit dem Schnäker hantiert.«
Dann holt er etwas weiter aus. »Achte mal drauf, womit die Weiber am liebsten hantieren. Die Waffen einer Frau sind in den Städten unten am See völlig andere als hier oben bei uns im Dorf.«
»Hä?«
»In Konstanz und Überlingen sind die Frauen jederzeit mit drei Dingen ausgerüstet: 4711 Kölnisch Wasser, Lippenstift und Nagellack. Schönheit zählt.« Dann beschreibt er mit dem Zeigefinger einen Bogen Richtung Magd: »Bei uns beherrschen sie dagegen bis ins höchste Alter den Umgang mit Axt, Spaltklotz und Schnäker. Arbeit zählt.«
»Aha.« Ich schwanke, ob er das im Witz oder im Ernst sagt. »Und mit welchen Waffen kommen Frauen weiter?«
»Unsere sind da klar im Vorteil. Für junge Mädle ist das Holzspalten ein bewährtes Hausmittel gegen Liebeskummer. Für alte Weiber ist es das geheime Elixier für ein langes Leben. Kein Jahrmarkt-Jux wie anderswo, oima andescht, die Altweibermühle.«
Um die letzten Zweifel auszuräumen, die er meiner Fragezeichenmiene entnimmt, fährt er fort: »Holzspalten hält wirklich jung. Nach einer halben Stunde vergessen die Landfrauen, unsere Baueraweiber, all ihre Zipperlein, nach einer ganzen Stunde das Leben mit all seinen Nöten. Den Schnäker legen sie zuletzt aus der Hand. Damit machen sie noch Anfeuerholz, Spächtele, bis kurz vor der Letzten Ölung.«
Dazu sage ich lieber nichts. Ich bin erst zwölf. Meinetwegen braucht vorerst kein Mädchen Holz zu spalten.
Mittlerweile ist die Magd beim Mexa vom Grob- zum Feinschlächtigen übergegangen. Mit ihren kopflosen Schützlingen hat sie noch ein Hühnchen zu rupfen, bevor sie sich einen frischen Schurz anzieht und auf den Weg macht zur Maiandacht mit anschließender Beichtgelegenheit.
Bei der Geflügelhaltung ziehen Bauer und Magd an einem Strang, aber am Beichten und den heiligen Sakramenten scheiden sich die Geister. Während die Magd ihrem Kinderglauben folgt und nachbetet, was im Magnificat unserer Freiburger Erzdiözese steht, geht der Bauer seinem eigenen Rüssel nach. »Religion ist wie Champagner bei der Flaschengärung«, lautet einer seiner Aussprüche. »Nur wenn man kräftig daran rüttelt, kann die Sache reifen.« Den Beichtstuhl hält er jedenfalls für das überflüssigste Möbelstück in der Kirche. Statt dort zerknirscht als armes Sünderlein seine Fehltritte zu bekennen, begibt er sich lieber gut gelaunt in den Goldenen Hirschen, wo man sich mit einem frisch gezapften Zoller-Maibock oder einem Viertele Seewein den Freispruch von den Sünden gegenseitig zuprostet.
Wenn der Bauer einen Bogen um den Beichtstuhl macht, denkt die Magd in ihrer eigenen Logik, dann springe ich für ihn ein. Das geht in einem Aufwasch mit meinen eigenen Sünden. Also beichtet sie für zwei. Für sich und ihren Bauern gleich mit, damit der Teufel am Ende leer ausgeht.
Die Kirchenbänke haben bei uns Ohren. Und die sind besonders gespitzt, wenn es um den Rüssel geht. Beichtgeheimnis? Ach was! Ein Maulkorb für den Pfarrer, nicht für die Gemeinde. Hinzu kommt, dass die Truthennen-Magd dollohrig, also schwerhörig ist und darüber das Flüstern verlernt hat. Hinter der mächtigen Thujahecke, die unseren Bauernhof wie eine Burgmauer einfriedet, ist heute die Maisonne noch nicht verglüht, da ist im Dorf schon in groben Zügen das jüngste Sündenregister durchgesickert. Es ist wie mit einem Schnäker dem Rüssel ins Kerbholz geritzt. Gott vergibt – die Lästermäuler eher nicht.
Mein Gott, was hat der Rüssel denn auf dem Kerbholz? Die Magd schleudert mit ihrer Kartoffelroder-stimme verständliche und unverständliche Laute durch ihre Zahnlücken. Nach außen dringen keine ganzen Sätze, nur Wortfetzen.
Bauer allafäzig, boshaft: Kein Platz am Tisch für Magd. Bauer Herrentisch, Magd Katzentisch. Er hanna, hüben. Ich danna, drüben. Muss allein auf Holzkiste essen. Allein. Zum Heulen, ’s ischt zum Blära.
Bauer hoffärtig, hochnäsig: neuer Porsche, roter Porsche, schöner Porsche. Bauer fährt umher, umanand, wie aufgeblasener Gockel. Bauer fährt Porsche – alle mal hergucken!
Bauer duranand, verwirrt im Kopf: Herrgottswinkel rausgerissen. Heiland ins Kachelloch, auf Schutthalde, geworfen. Bauer vom Glauben abgefallen. Großes Durcheinander im Haus. Elendigs Duranand, Herr Pfarr. Teufel hat Finger im Spiel.
Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Lästermäuler, die schon länger vermuten, dass in »Rüsselsheim« nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Für die Zubereitung in der Gerüchteküche ist es ideal, wenn nicht alle Tatsachen auf dem Tisch liegen, nur Bruchstücke und Wortfetzen. So lassen sich die Lücken umso ungenierter mit Verdrehungen, Vermutungen und Unterstellungen füllen. Erst die richtige Füllung bringt die Leute auf den Geschmack. Das gilt für nackte Tatsachen genauso wie für ausgenommene Truthennen.





























