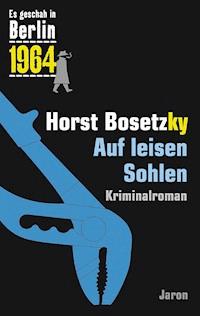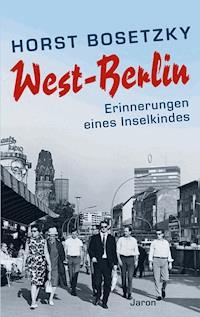3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mädchen und Motorräder, Capri und Kartoffelpuffer – das sind die Träume des jungen Manfred Matuschewski während seiner turbulenten Gymnasiastenzeit im Berlin der fünfziger Jahre. Wie in ›Brennholz für Kartoffelschalen‹ zeigt sich Bosetzky als brillanter Chronist deutscher Nachkriegsgeschichte. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Ähnliche
Horst Bosetzky
Capri und Kartoffelpuffer
FISCHER E-Books
Inhalt
… denn ein Traum ist alles Leben, und die Träume selbst ein Traum.
Calderón
Mit diesem Buch danke ich allen, die mir geholfen haben, in diesem Sinne zu träumen, Alpträume eingeschlossen. Und obwohl sich (fast) alles so ereignet hat, wie es hier geschrieben steht, und auch die historischen Daten und Fakten alle stimmen (oder wenigstens stimmen sollten), bedenke man doch bitte: Dies ist ein Roman – der zweite im Rahmen meiner »Manfred-Trilogie« –, also eine Mischung von Dichtung und Wahrheit.
Wer hat unseren Herrn Jesus Christus verraten?
Schule war nur schön, wenn sie ausfiel, und euphorische Gefühle ließ sie lediglich dann aufkommen, wenn die Ferien begannen. Heute aber schien nichts auszufallen, und bis zu den Weihnachtsferien dauerte es noch eine kleine Ewigkeit, denn es war erst Mitte September, September 1952.
Manfred Matuschewski, im Februar vierzehn geworden, besuchte seit kurzem die höhere Schule, das heißt, die II. Oberschule Wissenschaftlichen Zweiges zu Berlin-Neukölln, die an der Karl-Marx-Straße gelegen war, gleich beim Hermannplatz. Wer nun anhand des Straßennamens glaubt, diese Lehranstalt hätte zu einem der Ostberliner Bezirke und mithin zur DDR gehört, der irrt sich, denn Neukölln unterstand der amerikanischen Besatzungsmacht.
Erdkunde gab es in der ersten Stunde, und da die Geographie zu den wenigen Fächern gehörte, in denen Manfred mehr wußte, als nötig war, um über die Runden zu kommen, konnte er sich beruhigt seinen Tagträumen widmen, die in dieser Zeit nur um das eine kreisten: seine Torwartkarriere. Die hatte beim 1. FC Neukölln glanzvoll begonnen, und nun sah er sich mal als Heiner Stuhlfauth, den legendären Keeper des 1. FC Nürnberg, mal als Toni Turek, den Torhüter der Nationalmannschaft, durch das Gehäuse fliegen und die schärfsten Bälle aus dem Dreiangel fischen. Im Augenblick aber war er Ricardo Zamorra und tauchte gerade in die rechte Ecke, um einen Elfer um den Pfosten zu lenken.
Da kam Meph auf ihn zugeschossen, Dr. Mann. »Wie heißt die Insel, wo die Sonne aufgeht?«
»Capri!« rief Manfred wie aus der Pistole geschossen.
Da konnte Meph nicht anders, als sich, wie beim Elektroschock, beide Fäuste gegen die Schläfen zu pressen und Manfred anzuschreien: »Permanenter Döskopp du!«
Während Manfred gar nichts begriff, begann die letzte Reihe begeistert zu singen: »Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt … und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt …«
»Ruhe!« Meph schlug mit der flachen Hand auf das nächstbeste Pult. »Japan ist das Land der aufgehenden Sonne! Und bei Capri geht sie unter! Wiederhole das!«
»Japan ist das Land der aufgehenden Sonne. Und bei Capri geht sie unter.«
»Ja, so wie die meisten von euch an dieser Schule hier untergehen werden. Wie viele seid ihr in der 8a …? Sechsundvierzig, ja. Und von denen werden im Jahre 1957 allerhöchstens zehn das Abitur geschafft haben. Ich tippe mal auf acht.«
Mit den Fingern zeigte er auf die wenigen, die er für fähig hielt. Manfred war nicht darunter.
Sein Magen krampfte sich zusammen. Er haßte Meph. Meph kam von Mephisto, Mephistoteles, und irgendein begabter Schüler einer früheren Abiturientenklasse hatte den Roman Mephisto von Klaus Mann gelesen und dabei an seinen Chemie- und Erdkundelehrer gedacht, eben jenen Dr. Hans-Joachim Mann, der für viele Schüler durchaus der Teufel dieser Schule war, obgleich man ihn so im Faust nicht finden konnte, war er doch weit mehr ein verschlagener Gnom, ein Waldschrat, als ein vor Witz und Geist nur so sprühender und stets aasig blickender Gustaf Gründgens. Von seiner Schmöckwitzer Oma, die Anfang der dreißiger Jahre einem sozialdemokratischen Arbeiterbildungsverein vorgestanden hatte, war Manfred die Sache so erklärt worden.
Meph mährte sich nun weiter aus. Daß die Niederschlagsmenge in der australischen Wüste weniger als 25 cm betrüge, und die Blätter des Eukalyptusbaumes immer senkrecht zur Sonne stünden, um von deren sengenden Strahlen möglichst wenig getroffen zu werden. Dann zückte er sein grünes Notenbuch, um die Südsee-Inseln abzufragen, die sie in der letzten Stunde durchgenommen hatten. Fast alle Schülerinnen und Schüler duckten sich, denn sie wußten nichts und hingen einem alten magisch-kindlichen Glauben an: Wenn ich Meph nicht sehen kann, dann kann der mich auch nicht sehen. Manfred hingegen strahlte, denn da er alle Geschichten Jack Londons schon x-mal gelesen hatte, wußte er natürlich, wo Neukaledonien, die Marshall-, die Gesellschafts- und die Fidschiinseln lagen. Grund genug für Meph, ihn nicht nach vorn an die große Ozeanien-Karte zu holen, die Bimbo, der dieses Amt gern innehatte, vor Beginn der Stunde brav aufgehängt hatte. Von ihren Farben und Formen her war diese Karte wunderschön, das Hundsgemeine an ihr war aber, daß sie nicht beschriftet war, die Länder, Berge, Flüsse und Inseln also keine Namen trugen, und auch die Städte nur unterschiedlich große schwarze Punkte waren.
»Nobiling!« rief Meph, und die Klasse kicherte sofort in schadenfroher Erwartung, denn Ingolf Nobiling, lang aufgeschossen und der geborene Rebell, stand in dem Ruf, frech wie Oskar zu sein, und galt von vornherein als sicherer Sitzenbleiber.
Nobiling schlenderte nach vorn und genoß das ganze. Sein Vater hatte ihm schon längst eine Lehrstelle bei der Gasag beschafft.
»Pitcairn!« rief Meph, und Nobiling hatte nun mit dem Zeigefinger auf jenen Punkt zu tippen, der für diese abgelegene Insel stand.
»Hier ist ja alles voll von Fliegenschissen«, kommentierte Nobiling das, was Mikronesien, Polynesien und Melanesien war, und stieß den Finger schließlich da in die Karte, wo Australien wie ein fetter Tintenklecks im tiefen Blau der Ozeane schwamm.
Wieder preßte Meph beide Fäuste gegen die Schläfen und stampfte zudem noch mit den Füßen auf den Boden. »Ich halt’ das nicht mehr aus! Pitcairn, die Insel, auf der die Meuterer der ›Bounty‹ an Land gegangen sind – das muß jeder kennen, der sein Abi bauen will!«
»Ja, nun …«, brummte Nobiling.
»Hawaii!« war Mephs nächste Forderung. »Die Hauptstadt!?«
»Keine Ahnung …«
Da nahm Meph den eigenen Zeigefinger, um ihn wie eine anfliegende V 2 auf Honolulu niedergehen zu lassen. Die Folge waren ein Schrei, drei Blutstropfen, die auf die Erde klatschten, und eine Eintragung ins Klassenbuch. Nobiling hatte, um Irene Schwarz, der Klassenbesten, und anderen Strebern eins auszuwischen, von hinten einige Reißnägel durch die Karte getrieben und mit Klebstoff fixiert.
Es klingelte. Die erste Stunde war zu Ende. Doch die Freude war nur von Funkenlänge, denn fünf weitere Stunden lagen noch an.
Kaum hatte Meph das Feld geräumt, stand Frau Hünicke am Lehrertisch und legte 46 Aufsatzhefte ab. Nicht ganz so alt wie seine Mutter, blond und attraktiv wie eine Filmschauspielerin, hätte sie an sich, zumindest von den Jungen, bejubelt werden müssen, doch auch die senkten nur die Köpfe und dachten an nichts anderes als an Strafe und wen es heute wieder treffen würde. Alles an dieser Oberschule, hatte Manfred schnell erkannt, war darauf ausgerichtet, ihnen vorzuführen, wie klein und dämlich sie waren, unwürdig, hier zu sein. Angst war die große Herrscherin in dieser Schule, und seine Zeit in ihren Räumen, da war er sich sicher, würde nichts weiter sein als ein einziger Schmerz, den es zu ertragen galt.
»Setzen«, sagte Frau Hünicke.
Peter Stier, der neben ihm saß, von allen Bimbo genannt, strahlte seine Deutschlehrerin so verzückt an, daß es Manfred an die frommen Bildchen erinnerte, auf denen Missionare Heidenkindern die Ankunft des Herrn versprachen. Bimbo, sich seiner mangelnden Fähigkeiten bewußt, hatte instinktiv begriffen, daß da nur Schleimen half, um bis zum Abitur zu kommen. Anders hingegen Dirk Kollmannsperger, der sich dank seiner naturwissenschaftlichen Begabung stark genug fühlte, es mit den Lehrern aufzunehmen. Was er dachte, stand ihm ins Gesicht geschrieben: ›Ich bin das Genie, und ihr seid nichts weiter als der absolute Durchschnitt. Wenn ich so alt bin wie ihr, dann bin ich längst Professor und mehr.‹ Keine Gelegenheit ließ er sich entgehen, sie zu provozieren.
»Setzen?« fragte er, und dies, obwohl es in den Bart gemurmelt schien, in einer Lautstärke, daß Frau Hünicke es hören mußte. »Auf was? Auf ›Mauerblümchen‹ oder ›Sonnenschein‹? Sind wir beim Pferderennen hier?«
Frau Hünicke schluckte. »Auf deinen Stuhl sollst du dich setzen!« Das war wenig originell, und die Klasse wertete es als einen Punktsieg für Dirk Kollmannsperger.
Manfred duckte sich instinktiv, denn die Lehrer ließen ihre Wut über solche Niederlagen gern an allen anderen Schülern aus. So war er hin und hergerissen: Einerseits freute er sich über Kollmannspergers erfolgreiche Attacke, andererseits wünschte er ihn deswegen zum Teufel. Und seine Befürchtungen schienen sich sehr schnell zu bestätigen, denn genüßlich griff sich die Lehrerin nun die Aufsatzhefte mit den Fünfen. Mindestens zehn waren es, und Manfreds war darunter.
»Matuschewski. Unglaublich viele Fehler. Nicht genügend.«
Manfred bekam sein Heft auf den Tisch geworfen, und als er es aufschlug, sprang ihm üppig eingestreutes Rot in die Augen. Sogar die Rektorin, Frau Dr. Schaudin, hatte es zur Kenntnis genommen und mit einem ›ges. Sch.‹ abgesegnet. Als er sein Werk jetzt noch einmal überflog, fand er es aber eigentlich ganz passabel.
Die Schule strengt uns ebenso wie die körperliche Arbeit an. Täglich fast sechs Stunden in der Schule zu sein, ermüdet sehr. Das haben auch die Schulräte (?) eingesehen und schafften uns durch die (Einrichtung der) großen Pausen eine kleine, aber schöne Abwechslung.
Am Ende der Stunde, nach der eine (große) Pause kommt (A), flüstert es durch die Klasse: »Klingelt’s bald, (?) w(W)ie lange noch.(?)« Wenn dann endlich das Klingelzeichen ertönt(,) atmet alles auf. Blitzschnell werden Jacken und Handschuhe angezogen und die Stullen ergriffen. Mit »180 Sachen« geht’s die Treppe her(hin)unter, aber jeder will als erster unten sein(,) und so entsteht ein großes Gewühl am Ausgang. Ehe man nun die sichere Mauer erreicht hat, wird man noch ein/paarmal von »Einkriegezeck« spielenden (Schülern) umgerannt.
Eigentlich soll eine große Pause meist zur Erholung dienen,(.) d(D)ie Schüler sollen sich von den »Qualen« einer Stunde erholen und neue Kraft schöpfen. Aber oft gehen wir mit den Kameraden spazieren und unterhalten uns über die nächsten Stunden. »Wann ist dieser bekannte Mann geboren und wann jener,(?) hört man oft zwischen behaglichem Schmatzen. Oft vergessen wir auch die Schule und toben uns richtig aus. Leider fühlen sich oft einige Schüler dazu berufen(,) eine große Prügelei zu beginnen, die aber von einer Aufsichtsperson bald unterbrochen wird. Das Schneeballwerfen(,) im Winter(,) ist leider verboten, aber es (?) hat neben vielen schlechten Folgen und Gefahren(,) in unser(er) schneearmen Gegend auch gute Seiten. (unklar! Außerdem haben wir derzeit September!) Die Pausen sind für uns nie langweilig, es gibt sogar einige(,) die behaupten(,) die Pausen sind (seien) für uns jetzt das schönste an der Schule. Wenn es zur neuen Stunde klingelt(,) sagen wir: (»)Oach, det ging ab(er) schnell.« Merkwürdig ist (scheint), daß beim Ende der Pause alles nach oben drängt. Das (?) wird einem aber auch (?) klar, wenn er uns noch vor Beginn der Stunde noch (Wdh.) lernen sieht.
Die Pausen dienen nicht nur unser(er) Erholung, sondern auch der Gesundheit. 40 Kinder verschlechtern in einer Stunde die Luft so sehr, daß jemand(,) der aus frischer Luft kommt(,) direkt zurück(-)prallt. Die Fenster im Winter zu/öffnen(,) ist für die in seiner (dessen) Nähe sitzenden Schüler schädlich. Die notwendige frische Luft bekommen wir also in der Pause. Man kann sie und die Stunden mit einem Acker vergleichen (falscher Vergleich!), der bei der gleichen Bebauung zuletzt weniger einbringt(,) als bei einer Abwechslung im eintönigen Dasein.
25.10.52
Unglaublich viele Fehler!
nicht genügend!
Hü
ges. Sch. 27.10.52
Manfred war den Tränen nahe. Da hatte er nun sein Bestes gegeben und fand den Text selber auch sehr schön, und trotzdem war es eine Fünf geworden. Was das hieß, war klar: Abstiegsgefahr. Wenn er mit seinem 1. FC Neukölln nur Niederlagen wie diese bezog – mit 0:5 sozusagen –, stieg man eben in die nächsttiefere Spielklasse ab. Das Abitur konnte er sich dann in die Haare schmieren, blieb nur noch die ›Mittlere Reife‹. Er hörte die Stimme seiner Mutter: Da hat man sich nun abgerackert für dich – und das ist der Dank, daß du sitzenbleibst.
»Manfred!?«
»Ja.« Manfred fuhr hoch. Die Ausgabe der Hefte war längst beendet.
»Vielleicht kannst du im Mündlichen wiedergutmachen, was du da im Aufsatz vermasselt hast.« Frau Hünicke, alles andere als ein Unmensch, wollte ihm noch eine faire Chance geben. »Was hast du gerade gelesen? Was ist deine Lieblingsgeschichte?«
Manfred stand auf. »Jack London: ›Ein Sohn der Sonne‹.«
Frau Hünicke verzog das Gesicht, und Manfred registrierte, daß Jack London nicht zu den Schriftstellern zu gehören schien, die man an der II. OWZ besonders schätzte. »Na, erzähl trotzdem mal …«
Manfred sah aus dem Fenster und auf den großen Friedhof hinaus, der sich den Rollberg hinauf in Richtung Tempelhof erstreckte.
»Das spielt in … äh …«
»Äh – ist das ein Land? Äthiopien vielleicht?«
»Nein, in der Südsee spielt das, auf … auf Fuatino. Also, da kommen die mit einem Schüff …«
»Einem Schiff«, korrigierte ihn Frau Hünicke.
»Ja, sag’ ich doch. Sie kommen da an und warten vor der Einfahrt. David Grief, das ist der Held da, und die Rattler,das ist sein … Schoner.« Manfred war glücklich, diese Klippe umschifft zu haben. »Alle haben Angst vor einem tropischen Gewitta …«
»… einem Gewitter!«
»Ja, und sie warten draußen, bis ihnen gemeldet wird, daß Gangsta auf die Kratainsel gekommen sind und alles besetzt haben. Als David Grief dann mit seinen Leuten an Land geht, wird er auf dem Großen Felsen belagert. Sie haben nichts zu essen und zu trinken. ›Das halten wa nicht lange durch‹, sagt der Kapitän der Rattler zu David Grief …«
»Das halten wir nicht lange durch«, merkte Frau Hünicke an.
»Wieso?« Manfred war total verwirrt. »Das ist doch spannend.«
»Hoffnungslos ist das!« Frau Hünicke machte sich einen Vermerk im Notenbüchlein und gab das Wort an Henriette Trettin, die sie mit der Nacherzählung einer Geschichte von Arnold Zweig zu erfreuen wußte, mit dem Bennarône.
»Ausgezeichnet!« Frau Hünicke notierte sich eine Eins. »Zur nächsten Stunde bitte die Berichtigung. Und dann macht euch schon einmal Gedanken zu zwei Sprichwörtern: ›Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land‹ und ›Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr‹. Was sagt ihr dazu?«
Das hatte sie mit dem Blick auf ihre Armbanduhr gefragt, und richtig, die infernalisch laute Klingel ertönte auch schon. Die große Pause war gekommen, die Erlösung. Die meisten griffen sich ihre Stulle und stürzten aus dem Klassenzimmer, einige aber wollten trotz des Miefes hier oben nicht auf den Hof hinunter, und Frau Hünicke, die wie eine Erstickende die Fenster aufriß, hatte Mühe, sie zur Tür zu scheuchen.
Was immer es war, die Fürsorge für die Schülerinnen und Schüler, die ein paar Hofrunden in frischer Luft als dringende Notwendigkeit erscheinen ließ, oder aber die Angst, es könnte im Klassenzimmer ohne strenge pädagogische Aufsicht entweder zum schnellen Nachholen vergessener Hausarbeiten, zu lebensbedrohlichen Prügeleien, zu charakterverderbenden Glücksspielen oder zu unsittlichen Handlungen kommen: Die Räume wurden radikal geräumt, und man mußte fast schon mit einem ärztlichen Attest aufwarten, um nicht auf den Pausenhof gejagt zu werden.
Manfred aber eilte gerne hinunter, denn was das Reizvollste an den großen Pausen war, das hatte er in seinem Aufsatz wohlweislich verschwiegen: den Mädchen hinterherzulaufen. Auch heute wieder war er bemüht, sich mit Bimbo und Dirk Kollmannsperger so in die langsam rotierenden Gruppen einzuordnen, daß er Ingeborg im Blickfeld hatte. Sie und ihre Beine hatten es ihm angetan. Mit ihrem Bild vor Augen schlief er ein, und ihretwegen hatte es schon manchen feuchten Traum gegeben. Es war aber immer furchtbar schwierig, den Fleck im Nachthemd vor den Eltern zu verbergen. Zwar bekam er keine Ohrfeigen dafür wie andere in der Klasse, aber peinlich war es doch. Noch größer war das schlechte Gewissen, wenn man die Sache selber eingeleitet hatte, stand doch in fast allen Büchern, die er und die anderen hatten ergattern können, durchweg, daß dieses Tun sündhaft sei und der deutsche Jungmann sich zu beherrschen habe. Dazu kam die Angst, sein Rückenmark derart zu schädigen, daß man schwächlich wurde und mit der Zeit unweigerlich erkrankte, auch später in der Ehe nicht mehr genügend Samen hatte, um Kinder zu zeugen. Am meisten aber quälte die Jungen die ganz pragmatische Frage: Wohin damit, wenn es einem denn gekommen war? Dieses Problem sollte erst mit dem Aufkommen der Tempotaschentücher befriedigend gelöst werden.
Trotzdem konnte sich Manfred keine große Pause vorstellen, ohne auf eines der Mädchen fixiert zu sein, eines aus der Parallelklasse zumeist. Jutta, Eva, Ingeborg. Sie anzusprechen und zu fragen, ob sie mit ihnen ins Kino oder ein Eis essen gingen, traute sich keiner von Manfreds Freunden. Das war unvorstellbar, und es war ein Naturgesetz, daß man damit zu warten hatte, bis man älter war. Erst grünten die Bäume, dann blühten sie, dann reiften die Früchte heran. Vor der Zeit ernten zu wollen, war gegen Gottes Ordnung.
»Hast du eigentlich Englisch gemacht?« fragte Dirk Kollmannsperger.
Manfred erschrak. »Nein. Was’n?«
Bimbo wußte es natürlich. »Die Nacherzählung von Brave Grace Darling.«
»Scheibenkleister!« Vor dem Training hatte es Manfred nicht mehr geschafft – und dann total vergessen. Und von Eiko war bekannt, daß er vergessene Hausarbeiten gnadenlos bestrafte. Eiko hieß eigentlich Stabenow, war aber von früheren Jahrgängen wegen seines besonders geformten Schädels »Eierkopp« genannt worden, und daraus war dann im Laufe der Jahre Eiko geworden. Trotz seines grausamen Ti-äitschs stand Manfred bei Stabenow hoch im Kurs, und er brauchte zumindest in einem Fach eine Eins oder Eins-bis-Zwei, um einen Ausgleich für diverse schlechte Noten zu haben. Darum ging sein Blick hoffnungsvoll zu Bimbo: »Hast du’s gemacht?«
Der Klassenkamerad zögerte ein wenig, wohl wissend, daß sein eigener Ruhm erheblich verblaßte, wenn auch andere den Text vorweisen konnten. »Ja …«
Eine Armbanduhr hatte Manfred nicht, aber sein Gefühl sagte ihm, daß die große Pause gleich zu Ende sein mußte, und so lenkte er die Gruppe im richtigen Augenblick in Richtung Eingangstür. Als dann die Klingel das Signal »In die Klassen zurück!« ertönen ließ, waren sie mit die ersten in der Menge, die sich die Treppen hinaufwälzte.
In der dritten Stunde hatten sie Physik, und kaum war die Tür zum Saal von einem der stets wichtigtuerisch herumwuselnden Gehilfen aufgeschlossen worden, saß Manfred schon an seinem Platz und schrieb Bimbos Englisch-Arbeit ab:
Grace Darling was a simple girl, who did a deed, that will preserve her memory as long as England lasts. She lived with her father and mother in a lighthouse, which warns ships off the islands. On a September night in 1838, in wild weather, a steamer was disabled, driven on the rocks, and there split in two. Eight men and one woman clung to the wreck …
»Das ist ja interessant …!« Von Manfred völlig unbemerkt, war Hager, der Physiklehrer, hereingekommen und die Reihen der langen schwarzen Tische entlanggeschlendert. Er riß Manfred die beiden Englischhefte weg, seines und Bimbos, und nahm sie mit nach vorn. »Kollege Stabenow wird sich darüber freuen.«
Manfred nahm es hin wie beim Fußballspiel, wenn einen der Schiedsrichter nach einem Foul verwarnte und den Gegner einen Elfer schießen läßt. Was sollte man dagegen machen? Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Bimbo hingegen hatte einen roten Kopf bekommen und schäumte vor Wut. »Dir werd’ ich noch mal was geben!« Nicht nur Manfred, auch ihm drohte jetzt bei Eiko eine Fünf.
»Tut mir leid. Du hättest mich ja warnen können.«
»Ruhe!« Hager stand vorn am Experimentiertisch und blickte wie ein Dompteur im Tigerkäfig. Nur daß er, statt mit einer Peitsche zu knallen, mit seinem Schlüsselbund klimperte, schepperte, läutete und rasselte. Hohlwangig war er, und da alle zu wissen glaubten, daß er etwas mit Fräulein Klews hatte, Geschichte, Deutsch und Erdkunde, flüsterte Klaus Zeisig, daß sie wohl die Pause gemeinsam auf der Lehrertoilette verbracht hätten. »Ruhe!« Hager setzte sich, nahm das Klassenbuch zur Hand und machte sich an das allstündliche Ritual des Aufrufens. »Breuer?«
»Hier.«
»Böhlke?«
»Hier.«
»Eichborn?«
»Hier.«
»Geiger?«
»…«
»Geiger?«
»Hier!«
Diese winzigen Anzeichen hatten Hager stutzig werden lassen, und sofort war er aufgesprungen, um die Sache aufzuklären. Keine Minute später war dann der Betrug ans Licht gekommen – und Ingolf Nobiling hatte einen weiteren Tadel im Klassenbuch stehen: »Nobiling ahmt die Stimme des fehlenden Schülers Adolf Geiger nach, um dessen Anwesenheit im Unterricht vorzutäuschen.« Hager schlug das Logbuch ihrer endlosen Reise über den Ozean des Wissens geräuschvoll zu. »Nun zum Archimedischen Prinzip. Wer kommt zum Versuch nach vorn?«
Das war für die meisten Jungen in der Klasse die Androhung der Höchststrafe. Kamen sie nach vorn, wurden sie von Hager als Deppen vorgeführt und blamierten sich bis auf die Knochen. Und das vor ihren Mädchen, denen sie doch imponieren wollten. Nur wenige Schülerinnen und Schüler hatten bei Gerhard Hager eine Chance: Dirk Kollmannsperger beispielsweise, Henriette Trettin, Irene Schwarz und Guido Eichborn, vor allem aber Dietmar Kaddatz, der als ihr Einstein galt.
Manfred zögerte, ob er sich melden sollte oder nicht. Manche Lehrer übersahen ja gerade die, die mit hochgerecktem Arm und dezentem Schnipsen auf sich aufmerksam machen wollten. Aber wenn er denn doch genommen wurde? War es nicht klüger, die Augen zu senken und sich dem Glauben hinzugeben, der andere könne einen nicht sehen, wenn man ihn nicht sah? Manchmal half es auch, auf die zu blicken, die neben einem saßen, und zu hoffen, daß die Lehrer sich damit lenken ließen. Manfred entschloß sich für diese Möglichkeit – und richtig, Hager bat Bimbo nach vorn.
Bimbo mußte einen kleinen Stein, den Hager mit einer Drahtschlinge versehen hatte, an eine Federwaage hängen. Seine Finger zitterten dabei, und er schwitzte vor Angst derart, daß sich sein grünes Soldatenhemd unter den Achseln wie am Rücken dunkel färbte.
»Was wiegt der Stein? Lies mal ab!«
»Vierzig Kilo«, verkündete Bimbo, dessen Gesicht inzwischen rotblau angelaufen war.
Die Klasse jauchzte, und Hager fragte süffisant, ob Bimbo da nicht etwas durcheinanderbrächte, denn seiner Meinung seien das doch vierzig Tonnen und nicht Kilo.
»Gramm!« korrigierte sich Bimbo. »Gramm. Kleiner Irrtum.«
»Na, dann halt mal deinen kleinen Irrtum ins Wasser hier.«
Das löste bei allen gewaltige Lachstürme aus, denn da sich Bimbo in den Umkleidekabinen nie ohne Unterhose sehen ließ, wurde über das, was er da verbergen wollte, die wildesten Gerüchte ausgestreut. Hager, der das nicht wissen konnte, sah verständnislos in die Klasse, klingelte wild mit seinem Schlüsselbund und gebot der Meute, ruhig zu sein. »Herr Stier, was wiegt denn nun unser Stein, wenn er sich im Wasser befindet?«
Der arme Bimbo, nun gänzlich verloren, tauchte den Stein so tief ins Wasser, daß er bis auf den Boden kam, und als er nun dessen Gewicht von der Federwaage ablesen sollte, konnte er nur sagen: »Nichts mehr, null Gramm.«
Hager griff zu seinem Notizbuch, um die Fünf für Peter Stier, für Bimbo, zu vermerken. »Das Archimedische Prinzip besagt also, daß Körper, die man ins Wasser taucht, ihr Gewicht vollständig verlieren. Na, dann paß bloß auf, wenn du wieder einmal schwimmen gehst.«
Nun bogen sich wieder alle vor Lachen, während Bimbo auf seinen Platz zurücktrottete und sich nach allen Seiten hin verneigte. Er hatte instinktiv begriffen, daß er in dieser Gruppe am ehesten überleben konnte, wenn er die Clown-Rolle übernahm. Darin wetteiferte nur Adolf Geiger mit ihm, doch der war heute krank.
Nun wurden zwei Mädchen nach vorn gerufen, Jutta Böhlke und Renate Zerndt, und das Spielchen ging von vorne los. Bei Jutta Böhlke litt Manfred tüchtig mit, denn sie hatte eine niedliche Bluse an und duftete so verführerisch, daß er sich vorstellte, mit ihr im Faltboot zu sitzen und durch den Gosener Graben zu paddeln. Das Boot kippte um, er zog sie aus dem Wasser und …
»Matuschewski, was verursacht das Gewicht des Steines im Wasser?«
Das hatte Manfred schon gelernt, daß man immer Bedenkzeit gewann, wenn man die Frage wiederholte. »Das Gewicht des Steines im Wasser verursacht eine … einen …«
»Aufdruck«, flüsterte Dirk Kollmannsperger.
»… einen Aufdruck, einen Auftrieb …«
»Richtig, ja.«
Manfred dankte Dirk Kollmannsperger und wurde nun für den Rest der Stunde von Hager in Frieden gelassen. Das war zwar wunderbar, hatte aber den Nachteil, daß die Zeit nun gar nicht mehr vergehen wollte. Und da er keine Armbanduhr hatte, auf der sich wenigstens das Kriechen des Zeigers verfolgen ließ, dehnte sich alles noch viel mehr, und er fürchtete, die Zeit sei total stehengeblieben. Die Luft wurde immer stickiger, die Füße schmerzten, die Augen brannten, der Mund war ausgetrocknet, der Hintern tat weh, kurzum: es war eine einzige Qual. Und was der alte Archimedes da herausgebracht hatte, interessierte ihn nicht im allergeringsten, viel lieber hätte er gewußt, ob am Sonntag bei ihrem großen Spiel gegen Tennis Borussia der Sportkamerad Hörster wieder mitspielen konnte, der Hüne in ihrer Abwehr, weil er es dann als Torwart bei gegnerischen Eckbällen viel leichter hatte und auf der Linie bleiben konnte.
Bis zum Ende der Stunde hatten sie dann das Archimedische Prinzip endlich experimentell ermittelt: Ein Körper verliert in einer Flüssigkeit so viel an Gewicht, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt.
Wieder löste das Klingeln bei den meisten ein Glücksgefühl aus, doch schon zehn Minuten später gab es ein mächtiges Gestöhne, denn Rohrschach kündigte an, daß es eine Kopfrechen-Arbeit geben werde.
Rohrschach war ein würdiger älterer Herr, kurz davor, in den Ruhestand zu treten, und glich mit seiner grauen Mönchstonsur am ehesten jenen Professoren, die Manfred aus alten Filmen kannte. An sich war er gütig und wußte genau, daß Mathematik nicht jedermanns große Liebe war, quälte niemanden, wurde aber dennoch gefürchtet, weil seine Augen etwas Froschhaftes hatten und aufgrund verschobener Achsen immer wieder zu fatalen Irrtümern führten.
»Was haben wir in der letzten Stunde durchgenommen?« fragte er, und Manfred glaubte, daß Rohrschach ihn mit dieser Frage meinte, weil doch dessen Blicke ganz deutlich auf ihm – und nur ihm – zu ruhen schienen.
»Aufgaben mit x … x sei die gesuchte Zahl.«
»Du doch nicht!« schnauzte Rohrschach. »Der neben dir, der im Soldatenhemd!«
Bimbo, im festen Glauben, daß Manfred dran war, hatte abgeschaltet und überlegt, ob seine Harmoniumstunde heute nachmittag um drei oder erst um vier begann. »Wie bitte?«
Mißmutig wandte Rohrschach sich ab und guckte nun Dirk Kollmannsperger an. Der hatte die Rohrschachsche Achsenverschiebung längst durchschaut und stieß Eva an, die neben ihm saß.
»Aufgaben mit x … x sei die gesuchte Zahl«, wiederholte Eva Senff.
Damit war Rohrschach nun zufrieden und hieß sie alle aufstehen zur Kopfrechen-Arbeit, seiner ganz besonderen Spezialität. »Die Hefte aufschlagen, ›zweite Arbeit‹, die Bleistifte auf den Tisch legen und zuhören.« Jetzt las er die Aufgabe vor. »Sieben Arbeiter verdienen in einer Woche 193DM. Wieviel verdienen – unter sonst gleichen Umständen – 12 Arbeiter in einer Woche? Los!«
Es war nun mucksmäuschenstill im Klassenzimmer, und die Köpfe schienen zu rauchen. Manfred machte zwar einen halbherzigen Versuch, mit dem Rechnen zu beginnen, merkte aber schnell, daß er keine Chance hatte, das Ergebnis aus eigener Kraft zu ermitteln. Aber er zögerte nicht, einen Schüler zu spielen, der sich das Hirn zermarterte, und als nun der Befehl des Lehrers kam: »Bleistifte aufnehmen und die Lösung ins Heft eintragen!«, da tat er nur so, als schriebe er eine mehrstellige Zahl ins Heft, ließ aber in Wahrheit den Platz hinter dem schnell hingemalten 1.) frei.
Sie wechselten den Klassenraum, doch kaum hatten sie die Rangelei um die besten Plätze beendet, kam Gunnar Hinze, ihr Vertrauensschüler mit der Nachricht: »Englisch fällt aus, dafür haben wir zwei Stunden Schwimmen! Alles ab in die Ganghoferstraße!«
Der Jubel war groß, denn nicht nur, daß sie dem üblen Vokabelabfragen bei Eiko entgingen, sie brauchten sich auch nicht in der siebenten Stunde tödlich zu langweilen, wenn ihnen Rehberg zu erklären versuchte, wie Aurelius Augustinus den Begriff Kirche definiert hatte.
Doch als die Meute auf den Flur stürmen wollte, stellte sich ihnen die Rektorin in den Weg.
»Halt! Einen Moment noch!« rief Frau Dr. Schaudin mit ihrer scharfen Stakkato-Stimme, und die 8a schwappte, als wäre soeben ein Warnschuß gefallen, in den Klassenraum zurück. »Daß mir keiner auf die Idee kommt, im Anschluß an das Schwimmen gleich nach Hause zu gehen: Der Religionsunterricht findet statt wie vorgesehen.«
Die Enttäuschung der Jungen und Mädchen war so groß, daß auch die zu murren wagten, die der »Chefin« direkt in die Augen sehen konnten. Nur Bimbo strahlte, war er doch Rehbergs ganz besonderer Liebling. Dabei hätte er allen Grund gehabt, empört zu sein, denn er war wegen seines Herzfehlers vom Sport befreit und hatte nun zwei Freistunden in der Schule abzusitzen.
Von Nobiling und einigen der älteren Klassenkameraden unsanft in den Hintern getreten und an seine Pflichten ermahnt, wagte es Gunnar Hinze Einspruch einzulegen. »Ich als Vertrauensschüler … Also, wir meinen, daß wir nach zwei Stunden Schwimmen zu müde sind, um noch bei Herrn Rehberg aufpassen zu können. Außerdem ist ja Religion freiwillig.«
»Darum ja gerade will ich, daß ihr zurückkommt in die Schule, denn: Non scolae, sed vitae discimus.« Sie war nicht nur Deutsch-, sondern auch Latein-Lehrerin und hatte eine vielbenutzte (und -beschmutzte) lateinische Grammatik geschrieben.
»Wir sind hier in Westberlin«, sagte Dirk Kollmannsperger, »da haben wir nichts am Hut mit der SED.«
Frau Dr. Schaudin brauchte einige Sekunden, um diese Assoziation (sed: sondern, gleich SED) nachvollziehen zu können und schwankte dann, ob sie sie als Nachweis besonderer Kreativität positiv oder als Aufsässigkeit, wenn nicht gar Frechheit, negativ bewerten sollte, kam zu keinem Schluß und entlud ihre Spannung in einem lokähnlichen Zischen, das die erste Reihe entsetzt zurückfahren ließ. »Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und wenn ihr später heiratet, dann geschieht auch das freiwillig, und ihr könnt euch euren Pflichten nicht einfach entziehen, wenn es euch einmal zu unbequem sein sollte.«
»Den ›ehelichen Pflichten‹ würd’ ich mich nie entziehen«, brummte Dirk Kollmannsperger.
Die Chefin überhörte es. »Kurzum: Zur siebenten Stunde seid ihr pünktlich wieder hier!« Sie klatschte energisch in die Hände und machte sich auf den Weg zu ihrem Dienstzimmer.
Von ihrer Schule bis zum Hallenbad in der Ganghoferstraße waren es anderthalb Kilometer, und im einsetzenden Nieselregen trotteten sie wie ausrückende Sträflinge die ewig lange Karl-Marx-Straße hinauf. Da sie den Sportunterricht aufgrund fehlender Räumlichkeiten gemeinsam mit der Parallelklasse genießen durften, ergab das eine ganz schöne Kolonne.
Manfred wäre lieber zum Zahnarzt gegangen als zum Schwimmen, denn er haßte das gechlorte Wasser und die Hallenbäder. Sein einziger Trost war der Anblick der Straßenbahnzüge, die auf dem Mittelstreifen fuhren. Es waren entweder Triebwagen vom Typ TF50, die sogenannten »Panzerzüge«, wo man moderne Wagenkästen auf alte Gestelle gesetzt hatte, oder die urigen Verbundzüge der Baureihe TM36. Er kannte sich da aus, hatte viele Dutzend Fotos gesammelt, und sein großer Traum war es, selber einmal an der Kurbel zu stehen. Aber der würde sich sicher nie erfüllen; wie denn auch?
Manfred ging neben Dirk Kollmannsperger und hatte Mühe, dessen Tempo mitzuhalten, denn wenn der mit seinen Streichholzbeinen einen Schritt machte, hatte er mindestens anderthalb zu tun. Obwohl er ganz wunderbar Klavier spielen konnte, hatte er keinerlei Glück bei den Frauen, und so klagte ihm Dirk Kollmannsperger auch heute wieder sein Leid.
»Ich hätte der Eva Senff ja gerne meinen zugegeben, aber die wollte nicht …« Dann sang er: »Ich such’ die Frau meines Lebens, nach der mein Herz immer schrie … Es wär’ alles nicht so schwer, wenn es etwas leichter wär’.«
»Paß bloß auf, daß dir nachher keiner abgeht, wenn du die Eva im Badeanzug siehst«, warnte ihn Manfred.
»Die sind ja alle im Frauenbad drüben.«
»Schade.« Auch Manfred hätte gerne näher betrachtet, was die langen Röcke immer verbargen.
Da trat ihn jemand in die Hacken, und er fuhr herum, um diesem Blödmann die Faust in den Magen zu rammen. Doch er unterließ es schnell, denn der Täter war einer aus der 8b, ein bulliger Typ, und hatte, da er schwarzhaarig war, etwas Bärenhaftes an sich. Er hieß Peter Pankalla, und alle nannten ihn »Balla«, was daher kam, daß die Größeren ihm als kleinen Jungen immer »Pankalla – balla, balla!« hinterhergerufen hatten. Wer das heute tat, also das erlaubte »Balla« verdoppelte, der bekam eine aufs Maul, denn »balla-balla« stand als Synonym für »du bist ja bescheuert«.
Sport hatten sie bei Schädlich, einem der jüngeren Lehrer, der sich als Kumpel gab und nie jemanden in die Pfanne haute. Doch Manfred hatte das Talent, sich sogar mit solchen Leuten anzulegen, obwohl ihn seine Mutter so erzogen hatte, daß es ihm als höchstes Ziel erscheinen mußte, nirgends anzuecken.
Als sie sich umgezogen hatten und in ihren Badehosen, die alle wenig chic und furchtbar schlabbrig waren, in Reih und Glied am Beckenrand versammelt hatten, kam Schädlich auf sie zu, eine Stoppuhr in der Hand.
»Nutzen wir die Doppelstunde und sehen zu, daß jeder von euch seine Note im Schwimmen bekommt. Zweimal fünfundzwanzig Meter, die Stilart ist einem jedem freigestellt: Kraul, Brust, Rücken, Schmetterling. Die ersten vier an den Start: Nobiling, Kollmannsperger, Matuschewski und Kaddatz.«
Manfred fühlte sich wie vor der Hinrichtung. Zwar konnte er sich über Wasser halten, aber er hatte weder den Frei-, noch den Fahrtenschwimmer geschafft, und so unrecht hatte sein Vater nicht, wenn er meinte, er schwimme kaum besser als ’ne bleierne Ente auf ’m Grund. Da er einen sogenannten runden Rücken hatte, hing sein Kopf beim Brustschwimmen immer so tief im Wasser, daß er keine Luft mehr kriegte und sich andauernd verschluckte. Nur in der Rückenlage kam er voran, war dabei sogar um einiges schneller als manch anderer. So ging er wie selbstverständlich zur Leiter, um sich ins Becken hinabzulassen, zum Start zu schwimmen und sich dort unterhalb der Kante an die Spuckrinne zu klammern, echte Startblöcke gab es hier nicht.
Als Schädlich das sah, rief er Manfred zurück. »He, du da, wieder raus aus dem Wasser!«
»Wieso denn?«
»Ich will ’n Startsprung von dir sehen!«
Das war nun das, wovor sich Manfred ganz besonders fürchtete. Grund dafür waren seine beiden traumatischen Erlebnisse. Einmal wäre er als Baby um ein Haar in der Badewanne ertrunken und zum anderen im Dorfteich von Groß Pankow. So schrie er nach oben: »Ich mach’ Rückenschwimmen!«
Schädlich ließ deutlich erkennen, daß er nicht mit sich reden lassen würde. »Was du machst, ist mir egal: Zur Schwimmnote gehört der Startsprung dazu.«
»Und zum Rückenschwimmen gehört, daß man von unten aus startet.« Manfred mochte noch nicht aufgeben.
Schädlich sah seine Autorität untergraben und bellte jetzt nur noch. »Im Lehrplan Schwimmen ist der Startsprung bindend vorgeschrieben.«
»Und bei den Olympischen Spielen ist beim Rückenschwimmen der Startsprung bindend verboten – die können sich doch in der Luft nicht alle umdrehen.« Das war Dirk Kollmannsperger, und die vereinigten achten Klassen machten einen Höllenlärm, so begeistert waren sie über dieses Duell. »Was zählt dann da mehr: die Wettkampfordnung oder die Schule?«
»Ja, gehen Sie doch mal ins Kino und sehen sich die Wochenschau an«, fügte Manfred von unten hinzu. »Wie die richtigen Schwimmer das machen.«
Schädlich blieb hart. »Du kommst jetzt raus, machst deinen Startsprung wie alle anderen auch und drehst dich dann in die Rückenlage.«
»Das ist unfair, Herr Schädlich.« Nun ergriff auch Gunnar Hinze, der Klassensprecher der 8a, Partei für Manfred. »Da verliert er doch viele Sekunden dabei und bekommt ’ne schlechtere Note.«
Das sah der Sportlehrer, gerecht wie er war, auch ein, nachdem einige andere dieses Argument wiederholt hatten. »Gut. Ich ziehe ihm nachher fünf Sekunden von der Zeit ab, die er effektiv geschwommen ist.«
Alle hielten das für einen salomonischen Spruch und klatschten dementsprechend Beifall, ahnten ja nicht, wie schlimm dieser Sprung in den Tod für Manfred sein würde, und was blieb dem anderes übrig, als wieder aus dem Wasser zu klettern und am Beckenrand Aufstellung zu nehmen. Hoffentlich kam einer und rettete ihn.
»An den Start!« rief Schädlich, drückte die Stoppuhr auf Null und wartete, bis die vier Jungen sich vor ihm aufgebaut hatten. »Fertig …«
Manfred kam sich vor wie einer dieser Springer in Kalifornien, die vom hohen Felsen ins Wasser hechten.
»Und: Los!«
Manfred stürzte sich ins Nichts, tauchte ein, schluckte Unmengen an Wasser, wußte nicht mehr, wo oben und wo unten war, fühlte sich eingeschlossen wie eine Fliege im Bernstein und hatte keinerlei Hoffnung mehr, noch einmal aufzutauchen. Eine Ewigkeit verging, und er strampelte in seiner Panik wirklich wie jemand, der am Ertrinken war. Die Lungen schienen ihm zu platzen, und im Kopf dröhnte es so, als hätte man ihm eine Kraftwerksturbine eingebaut. Er hatte echte Todesangst, glaubte wirklich, im Dorfteich zu stecken und sterben zu müssen.
Als er endlich wieder aufgetaucht war, brauchte er geraume Zeit, um das geschluckte Wasser auszuspucken und aus den Ohren zu schleudern, vor allem, um die Orientierung wiederzufinden. Dirk Kollmannsperger war schon fast an der Wende hinten am Kinderbecken.
»Raus!« hörte er Schädlich oben vom Beckenrand schreien. Der war der festen Ansicht, Manfred habe ihn vergackeiern wollen und gab ihm nicht nur eine Fünf in Schwimmen, sondern verpaßte ihm auch eine Eintragung ins Klassenbuch: »Matuschewski stört durch sein aufsässiges Verhalten und seine Albernheiten den Unterricht.«
Manfred nahm es hin. Für die anderen war er nun ein Held, hätte er aber gegen diese Ungerechtigkeit unter Tränen protestiert und auf seine Todesangst verwiesen, wäre er von seinen Kameraden nur verspottet worden, und der Lehrer hätte ihm ganz sicher nicht geglaubt.
»Ja, ja, das Leben ist eines der härtesten«, kommentierte Dirk Kollmannsperger die Szene.
Mit dieser tiefen Erkenntnis zog sich Manfred wieder an und trabte mit den anderen zur aufgezwungenen Religionsstunde in die Schule zurück. Bei Rehberg kam es dann zum eigentlichen Eklat.
Der Religionslehrer, ein Charakterkopf wie der Apostel Paulus und von Manfred an sich schon deswegen geschätzt, weil er wie sein Vater aufgrund einer Kriegsverletzung am Stock gehen mußte, hatte es schwer, gegen den allgemeinen Unwillen der Klasse anzukommen.
»Um 400 nach Christus begegnen wir Aurelius Augustinus als dem bedeutendsten Theologen und Apostel seiner Zeit. Ja, bitte …?«
Dirk Kollmannsperger hatte sich gemeldet.
»Das versteh’ ich aber nicht …«
»Was verstehst du nicht?«
»Na …« Dirk Kollmannsperger hatte die wunderbare Eigenschaft, bei allem, was er sagte, intellektuell und grüblerisch zu wirken. »… daß sie immer alle vom ›dummen August‹ sprechen …«
Alle bogen sich vor Lachen, doch Rehberg konnte sich nicht entschließen, Dirk Kollmannspergers Beitrag als Aggression zu werten. Andererseits litt er darunter, von der Klasse nicht für voll genommen zu werden. Schließlich hatte er die vielbeachtete Dissertation »Kasualgebete im Wandel der Zeiten« verfaßt und galt in der Synode als kommender Mann.
»Damit ist sicherlich nicht dieser Aurelius Augustinus gemeint«, entgegnete er ernsthaft auf Kollmannspergers Einwurf und bewahrte die Contenance, obwohl er ziemlich geladen war. »Ich werde aber einmal nachsehen, woher diese Wendung stammt. Aus der Zirkuswelt wahrscheinlich. Nun zurück zum großen Augustinus … Wie gesagt, er prägte den Kirchenbegriff: Kirche ist die Gemeinschaft der Getauften, Kirche ist die Gemeinschaft der Erwählten, Kirche ist die Gemeinschaft der kämpfenden (noch lebenden) und der schon triumphierenden (bereits gestorbenen) Auserwählten. Kommen wir damit zum Leben der Urgemeinde und zum Begriff der Eucharistie. Wißt ihr, was das Abendmahl ist?«
»Bei uns gibt es immer eine Stulle mit Käse und eine mit Wurst!« rief Nobiling.
»Bei uns immer Tomaten. Aber nur, wenn sie schon rot geworden sind«, fügte Utz Niederberger hinzu.
Rehberg lächelte. »Kennt ihr nicht die Bergpredigt: ›Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.‹ Wenn euch das lieber ist, laßt uns vom Frieden reden und vom Schrecken der Atombombe …«
»Wummmm!« machte Thomas Zernicke.
»Nun …« Rehberg lächelte noch immer wie ein Missionar, der sein Glück irrtümlicherweise in der Heidenmission gesucht hat. »Wie lauten zwei der Sprüche Salomos: ›Tue von dir den verkehrten Mund und laß das Lästermaul ferne von dir sein.‹ Und: ›Gehe hin zur Ameise, du Fauler; sieh ihre Weise an und lerne!‹ Was sagt uns das?«
Manfred interessierte all dies nicht die Bohne, und er empfand diese Religionsstunde als etwas, das ihm gewaltsam angetan wurde. Man hatte ihn hier gegen seinen erklärten Willen eingesperrt, und er war todmüde, wollte nichts anderes, als zu Hause auf dem Sofa liegen und gegen die Decke starren.
Nur so war zu erklären, daß er jetzt gegen Dr. Rehberg auf eine ganz besondere Art und Weise protestierte: Er zog sein Taschenmesser heraus, klappte es auf und säuberte sich die Fingernägel, obwohl sie nach dem Schwimmunterricht ausnahmsweise gar nicht schmutzig waren.
Es dauerte keine zehn Sekunden, da kam der Religionslehrer auch schon auf ihn zugestürzt.
»Raus hier!«
Manfred feixte, denn genau das war es, was er mit seiner Protestaktion bezweckt hatte. Er stand auf, nahm seine Mappe und begab sich in Richtung Tür. Und es wäre auch alles geglückt, wenn nicht nahezu alle anderen Jungen ebenfalls ihre stets bereiten Taschenmesser herausgerissen und sich auch über ihre Fingernägel hergemacht hätten.
Da verlor Rehberg dann doch die Gewalt über sich. »Das wird Folgen für dich haben, Matuschewski, schlimme Folgen! Du bleibst hier, und dein Vater kommt her! Das Weitere wird dann von Frau Dr. Schaudin veranlaßt werden!«
Plötzlich herrschte Totenstille in der 8a, denn alle wußten, was das hieß: Abgang von der Schule.
Manfred wachte auf, als sein Wecker mit einem harten Plopp erkennen ließ, daß er bereit war, in zehn Sekunden loszulärmen. Manfreds Hand schnellte vor, um den Mechanismus außer Kraft zu setzen. Dieses Ungetüm von Wecker, immerhin von der Größe einer aufrecht stehenden Zigarrenkiste, stammte noch von seinem Urgroßvater August Quade, und seine Urgewalt reichte, nicht nur um seine Eltern nebenan im kleinen Zimmer hochfahren zu lassen, sondern das ganze Haus aus dem Schlaf zu reißen.
Es war Sonntagmorgen kurz vor sieben. Im engen Schacht des Hinterhofes gurrten die Tauben. Und als Manfred den Kopf ein wenig über die Sofakante hängen ließ, konnte er ein Stück des seidigen Oktoberhimmels erkennen. Sie hatten also schönes Wetter, und er brauchte keine Angst zu haben, daß das Spiel gegen TeBe ausfiel, weil der Platz mal wieder unter Wasser stand. Vorsichtig stand er auf. Seit sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war, schlief er im Wohnzimmer. Das Sofa, das jeden Abend hergerichtet werden mußte, war so schmal, daß er mehrmals in der Woche nachts hinunter auf den Teppich plumpste, doch sein Vater wies ihn, wenn er sich beschwerte, jeweils mit dem Hinweis ab, daß einer, der kein Bett habe, auch nicht aus demselben fallen könne. Außerdem würde man sich ja um eine Neubauwohnung bemühen. Manfred glaubte das, denn für seine Eltern war es auch nicht gerade das Wahre, jeden Abend gegen neun aus ihrem Wohnzimmer vertrieben zu werden. Sonnabends, wenn sie mit ihren Freunden Karten spielten, durfte es auch nie später als Mitternacht werden, was besonders Neutigs schimpfen ließ. »Der Junge braucht seinen Schlaf«, sagte seine Mutter dann.
Manfred zog sich an. Morgenwäsche und Zähneputzen ließ er ausfallen. Natürlich hatten sie in ihrem Neuköllner Hinterhaus kein Badezimmer, und wenn er sich in der Küche gewaschen hätte, wären seine Eltern aufgewacht. Außerdem: Beim Fußballspielen wurde er ja doch wieder dreckig.
Bevor er zum Frühstücken in die Küche ging, war noch der kleine Sportkoffer zu packen, ein braunes Pappding aus Nazizeiten, groß genug für seine Töppen, das Jersey, die Hose, die Stutzen und die beiden Schienbeinschoner. Blaue Hose, gelbes Hemd, so spielte der 1. FC Neukölln – »95« in der Fachsprache, weil 1895 gegründet – seit ewigen Zeiten. Als die beiden Schlösser zugeschnappt waren, schlich Manfred sich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer. Der Korridor war lang, schmal und dunkel. Links lag das Schlafzimmer seiner Eltern, und er hörte seinen Vater schnarchen. Es war ein mächtig dicker Baum, den er da zersägte. »Otto!« Seine Mutter war offenbar gerade dabei, ihren Mann mit einem kurzen Stoß in die Rippen dahin zu bringen, sich auf die andere Seite zu wälzen. Meist kam sein Vater zu den Heimspielen mit auf den Platz, heute aber hatte er ausschlafen wollen.
Manfred tappte weiter in Richtung Küche und Klo. Dort wagte er nicht, die Spülung zu drücken, denn deren Rauschen war so gewaltig, daß sein Vater öfter davon sprach, sie brauchten gar nicht nach Amerika zu reisen, sie hätten ja die Niagarafälle bei sich zu Hause.
In der Küche waren die beiden Frühstücksstullen schnell geschmiert, eine mit Braunschweiger, einer Wurst, die bei ihnen »Fensterkitt« hieß, und eine mit Schmöckwitzer Rhabarber-Himbeer-Marmelade. Dazu las er zuerst im Telegraf und blätterte dann im Stern herum, ob sich nicht eine Seite finden ließ, auf der eine Frau für die neuesten Hüfthalter Reklame machte. Als er eine gefunden hatte, stellte er sich vor, daß er sie ganz für sich alleine hatte, wenn er erst einmal Torwart der Nationalmannschaft war. Derart euphorisch gestimmt, verließ er die Wohnung, nicht ohne sorgsam abzuschließen. Im Hause war es noch ruhig, nur Erich Lewandowski saß schon auf der Toilette, die sich außerhalb seiner Wohnung in halber Höhe zwischen der zweiten und dritten Etage befand. Die Tür stand offen, und da der Nachbar nicht nur über eine sehr kräftige Eigenmarke verfügte, sondern auch noch seit einer halben Stunde an einer selbstgefertigten Zigarre nuppelte, Marke »Siedlerstolz«, mußte sich Manfred die Nase zuhalten, um nicht umzukippen.
Doch kaum hatte er diese Gefahrenstelle hinter sich gelassen, rumorte es auch bei ihm im Bauch, und er mußte noch einmal zu einer Notlandung in die Wohnung zurück. Das war die Aufregung vor dem Spiel. Es war schon etwas anderes, gegen Tennis Borussia anzutreten als gegen Cimbria, Sperber, Stern 89 oder Helgoland.
So überquerte er den Hof erst mit einiger Verspätung, sprang durch das Vorderhaus und rannte dann die Ossastraße hinunter, benannt nach einem Nebenfluß der Weichsel, die sich im leichten Bogen zwischen Fulda- und Weichselstraße erstreckte und im Krieg, welch Wunder, nicht ein einziges ihrer vielen Vorderhäuser verloren hatte. Weder die unterschiedlichen Altbauten auf ihrer Nord- noch die geschlossene Neubaureihe auf ihrer Südseite hatte es erwischt, die Bomben hatten nur eines der Hinterhäuser in Schutt und Asche gelegt, vor allem aber die Häuser gleich an der Fuldastraße getroffen. Deren Reste hatte man gesprengt, die Trümmer aber noch immer nicht beseitigt. Früher hatte Manfred oft in diesen Ruinen gespielt, jetzt aber gab es für ihn nur noch die Fußballplätze.
Die Straße war noch menschenleer, und er bedauerte, daß keiner seiner Mannschaftskameraden in der Ossastraße wohnt. So mußte er allein zur Sonnenallee traben, wo die nächste Haltestelle der 95 zu finden war. Als er den furchteinflößenden Backsteinbau der Martin-Luther-Kirche rechts von sich in den seidenblauen Himmel ragen sah, fiel ihm mit Schrecken wieder ein, was sich am Freitagnachmittag bei Dr. Rehberg zugetragen hatte. Dessen Brief war in der Ossastraße noch nicht eingetroffen, wahrscheinlich, weil ihn die Chefin selbst abfassen sollte. Vielleicht hatten sie beschlossen, das ganze zu vergessen. Manfred sah zum Kirchturm hinauf: Lieber Gott, mach, daß sie den Brief nicht schreiben.
Nach zehn Minuten kam die Straßenbahn, und zu Manfreds Freude war es ein Triebwagen vom Typ T 24, der hinten an der Weichselstraße sichtbar wurde. Dessen gemütliches Nietengesicht liebte er, weil es ihn irgendwie an seine Schmöckwitzer Oma erinnerte. Seine Hoffnung, den begehrten Platz links neben dem Fahrer unbesetzt zu finden, erfüllte sich, und so hatte er die ganze Zeit über freie Sicht auf die Strecke. Zuerst ging es die Sonnenallee hinunter, immer an der Promenade entlang, deren Bäume langsam ihre bunten Blätter verloren. Den ersten Höhepunkt der kurzen Fahrt gab es an der Kreuzung mit der Erk- und der Wildenbruchstraße, wo vor ihnen ganz offenbar ein aussetzender Straßenbahnzug nach links abgebogen war, um das Depot in der Elsenstraße anzufahren. Als der Wagenführer vorn aus dem Schiebefenster hing und mühsam versuchte, die Weiche von Hand aus mit seinem langen Stellhebel wieder auf geradeaus zu stellen, hatte Manfred gegen die Versuchung anzukämpfen, selber die Hand an die Kurbel zu legen. Es zuckte regelrecht in ihm. Aber wahrscheinlich wäre er dann mit der 6 zusammengestoßen, die gerade von der Karl-Marx-Straße herangerauscht kam. Zwei Stationen weiter rollten sie dann am Hertzbergplatz vorüber, wo sein Verein an sich zu Hause war, aber die Spiele der Schülermannschaften wurden meistens am Dammweg ausgetragen. Für Manfred als Straßenbahnnarren wurde es noch einmal interessant, als sie kurz vor Unterqueren der S-Bahn am Bahnhof Sonnenallee einen Zug der Linie 15 vor sich hatten, den man typenrein aus sogenannten Hawa-Wagen zusammengesetzt hatte.
Jetzt ging es ein Stückchen durch Industrie- und Laubengelände, dann tauchte rechter Hand der langgestreckte rote Backsteinbau des Arbeitsamtes auf. Manfred stieg aus und lief mit seinem braunen Sportkoffer den Sackführerdamm hinunter, den auf der einen Seite in sanftem Schwung Neubauten aus Vorkriegstagen säumten, während auf der anderen Straßenseite das Laubengelände begann, das sich weit nach Ostberlin hinüberzog. Inmitten dieses ausgedehnten Grüns lagen wie große Lichtungen zwei Fußballplätze. Der Clou dort war der flache Weltkriegsbunker, dessen graue Räume sie nun als Kabinen nutzen konnten.
Fast die gesamte Mannschaft traf er dort. Nur Kautz und Klinger fehlten noch. Kautz war ihr Genie, ein Spielmacher im kleinen wie Fritz Walter im großen, bei dem es zum guten Ruf gehörte, zu spät zu kommen. Klinger dagegen war nicht in der Lage, sich den Weg zum Platz zu merken, und verlor sich jedesmal im Labyrinth der Laubengänge.
Günther Schäfer, Mannschaftsbetreuer der ersten Schüler des 1. FC Neukölln, blickte auf die Uhr, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Finanzbeamter war er, hatte sich immer selber Jungen gewünscht, aber nur Mädchen bekommen, und war deswegen gerne jeden Sonntag mit der Mannschaft auf Achse. Assistiert wurde er von Knolle, dem Opa, einem ausrangierten Schulhausmeister mit Hasenscharte und schiefem Gesicht, der stets in seinem schwarzen Hochzeitsanzug erschien, die Taschenuhr an der goldenen Kette, die Zigarre im Mund, und dem ganzen Verein viel bürgerliche Würde verlieh. Ihr Trainer hieß Bachmeier, kam aus Österreich, ließ sich aber während der Spiele nie blicken.
Die Jerseys der Jungen strahlten alle im frischen Butterblumengelb, und keine ihrer preußischblauen Hosen wiesen Flecken auf, wie auch die blau-gelben Stutzen und die Fußballschuhe von äußerster Sauberkeit waren. Keiner kam auf die Idee, dies den Verein erledigen zu lassen, bei den meisten weigerten sich sogar die Mütter, die verdreckte Fußballkluft zu waschen, und die Jungen hatten alles selber einzuweichen, zu kochen, zu spülen, auf die Leine zu hängen und schließlich zu bügeln. So auch Manfred.
»Mach ma Platz da!« sagte Hörster, und brav rückte Manfred zur Seite. In der Hackordnung der Mannschaft, das wußte er, stand er ziemlich weit unten. Das lag zum einen daran, daß man zu Torwarten wie Linksaußen stets die größten Deppen machte, zum anderen aber waren seine Vorderleute so gut, daß er selten etwas zu halten bekam. Kautz war große Klasse, aber auch Machnik galt als begnadeter Techniker, um den sich schon die Späher von Viktoria 89 und Blau-Weiß 90 gekümmert hatten. Kölblin und Brunow, beides Ballschlepper mit einer Pferdelunge, und Hörster, der Abwehrhüne, war später einen Platz in der ersten Herrenmannschaft sicher. Mittelmaß waren Werner Guse, der in Manfreds Parallelklasse ging, Klinger, Blumentritt, Hütterer und Emmler; der aber hatte die größte Schnauze von allen.
»Gegen Tennisch müscht ihr alle verteidigen. Wenn Tennisch dasch Leder hat, dann die Schtürma zurück nach hinten.« Knolle wiederholte die angesagte Strategie. »Wenn ihr den Ball erobert habt, dann mit einem Schteilpasch vor das gegnerische Tor. Verschtanden!?«
»Ja.«
Und der Betreuer ermahnte sie immer wieder, nicht vor Ehrfurcht zu erstarren, wenn »die Veilchen« – so nannte man die Borussen wegen ihrer lilafarbenen Trikots allenthalben – sie attackierten. Aber das war leichter gesagt als getan, denn als Neuköllner, Söhne kleiner und manchmal richtiggehend armer Leute, fühlten sie sich den Jungens vom Rande des Grunewalds, den Charlottenburgern, automatisch unterlegen. »Die kochen auch nur mit Wasser.«
»Und machen beim Kacken die Knie jenauso krumm wie ihr«, fügte Knolle hinzu. »Keine Angscht vor großen Tieren!«
Und Hörster, ihr Kapitän, ging in die Kabinenecke, zog seinen ganzen Rotz die Nase hoch und ließ ihn, ebenso per herausgepreßter Luft wie mit Hilfe von Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand, nach Altberliner Art auf den Zementboden flutschen. »Det ist für mich ’n Charlottenburger!«
Die Mannschaft johlte und war bester Laune, zumal jetzt auch noch Klinger und Kautz erschienen, letzterer in neuen weißen Fußballschuhen.
Manfred schnürte sich zum wiederholten Male seine eigenen und ziemlich ausgelatschten Töppen zu. Das heißt, seine eigenen waren es gar nicht, sie gehörten Onkel Helmut und waren nur geborgt. Vom Taschengeld gekauft hatte er sich die knallroten Senkel, die wegen ihrer Überlänge mehrmals um den Schuh geschlungen wurden. So wie er es in der Wochenschau bei den richtigen Torleuten gesehen hatte. Eigene Fußballschuhe zu haben, war sein großer Traum.
»Na, zitterste wieder?« Das war Emmler, der ihm da den Ellenbogen in die Rippen stieß, ihr größter Angeber.
»Nur davor, daß de wieder ’n Selbsttor schießt.«
Manfred hatte heute ein gutes Gefühl. Das lag auch daran, daß seine Mutter ihm erlaubt hatte, seinen Lieblingspullover anzuziehen, den dunkelgrünen, den ihm die Kohlenoma Weihnachten gestrickt hatte.
»Wir müssen raus zum Anpfiff, hopp!« Der Mannschaftsbetreuer öffnete die Stahltür, und sie marschierten durch die Bunkergänge. Mit ihren Stollen machten sie einen ohrenbetäubenden Lärm. Immer wieder gab es kleine Staus, weil einige ihre Töppen nicht richtig zugeschnürt hatten.
»Mann, is det wieder ’n Acker heute!« rief Machnik, als sie auf den Platz liefen, auf dem sich die Jungen in den veilchenblauen Jerseys schon zum Warmmachen eingefunden hatten. Und recht hatte er, denn der schüttere Rasen wurde nicht nur immer wieder von Sandflatschen unterbrochen, sondern auch von Maulwurfshügeln und Karnickellöchern. So hatten sie einige Zeit zu tun, Sand in die Löcher zu stopfen, teils mit den Händen, teils mit den Füßen, denn sie waren die »platzbauende Mannschaft«. Opa Knolle und ihr Betreuer liefen inzwischen die Außenlinie entlang und steckten die weißen Fahnenstangen in den Sand.
Manfred hatte inzwischen seinen Posten im Tor bezogen und wurde warm geschossen. Da es keine Tornetze gab, war es ratsam, die heranzischenden Bälle zu halten, weil er sonst meilenweit zu laufen hatte.
Jetzt kam der Schiedsrichter, ein Dicker mit Doppelbauch, und Manfred hielt den Atem an, denn das war sein Onkel Richard, der Schwager seiner Schmöckwitzer Oma. Er lief hin, um ihn zu begrüßen. Man konnte ja nie wissen, und vielleicht übersah er es, wenn er den Ball mal hinter der Torlinie fing. Aber Onkel Richard tat so, als kenne er ihn nicht. Manfred war tief enttäuscht. Zwar nannten sie einen Schiedsrichter immer »den Unparteiischen«, aber so weit mußte das ja nun wirklich nicht gehen.
Der Anpfiff kam, und das Spiel entwickelte sich so, wie sie es befürchtet hatten: Die Schüler von Tennis Borussia, die Charlottenburger, waren selbstbewußter und eleganter als die Jungen aus Neukölln und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor von »95«, doch Manfred war auf dem Posten. Je schärfer und plazierter die Schüsse, desto wohler fühlte er sich, denn vor nichts hat ein Torwart mehr Angst als vor sogenannten leichten Bällen. Kamen die dann angehoppelt und prallten, gerade als er lässig zupacken wollte, auf einen der unzähligen Grasbüschel, so griff er ins Leere. Wenn die Gegner dann ihren Torschrei erschallen ließen und die Mannschaftskameraden ihn auslachten und mit Vorwürfen überhäuften – »Fliegenfänger!«, »Du Blinder, du!« –, dann wäre er am liebsten vor Scham im Boden versunken.
Heute aber gab es keine Kullerbälle. Wieder fummelte sich ein Tennis Borusse durchs Mittelfeld, spielte dem hüftsteifen Guse den Ball durch die Beine, ließ auch Hörster aussteigen und strebte, den Ball eng am Fuß, unaufhaltsam Manfreds Tor entgegen. An sich gab es für Manfred keine Chance, den Treffer zu verhindern, so geschickt er dem Stürmer auch entgegenlief, um den Winkel abzukürzen. Er rechnete mit einem Heber, doch ein Mordsschuß kam, eine echte Granate. Manfred riß die Arme hoch und bekam tatsächlich noch die Fingerspitzen an den Ball. Der gewann dadurch soviel an Auftrieb und Höhe, daß er nicht nur weit über die Torlatte flog, sondern auch noch über den angrenzenden Zaun und bei den Laubenpiepern nebenan auf dem Frühstückstisch einschlug wie eine Bombe. Ein gewaltiges Klirren und Scheppern und Schreie wie: »Mein schönes Geschirr!«
Manfred lief zum Zaun. »Entschuldigung, kann ich bitte unsern Ball wiederhaben?«
»… ’ne Tracht Prügel kannste dir abholen!«
Nicht mal Opa Knolle im schwarzen Anzug schaffte es, die Leute zur Herausgabe des Balles zu bewegen, und so mußten sie ihn schweren Herzens abschreiben und mit einem Ersatzball weiterspielen.
Für die Jungen des 1. FC Neukölln war es schwer zu verdauen, diesmal die Schwächeren zu sein, doch sie stemmten sich mit aller Kraft und Hingabe gegen die drohende Niederlage durch die verhaßten Milchreisbubis aus Charlottenburg, traten nach allem, was sich bewegte, und begingen so viele Fouls, daß Onkel Richard kaum noch Atem holen konnte, so viele Verwarnungen waren auszusprechen. Brunow stellte er sogar vom Platz. Doch so gelang es ihnen, bis zur letzten Spielminute ein stolzes 0:0 zu halten. Dies vor allem dank Manfreds Klasseleistung. Es war phantastisch, wie er die Bälle aus dem Dreiangel holte, in die Ecken tauchte, den Gegnern die Bälle von den Füßen fischte oder bei Flanken hochstieg, um zu fausten.
Es schien alles gutzugehen, dann aber machte Emmler großen Mist, als er nämlich eine Flanke von links mit dem linken Unterarm abfing, bevor der Mittelstürmer der Veilchen mit Kopf herankommen konnte.
»Elfer!« schrien die Borussen.
Hörster trat Emmler in den Hintern. »Idiot, du, den hätt’ Manni doch dicke jehalten!«
»Außerdem ist es Abseits gewesen!« rief Manfred und warf einen flehentlichen Blick zu Onkel Richard hin, war sich eigentlich sicher, daß der im Zweifelsfalle für die Familie sein würde. »Und wenn es Abseits war, kann es keinen Elfer für geben.«
Onkel Richard zögerte, und Manfred triumphierte schon. Doch zu früh, denn der Schiedsrichter Richard Schattan, ein Bruder von Manfreds schon 1937 verstorbenem Großvater Oskar Schattan, erwies sich als unbestechlich.
»Abseits war es nicht, also war es ein Elfmeter.« Damit legte er den Ball auf den ominösen Punkt.
Manfred kehrte enttäuscht ins Tor zurück. Eine mit weißem Kalk markierte Torlinie gab es hier nicht, ein mit den Hacken seiner Töppen in den Sand gefräster Strich hatte zu reichen. In seiner Mitte hatte Manfred einen kleinen Querstrich angebracht, um bei turbulenten Torraumszenen eine sichere Orientierung zu haben. Auf diese Marke hätte er sich nun stellen müssen, um von beiden Pfosten gleich weit entfernt zu sein. Doch um den Elfmeterschützen der Borussen zu irritieren, nahm er deutlich links von ihr Aufstellung und bot dem anderen damit die viel größere Seite zum Einschuß an. Der andere war ein dunkelhaariger Typ mit viel Pomade im Haar. Was würde der jetzt denken? Daß Manfred dachte, er würde das Angebot der größeren Seite dankbar annehmen und in diese Richtung hechten. Wenn er dies dachte, dann schoß er garantiert in die kürzere Ecke, und Manfred brauchte quasi nur stehenzubleiben, um den Ball zu halten. Wenn der andere aber nun dachte, daß Manfred das dachte, dann schoß er doch in die längere Ecke. Es war zum Verzweifeln und brachte nichts.
Jetzt pfiff Onkel Richard, und Manfred stellte sich nun doch genau in die Mitte seines Tores und beschloß, auf der Seite in Richtung Pfosten zu hechten, wo er am höchsten und am weitesten kam: nach links also. Egal, wohin der andere zu schießen schien.
Der Schütze lief an, Manfred warf sich automatisch nach links … und war so rechtzeitig am Boden unten, daß er den plazierten Flachschuß gerade eben um den Pfosten drehen konnte.
Der Schlußpfiff seines Onkel ging im Jubel seiner Mannschaft unter. Sie trugen ihn auf den Schultern vom Platz, und es war der schönste Tag seines Lebens.
Auch in der Schule war er montags noch der Held, doch als er dann nach Hause kam, lag der Brief an seinen Vater auf dem Tisch. Tante Trudchen und seine Kohlenoma, die heute zur großen Wäsche nach Neukölln gekommen waren, hatten ihn offenbar gefunden, nachdem er vom Postboten durch den Schlitz geschoben worden war. Da hatte er keine Chance mehr, ihn einfach verschwinden zu lassen, um die Sache zumindest ein wenig hinauszuzögern, vielleicht sogar zu hoffen, daß die Erwachsenen alles vergaßen, weil sie Wichtigeres zu tun hatten, als sich darüber aufzuregen, daß sich einer beim Religionsunterricht die Fingernägel saubermachte. Ein böses Omen war es auch, daß es ein blauer Umschlag war, ein »blauer Brief« sozusagen. Hiermit empfehlen wir Ihnen, Ihren Sohn Manfred von der II. Oberschule Wissenschaftlichen Zweiges zu nehmen, weil er deren Anforderungen nicht entspricht.