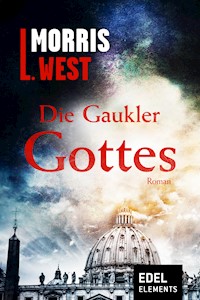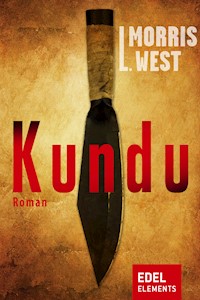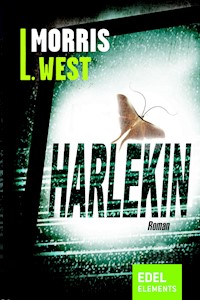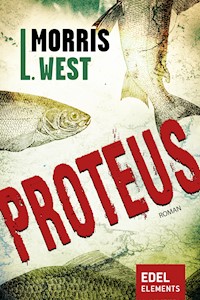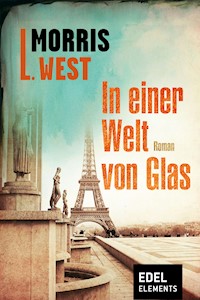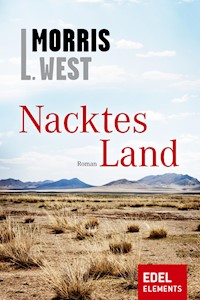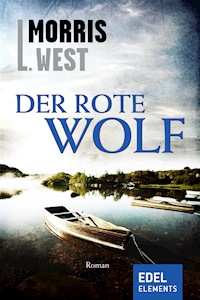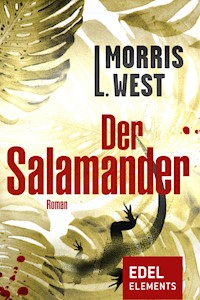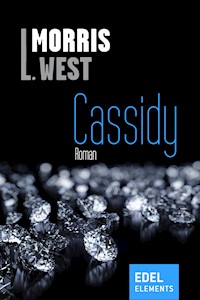
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als todkranker Mann taucht Charles Parnell Cassidy bei seiner Familie in London auf. Der erfolgsverwöhnte Ire hat in Australien Karriere gemacht und hält nun für seinen Schwiegersohn Martin ein verhängnisvolles Testament bereit. In der Öffentlichkeit gilt Cassidy als politischer Held, als Self-made-Millionär und Mustergatte. Doch zu Hause hatte er sich als Tyrann erwiesen, der nach der Tochter und dem Schwiegersohn auch die Frau vertrieb. Jetzt, da der Schwiegersohn Martin zu allen Akten und zu Cassidys Safe Zugang erhält, sieht er sich einem fatalen Vermächtnis gegenüber: Er stößt nicht nur auf Unsummen von Geld in allen Währungen und auf wertvolle Edelsteine – sondern auch auf pornographische Fotos bedeutender Persönlichkeiten sowie weiteres belastendes Material, das weltweite kriminelle Machenschaften aufdeckt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Cassidy
Roman
Ins Deutsche übertragen von Karl-Otto und Friderike von Czernicki
Edel eBooks
Vorbemerkung des Verfassers
Dies ist ein Roman, ein Märchen, kein Geschichtsbuch. Wer hinter der Maske der Romanfiguren lebendige Menschen entdecken will, wird in die Irre gehen. Wem es auf den Wahrheitsgehalt bezüglich der Lage der Nation ankommt, wird deren Umrisse unter dem Gespinst des Gleichnisses entdecken.
M.L.W.
Er haßte die Narren, er haßte die Gauner, und er haßte die Liberalen. Er war ein sehr guter Hasser.
(Samuel Johnson über den Earl of Bathurst)
1
Charles Parnell Cassidy – Gott sei seiner Seele gnädig! – war der Inbegriff eines irischen Politikers. Die Iren sind Nomaden, deshalb findet man sie überall: in Boston, New York, Chile, im Vatikan, in Liverpool, Peru und in Sydney, Australien. Sie sind kräftig, langlebig, widerstandsfähig gegen Krankheiten und neue Ideen, nur wenig formbar durch regionale Einflüsse.
Mag sein, daß sich der Akzent ein wenig verschiebt. Der Dialekt paßt sich dem örtlichen Sprachgebrauch an; aber dies ist ein Trick wie beim Chamäleon: eine Schutzfärbung, weiter nichts. Alles übrige, die umständliche Denkweise, die schnell aufflammende Leidenschaft, der begehrliche Blick, das jederzeit bereite Lächeln, der elegante, dandyhafte Gang, die flexiblen Moralvorstellungen, die wohlklingende Redeweise, die üblen Zornausbrüche – all dies ändert sich nie.
Charles Parnell Cassidy hätte alles sein können, vom Pferdehändler bis zum Kardinal – nur daß er für den einen Beruf zu intelligent und für den anderen nicht enthaltsam genug war. Er wollte zweierlei: Geld und Macht. Zuerst wurde er Jurist: Steuerrecht und Wirtschaftsrecht, was sonst? Dann verdiente er Geld. Wie sollte er da Schiffbruch erleiden – mit den Brauereiaktien, die ihm sein Vater hinterlassen hatte, und seinen eigenen Handelsbeziehungen? Dann kam die Politik – natürlich für die Labor Party. Scheffle das Geld bei den Privilegierten, und laß es dann vom Proletariat schützen!
Er war ein Senkrechtstarter: Eine Legislaturperiode lang Hinterbänkler im Unterhaus, danach spielte er schon eine Rolle in der Opposition. Als dann eine Wahl bevorstand, machte man ihn zum Führer der Parlamentsfraktion im Bundesstaat New South Wales, der, wie die ganze Welt weiß, als Müllabladeplatz für britische Gauner und verarmte Iren gegründet worden war. Sprachgewandt und mit einem Sendungsbewußtsein, das er wie die Salbe in Gilead über seine Zuhörer ausgoß – ganz zu schweigen von viel Beinarbeit und einer Menge Geld, das er in den wirtschaftlich armen Gebieten seines Wahlkreises verteilte –, führte Cassidy die Labor Party zu einem überwältigenden Sieg und einer zehnjährigen Regierungszeit.
Es klingt wie ein Wunder, aber es war keines. Er war ein Naturtalent. Die Fähigkeit, dieses Spiel zu spielen, war ihm angeboren. Er entstammte demselben Volk wie die Kennedys und Fitzgeralds in Boston, die Moynihans in New York, die Duhigs und die Codys in der Kirche und wie jener Reagan, der in California agierte.
Sie alle waren von dem großen Brian Boru gezeugt worden in jener alten, weit zurückliegenden Zeit, die für die Iren auch heute noch »jetzt« ist. Cassidy kannte sie alle persönlich, hatte mit ihnen diniert, mit ihnen – oder ihren Frauen! – korrespondiert, hatte gelernt, wie ihre Wahlmaschinerie gesteuert wurde und wie sie ihren Verpflichtungen gerecht wurden. Dann kehrte er nach Sydney zurück und verarbeitete sein Wissen zu einer revidierten Version des Evangeliums, das nun laut Cassidy folgendermaßen lautete:
»Halte alles schriftlich fest. Wenn du es nicht niederschreiben kannst, dann tu es gar nicht erst. Laß eine solche Arbeit von einem anderen verrichten.
Ziehe alle Schulden in Form von Sachwerten oder in Steuerparadiesen ein. Bargeld auf der Bank läßt sich zu leicht nachweisen.
Fahre nie aus der Haut, bleibe immer gelassen! Denke an Shakespeare: Ein Mann kann lächeln und lächeln und trotzdem raffiniert sein!
Schließe nie Wetten beim Kartenspiel oder Pferderennen ab. Die Wähler lieben einen sportlichen Typ; ein Spieler aber macht sie mißtrauisch.
Wenn du gern mehr Sex hättest, als du zu Hause bekommst, halte dich von den Huren fern, und suche dir eine diskrete Geliebte. Das Publikum liebt das Romantische; es hat nichts dafür übrig, daß seine gewählten Vertreter auf pornographischen Postkarten erscheinen.
Nominiere deinen Polizeichef selbst, aber überlaß es einem anderen Minister, ihn zu ernennen und zu beaufsichtigen. Auf diese Weise hast du stets eine weiße Weste, und die Polizei folgt dir aufs Wort.
Sorge dafür, daß du einen guten Parteigenossen in jeder Minderheitengruppe hast. Du würdest es dir nie verzeihen, wenn die Kroaten oder die Türken deine Karriere gefährdeten.
Sieh zu, daß ein paar gescheite Frauen in der Fraktion etwas zu sagen haben. Überlaß es ihnen, sich mit heiklen Themen wie Abtreibung und Gewalt gegen Frauen zu befassen … Ein Mann klingt immer wie ein Idiot, wenn er vom Recht der Frau, selbst über ihren Körper zu bestimmen, spricht.
Laß dich nie auf Debatten über politische Theorien ein. Es ist vergebliche Liebesmüh.
Halte dich fern von Wirtschaftswissenschaftlern. Sie können dich einen Wahlsieg kosten und behalten trotzdem ihren Lehrstuhl an der Universität.
Das Gesetz ist das eigentliche Machtinstrument. Solange du zu den Gesetzgebern gehörst, bist du der Mann, der davon Gebrauch macht.«
Bei einem solchen Glaubensbekenntnis und dem Mut, es in die Praxis umzusetzen, bestand kein Grund, warum Charles Parnell Cassidy nicht das ganze Land hätte führen können. Die Partei versuchte intensiv, ihn auf Bundesebene als Kandidaten aufzustellen; aber seine Ambitionen hörten an den Grenzen des Bundesstaates auf.
»Dies ist mein Amtsbezirk«, pflegte er in der weichen irischen Mundart zu sagen. »Ich weiß, wie er geführt werden muß. Warum sollte ich mich in der Hauptstadt wie ein Ochsenfrosch aufblasen? Das wäre bestenfalls ein kurzfristiges Unternehmen – und dann endet man meistens auf dem Schafott. Hier«, ein vielsagendes Achselzucken und ein geringschätziges Lächeln, »hier weiß ich, wann es Zeit ist, abzutreten, und ich werde nicht warten, bis man mich vor die Tür setzt.«
Bei den Leuten von New South Wales war er natürlich außerordentlich beliebt. Rund um den Kirchturm ist man um so populärer, je einfacher man ist – und Cassidy war so einfach wie die Schlange in der Bibel. Natürlich wollte er nicht abtreten, jedenfalls noch lange nicht; er scheffelte Millionen.
Ich hatte damals noch keine Ahnung – jetzt weiß ich es! – von der Größe des Imperiums, das er dadurch aufbaute, daß er innerhalb und außerhalb des Landes verschiedene Konzerne miteinander verzahnte. Aber zu seinen Lebzeiten behielt er eine weiße Weste. Er war schon reich, als er gewählt wurde. Er hatte ein Recht auf die natürliche Vermehrung seines Vermögens. Er war nicht käuflich; er war nicht protzig. Er spendete großzügig aus eigener Tasche für Wohlfahrtseinrichtungen. Er trank wenig, wirkte fit und fiel nie aus der Rolle. Er förderte das Verkehrswesen, hielt die Krankenhäuser offen und sorgte dafür, daß man sich auf den Straßen so sicher bewegen konnte, wie es in einem Zeitalter der Gewalttätigkeit überhaupt möglich war. Die Wähler spürten, daß sie den richtigen Mann gewählt hatten.
Über sein Privatleben war wenig bekannt. Während der Sitzungsperiode wohnte er in einem Apartment in Hafennähe; er wurde von einem Ehepaar versorgt. Seine Begleiterin bei offiziellen Anlässen war eine junge Parteigenossin, eine Hinterbänklerin, die er für ein untergeordnetes Ministerium aufbaute. Mrs. Cassidy, von der es hieß, sie kränkle, lebte abgeschieden auf ihrem Landsitz. Sie hatten eine Tochter, Patricia, die seit langem verheiratet war und im Ausland lebte. Der arme Kerl führte ganz offensichtlich ein einsames Leben, aber man achtete ihn als einen Mann, der sein Kreuz tapfer trug. Die Presse hatte ihre üblichen Versuche, ihm einen Skandal anzuhängen, aufgegeben.
Alles war aufs schönste eingerichtet. Sogar ich, der ihm seine Tochter gestohlen und seiner Frau, als sie ihn verließ, Zuflucht gewährt hatte, mußte ihm widerwillig Respekt zollen. Einmal hatte ich ihn während einer wütenden Auseinandersetzung einen heruntergekommenen Iren genannt, der versuche, Spitzenvorhänge zu kaufen. Schön, jetzt hatte er es geschafft. Das Heruntergekommensein lag Generationen zurück. Auch die Spitzenvorhänge gehörten der Vergangenheit an. Charles Parnell Cassidy war der Gesetzgeber, der »Kaiser von China«, und sein Wort hatte mehr Gewicht, als ich mir damals vorstellen konnte.
Damals arbeiteten Cassidy und ich eng zusammen. Er gab mir meinen ersten Job, nachdem ich mein Studium beendet hatte. In jenen Tagen war er leitender Partner von Cassidy, Carmody, Desmond und Gorman. Ich rackerte mich für ihn ab, war für die Erzdiözese Sydney und die großen katholischen Wohlfahrtseinrichtungen tätig. Als er merkte, daß ich mich für seine Tochter interessierte, warnte er mich. Ich sei zu alt für sie, meinte er, zu arm und ohne große Zukunftsaussichten – und außerdem hatte er etwas gegen Mitgiftjäger, die, statt zu arbeiten, reich einheiraten wollten.
Vielleicht wollte er mich nur auf die Probe stellen oder ärgern – oder beides. Aber auch in mir fließt irisches Blut, und ich kann es nicht leiden, wenn man mir auf die Füße tritt. Ich sagte ihm, was er meinetwegen mit seinem Geld anfangen könne, und ging.
Eine Woche später hatte ich einen Job in der Rechtsabteilung einer Handelsbank mit Verbindungen in die Schweiz, nach Paris und London.
Kurz darauf heirateten Pat und ich standesamtlich, denn wir konnten nicht riskieren, daß die Geistlichkeit Cassidy vorher unterrichtete oder daß von der Kanzel herab das Aufgebot verkündet wurde. Ihre Mutter war eingeweiht; als wir aber Cassidy die Nachricht mitteilten und ihn zu einem Versöhnungsessen einluden, sagte er uns, er würde uns lieber in der Hölle wiedersehen, als mit uns das Brot zu brechen oder Wein zu trinken. Falls Kinder auf die Welt kämen, seien sie in den Augen der Kirche Bastarde, und er wolle nichts mit ihnen zu tun haben.
Es war ein so grausamer und schmutziger Familienstreit, wie ihn nur Iren fertigbringen. Es wurde noch schlimmer, als Clare Cassidy ihren Mann zwei Jahre später verließ und zu Pat, mir und den Kindern nach Paris zog, wo ich bei Lazard Frères arbeitete.
Cassidy, erzählte sie uns, sei ein Besessener. Die Zahl seiner Mandanten hatte sich verdoppelt. Vier Abende in der Woche ging er aus, aß mit Gewerkschaftsführern oder Partei-Lobbyisten oder sprach in Ausschußsitzungen über die Strategie und die Reden für seinen Wahlkampf. Außerdem hatte er es mit dem Glücksspiel, war jeden Mittwoch auf dem Golfplatz, wettete samstags beim Pferderennen, war am Sonntag Gast bei oder Gastgeber von Grillpartys und stets von hübschen Frauen umgeben.
Als Clare gegen seine Herumtreibereien protestierte, warf er ihr und uns vor, wir hätten uns verschworen, ihn zu entmachten, seinen Namen zu verunglimpfen und seine Karriere zu zerstören. Als wir ihm Fotos der Enkelkinder schickten – zwei hübsche Kinder –, übergab er Clare die Bilder mit einem Achselzucken und meinte nur: »Arme kleine Bastarde!«
Damit brach ihre ohnehin angeschlagene Ehe zusammen. Clare Cassidy packte ihre Koffer und fuhr weg. Sie sprach mit einem hartgesottenen Anwalt, der Cassidy zu verstehen gab, daß er, wenn er es auf einen Kampf ankommen lassen wolle, diesen jederzeit haben könne; wenn er aber eine Trennung ohne Skandal und eine Scheidung im gegenseitigen Einverständnis wünsche, werde der Preis zwar hoch, aber angemessen sein. Cassidy war zu klug, um es auf die Spitze zu treiben. Ihm wurden die besten Seiten zweier Welten geboten: eine Vernunftehe, damit ihm die Katholiken nichts anhaben konnten, und ein Junggesellenleben; eine vernünftige Kostenrechnung und niemanden, dem er über spätere Profite Rechenschaft ablegen mußte. Er unterzeichnete die Vereinbarung und setzte seinen Siegeszug fort.
Nur Pat weigerte sich, aus dem Leben ihres Vaters verstoßen zu werden. Jedes Jahr zu Weihnachten schickte sie ihm einen Brief mit Fotos von den Kindern. Jedes Jahr kam der Brief ungeöffnet zurück. Sie war gekränkt, nahm es aber gelassen hin. Sie hatte ihre Pflicht getan. Sie hielt die Tür offen. Es war Sache ihres Vaters, durch diese Tür hereinzukommen. Ich war überzeugt, daß er es nie tun würde. Er hatte den Haß zu einer Kunstform entwickelt. Ich, meinerseits, fühlte mich nicht mehr betroffen. Die Kinder waren jetzt Teenager. Sie hatten drei Großelternteile. Ein schwarzhaariger irischer Griesgram würde ihnen nicht weh tun. Wir lebten damals in London. Ich war in der Bankenhierarchie vorangekommen, hatte ein halbes Dutzend gutbezahlter Direktorenposten, hatte gute Freunde in den besten Häusern und ausgezeichnete geschäftliche Beziehungen.
Dann, an einem trüben Dienstag im Februar, wurde mir durch Boten ein Brief zugestellt. Es gab keine Adressenangabe, keinen Absender, nichts – nur Cassidys energische Handschrift.
»Ich müßte eigentlich in New York sein. Ich bin hier in London. Abgesehen von den Sterbesakramenten und dem letzten Atemzug, bin ich ein toter Mann. Ich möchte meiner Tochter sagen, daß es mir leid tut, und ich möchte meinen Enkeln einen Kuß geben, bevor ich gehe. Ich möchte auch Dir die Hand schütteln. Wenn Du willst, hole mich heute nachmittag um 17.30 Uhr an der Jesuitenkirche in der Mount Street ab. Ich werde in der letzten Reihe sitzen – wie der Zöllner im Evangelium. Wenn Du bis sechs Uhr nicht da bist, werde ich gehen, und ich werde Dir deswegen keinen Vorwurf machen. Cassidy.«
Ich glaube, ich habe ihn nie so gehaßt wie in diesem Augenblick. Selbst wenn er im Sterben lag – und das würde ich erst glauben, wenn ich die Leute vom Bestattungsinstitut sah! –, hatte er kein Recht, sich wie ein Schuljunge, der den Unterricht geschwänzt hat, wieder in unser Leben zu schleichen. Und wie stand es mit Clare? Sollte sie in die Versöhnung mit eingeschlossen werden? Sie war bis Montag in Paris. Sie war inzwischen eine alte Dame geworden. Ich sah keinen Grund, weshalb sie einer unnötigen Kränkung ausgesetzt werden sollte.
Ich rief Pat an, las ihr den Brief vor und fragte sie, was sie machen wolle. Sie meinte, genau wie ich, daß »der letzte Atemzug und die Sterbesakramente« wenigstens zur Hälfte bloße Rhetorik seien. Und dann sagte sie mir, zwischen Lachen und Tränen: »… Er bleibt sich stets treu, nicht wahr? Natürlich bin ich froh, daß er schließlich doch noch Vernunft angenommen hat; aber ich würde ihm trotzdem gern eine Abreibung verpassen wegen der vielen Jahre, die er uns verdorben hat … Die Kinder kommen erst am Wochenende aus der Schule, dann haben wir, du und ich, das Schlimmste schon hinter uns … Ich werde zum Abendessen ein Roastbeef servieren. Das mag er gern. Und hast du einen Glenfiddich in der Hausbar? Es ist der einzige Scotch, den er trinkt … Mutter? Um sie brauchen wir uns noch keine Sorgen zu machen. Ich erhielt heute von ihr eine Ansichtskarte. Sie hat in Giverney einen älteren amerikanischen Kunsthistoriker kennengelernt. Sie findet ihn sehr sympathisch und fährt mit ihm hinunter nach Arles …«
Großartig! Mutter hatte ihren Gelehrten. Die Kinder würden nicht zu Hause sein. Wir würden das alte Ungetüm ganz für uns allein haben. Wenn es die Sache besser machen würde – aber ich wußte, daß dies nicht der Fall war –, würde ich ihn in Glenfiddich einlegen und dem Naturhistorischen Museum zum Geschenk machen: elephantus hibernicus malitiosus, ein echter menschenfressender Elefant aus Irland.
… Woran man die Tricks erkennt, die einem die Erinnerung und eine böse Phantasie spielen können. Als ich ihn, in einen dicken Mantel gehüllt, in der Kirche sah, war ich überrascht, wie klein er war. Als ich seine Schulter berührte, konnte ich die Knochen unter dem dicken Tweed fühlen. Das Gesicht, das er mir zuwandte, war gelblich und ausgemergelt. Die Augen waren tief eingesunken. Aber er konnte sich noch zu dem alten, spöttischen Cassidy-Grinsen aufraffen.
»Erstaunt, Sonnyboy?«
Ich war bis ins Mark erschüttert. Meine Stimme klang unnatürlich laut in der leeren Kirche.
»Charles! Was ist denn mit dir passiert, um alles in der Welt?« Er deutete auf das Tabernakel und den Altar.
»Einer der kleinen Scherze des Allmächtigen. Ich habe gerade mit Ihm darüber gesprochen; es ist nur ein schwacher Trost, den Er uns bietet. Willst du mir beim Aufstehen helfen? Diese Bänke sind verdammt hart, und von dem Polster auf meiner Rückseite ist nicht mehr viel übriggeblieben.«
Im Gestühl neben ihm lag eine Aktentasche. Als ich ihm beim Aufstehen half, schob er sie mir zu. Sie war ziemlich schwer. Ich fragte mich, wie weit er sie wohl mit sich getragen hatte. Er stützte sich auf meinen Arm, als wir aus der Kirche hinaustraten; ich mußte ihm wie einem Kranken beim Einsteigen ins Auto helfen. Ihn fröstelte, deshalb ließ ich den Motor an und wartete, bis es im Fahrzeug etwas wärmer geworden war. Ich mußte mit ihm sprechen, bevor wir nach Hause kamen. Wir mußten uns auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, bevor ich ihn in unser Haus eintreten ließ. Die Worte klangen steif und ungehobelt, aber bessere fielen mir nicht ein.
»Du bist willkommen. Ich freue mich um Pats willen, daß du gekommen bist. Im Augenblick sind wir allein im Haus. Die Kinder sind bis Freitag in der Schule, Clare ist in Frankreich. Deshalb haben wir Zeit, uns auszusprechen und uns von neuem kennenzulernen. Aber ich warne dich, Charles. Mach keine Spielchen – mit keinem von uns. Das mache ich nicht mit!«
»Spielchen?« Er hüstelte und lachte, aber es klang überhaupt nicht fröhlich. »Spielchen, sagst du? Mein Todesurteil ist gesprochen, Sonnyboy. Siehst du es mir nicht an?«
»Lebendig oder auf dem Totenbett, Charles, die Warnung bleibt bestehen. Du hast genug Unheil angerichtet. Deshalb benimm dich anständig, hier in meinem Haus – und nenne mich nie wieder Sonnyboy! Ich heiße Martin; Martin Gregory, falls du es vergessen haben solltest. Auch Pat und unsere Kinder sind Gregorys.«
»Also gut …« Er atmete langsam aus. »Ich will nicht zanken – und außerdem bin ich zu müde, um mich mit dir herumzustreiten. Wollen wir uns zur Versöhnung die Hand geben?« Seine Haut fühlte sich kalt und feucht an. Ich hatte den Eindruck, daß die Knochen brüchig waren und brechen würden, wenn ich zu fest zugriff. Ich fragte ihn:
»Woran leidest du, Charles?«
»Darmkrebs in fortgeschrittenem Stadium mit Metastasen in der Leber. Dagegen kann man nichts machen. Ich werde so lange auf den Beinen bleiben, wie ich kann, dann gehe ich in ein Sanatorium. Es ist schon alles vorbereitet.«
»Wie lange weißt du es schon?«
»Drei Wochen. Mein Arzt in Sydney hat die ersten Untersuchungen durchgeführt. Über die Diagnose gab es kaum einen Zweifel. Ich habe ihn zur Verschwiegenheit verpflichtet, flog nach New York und begab mich zu weiteren Tests ins Sloan-Kettering. Sobald die Diagnose bestätigt worden war, informierte ich das Kabinett, daß ich einen Monat Urlaub in der Karibik machen wolle. Statt dessen kam ich hierher.«
»Es weiß also niemand, daß du krank bist oder wo du dich aufhältst.«
»Noch nicht. Es sind gerade Parlamentsferien. In Australien ist Hochsommer; mein Vizepremier hält die Stellung. Ich werde also von niemandem besonders vermißt. Das ist auch gut so, denn sobald ich meinen Zustand bekanntgebe, ist die Hölle los. Man wird mit schwerem Geschütz auf mich schießen. Wenn ich Glück habe, bin ich tot, bevor sie mich finden.«
»Was soll denn das schon wieder heißen?«
»Genau das, was ich gesagt habe; aber ich kann es dir besser erklären, wenn ich ein paar Drinks intus habe. Können wir jetzt fahren?«
»Noch einen Augenblick. Wo wohnst du in London?«
»Bei einer alten und guten Freundin, einer adligen Dame in Belgravia. Sie hat einen guten Arzt in der Nähe, und er hat versprochen, mich bei den ersten Anzeichen der Auflösung ins St. Marks zu transportieren. Willst du mich jetzt endlich von diesem scheußlichen Wetter erlösen? … Hoffentlich hast du zu Hause einen anständigen Whiskey. Das Zeug, das man jetzt unter die Leute bringt, schmeckt wie Terpentin!«
»Bist du sicher, daß du Alkohol trinken darfst?«
»Ich darf verdammt noch mal alles, was mir gefällt. Der Tod dauert lange genug!«
Auf der langsamen Heimfahrt durch den Stoßverkehr nach Richmond sagte ich ihm: »Pat wird sich sehr aufregen.« Cassidy zuckte müde mit den Achseln.
»Es gibt keine Möglichkeit, es ihr schonend beizubringen. Sie braucht mich nur anzusehen und weiß schon alles.«
»Warum hast du dich nicht früher gemeldet? Warum hast du so lange gewartet?«
Er fuhr mich sofort an und sagte: »Weil ich dich früher nicht brauchte. Jetzt brauche ich dich.«
»Deine Manieren haben sich nicht gebessert, Charles. Hoffentlich hast du für Pat eine rücksichtsvollere Antwort bereit.«
»Ich spreche jetzt nicht mit Pat, sondern mit dir, Martin. Du bist immer der spitze Kieselstein in meinem Schuh gewesen: überschlau und so selbstgerecht wie der verdammte Cromwell. Der einzige Weg, an meine Tochter, an meine Enkelkinder – sogar an meine eigene Frau! – heranzukommen, führte über dich. Das hat mich immer abgeschreckt. Auch jetzt noch.«
»Jetzt hast du dich ja überwunden, Charles. Du wirst bald vor deiner Tochter stehen. Sei lieb zu ihr.«
»Ich habe einen ganzen Stall voller Leute, die Reden für mich verfassen«, sagte Charles Parnell Cassidy gereizt. »Noch einen brauche ich sowenig wie einen Kropf!«
Es erwies sich, daß nur wenige Worte vonnöten waren. Als Cassidy eintrat, überzog der Ausdruck tiefen Kummers Pats Gesicht, und sie klammerte sich schluchzend an ihn. Cassidy hielt sie an sich gepreßt und versuchte sie zu trösten. »Ist ja gut, mein Kind! Es steht alles zum besten. Du wirst sehen, es steht alles zum besten.«
Ich sah es keineswegs so. Ich habe diese Redensart, es stehe alles zum besten in der besten aller möglichen Welten, immer als Opium für Idioten betrachtet. Aber dieser Augenblick gehörte Pat, nicht mir; deshalb begab ich mich ins Arbeitszimmer, schenkte mir einen großen Drink ein und wartete auf Vater und Tochter.
Cassidy führte etwas im Schilde, aber ich hatte keine Ahnung, worum es sich handeln könnte. Ich glaubte ihm kein Wort, wenn er behauptete, er wolle alles wiedergutmachen, bevor er vor seinen Schöpfer trete. Das war nicht seine Art. Wenn er schon nicht den Herrn der Welt betrügen konnte, so hatte er doch eine gute Chance, den Teufel zu betrügen – und ich war der Strohmann, den er sich als Gehilfen ausgesucht hatte. Es mag grob und hysterisch klingen, aber ich kannte das alte Ungeheuer zu gut. Wenn man ihm nur das kleinste Zugeständnis machte, drückte er einem mit beiden Daumen die Luft ab – und dann war man noch vor ihm ein toter Mann. Er kam allein ins Arbeitszimmer und schleppte die schwere Aktentasche mit, die er dann mit dem Fuß unter den Schreibtisch schob. Während ich ihm seinen Drink einschenkte, sagte er:
»Pat schminkt sich ihr Gesicht neu. Sie wird uns rufen, wenn das Essen fertig ist … Sie hat mir erzählt, daß du ein guter Ehemann bist und sie glücklich machst. Dafür meinen Dank.«
»Wir machen uns gegenseitig glücklich.«
»Gut. Ich vermache den größten Teil meines Vermögens ihr und den Kindern.«
»Und Clare?«
»Ich habe sie unter einer Stiftung bedacht. Ihr Erbteil fällt recht großzügig aus. Ich habe dich als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Ich hoffe, du wirst diese Aufgabe übernehmen.«
»Natürlich, wenn du willst.«
»Danke.«
»Und jetzt möchte ich dich um einen Gefallen für Pat und mich bitten.«
»Und was wäre das?«
»Ruf Clare an. Sie ist immer noch deine Frau. Sie hat ein Recht zu wissen, was geschehen ist – was mit dir geschehen wird.«
»Ich weiß nicht.« Er zuckte müde mit den Achseln. »Wir haben uns vor langer Zeit im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Alles Weitere ist reine Höflichkeit.«
»Das bist du ihr schuldig.«
Er wurde sofort wieder feindselig.
»Nach meinem Tod regelst du alles! Aber bis dahin bringe ich meine Angelegenheiten selbst in Ordnung. Danke!«
»Ich erinnere dich an eine Schuld, Cassidy!« Einen Augenblick dachte ich, er werde wieder zum Angriff übergehen; aber zu meiner Überraschung grinste er nur und hob das Glas zu einem ironischen Toast.
»Auf alle die verdammten Selbstgerechten! Mein Gott! Du bist ein halsstarriger Schuft, Martin. Du weichst keinen Zentimeter zurück, nicht einmal vor einem Sterbenden!«
»Kannst du mir angesichts deiner Vergangenheit daraus einen Vorwurf machen?«
Er lachte, und ich lachte ebenfalls. Dann ging er auf ein anderes Thema über.
»Sag mir, Martin, habt ihr einen Tresor an deinem Arbeitsplatz?«
»Allerdings, das neueste und beste Modell. Warum?«
»Ich möchte, daß du morgen früh meine Aktentasche dort deponierst. Die Kombination besteht aus Tag, Monat und Jahr von Pats Geburt. Du öffnest sie erst nach meinem Tod.«
»Irgendwelche besonderen Anweisungen hinsichtlich des Inhalts?«
»Die Anweisungen sind in einem versiegelten Umschlag darin, zusammen mit meinem Testament. Alles andere ist auf Mikrofilm festgehalten; es ist geheim, enthält Hinweise auf den Zugang zu den Originalunterlagen. Du wirst feststellen, daß alles ganz klar ist. Ich bin immer sehr methodisch vorgegangen, wie du weißt.«
»Es tut mir leid, daß ich dich nicht besser kennengelernt habe. Ich meine das ernst.«
Er zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf.
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen! Ich war es, der die Jahre vergeudet hat, nicht du.«
»Gibt es einen Grund, warum du nicht den Rest deiner Zeit bei uns verbringen kannst?«
»Ja, es gibt einen. Ihr Name ist Marian. Sie ist eine große Dame. Wir sind gern beieinander, und ich will ihr nicht weh tun. Wobei mir einfällt … ich will nicht den Skandal, der unweigerlich käme, falls ich in ihrem Bett sterbe oder in einem Krankenwagen aus ihrer Wohnung weggeschafft werden sollte. Ich wünsche, daß die Presse berichtet, ich sei friedlich im Schoße meiner Familie dahingegangen. Das ist doch nicht zuviel verlangt, oder? Eine kleine Notlüge oder zwei, der Nachwelt zuliebe?«
Dann erkannte ich seine List – oder glaubte sie wenigstens zu erkennen –, und ich mußte lachen, bis mir die Tränen kamen. Cassidy schien nur wenig belustigt zu sein.
»Was ist daran so komisch? Jedermann biegt sich die Geschichte nach seinem eigenen Geschmack zurecht. Warum sollte es bei mir kein Happy-End geben? … Außerdem solltest du an Pat und die Kinder denken. Sie wären von einem Skandal am meisten betroffen. Ich bin dann tot, mich kümmert es dann nicht mehr.«
Er hatte sich klar ausgedrückt. Ich sagte ihm, ich würde mein Bestes tun, damit er als frommer Mann aus diesem Leben scheide. Ich weiß nicht, warum ich gerade dieses Wort benutzte; aber Cassidy war angenehm berührt, weil es einen so schönen Klang hatte.
»Fromm! Das ist gut … ›iustus piusque‹: Das paßt, findest du nicht auch? Charles Parnell Cassidy, gerecht und pflichtbewußt bis zum Ende. Vielleicht findest du einen Lateiner, der imstande ist, diese Worte in meine Grabinschrift einzubauen … Oh, da ist noch etwas anderes! Ein Staatsbegräbnis kommt auf mich zu. Das will ich nicht missen. Ich habe Anweisungen hinterlassen, mich einzubalsamieren und nach Hause zu fliegen, damit ich mich des Spektakels erfreuen kann, wenn sich alle meine Feinde um mein Grab drängen, um ganz sicherzugehen, daß ich wirklich unter der Erde bin …« Er hielt mir sein Glas hin. »Jetzt wollen wir aber nicht mehr vom Tod reden. Gib mir noch einen Drink, und zwar einen großen, wenn ich bitten darf, und ich werde dir die köstliche Geschichte von den drei Mädchen am Piccadilly erzählen …«
Als Pat schließlich kam, um uns zu Tisch zu bitten, war ich ihm irgendwie wieder nähergekommen – wie damals, als ich in Sydney für ihn schuftete. Man konnte ihn verfluchen, aber der Mann hatte Stil. Er litt. Er fühlte sich durch seinen Zustand gedemütigt. Der Auflösungsprozeß hatte bereits begonnen. Dennoch gelang es ihm, jene hintergründige und gewandte Art des irischen Playboys an den Tag zu legen.
Auch seine Tochter hatte Stil. Ich kannte sie wie meinen eigenen Pulsschlag. Sie litt unter Cassidy und weinte den Jahren nach, die er ihr gestohlen hatte, aber sie plauderte noch immer vergnügt, lachte über seine Witze und erwies ihm allerlei kleine Aufmerksamkeiten. Ich muß zugeben, daß er auch mit ihr zartfühlend umging. Die frühere derbe Art war durch einen elegischen Humor gemildert worden. Wenn er sich auch nicht an die Brust schlug, so ließ er sich immerhin herbei, »mea culpa« zu sagen wegen des Fehlschlags seiner eigenen Ehe und der Schwierigkeiten, die er der unseren zu bereiten versucht hatte.
Ich konnte ihn zwar nicht lieben, aber ich wollte ihm wenigstens vertrauen können. Ich wollte ihm Respekt entgegenbringen wie einem Vater und ihm die letzten schweren Tage erleichtern, aber ich wagte es nicht. Instinktiv hatte ich das Gefühl, vor ihm auf der Hut sein zu müssen, bis sein Herz aufgehört hatte zu schlagen und auf seinem Grab die Blumen wuchsen. Das Beste, was ich fertigbrachte, war eine äußerliche Bekundung von Herzlichkeit, damit Pats Dinnerparty kein Reinfall wurde.
Als wir das Dessert gegessen hatten und Pat in der Küche war, um Kaffee zu machen, fiel mir das Schlüsselwort, das ich gehört und vergessen hatte, wieder ein.
»Das schwere Geschütz … Du sagtest, man schieße mit schwerem Geschütz auf dich, Charles. Was hast du damit gemeint?« »Ach, das!« Sofort trug er wieder die Bühnenschminke, der alte Schmierenkomödiant, der vor seinem einfältigen Publikum auftritt. »Ein Schlagwort, weiter nichts! Du weißt, wie eine Parteiversammlung abläuft. Wenn du nicht mit dem Strom schwimmst, fahren sie schweres Geschütz auf, verrenken dir den Arm, treten dir auf die Füße, fordern deine Schulden ein und erinnern dich dabei an die Nächte, die du in Minnie Murphys Bordell verbracht hast. Ich wußte, wie man mit solchen Leuten fertig wird; deshalb haben sie mir keine allzu großen Sorgen gemacht.«
»Aber jetzt bereiten sie dir Sorgen.«
»Allerdings!« Seine Empörung hatte etwas Endgültiges an sich. »Was können sie tun? Meinen Sarg wieder ausgraben und die Knochen in alle Winde zerstreuen?«
»Ich weiß nicht. Deshalb frage ich dich ja.«
»Sie können nichts tun. Es geht nur darum, daß ich es satt habe, mich um Mitternacht auf Auseinandersetzungen und auf Geschäfte und alkoholisierte Reden einzulassen und den Geruch billiger Zigarren einzuatmen. Wenn die Partei wüßte, in welchem Zustand ich mich befinde, würde sie innerhalb achtundvierzig Stunden in London über meine Nachfolge verhandeln und die Herausgabe meiner persönlichen Papiere verlangen. Das will ich nicht. Damit werde ich nicht mehr fertig … Hast du einen ordentlichen Portwein im Haus?«
Ich wußte, daß ich nichts mehr aus ihm herausbringen würde. Dieses sprunghafte Übergehen von einem Thema zum anderen wirkte immer. Es wird in den Priesterseminaren gelehrt, und für Bischöfe und Minister der Krone gibt es einen Intensivkursus. Cassidy hatte den Lehrgang summa cum laude absolviert. Ich reichte ihm die Karaffe mit dem Portwein, aber er bat mich, ihm einzuschenken. Als er sein Glas hob, sah ich, daß seine Hand zitterte und ihm Schweißperlen auf Stirn und Oberlippe standen. Offensichtlich fühlte er sich nicht gut. Ich schlug vor, er solle sich hinlegen, und ich würde einen Arzt rufen. Nein! Er wollte seinen Port austrinken. Dann könne ich ihn nach Belgravia fahren. Und er wünsche nicht, daß Pat mitkommt. Er hasse Abschiedsszenen. So sei es, Amen!
Um die Wahrheit zu sagen, ich war froh, daß sich Pat nicht mit ihm abgeben und ich mich nicht mit meiner ziemlich paranoiden Abneigung gegen den Mann auseinandersetzen mußte. Ich würde ihn bei seiner Marian abliefern, dann nach Hause fahren und mit meiner Frau ins Bett gehen. Und das war noch so eine Sache, über die ich nicht allzulange nachdenken wollte: So groß meine Abneigung gegen Cassidy war, so sehr gelüstete es mich nach der Frau, die ich ihm weggenommen hatte.
Den ersten Teil der Strecke legten wir schweigend zurück. Cassidys Zustand verschlimmerte sich. Er saß mit geschlossenen Augen zurückgelehnt auf seinem Sitz und sog die Luft ein, um seinen Lungen Sauerstoff zuzuführen und den Herzschlag zu normalisieren. Zwischen einzelnen Atemstößen konnte er mir noch sagen, daß er wieder Herzarrhythmien habe und daß ich seinen Arzt benachrichtigen und ihn dann direkt ins Krankenhaus fahren solle. Er zog eine Visitenkarte des Arztes mit dessen Notrufnummer aus der Tasche.
Ich bog in einen kleinen Park in der Mitte eines Platzes ein, wo ein Telefonhäuschen stand, und rief den Arzt an. Er sagte mir, er werde uns im St. Marks Hospital treffen. Bei der Rückkehr zum Auto sah ich, daß Cassidy eine Kapsel aus einer kleinen emaillierten Schachtel herausnahm. Er warf sich die Kapsel mit der flachen Hand in den Mund, schob dann die Schachtel wieder in seine Uhrtasche, sank zurück und rang nach Atem. Ich fuhr, so schnell ich konnte, zum St. Marks Hospital, dessen abweisende, viktorianische Gebäude die Wohltaten Lügen strafen, die dort an Krebspatienten vollbracht werden.
Gleich hinter der Harley Street hielt mich ein Polizeibeamter auf einem Motorrad an. Er sagte mir, ich hätte die Geschwindigkeitsbeschränkung um dreißig Stundenkilometer überschritten. Ich nannte ihm den Grund. Er warf einen Blick auf meinen Beifahrer und fuhr dann die ganze Strecke bis zum St. Marks vor mir her. Als wir dort ankamen, war Charles Parnell Cassidy tot.
2
Cassidys Arzt, ein weltmännischer grauhaariger Herr Mitte Fünfzig, begrüßte mich kurz, bat mich zu warten und ging dann hinaus, um sich mit dem zuständigen Arzt des Krankenhauses zu besprechen. Eine halbe Stunde später kam er zurück und ersuchte mich, im Ärztezimmer eine Tasse Kaffee mit ihm zu trinken. Er bekundete sein Beileid – eine Reihe nichtssagender Worte.
»… Diese plötzlichen Zusammenbrüche treten bei Patienten im letzten Stadium nicht selten auf. Offen gesagt, ich bin überrascht, daß der Mann noch so lange auf den Beinen geblieben ist. Er war von Metastasen förmlich durchsetzt. Die Leber- und Nierenfunktion war auf ein Minimum zurückgegangen. Ich würde sagen, für ihn war es eine Erlösung … Hinsichtlich des Totenscheins bestehen keine Probleme. Ich habe alle Röntgenaufnahmen und die Berichte von Sloan-Kettering gesehen. Ich habe ihn lange genug behandelt, um den Schein ohne Bedenken auszustellen. Sie können ihn draußen abholen, bevor Sie gehen, und gleichzeitig die Übernahme seiner persönlichen Habe bescheinigen … Er sagte mir, Sie seien sein Testamentsvollstrecker. Ich nehme an, Sie werden die Regierung unterrichten und Vorsorge für die Beisetzungsfeierlichkeiten treffen … Soviel ich weiß, haben Sie Marian nie kennengelernt … Ich werde ihr die Nachricht übermitteln. Sie ist natürlich darauf vorbereitet, aber sie wird jemanden brauchen, der ihr die Hand hält. Sie und Cassidy waren sehr eng befreundet, sehr eng … Schön, wenn es sonst nichts mehr gibt, Mr. Gregory, mache ich mich auf den Weg. Hier ist meine Karte, falls es noch irgendwelche Rückfragen gibt, was ich jedoch nicht annehme. Mein Beileid auch an Ihre Frau. Versuchen Sie ihr zu erklären, daß es eine Erlösung war … Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Doktor.«
Und gute Nacht auch dir, Charles Parnell Cassidy, der du jetzt kalt und bleich auf der Totenbahre liegst … Jetzt bin ich der Hüter dessen, was man deine Hinterlassenschaft nennt: deiner Frau, deiner Tochter, der Enkelkinder, die du nie anerkannt hast, und aller Geheimnisse, die in jener Aktentasche verschlossen sind, die du unter meinen Schreibtisch geschoben hast …
Es war halb zwei Uhr morgens, als ich nach Hause zurückkehrte. Kaum war ich eingetreten, kam Pat mir schon entgegen. »Er ist tot, nicht wahr? Er lag schon im Sterben, als er das Haus verließ. Ich wollte bei ihm sein, aber er ließ es nicht zu!«
Ich wollte sie in die Arme nehmen, aber sie stieß mich von sich. »Rühr mich nicht an! Noch nicht … Bitte, Martin!«
Ich war verblüfft. In all den Jahren unserer Ehe hatte keiner von uns jemals eine Liebkosung des anderen zurückgewiesen. Dann beschlich mich plötzlich eine unerklärliche Angst. Es war, als ob sich Cassidys unversöhnlicher Geist im Körper seiner Tochter verschanzt hätte und mich aus ihren tränenlosen Augen und ihren zusammengekniffenen, blassen Lippen zur Rechenschaft zog. Diesmal jedoch war ich nicht in der Lage zu kämpfen. Ich fand, daß wir beide jetzt einen Drink gebrauchen konnten.
Sie goß mir einen steifen Whiskey ein und sich selbst ein Glas Mineralwasser. Wir tranken uns nicht zu. Der Whiskey brannte mir in der Kehle. Dann äußerte Pat eine Entschuldigung, die so unpersönlich und reserviert klang, daß sie mehr schmerzte als die Zurückweisung.
»Ich will dich nicht verletzen, Martin. Wirklich nicht. Ich liebe dich, aber das gehört jetzt nicht hierher … Ich fühle mich von dir bedroht …«
»Das glaubst du doch selbst nicht!«
»Es ist aber so. Heute abend beim Essen hast du dich ehrlich bemüht, zivilisiert und mitfühlend zu sein, aber du warst genauso unnachgiebig wie mein Vater. Ich glaubte, einem Kampf auf Leben und Tod zwischen zwei Besessenen zuzuschauen.«
»Und aus diesem Grund kannst du nicht ertragen, daß ich dich berühre? – Du gibst mir die Schuld am Tod deines Vaters?«
»Nein, es ist etwas anderes.« Sie sprach in monotonem Tonfall weiter. »Ich komme mir wie ein Objekt vor, das ewig zwischen euch beiden hin- und hergeschoben wird. Ich halte es nicht mehr aus.«
»Liebling, bitte! Das bist nicht du. Hier spricht eine Frau, die unter Schock steht. Noch vor zwei Stunden war dein Vater am Leben. Jetzt ist er tot. Er starb neben mir im Auto – und ich konnte nichts anderes tun, als schneller zu fahren … Jetzt muß ich alles Notwendige veranlassen, damit seine Kollegen verständigt werden. Das hilft mir, aber du mußt dir von mir helfen lassen. Schließ dich nicht ein. Du brauchst …«
»Ich brauche gar nichts – außer meinen eigenen Freiraum.«
»Den hast du doch … du hast ihn immer gehabt.«
»Ich weiß.« Die Worte klangen irgendwie abschließend. »Ich mache mir Sorgen um Mutter. Sie darf nicht aus der Zeitung davon erfahren.«
»Ich werde gleich morgen früh unsere Botschaft in Paris anrufen. Sie wird versuchen, Mutter durch die französische Polizei ausfindig machen zu lassen … Warum gehst du nicht ins Bett? Ich komme hinauf, mummle dich ein und gebe dir eine Schlaftablette.«
»Mach dir um mich keine Sorgen. Du hast jetzt genug um die Ohren. Versuch nur, mich nicht zu sehr zu hassen.« Ich streckte meinen Arm aus, um sie zu einem Gutenachtkuß an mich zu ziehen. Sie berührte meine Handfläche ganz leicht mit ihren Fingerspitzen und ging. Ich machte keine Anstalten, sie zum Bleiben zu bewegen. Ich war froh, allein zu sein und mich gegen das Neue zu wappnen, das in mein Haus eingezogen war.
Ich schloß mich in mein Arbeitszimmer ein und telefonierte mit Sydney, Australien. Cassidys Amtsnachfolger, der Stellvertretende Premierminister, war gerade beim Mittagessen. Seine Sekretärin wollte ihn nicht stören. Ein paar unmißverständliche Worte überzeugten sie, daß sie es doch tun solle. Ich wurde mit dem Speisesaal des Kabinetts verbunden. Der Vizepremier war fassungslos:
»Tot! Ich kann es nicht glauben! Mein Gott, das ist ja schrecklich! Es hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt passieren können. Wir haben Kabinettsferien. Einige meiner Minister befinden sich im Ausland, die anderen sind auf Urlaub. Wir erwarten zwei Gerichtsverfahren gegen Beamte des öffentlichen Dienstes im März. Warum, in Gottes Namen, hat uns Cassidy nicht wissen lassen, daß er krank war! Aber das ist jetzt unser Problem. Wir werden schon fertig damit. Ich werde unseren Vertreter in London anrufen und veranlassen, daß er sich um die protokollarischen Angelegenheiten kümmert – Hof, Parlament, die Dienststellen des Commonwealth, die Presse – und natürlich um die Überführung des Toten nach Australien. Wenn es irgend etwas gibt, das er für Mrs. Cassidy oder Ihre Familie tun kann, wenden Sie sich an ihn. Hat Cassidy übrigens irgendwelche Regierungsunterlagen bei Ihnen hinterlassen – dienstliche Korrespondenz, Akten oder so etwas?«
Meine Antwort war ehrlich, wenn auch unvollständig.
»Ich bin der Testamentsvollstrecker, aber ich habe das Dokument noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Es wird einige Tage dauern, bis ich feststellen kann, wo und wie seine Unterlagen aufbewahrt worden sind. Dann werden die üblichen Nachforschungen beginnen. Falls ich auf irgendwelche Regierungsunterlagen stoße, werde ich es Sie wissen lassen – außer, natürlich, es findet sich etwas Besonderes, das sofortige Bearbeitung erfordert.«
»Wissen Sie, wo solches Material zu finden sein könnte, Mr. Gregory?«
»Um Himmels willen! Bei uns ist es jetzt zwei Uhr morgens. Cassidy ist erst vor drei Stunden gestorben. Meine Frau hat einen Schock erlitten. Ich habe viel zu tun. Eine Suche nach Akten ist das letzte, woran ich jetzt denken kann!«
»Verzeihen Sie, Mr. Gregory.« Der Stellvertretende Premierminister lenkte plötzlich ein. »Auch ich bin schockiert und spreche ganz unvernünftig. Meine Leute und ich werden uns sicher mit Ihnen noch unterhalten müssen; deshalb seien Sie bitte so freundlich, mir die Telefonnummern Ihrer Wohnung und Ihres Büros zu geben.«
Ich nannte sie ihm. Er dankte mir hastig und legte auf. Ich hob Cassidys Aktentasche auf, legte sie auf den Schreibtisch und stellte die Kombination nach Tag, Monat und Jahr von Pats Geburt ein. Ich war schon im Begriff, das Schloß zu öffnen, als mir ein neuer Gedanke kam.
Cassidy war eine bedeutende Persönlichkeit gewesen. Er hatte weder im privaten noch im öffentlichen Leben je etwas hergeschenkt. Deshalb würden alle möglichen Leute ein Interesse an seinen Papieren und an mir als ihrem rechtmäßigen Verwalter haben. Diejenigen, die sich bedroht fühlten, konnten ebensogut auch mich, oder meine Familie, in Gefahr bringen. Wer auf Macht oder Profit aus war, konnte in mir den Hüter eines wunderwirkenden Talismans sehen.
Und dann, bevor ich auch nur eine einzige Zeile überflogen hatte, erkannte ich das wahre Wesen der List, die Cassidy mir gegenüber angewendet hatte. Ich war gesetzlich verpflichtet, alles zu ordnen, was er in einem wilden Durcheinander zurückgelassen hatte. Für alle Schulden, die er nicht bezahlt hatte, würde ich aufkommen müssen. Alle Geheimnisse, die er hatte, würde ich unter dem Deckmantel rechtlicher Schweigepflicht bewahren müssen. Die Freunde, die er hatte, würden sich um Schutz an mich wenden. Früher oder später würden seine Feinde kommen und an meine Tür klopfen. In einem kurzen, verrückten Augenblick sah ich ihn als häßlichen Gnom auf dem Deckel der Aktentasche sitzen und mich mit einem weiteren Zitat aus dem Cassidyschen Evangelium verspotten:
»Die Tugend hat ihren eigenen Lohn: Hungerrationen und einen nackten Hintern! Heb jetzt den Deckel auf, Sonnyboy, und schau dir Charlie Cassidys Schlaraffenland an!«
Und das tat ich. Ich öffnete die Aktentasche und fand sie angefüllt mit Mikrofilmkassetten, die laufend durchnummeriert und mit Inhaltsangaben versehen waren. Oben auf den Kassetten lag ein dicker Umschlag mit Cassidys Testament und drei Treuhandverträgen. Außerdem befand sich darin ein an mich adressierter handgeschriebener Brief:
»… Was das Testament angeht, so mußt sogar Du, Martin der Selbstgerechte, mir beipflichten, daß es sich um ein ausgewogenes und großzügiges Dokument handelt. Zunächst die üblichen Gaben an die Dienerschaft und an alte Angestellte, dann vier Millionen in verschiedenen Vermögenswerten für meine Tochter und ihre Nachkommenschaft. Auch das dürfte für meinen Testamentsvollstrecker kein Problem darstellen. Die Vermögenswerte entsprechen dem Wert vom 31. Dezember letzten Jahres. Die Urkunden befinden sich in der Zentrale meiner Bank. Geld für Steuerzahlungen und andere laufende Verbindlichkeiten liegt bereit.
Dann kommen die Stiftungen, die Dir keine Arbeit abfordern, sondern lediglich Kenntnis der Dokumente. Da ist die Clare-Cassidy-Stiftung, die meine Frau zu ihren Lebzeiten in der Weise versorgt, an die ich sie gewöhnt habe und die nach ihrem Tod auf die Innere Mission übergeht. Die Gemälde-Dotation umfaßt meine eigene Kunstsammlung – übrigens keine schlechte, wenn man bedenkt, daß ich als junger Mann vom Lande die ersten Bilder auf einer Pralinenschachtel gesehen habe – und einen hübschen Jahresbetrag für künftige Neuerwerbungen. Ich bin kein Paul Getty, aber schlecht reden wird man auch über mich nicht, besonders wenn man sieht, welchen Betrag ich für die ärztliche Versorgung behinderter Kinder und ihre Weiterbildung ausgesetzt habe.
Alles zusammen beläuft sich auf runde zehn Millionen, was etwa der Summe entspricht, die meine Anhänger von mir erwarten und für die sie mich nach meinem Tode loben werden. Es kommt nur darauf an, reich genug zu sein, so daß die Leute wissen, daß man es zu etwas gebracht hat – aber nicht stinkreich, dann bleibt es ihnen im Halse stecken. Und wenn Du findest, daß ich mich noch aus dem Grab sehr um meinen Ruf besorgt zeige, so hast Du recht! Wer will schon auf Ewigkeit der Schande preisgegeben sein!
Aber da Politiker immer niederträchtig sind, habe ich schon vor langer Zeit beschlossen, mich damit abzufinden und, wenn möglich, Profit daraus zu ziehen. Deshalb begann ich die kleine Sammlung, die Du jetzt vor Dir hast. Sie sieht aus wie ein Sammelsurium von Briefen, Dokumenten, Tagebucheintragungen, Rechnungen, Todesanzeigen, Ausschnitten aus Telefongesprächen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine systematische Übersicht über das Leben, die Zeit und die offiziell nicht bekannten Amusements von Charles Parnell Cassidy. Bevor Du Dich jedoch genauer damit befaßt, möchte ich Dich aus Gründen der Fairneß warnen. Alles darin enthaltene Material ist gefährlich, einiges davon tödlich. Deshalb schlage ich Dir drei Möglichkeiten der Vorgehensweise vor.
Die erste ist, daß Du Dich dieses Materials gewinnbringend entledigst. Du übergibst es zu treuen Händen der Nordfinanz-Bank in Zürich zu Händen eines gewissen Mr. Marius Melville. Du wirst dann nichts mehr davon hören, und die Bank wird Dir sofort fünf Millionen US-Dollar gutschreiben, was dem Preis entspricht, den ich mit Mr. Melville vereinbart habe, falls ich mich jemals entschließen sollte, die Unterlagen zu verkaufen.
Dieses Arrangement hat nur einen einzigen Haken: Es überträgt Mr. Melville außerordentlich viel Macht, und da ich nicht mehr bin, würde er nicht zögern, davon Gebrauch zu machen. Wenn Du ihm je begegnest, bezeige ihm Respekt. Er verdient ihn. Und vergiß nie, daß er, während er eisern zu seinen Freunden hält, rücksichtslos wie Caligula vorgeht, wenn es sich um seine Feinde handelt.
Die zweite Möglichkeit ist die, das gesamte Material dem Justizminister des Bundesstaates New South Wales zu übergeben. Er wird Dir dafür nichts zahlen. Er wird Dir nicht einmal besonders gewogen sein, wenn er erst gesehen hat, um was für Unterlagen es sich handelt! Er wird die ganze Sammlung seinen Mitarbeitern zur ›Verifizierung und Veranschlagung‹ weiterreichen. Man kann es auch so ausdrücken: Er wird sich glücklich schätzen, auf diese Weise das ganze Material loszuwerden. Dann, nach allerlei Aufregungen und Indiskretionen der Presse und dem Ruf nach noch einer Royal Commission, ist alles ausgestanden. Teile des Materials werden verschwinden, Schlüsseldokumente gehen verloren, bis der gesamte Zündstoff verschwunden ist. Du brauchst Dir natürlich keinerlei Sorgen zu machen. Du bleibst Martin der Rechtschaffene und schläfst den Schlaf der Gerechten, mit der Quittung für eine mißlungene Gegendarstellung unter dem Kopfkissen.
Schließlich hast Du noch die Wahl, die Unterlagen persönlich zu prüfen und selbst zu entscheiden, ob Du sie verwenden oder vernichten willst. Dann sitzt Du am längeren Hebel – wenn Du es willst. Du wirst reich sein – falls es Dir darauf ankommt. Allerdings wirst Du dann auch die Zielscheibe für jeden sein, der Angst hat vor dem, was ich über ihn weiß – und es gibt da eine lange Liste mit vielen berühmten Namen. Eine interessante Situation, nicht wahr? Schade, daß ich nicht mehr hiersein werde, um zu erfahren, wie Du Dich entschließt, aber vielleicht wird mir der Allmächtige noch einen Blick zurück gönnen, bevor Er mich in den Fünften Kreis der Hölle hinabstößt. Warum den Fünften? Ich gebe Dir Dantes Antwort:
Lo buon maestro disse: Figlio or vedi
L’anime di color che vinse l’ira …
Das bin ich, und das bist Du, Sonnyboy:
›Die Seelen derer, die der Zorn besiegte.‹
Du hast es nie gewußt, und ich habe fünfzehn Jahre gebraucht, um Dir zu sagen, daß Du der Sohn warst, den ich mir immer gewünscht und nie bekommen habe. Wie jeder Vater seinen Erstgeborenen wollte ich Dich nach meinem eigenen Abbild prägen oder wenigstens zu einem geläuterten Ebenbild meiner selbst machen. Aber Du hast dagegen rebelliert. Du wolltest um jeden Preis eigenständig sein – und uns allen kam das teuer zu stehen. Als wir uns das erstemal stritten, dachte ich, Du würdest über mich herfallen. Dann haben wir uns alle geküßt und versöhnt und uns jeweils mit bösen Hintergedanken zufriedengegeben – so wie es die Iren gern tun, wo immer sie leben.
Statt dessen bin ich dir zum Opfer gefallen. Ich verlor meine Tochter. Ich verlor meine Frau. Ich verlor alle Freude an meinen Enkelkindern. Schließlich haßte ich den Mann, den ich wie einen Sohn lieben wollte. Meine einzige Genugtuung war die Tatsache, daß ich auch in Deinen Kelch etwas Gift hineintropfen ließ. Albern, nicht wahr – aber so ist der Mensch nun einmal. Es wird eine Zeit kommen, wir beide wissen das, da werden sich die Dinge so weit entwickelt haben, daß man nichts mehr rückgängig machen kann, da wird die Liebe verdorrt sein und das Herz sich verhärtet haben. Aus diesem Grunde habe ich Dich aus meinem Testament herausgeschnitten und so gewissermaßen zum Ebenbild der schlechtesten Seite meiner Selbst gemacht.
Das ist noch ein Grund, weshalb ich nicht bereit bin, die letzten schlimmen Tage über mich ergehen zu lassen. Marians Arzt tritt für ein schmerzloses und sauberes Ausscheiden aus diesem Leben ein. Er hat mir eine Pille gegeben, so daß ich meinem Leben selbst ein Ende setzen kann, bevor es zu schwer wird, und er wird den Totenschein unterschreiben, ohne mit der Wimper zu zucken.
Was gibt es sonst noch zu sagen? Alles übrige ist Klischee.
Moriturus te salutat …
Charles«
Plötzlich kam angesichts der ganzen Sinnlosigkeit dieses üblen Scherzes der Zorn in mir hoch. Ich ging mit dem Brief in der Faust hinauf und warf ihn Pat hin, die schlaflos in den Kissen lag und zur Decke starrte.
»Lies das!« sagte ich schroff. »Lies es und sag mir, welches der beiden wilden Tiere den Kampf gewonnen hat.« Dann ging ich hinaus und kehrte in mein Arbeitszimmer zurück. Ich goß mir ein halbes Glas Whiskey ein, bekam den ersten Schluck in die falsche Kehle und stürzte ins Badezimmer, um mich zu übergeben.
Als ich schweißgebadet ins Schlafzimmer zurückkam, erwartete Pat mich. Sie streckte mir die Hände entgegen; ich ergriff sie dankbar. Sie sagte:
»Ich möchte dich um etwas ganz Besonderes bitten, Martin. Ich möchte, daß du zusammen mit mir für sein Seelenheil ein Gebet sprichst.«
Mir war jetzt nicht nach Beten zumute. Sie wußte es, aber sie sprach leise weiter.
»Er zitierte oft ein altes Sprichwort. Er sagte, es sei gälisch. ›Ein Wolf muß in seiner eigenen Haut sterben.‹ Und genau das hat er getan. Ich wünschte, ich könnte um ihn weinen. Ich kann es nicht. Aber ich schulde ihm wenigstens ein Gebet. Weißt du, er suchte Vergebung, aber er war zu stolz, darum zu bitten. Deshalb nahm er die Todespille. Er wollte uns nicht mit einer Fürsorge belasten, die er seiner Meinung nach nicht verdiente. Kannst du das glauben? Willst du versuchen, es zu glauben, uns beiden zuliebe?«
»Ich würde es gerne glauben. Aber was soll diese – diese Sammlung, die er hinterlassen hat und die mich reich, einflußreich machen, aber mich auch töten kann? Es klingt wie die Äpfel von Sodom, die im Mund zu Staub zerfallen.«
»Ich glaube, es ist etwas anderes, ein Gefallen, den man ihm tun muß. Ich glaube nicht, daß man ein Leben wie seins in einem Testament und drei Treuhandverträgen zusammenfassen kann. Es muß noch andere unbezahlte Schulden geben, Verpflichtungen irgendeiner Art. Er konnte dich nicht direkt bitten, deshalb hat er dich in seinem Brief anzustacheln versucht, ihm zu helfen.«
»Vielleicht sollten wir zwei Gebete sprechen – eines für ihn und eins, auf daß er uns nicht noch einmal einen miesen Streich spielt.«
Sie kramte in der Nachttischschublade und brachte ein altes Gebetbuch zum Vorschein, das sie als Mädchen benutzt hatte. Wir sprachen ein Vaterunser und ein Ave Maria und das De profundis, gingen ins Bett, liebten uns auf eine merkwürdige, flüchtige Art und schliefen dann getrennt und gefühllos ein wie Marmorfiguren auf dem Grabmal in einer Kathedrale.
Ich erwachte noch vor Tagesanbruch aus einem merkwürdigen Alptraum, in dem Leprechaun Cassidy, die Hände voller Dollarnoten, auf unserer Marmorplatte zu den Tönen von Strawinskys »Feuervogel« einen wilden Tanz aufführte.
3
Drei Tage später verließ ich London mit dem Qantas-Flug QF2 nach Sydney über Bahrain und Singapur. Charles Parnell Cassidy flog mit; sein einbalsamierter Leichnam lag in einem Mahagonisarg mit silbernen Beschlägen, der in einem Container aus rostfreiem Stahl versiegelt war; seine geheime Geschichte befand sich in der Aktentasche unter meinem Sitz. Meine Sitznachbarin war nicht wesentlich lebendiger: ein gutaussehendes Mädchen in einem grauen Overall und einer großen Eulenbrille, das kurz nach dem Start ein paar Tabletten schluckte, sich in eine Decke hüllte und einschlief. Ich bedauerte das. Auf Reisen habe ich gern Gesellschaft, und die Gesellschaft von Frauen ist mir jederzeit willkommen. Gerade in dieser Nacht wäre ich froh gewesen, mich von den schwarzen Kobolden ablenken zu können, die in meinem Gehirn einen wilden Tanz aufführten.
Ich war sehr deprimiert und hatte mehr Angst, als ich zugeben wollte. Cassidys schweres Geschütz gefiel mir ganz und gar nicht. Australien kann auf eine lange Geschichte hartgesottener Politiker zurückblicken, und in Sydney ist mehr als die übliche Anzahl von Profis auf diesem Gebiet zur Welt gekommen. Wenn sie sich einschalteten, würden sie mit Verhandlungsangeboten beginnen. Wenn ich mich weigerte, würde man zu harten Bandagen greifen – und davon wollte ich meine Familie dann so weit wie möglich weg wissen.
Wir waren deshalb übereingekommen – wenn auch nicht ohne einige scharfe Auseinandersetzungen –, daß ich Cassidy nach Australien zurückbringen und bestatten sollte. Ich stand ihm familiär so nahe, daß ich alle Verpflichtungen bei den öffentlichen Zeremonien erfüllen konnte: dem Requiem und dem Staatsbegräbnis beiwohnen, die erste Schaufel Erde in das Grab werfen und den Prominenten in der Trauergemeinde die Hand schütteln. Pat und Clare und die Kinder so weit wie möglich aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit und allem Tratsch herauszuhalten schien mir ein Gebot der Klugheit zu sein.
In den Leitartikeln der australischen Presse war bereits zu lesen, daß Cassidy sich für seinen Tod einen günstigen Zeitpunkt ausgesucht habe. Überall roch es nach Skandalen: Man sprach von Drogen, Gewalttätigkeiten, Korruption innerhalb der Polizei, im Justizministerium, sogar im Parlament. Der tote Cassidy brauchte die Folgen nicht mehr zu tragen. Die Opposition konnte seinen Ruf nicht anfechten, ohne ihren eigenen zu schädigen. Die Regierung konnte alle ihre Skandale auf seinem Grab abladen und mit sauberer Weste und tugendhaftem Lächeln davongehen – aber natürlich nur, wenn nicht ein gewisser Martin Gregory plötzlich Gewissensbisse bekam und sich entschloß, mit Cassidys persönlichen Akten an die Öffentlichkeit zu treten.
Ich war mein ganzes Leben hindurch ein Diener des Rechtsstaates gewesen. Ich war überzeugt, diesen Dienst stets gut versehen zu haben. Cassidy selbst hatte mich herangebildet. Als er mir dann die Unterlagen über seine Aktivitäten übergab, wußte er also, daß er mir damit ein härenes Hemd reichte, das mich zerkratzen würde, bis ich es auszog. Während ich mich in den frühen Morgenstunden unruhig hin und her warf, erwartete ich schon beinahe, daß er wie ein Schachtelteufelchen aus dem Boden hervorspringen und mir eine lange Nase machen würde. Das war das Widersprüchliche an diesem Mann. Früher war er stets für das Gesetz eingetreten. Er begriff dessen uralte Grundsätze. Er liebte die Feinheiten der Rechtsprechung. »Wenn du das Glücksspiel liebst«, pflegte er zu sagen, »geh zum Hunderennen, und setze dein eigenes Geld, nicht das der Mandanten. Du hast es hier mit geheiligten Angelegenheiten zu tun, mit vertraulichen Angelegenheiten, mit Entscheidungen, an die sich spätere Generationen gebunden fühlen werden. Und krieg es in deinen Dickschädel rein: Wir verdienen unser Geld aus den Fehlern anderer Anwälte!«
Das war hochmütig, hitzig dahingesagt, und wir Jüngeren liebten ihn dafür, auch wenn wir seine krächzende Stimme haßten.